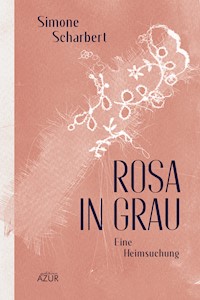
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition AZUR
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wann immer ich kann, male ich Wörter. Mit dem Zeigefinger. Auch hier in der Anstalt. Drinnen, draußen. Auf alles, was mir unterkommt, male ich Wörter. Ich male auf Wände, auf Fenster, auf Tischplatten. Ich male auf Haut, auf Kleidung, auf Laken.« Simone Scharbert führt uns mit »Rosa in Grau« in psychiatrische Anstalten der Nachkriegszeit. An Orte, wo Menschen ohne Privatsphäre unter katastrophalen Bedingungen leben. Erzählt wird aus der Perspektive einer jungen Mutter, die Anfang der 50er-Jahre in Haar-Eglfing eingeliefert wird. Wie so viele Frauen, die sich nicht in die Gesellschaft ihrer Zeit einfinden können. Frauen, die gezwungen sind, ihr eigenes Leben aufzugeben und stattdessen Jahrzehnte in der Psychiatrie verbringen – mehr verwahrt als behandelt. Menschen, die etwas aus sich selbst heraus schaffen müssen, um das Leben weiter zu ertragen. Ein aufwühlender, sprachlich funkelnder Roman über Kontrollverlust und Grenzerfahrungen, über Liebe und Freundschaft. Und über die Kunst als letztes Refugium der Hoffnung – mit engen Bezügen zur Sammlung Prinzhorn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simone Scharbert
ROSA IN GRAU
Eine Heimsuchung
Für M.
»Wenn nur jeder Mensch jemanden hat,der nach ihm sieht.«
Helga M. Novak
Ich nehme den Mantel ab, hänge ihn an den Haken neben der Tür. Der Mantel ist weit, ein ganzes Land. Mein Körper darin verschwindend. Zu klein für den Mantel, zu klein für die Stadt.
Ich durchmesse die Stadt mit Schritten. Jeden Tag aufs Neue. Ich kenne die Wege genau. In meinem Kopf ein Brei an Lauten. Stimmen schwimmen. Dazwischen meine eigene. Dünner Faden auf einer Spule, am Anschlag. Immer wieder der Versuch, Namen zu erinnern. Meine Gedanken greifen ins Nichts. Kein Ton, kein Anlaut, kein Anruf eines Namens. Nichts. Während ich gehe, hole ich Luft, atme ruhig. Bin mir selbst Begleitung. Beobachte mich genau. Meinen Gang, die Stiefel. Meine Figur, zu dünn. Lotternd. Im großen, zu weiten Mantel. Als wäre er ein Versteck. Aber die Stadt findet mich immer wieder, lässt mich nicht bleiben. Spuckt mich aus wie ein zähes Stück Fleisch.
Inhalt
1951 – »ZU HAUSE«
1953 – »HEIL- UND PFLEGEANSTALT HAAR«
1954 – »ZU HAUSE«
1956 – »NERVENKRANKENHAUS HAAR«
LEERSTELLEN
TEXT- & KUNSTQUELLEN
WEITERE TITEL IN DER EDITION AZUR
1951
»ZU HAUSE«
Rosa sitzt am Küchentisch. Ich sehe, dass ihre Füße noch immer nicht den Boden berühren. Sie stecken in Sandalen, es ist warm. Wahrscheinlich ist es Sommer. Juli. August vielleicht. Sie sitzt auf der Eckbank, etwa zehn Zentimeter fehlen ihr noch zum Boden. Ihre Beine baumeln gleichmäßig. Ich überlege, wie viele Jahre in zehn Zentimeter passen. Rolle das Maßband aus, lege es in die Zukunft. Ins Ungewisse. Rosa sitzt still.
Jemand hat ihre dunklen Haare zu zwei dünnen Zöpfen geflochten. Vielleicht ich. Ihre Augen sind auf mich gerichtet, groß, fast so groß wie der Mantel sind sie. Rosa kann atmen, ohne dass man es sieht. Ohne dass ich es sehe. Von Anfang an konnte sie das, von dem Moment an, als sie auf der Welt war. In der Welt war. Sie kam still. Als wollte sie nicht stören. Schmiegte sich ein, fand Platz in den Ritzen unseres Alltags. Ein warmes Bündel, das an meiner Brust trank, die Augen weit offen. Ein warmes Bündel, das durch die Nacht schlief, keine Angst hatte. Weder vor Dunklem noch vor meinem Gesang, mit Näglein besteckt. Diese kleinen Näglein, mit denen man die Nacht festheftet. Auf einer Bettdecke, auf einem Kissen, am Nachthemd, sodass sie nicht verrutschen kann. Diese kleinen Näglein, vor denen ich als Kind so viel Angst hatte. Ich erinnere genau, wie sie im Gesang meiner Mutter steckten, wusste nicht, dass diese Näglein ein Gewürz sind, in ein anderes Land führen, das ich nie sehen würde, das nur seinen Geruch verströmte, aus Braten, aus Suppen, aus Weihnachtsgebäck. In der Nacht war nichts zu riechen. Stille hat keinen Geruch.
Rosa öffnet den Mund, ich sehe es genau. Sie spricht ein paar Worte, in Zeitlupe: das Auf und Ab ihrer Lippen, wie in einem Aquarium, hinter Glas. Nichts zu hören, nur das feine Schweben der Luftblasen zu sehen. Ich konzentriere mich. Komme aber gegen die Scheibe nicht an, klebe fest. Kann nicht zu Rosa, kann sie nicht hören. Obwohl ich nur wenige Meter von ihr entfernt bin. Versuche, ruhig zu atmen, etwas zu hören, aber da ist nichts, keine Stimme auszumachen. In meinen Ohren ein Tosen, ein Rauschen, das mich wegspült, aus der Küche, an Rosas offenem Mund vorbei.
Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Wie viel Zeit in dieses Rauschen passt. Wie viele Zentimeter, bis ich wieder Boden unter den Füßen habe. Deutlich höre ich das Ticken der Zeiger hinter meinem Rücken. Vor mir Rosa, wie sie immer noch am Küchentisch sitzt, still, die Augen weiter groß auf mich gerichtet, als wäre keine Zeit vergangen, als wäre alles noch wie immer, und ich taste vorsichtig nach der Scheibe, aber da ist nichts, kein Aquarium, kein Wasser, nur die Küche, Rosa und ich, und jetzt verstehe ich sie ganz deutlich, ihre wenigen Worte, die helle Stimme, Rosas Silberklang,
Ich habe Hunger,
und vorsichtig schiebt sie noch ein Wort hinterher,
zwei Silben, Gleichklang,
ich weiß, dass sie mich damit meint,
Mama,
ich fühle mich ertappt,
blicke zurück,
Mama,
der Ton jetzt fragend, als wäre ich nicht da, bittend auch, und ihre Augen immer noch so groß, größer als der Mantel, ob ihr jemand Frühstück gemacht hat, frage ich mich, vielleicht ich, aber das ist ungewiss, wie lange sie da sitzt, auch das frage ich mich, und jetzt rutscht sie auf der Eckbank an den Rand, lässt die Füße auf den Boden gleiten, eine schnelle Bewegung, etwas Vertrautes, die Sandalen geben einen Laut, als wollten sie Rosas Anwesenheit verkünden, aber ich sehe sie ja, wie sie jetzt neben dem Küchentisch steht, mit ihrem kleinen Körper, den dünnen Zöpfen, und sehe auch, wie sie auf mich zukommt, die wenigen Schritte, und dann meine Beine umarmt, den Kopf in meiner Schürze verbirgt, ihre Arme fester um mich zieht, als würde sie mich halten, so ein kleines Kind, mich, in der Gegenwart, im Jetzt.
Sacht löse ich Rosa von mir, schaffe Abstand zwischen uns. Setz dich, aber sie bleibt stehen, störrisch, weicht nicht von meiner Seite. Und also greife ich ihr mit beiden Händen unter die Achseln, greife fest zu, spüre sofort Rosas Rippen, deutlich unter ihrem Kleid, hebe sie hoch, sie ist so leicht, zu leicht, denke ich, setze sie auf die Anrichte. Rosa lässt alles mit sich geschehen. Ruhig bleibt sie sitzen, ihre Beine reichen gerade mal über die Schubladen. Erst jetzt sehe ich ihr schrundiges Knie. Das Blut vertrocknet. Ein kleines Krustenland auf ihrer Haut. Ich deute darauf, fragend. Und Rosa zuckt mit den Schultern, sagt, dass es nicht schlimm, sie nur gestolpert sei. Ich sage nichts. Weiß nicht, was zu tun ist in so einem Moment. Was gut ist für Rosa. Hole den kleinen Topf aus der Anrichte, halte ihn ins Spülbecken und drehe den Hahn auf. Sehe dem Wasser zu, wie es in den Topf läuft, die weiße Emaille füllt. Im Topf spiegelt sich mein Gesicht: wie es im Wasser schwimmt, verzerrt von kleinen Wellen. Und Rosas Kopf, wie er neben mir auftaucht, wie wir gemeinsam schwimmen. Rosas Lächeln, wie es sich ausbreitet, ohne Angst, und also drehe ich den Hahn zu, halte die Zeit an. Rosas Lächeln bleibt ruhig auf dem Wasser liegen.
Den Herd muss ich anmachen. Eine Hand greift nach den Streichhölzern, die andere drückt und dreht den Knopf, hält ihn. Gas zischt leise und ich versuche mit nur einer Hand ein Hölzchen aus der Schachtel zu nehmen. Bin aber zu ungeschickt. Rosa beobachtet jede Handbewegung genau. Ich halte ihr das Schächtelchen hin. Sie versteht sofort, greift hinein, greift nach einem einzelnen Hölzchen. Zielsicher macht sie das, streckt es triumphierend in die Höhe: Als wollte sie sagen, siehst du, wir schaffen es, gemeinsam bekommen wir es hin. Ich streiche ihr über den Kopf. Langsam. Murmle ihren Namen, Rosa.
Es ist Mittag. Vielleicht Nachmittag. Ich stehe in der Küche. Immer noch oder schon wieder. Um mich nur Rosas. Ich kann sie nicht zählen, nicht voneinander unterscheiden. Schauen zu mir auf. Alle tragen das gleiche Kleidchen, die Haare zu dünnen Zöpfen geflochten. Jemand muss das gemacht haben. Ich nicht. Das ist sicher. Ich kann schon lange keine Zöpfe mehr flechten, auf meine Finger ist kein Verlass. Die Rosas greifen nach mir, legen ihre Hände auf meinen Bauch, auf meinen Rücken. Streicheln mir über die Arme, über die Hände. Ziehen Linien über meine Kleidung, Berührungsmuster. Manche legen ihr Gesicht auf meine Brust, stellen sich auf die Zehenspitzen. Unheimlich ist das. Ihre Stimmen formieren sich, summend, zunächst leise, schön klingt das, noch, dann aber schälen sich einzelne Silben aus dem Gesang, werden deutlicher, lauter, Ma-ma, dieses ewig wiederkehrende Ma-ma, und ich sehe wie ihre Gesichter zu offenen Mündern werden, dunkle Vokalhöhlen für dieses eine Wort, das sie nun schreien, gemeinsam. Sich übertönen, kreischen, weinen. Sie legen ihre Hände auf mich, packen richtig zu, lassen mich nicht mehr los, krallen sich in mich, und ich weiß nicht, wie ich sie beruhigen kann, ich kann nichts tun gegen die Scheibe, gegen das Wüten meines Körpers, gegen die bebende Stille in meinem Kopf.
Ich reiße Blätter vom Kalender. Zahlen, Monatsnamen. Verbrenne sie. Heimlich. Ich habe meine eigene Zeitrechnung. Jemand sagt, dass jetzt die Weihnachtszeit beginne, dass Advent sei. Wahrscheinlich die Nachbarin. Advent. Ich spreche das Wort leise, schiebe es in meinen Mund hin und her, Advent. Komisch fühlt sich das an. Meine Zunge stolpert, bleibt hängen. Ich nicke, versuche mir zu merken, dass jetzt der Advent beginnt. Eine Hand legt sich in meine, eine Stimme in mein Ohr.
Mama.
Ich erschrecke.
Mama?
Zucke zusammen.
Rosa steht neben mir, steht einfach da.
Sie sagt nichts weiter. Reicht mir nur ihren Blick.
Es ist Advent, sage ich zu ihr.
Rosa nickt. Ohne ein weiteres Wort zieht sie ihre Stiefel an: Setzt sich auf den Boden, nimmt mit beiden Händen erst den einen, dann den anderen Stiefel, steckt ihre Füße hinein. Ich sehe zu, wie sie die Schnüre um die Ösen legt. So konzentriert ist. Einen Knoten zieht, eine Schleife bindet. Auf beiden Seiten. Geschnürtes Schweigen zwischen uns. Rosa steht auf, blickt auf ihre Stiefel, dann zu mir. Wahrscheinlich ist sie stolz, aber sie sagt nichts. Wahrscheinlich soll ich etwas sagen, weiß aber nicht, was. Und also nehme ich ihren Kindermantel vom Haken. Halte ihn so, dass sie hineinschlüpfen kann. Ihr Mantel, ein kleines Land. Geschickt ist sie. Steckt erst den rechten Arm, dann den linken hinein. Lacht dabei, ein Kichern eher. Ich knie mich vor sie, knöpfe ihr den Mantel zu. Einen Knopf nach dem andern, summe dabei, Knöpfchen, Knöpfchen, du musst wandern. Rosa lässt sich nach vorne fallen, legt ihr Gesicht an meine Brust. Legt sich ins Leise. Wenn ich vor ihr knie, sind wir fast gleich groß. Auf Augenhöhe. Pupillengespräch. Ich singe kaum hörbar weiter.
Von der einen Hand zur andern.
Nehme Rosa in den Arm, halte sie fest.
Spüre den kleinen Körper. Ihren Atem.
Das Herz. Wie schnell es klopft.
Schließe die Augen.
Das ist schön, das ist schön,
und Rosa singt jetzt leise mit, ihr Silberklang in meinem, Gleichklang, ein schönes Gefühl, Knöpfchen, lass dich nur nicht sehn, sie kichert wieder, zeigt auf ihre Knöpfe, gut sichtbar, rote Knöpfe, vier Stück an der Zahl, es ist Advent, sage ich, und Rosa nickt. Ich bin beruhigt. Das also ist gewiss.
Nur schwaches Licht über mir. Dämmert. Mein Körper weit entfernt, ungelenk. Das Schärfen der Augen, ein Versuch. Das Sich-wieder-Finden. Zwischen Regalen. Offenem Mauerwerk. Im Keller. Modrig riecht es, feucht. Meine Hand streicht über einzelne Kisten, ich sehe mir selbst dabei zu. Weiß nicht, warum ich nach unten gegangen bin. Drei Stockwerke in den Keller. Was ich hier holen wollte, wonach ich suche. Ob ich überhaupt etwas suche. In meinem Kopf ist es verdächtig ruhig. Ich stehe auf, gehe Regale entlang, greife nach Gläsern. Erkenne meine Schrift, lese: Namen für eingeweckte Beeren, eingekochtes Rot. Aus einer anderen Welt. Aus einem Damals. Denke daran, wie ich Beeren und Kerne durchs Geschirrtuch abgeseiht, Fruchtmus durchgedrückt, Gelee gekocht habe. Dass ich das konnte. Und wie das aussah, rote Kerne im weißen Leinen. Ihr Glänzen, ihre Vereinzelung. Als würden sie dort nicht hingehören, wären fehl am Platz. Ich gehe weiter, langsam, nur ein, zwei Schritte, bleibe beim Rhabarberkompott stehen. Ich mag Rhabarber, mag das Widerspenstige, dass er überall Fuß fassen kann. Ob es Winter, vielleicht sogar Weihnachten ist, frage ich mich. Dass ich mir das merken wollte. Sehe mich um, ob irgendetwas darauf hindeutet. Weihnachtsschmuck. Kerzen. Warme Kleidung. Ein Geruch, vielleicht. Aber nein, nichts. Hier im Keller gibt es Jahreszeiten nur im Glas. Eingemacht, verschlossen. Haltbar auf ewig, was auch immer das bedeuten mag.
Plötzlich hängt Rosa an mir, ich erschrecke. Wie eine Katze ist sie manchmal, so leichtfüßig und nicht zu hören. Auch ihre Art, sich an mich zu schmiegen, uns gemeinsam ins Jetzt zu wiegen. Ich streiche ihr übers Haar, sie zuckt zurück, wendet mir ihr Gesicht zu. Überrascht sieht sie aus. Ihre Augen so groß, randlos, spiegeln die Glühbirne, verdoppeln sie. Leuchtdraht in ihren Pupillen: Unheimlich, die dünn schimmernden Linien im kleinen Kind.
Ich schiebe Rosa von mir, bedeute ihr, dass sie kurz stehen bleiben soll. Warte. Greife nach einem Glas, drehe es so, dass ich das Etikett lesen kann. Eingestaubt ist es, die Schrift kaum zu entziffern, das Innere dunkel. Meine Augen müssen sich erst gewöhnen. An diese Welt und wie sie jetzt ist. Rosa drängt sich an meinen Körper, ich spüre ihre Neugier. Höre ihre Stimme, wie sie zu mir reicht.
Mama? Was ist in dem Glas?
Stille.
Es sieht komisch aus, oder?
Nicken. Stille.
Hast du das gekocht?
Unsicherheit. Stille.
Ich nehme das Glas in die Hand, ziehe es aus dem Regal und halte es ins Licht. Drehe es leicht hin und her, verfolge die Bewegung des Inhalts. Es sieht nach Rotkohl aus. Dünn geschnittenes Violett, wenig Flüssigkeit, verschlossene Novemberluft. Ich sehe abgeerntete Felder. Sehe das Gähnen der Pflanzen, ihr Verfaulen auf dem Acker. Und wie es dauert. Überdauert.
Rosa zupft an meinem Rock, energisch. Ich wische ihre Hand vom Stoff, stelle das Glas zurück ins Regal. Weiß noch immer nicht, was tun. Weiß nicht, was ich hier wollte, im Keller. Drehe mich unwirsch um. Rosa stolpert, fällt beinahe. Gibt keinen Laut von sich, fängt sich selbst auf. Sie ist so geschickt. Und irgendetwas in mir reißt auf, als ich sie so sehe, Stimmen sitzen wieder im Mantel, in mir, ein weites Land, Bilder verschwommen, dazwischen ein scharfes
Lass mich los,
aber nein, das haben wir nicht gesehen, durften wir nicht sehen, haben wir uns nur ausgemalt, mit erzählten Farben, unsere Finger färbten sich davon, erst die Kuppen, dann der Rest. Gräulich. Violett. Ein leichtes Grün. Das Wachsen der Stille, der Leere. Übers Feld, unsere inneren Äcker. Brachland. Gefolgt vom Einlegen der Erinnerung, kleine Scheibchen, dünn geschnitten. Mehr war nicht zu verkraften, ein Vater, der von der Decke hängt,
Lass mich los,
Rosa brüllt jetzt. Ich kann es sehen, aber nicht hören. Stehe wieder hinter der Scheibe, dränge mich dagegen, schlage aufs Glas, rhythmisch, schließe die Augen, Lidschlag, Herzschlag, Faustschlag. Rauschen.
Es ist Weihnachten, diesmal ist es gewiss. Jemand hat Sterne in die Fenster gehängt. Aus Stroh. Dahinter die Stadt. In der Küche steht ein Adventskranz. Gebundenes Grün. Darauf: vier Kerzen, rot. Auf einem Teller. Jemand hat sie angezündet. Die Flammen sengen den Nachmittag an. Stete Verformung. Verfließen. Jemand hat auch den Tisch gedeckt. Vier Teller, vier Schüsseln, vier Gläser. Aber niemand hat gesagt, was ich tun, was ich anziehen soll.
Ich stehe vor meinem Schrank. Im Schlafzimmer. Die Türen weit geöffnet. Dahinter Leere. Vor mir ein Kleiderberg. Blusen, Röcke. Übereinandergeworfen. Darauf Strümpfe, die über den Berg kriechen. Wie Schlangen. Das macht mir Angst. Weniger die Büstenhalter, die vielen Unterhosen. Cremefarben sind sie, schimmern leicht. Ich sehe an mir runter. Meine Füße sind nackt, kaum zu sehen. Ich stecke fest in meinem Nachthemd. Niemand hat gesagt, dass ich es ausziehen soll. Es ist weiß, aus dickem Stoff. Darauf kleine Blumen. Jemand muss sie gestickt haben. Der Kragen vom Nachthemd reicht mir bis unters Kinn, der Saum bis an die Füße. Ich denke mich als Engel. Das ist gut. Strecke die Arme in die Luft, senke sie. Wiederhole das Ganze. Einmal, zweimal. Dann immer wieder. Werde schneller, lasse die Arme nach oben und nach unten sausen. Natürlich, ein Flügelschlagen. Was sonst? Ich kann die Luft hören, ihr Sausen, ihr Flüstern. Steige weiter auf den Kleiderberg, sinke ein bisschen ein. Meine Füße stecken im Stoff, weich fühlt sich das an. Für einen Moment schwebe ich im Tag. Fühle mich leicht. Unberührbar.
Mama? Was machst du?
Sie greifen nach mir. Meine Augen sind geschlossen.
Die Flügel schlagen weiter. Ununterbrochen.
Wieso stehst du auf deinen Kleidern?
Was machst du mit deinen Armen?
Ich lächle. Lächle sie an.
Kommt, kommt zu mir.
Zwei Kinder sind es. Sie klettern zu mir auf den Kleiderberg. Auf den Olymp der Ungewissheit. Steigen auf. Suchen Halt an meinen Beinen, an den Hüften. Gemeinsam steigen wir weiter hoch. Ich reiche ihnen die Hand. Ins Helle, ins Leichte. Ich kann es sehen. Wir schlagen mit unseren Armen, diesen Stoffflügeln. Wir kichern und lachen. Kräftige Farben in meinem Hirn, ein Aufbrechen. Ich schlage weiter mit den Flügeln, lege den Kopf in den Nacken. Genieße das Leichte. Kann meine eigene Stimme hören. Schrill ist sie. Dünn. Zu laut. Dann ist Ruhe. Stille Nacht.
Dass ich mich an die Wand stellen solle, sagt sie. Mit dem Rücken. Dass ich den Kopf still, gerade halten solle. Ich sage nichts. Schaue sie an. Schaue an ihr vorbei. Schaue sie wieder an. Rühre mich nicht. Keinen Zentimeter. Sehe genau, wie sich ihr Mund bewegt, mit mir spricht. Konzentriere mich. Möchte genau verstehen, was sie sagt. Höre aber nichts. Die Scheibe ist wieder da, ich weiß es genau. Das ist sicher. Dahinter ihr Mund, ihre Augen und ihre Hände. Sie weiß, was zu tun ist. Ich nehme das einfach so an. Glaube ihr. Durch die Scheibe. Das ist gut. Alles an ihr scheint mir gewiss. Ihre Hände schieben mich an die Wand. Ans Weiße. Überhaupt ist hier alles weiß. Weißer, als ich vertragen kann. Augenflimmern. Die Schränke. Weiß. Der Tisch. Weiß. Zwei Stühle. Weiß. Die Deckenlampe, rund. Und weiß. Ihre Schürze. Lang, straff gebunden. Weiß. Ihre Sprache, die einzelnen Worte. Weiß. Scharf. Klar. Dass ich ruhighalten solle, sagt sie. Sie mich sonst nicht messen könne, sie aber wissen müsse, wie groß ich sei. Warum sie das wissen muss, sagt sie nicht. Ich halte ruhig, warte, bis sie eine Zahl sagt. Meine Größe. Ein Meter. Vierundsiebzig Zentimeter. Kurze Pause. Dann ihre Stimme. Dass das groß sei für eine Frau. Eher selten. Sagt sie. Mein Schulterzucken, ein inneres. Als ob diese Zahl etwas über mich aussagen würde. Meine Kleidung ist anders, ohne Taschen. Komisch fühlt sich das an. Ich sehe zu ihr. Durch die Scheibe.
Steigen Sie auf die Waage.
Ich sehe nach unten. Trage keine Schuhe.
Steigen Sie einfach drauf.
Meine Füße nackt, die Zehen kleben aneinander.
Rühren sich nicht.
Ihre Füße müssen auf die Waage, bitte.
Schmal sind sie, diese Zehen, gekrümmt.
Die Haut weiß. Viel zu weiß.
Ich gebe mir Mühe. Setze den linken, dann den rechten Fuß auf die Waage. Höre ein Geräusch. Höre mich, meinen Körper. Sein Gewicht. Sein Nicht-Gewicht. Sehe nach unten, sehe, wie der schwarze Zeiger springt. Wie er sich einpendelt, an einem Strich. Dann ihre Stimme wieder. Eine weitere Zahl, ihr Kopfschütteln. Resigniert.
Zu leicht. Sie wiegen zu wenig.
Meine Füße nicken. Wissen Bescheid. Natürlich.
Sie müssen essen. Mehr essen.
Es geht sich leichter mit wenig Gewicht,
denke ich. Sage nichts.
Bleibe stehen. Hinter der Scheibe. Komme da nicht weg, nicht durch. Überlege, was die Zahlen alles nicht erzählen. Etwa wie oft ich den Kopf an die Wand geschlagen habe. Wie oft ich das noch tun werde. Den Kopf an die Wand schlagen. Die Stirn. Wie viele Minuten. Wie lange es dauert, bis die Haut aufplatzt. Dass ich dann sofort aufhöre. Es zumindest versuche. Wie oft ich mir die Ohren zugehalten habe. Mit den Händen. Bis nichts mehr zu hören war, nur dieses dumpfe Surren. Wie lange ich die Luft angehalten habe. Wie viele Sekunden ich unter Wasser war. In der Badewanne. Mein Körper so ein ungutes Anhängsel. Zu leicht, zu schwer. Beides zugleich. Wie oft ich vor der Badewanne gesessen bin. Nackt. Auf dem Boden. Die Knie angezogen, die Tür verschlossen. Den Kopf in die Knie vergraben. In meine Hand, in die Finger gebissen, daran gesaugt habe. Was für Muster entstanden sind. Welche Farben und Flecken. Zwischen Blau und Rot. Wie viele Farbabstufungen es gibt. Dass zwischen Blau und Rot ein ganz eigener Geschmack liegt. Eine Ahnung vom eigenen Ich. Diesem zähen Stück Fleisch. Dass man dafür kein Licht braucht. Wie oft ich den Schlüssel gedreht habe. Bis zum Anschlag. Wie oft ich versucht habe, kein Geräusch zu machen. Ein unhörbarer Mensch zu sein. Unmöglich. Das Licht ausgeschalten habe. Nachts. Wie oft ich nichts mehr sehen, nichts mehr hören wollte. Wie oft ich mich vor den Spiegel gestellt habe. Tagsüber. Die Tür offen. Den Schlüssel nicht gedreht habe. Wie oft ich allein war. Mich angebrüllt, an den Haaren gezogen, sie mir ausgerissen habe.
Ich denke daran, dass ich sie mir nur einmal geschnitten habe. Um mir irgendwie selbst zu entkommen. Dass das schnell ging. Schneller als erwartet. Dass es nicht schwer war. Überraschend auch. Wie die dunklen Haare dann im Waschbecken lagen. Wie sich mein Gesicht verändert hat. Mit den kurzen Haaren. Wie das aussah. Wie ich sie mit Trotz und Wut gewaschen habe. Mir selbst Mut machte. Wieder und wieder. Wie er dann an diesem Abend nach Hause kam. Mich ansah. Sich umdrehte, zurückkehrte. Kein Wort. Mir ein Tuch hinlegte. Wie dann seine Stimme klang. Wie er sagte, dass ich es umbinden solle. Wie ich nickte, in seinen Blick, in seine Ohnmacht hinein. Wie wir nicht wussten, wohin mit uns. Die Zeit sich ausbreitete wie ein großer Flecken Wasser. Zwischen uns. Dass das noch nicht so lang her ist. Und dass es sich merkwürdig mit der Zeit verhält. Dass ich kein Maß für sie habe. Noch nie hatte.
Nehmen Sie das Tuch ab.
Ich blinzle. Aus der Vergangenheit.
Lege meine Hände an den Kopf, in den Nacken.
Versuche den Knoten zu lösen, das Tuch aufzubinden.
Verhake mich in den eigenen Fingern.
Weine in Worten. Sie reagiert nicht.
Ich muss Ihren Blutdruck messen.
Halten Sie den Arm hoch. Den linken.





























