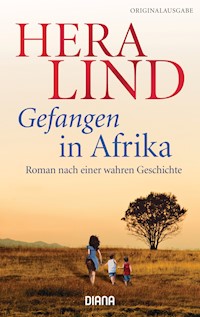10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die dramatische Geschichte einer jungen Frau, die nach Kriegsende auf der Flucht in den Westen ihr Baby und sich selbst retten muss - ein Tatsachenroman von Platz 1-Spiegelbestsellerautorin Hera Lind
Paula findet in einer Küchenschublade das Tagebuch ihrer verstorbenen Mutter. Nie hatte Anna von ihrer Flucht mit Baby Paula aus Pommern nach Kriegsende 1945 erzählt. Doch beim Lesen offenbart sich Paula eine Wahrheit, die sie vollkommen aus der Bahn wirft. Ergreifend berichtet Anna von ihrem monatelangen Verstecken mit dem Säugling auf einem Dachboden, von ihrer Verzweiflung, immer den Tod vor Augen, und von dem Deserteur Karl, der Anna und die kleine Tochter in letzter Sekunde rettet. Als Paula von ihrer wahren Identität erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen, und sie macht sich auf, um ihre Spuren zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Der Roman
»Für Paula, damit sie eines Tages die Wahrheit erfährt.«
Die sechzigjährige Paula findet tief unter dem Backpapier einer alten Küchenschublade versteckt das Tagebuch ihrer verstorbenen Mutter. Darin erzählt Anna, was sie Ende des Zweiten Weltkrieges und danach durchmachen musste. Als die sowjetischen Truppen Weihnachten 1944 in Pommern einfallen, versteckt sich die hochschwangere Anna in einem Bunker und muss später mit dem neugeborenen Baby Paula bei eisigen Temperaturen auf einem Dachboden ausharren. Es sind grauenvolle, lebensbedrohliche Monate. Annas Weg führt bis nach Stettin zum Hafen, wo sie ein überfülltes Schiff erreichen will, immer den Tod vor Augen. Als sie ihrem und dem Leben ihres Babys Paula ein Ende setzen will, begegnet Anna dem deutschen Deserteur Karl, der sich den beiden annimmt. Diesen Mann hat Paula immer für ihren Vater gehalten, doch dann ist nichts mehr so wie es schien …
Die Autorin
Hera Lind studierte Germanistik, Musik und Theologie und war Sängerin, bevor sie mit zahlreichen Romanen sensationellen Erfolg hatte. Seit einigen Jahren schreibt sie ausschließlich Tatsachenromane, ein Genre, das zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Mit diesen Romanen erobert sie immer wieder die SPIEGEL-Bestsellerliste. Zuletzt stieg »Die Hölle war der Preis« direkt auf Platz 1 ein, gefolgt von »Die Frau zwischen den Welten«, »Grenzgängerin aus Liebe« und »Mit dem Rücken zur Wand« jeweils auf Platz 2. Hera Lind lebt mit ihrem Mann in Salzburg, wo sie auch gemeinsam Schreibseminare geben.
HERA
LIND
Für immer
deine Tochter
Roman nach einer wahren Geschichte
Vorbemerkung
Dieses Buch erhebt keinen Faktizitätsanspruch. Es basiert zwar zum Teil auf wahren Begebenheiten und behandelt typisierte Personen, die es so oder so ähnlich gegeben haben könnte. Diese Urbilder wurden jedoch durch künstlerische Gestaltung des Stoffs und dessen Ein- und Unterordnung in den Gesamtorganismus dieses Kunstwerks gegenüber den im Text beschriebenen Abbildern so stark verselbstständigt, dass das Individuelle, Persönlich-Intime zugunsten des Allgemeinen, Zeichenhaften der Figuren objektiviert ist.
Für alle Leser erkennbar erschöpft sich der Text nicht in einer reportagehaften Schilderung von realen Personen und Ereignissen, sondern besitzt eine zweite Ebene hinter der realistischen Ebene. Es findet ein Spiel der Autorin mit der Verschränkung von Wahrheit und Fiktion statt. Sie lässt bewusst Grenzen verschwimmen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 04/2022
Copyright © 2022 by Diana Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München
Umschlagmotive: © Mark Owen / Trevillion Images;
© Deutsches Historisches Museum / © DHM / Bridgeman Images;
Shutterstock.com (kzww; Tomsickova Tatyana)
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-24548-1V001
www.diana-verlag.de
1
PAULA
Bamberg, 20. April 2004
Nebenan polterte es in der Küche. Da war aber jemand sauer!
»Au! Scheiße! Verdammte Kacke!«
Also bitte! Doch nicht aus dem Munde meiner Tochter!
»Rosa? Alles in Ordnung?« Ich erhob mich mit schmerzenden Knien aus meiner unbequemen Position. Das Putzen unter dem klobigen Wohnzimmerschrank von meiner unlängst verstorbenen Mutter war nichts mehr für meine morschen Knochen. Jedenfalls bildete ich mir das ein, sollte ich doch in Kürze sechzig werden. Dieser runde Geburtstag lähmte mich, und jetzt auch noch dieser verdammte Streit mit Rosa. Ja, es war eine vertrackte Situation, in der wir uns da gerade befanden. Rosa und ich hatten gemeinsam Mutters altes Haus geerbt … und ich hatte Rosas heiß geliebten Opa, meinen Vater Karl, ins Heim gesteckt!
Aber was sollte ich denn machen, jetzt, wo er Witwer war und allein nicht mehr zurechtkam? Schließlich war ich als Oberstudienrätin voll berufstätig. Ich liebte meinen Job und meine Schüler! Rosa hingegen hatte gerade das Referendariat beendet und würde nach den Sommerferien ebenfalls mit einer vollen Stelle an meinem Gymnasium anfangen: am E.T.A.-Hoffmann Gymnasium, wo schon mein Vater Karl und davor sein Vater Karl senior Direktor gewesen waren. Stolz hielten wir die Familientradition hoch, doch wenn Opa Karl zu Hause weiterleben sollte, musste eine von uns beiden den alten Mann pflegen und zu ihm in dieses Haus ziehen.
Rosa befand, dass sie dafür zu jung sei, und ich, dass ich mit sechzig noch lange nicht den Schuldienst quittieren wollte. Das aber verlangte mein Fräulein Tochter dreist von mir!
Darüber waren wir so in Streit geraten, dass wir gerade schweigend das Haus ausräumten, ohne zu wissen, was damit geschehen sollte. Es war doch mein Elternhaus, und Rosa hatte bei ihren geliebten Großeltern ebenfalls eine schöne Kindheit verbracht.
Dass meine Tochter jetzt so fluchte, lag auch an ihrer inneren Zerrissenheit.
Niemand von uns beiden konnte sich um meinen 89-jährigen Vater kümmern, der in letzter Zeit ziemlich dement wirkte. Er redete inzwischen häufig ziemlich wirres Zeug, manchmal sprach er mich sogar mit falschem Vornamen an. Es würde also das Beste sein, das Haus so schnell wie möglich zu verkaufen. Es befand sich nämlich in einer Traumlage, direkt an der Regnitz in Bambergs bezaubernder Altstadt, und Rosas Zukunft würde durch den Hausverkauf ebenso abgesichert sein wie mein späterer Ruhestand. Schließlich wollten Rosa und ich auch noch reisen, solange sie nicht verheiratet war. Also ich wollte das. Denn eigentlich standen uns Rosa und ich sehr nahe. Ich hatte sie ganz allein großgezogen, und die Großeltern Anna und Karl hatten sich stets liebevoll um ihre einzige Enkelin gekümmert, sie mit Liebe und Zuneigung überschüttet, wenn ich arbeiten musste. Wir waren eine kleine heile Familie gewesen, immer für den anderen da. Bis Oma Anna ganz plötzlich verstorben war. Und ich Opa Karl schweren Herzens, in Rosas Augen herzlos, »ins Heim gesteckt« hatte.
Stumm wühlten wir uns durch Schränke und Schubladen und wurden von den vielen Erinnerungen förmlich erschlagen.
In der Küche fluchte Rosa gerade, dass sich die Balken bogen, und machte ihrem Herzen auf diese Weise Luft.
Beunruhigt spähte ich um die Ecke. Rosa saß mit Tränen in den Augen vor der alten Küchenkommode und lutschte an ihrem Finger.
»Hast du dich verletzt, Rosa?«
»Das Scheißding hat geklemmt!« Ihr Tonfall klang so vorwurfsvoll, als wäre das meine Schuld. Natürlich. Ich war gerade an allem schuld.
Da lag sie, die alte Schublade, auf dem Gesicht, und um sie herum tausend Krümel, alte Salmiakpastillen, verstaubte Pralinen, ein Nadelkissen, Würfel … Zeugen eines gelebten Lebens, verstreut auf dem Küchenfußboden.
Habe ich eigentlich jemals so einen Streit mit meiner Mutter gehabt?, fragte ich mich, während ich dieses »Stillleben« betrachtete. Hatte ich es jemals gewagt, sie so anzugreifen? Und von ihr verlangt, dass sie in Frührente ging? Mutter hatte bis zuletzt mit Freude und Fleiß den Kiosk gegenüber unserer Schule betrieben. Und damit tausend Schülerherzen die Geborgenheit geschenkt, die auch Rosa und ich durch sie stets erfahren durften.
»Und jetzt hab ich mir einen Splitter eingezogen!« Rosas Gesicht war schmerzverzerrt. Es ging um die hölzerne Schublade mit der Aufschrift »Feigenkaffee«. Die anderen Schubladen hießen »Mehl«, »Salz« und »Grieß« – sie hatten sich problemlos herausziehen lassen. Die »Feigenkaffee«-Schublade hingegen hatte sich heftig gewehrt, weil sich das vergilbte Wachspapier, mit dem sie ausgeschlagen war, wohl verkeilt hatte. Das schaute jetzt unter der auf dem Boden liegenden Schublade hervor. Das und etwas Schwarzes. Ein Fotoalbum?
Doch zunächst inspizierte ich den Splitter, der fest im Zeigefinger meiner Tochter steckte.
»Brauchst du einen Arzt?« Ich zog eine spöttische, aber liebevolle Grimasse. »Oder soll ich pusten?«
»Nein. Mit einer desinfizierten Nadel dürften wir den Übeltäter schon loswerden. Du bist gut in so was, Mama. Also mach schon.«
Na also. War das jetzt schon Frieden oder noch Waffenstillstand? Rosa ließ mich wieder an sich heran, nach fast einer Woche Funkstille. Danke, liebe Schublade!
Ich hielt eine Nadel über die Gasherdflamme, und während ich, ganz Mama, vorsichtig den Splitter entfernte, sah ich mich wieder als Kind in dieser Küche stehen und meine eigene Mama Anna für mich sorgen.
Meine Mutter war ebenfalls streng gewesen, konsequent, aber auch fürsorglich und liebevoll. Ich war ihre einzige Tochter gewesen, genau wie Rosa meine einzige Tochter war, und diese weiße Küchenkommode hatte meine Kindheit begleitet. Immer waren köstliche Dinge darin gewesen, angefangen vom duftenden Kakao in der goldenen eckigen Dose über selbst gebackene Kekse in der runden roten Dose bis hin zu Malstiften und Fotoalben, in denen meine sorglose Kindheit erst in Schwarz-Weiß und später in Farbe zwischen knisternden Pergamentseiten festgehalten worden war. Von Pagenkopf bis Petticoat: Es war die typische Zeit der Fünfziger-, Sechzigerjahre.
So. Der Splitter war raus. Kein »Danke, Mama«. Da wurde noch ein bisschen nachgeschmollt.
Ich griff zu einem aus der Schublade gefallenen Album. »Schau mal hier, darin habe ich ja schon ewig nicht mehr geblättert!«
»Mama, willst du jetzt Fotos schauen oder weiter ausräumen?« Rosa hatte den Finger wieder in den Mund gesteckt und sah mich vorwurfsvoll an. »Schließlich willst du dieses Haus ja so schnell wie möglich verkaufen!«
Schon wieder dieser unterschwellige Vorwurf. Sie ahnte wahrscheinlich gar nicht, was so ein Heimplatz in einem privaten Pflegeheim mit Rundumbetreuung kostete! Ich fühlte mich einfach nur erschöpft.
»Gönn deiner alten Mutter doch mal eine kleine Pause!«
Versöhnlich legte ich den Arm um sie.
»Schau, das bin ich mit Opa Karl und Oma Anna, an meinem dritten Geburtstag. Ich konnte kaum über den Tisch schauen, um die Kerzen auszublasen.«
Rosa war immer noch mit der kleinen Wunde an ihrem Finger und wahrscheinlich auch an ihrem Herzen beschäftigt. Als ob mir mein Vater nicht auch leidgetan hätte! Bisher hatte er sich noch nicht eingelebt, fragte immer nach seiner Anna oder nach ganz anderen Frauen und wollte nach Hause. Ich versuchte mein schlechtes Gewissen zu verdrängen. Es ging eben nicht anders!
»Und da siehst du mich mit Tante Martha, mein erster Schultag, das war 1950, hier in Bamberg. Ich weiß noch, dass ich das kleinste Kind der Klasse war und die größte Schultüte hatte!«
Rosa schaute mir immerhin über die Schulter. »Logisch, wenn deine Mutter einen Kiosk hatte. Die anderen Kinder müssen ganz schön neidisch gewesen sein!«
»Das stimmt.« Ich grinste meine Tochter über die Schulter hinweg an. »Niemand hat es je gewagt, mir etwas zuleide zu tun, denn durch mich kam man an Brausepulver und Abziehbildchen, später dann an Zeitschriften wie die Bravo, die ich heimlich irgendwo versteckt hatte.«
Rosa lächelte inzwischen und blätterte eine Seite weiter.
»Das Klassenfoto. Gott, wie viele ihr da seid! Das sind ja fast fünfzig Kinder! Welches bist du?«
»Da, ganz außen links in der ersten Reihe. Der blonde Winzling mit den Zöpfen.«
»Mama, du warst aber wirklich klein. Warum wurdest du nicht einfach für ein Jahr zurückgestellt?« Die angehende Lehrerin sah mich missbilligend an. »Haben die keinen Schulreifetest mit dir gemacht?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung. Ich bin im Mai geboren. Damals wurde nicht lange nach Schulreife gefragt. Es gab ja nur eine Klasse pro Jahrgang, so kurz nach dem Krieg.«
»Heute gibt es Kinderpsychologen, die sich ausgiebig mit solchen Fragen beschäftigen.«
»Ich weiß«, sagte ich. »Heute gibt es Vorschulen und Förderprogramme und so was alles.«
Ich hob die Schublade auf, die immer noch auf dem Fußboden lag. »Oh, schau mal, was sich hier noch versteckt!«
Mit spitzen Fingern befreite ich eine alte schwarze Kladde, die von einem Einweckglas-Gummiring zusammengehalten wurde, vom Wachspapier.
»Wieso war das unter dem Wachspapier?«
Vorsichtig nahm ich das schwarze Büchlein in die Hand. Ich hatte es noch nie gesehen.
Rosa entriss es mir neugierig und setzte sich im Schneidersitz auf das Küchensofa. »Vielleicht Omas geheime Kochrezepte: Die pommersche Küche. Das könnte ein Bestseller werden!« Schon streiften ihre Finger eifrig den dicken Gummiring ab, der mehrfach darumgeschlungen war, als sollte er ein Geheimnis wahren.
»Das sind keine Kochrezepte.«
Rosa gab mir das Büchlein enttäuscht zurück. Ich musste erst meine Lesebrille suchen. Ächzend ließ ich mich auf das bequeme Sofa fallen, auf dem Opa Karl immer so gern seine Zeitung gelesen hatte.
»Rutsch mal.«
Ich zog die Leselampe näher und fühlte mich plötzlich so wie früher, voller Vorfreude und Neugierde auf eine spannende Geschichte. Wie oft hatte meine Mutter Anna mir hier Märchen vorgelesen! Später hatte Vater mich dann Lateinvokabeln abgefragt und mir mathematische Formeln erklärt.
»Gott, das ist noch ein ganz altes Schulheft mit vorgezeichneten Linien und Löschblatt.«
Ehrfürchtig schlug ich das Büchlein auf. Und entdeckte ein mir vertrautes Kinderlied:
Maikäfer, flieg!
Der Vater ist im Krieg.
Die Mutter ist im Pommerland.
Pommerland ist abgebrannt.
Maikäfer, flieg!
Mit einer merkwürdig heiseren Stimme trug ich es meiner Tochter vor. Wie lange hatte ich es schon nicht mehr gehört? Mich überzog eine Gänsehaut.
»Kennst du das noch? Meine Mama hat es mir oft vorgesungen, als ich klein war.«
»Ist das politisch korrekt? Oder diffamiert es Migranten mit pommerschen Wurzeln?« Rosa rieb sich die Nase. »Was heißt das überhaupt, Pommerland?«
»Damit ist das heutige Polen gemeint.« Ich schüttelte den Kopf. »Über so was haben wir uns damals keine Gedanken gemacht.«
»Pommerland ist abgebrannt, wie traurig. Warum schreibt sie das auf die erste Seite?«, fragte Rosa.
»Meine Eltern sind nach dem Krieg aus Pommern geflohen, aber mehr wollten sie darüber nie erzählen.«
»Warum eigentlich nicht? Hast du nie gefragt?«
»Sie haben das Thema immer gemieden. Es war offensichtlich zu schmerzhaft. Sie haben es verdrängt, wie so viele, die nach dem Krieg neu angefangen haben. Irgendwann habe ich es nicht mehr gewagt zu fragen.«
Ich blätterte weiter und zuckte mit den Schultern. »Aber es ist ein Tagebuch, schau mal.«
Rosa legte die Hand darauf. »Wenn sie es so gut versteckt hat … meinst du, sie möchte, dass wir das lesen?«
Ich überlegte. »Sie hat uns ihr Haus vererbt, mein Schatz. Dir und mir. Und damit auch diese Küchenkommode. Mitsamt ihrem Tagebuch.«
»Wir könnten es Opa Karl mitbringen, wenn wir ihn nachher im Altersheim besuchen. Und ihm daraus vorlesen. Das freut den alten Herrn vielleicht.«
Merkwürdigerweise spürte ich ein Unbehagen. Er wollte doch nie über die Vergangenheit reden! Wusste er überhaupt von Mutters Tagebuch?
»Opa Karl wird nicht mehr viel davon mitkriegen. Weißt du, Oma Anna war ja bis zuletzt geistig fit. Warum hat sie uns wohl das Haus vererbt? Weil sie genau wusste, dass es Opa Karl nicht alleine schaffen würde. Sie war sehr praktisch veranlagt und hat sich bestimmt gewünscht, was wir jetzt vorhaben: das Haus verkaufen und Opa Karl von dem Erlös ein luxuriöses Pflegeheim finanzieren.«
»Mama, fang jetzt nicht wieder damit an!« Rosa rückte sofort wieder von mir ab. »Das wollte Oma Anna ganz bestimmt nicht, dass du den armen Opa einfach abschiebst.«
»Ich? Oder wir? Du bist doch auch erwachsen, Rosa! Willst du ihn hier zu Hause pflegen? Hm? Und deine Stelle im Gymnasium erst antreten, wenn Opa Karl gestorben ist? Du hast noch keine eigene Klasse. Aber ich schon. Und die steht kurz vor dem Abitur.«
Rosa schüttelte verärgert den Kopf. »Ich bin sechsundzwanzig und muss in den Beruf. Aber du musst nicht mehr, Mama. Deine Pension wäre schon jetzt fett genug.«
»Rosa, diesen Ton verbitte ich mir! Das steht dir nicht zu, so mit mir zu sprechen!«
»Streiten wir also doch wieder?«
»Nein. Verschieben wir es auf morgen.«
Wieder warf ich einen Blick auf die Kladde.
»Nachstehendes schreibe ich für meine Tochter Paula, damit sie in späteren Jahren einmal die Wahrheit erfährt. In Liebe, immer deine Mutter Anna.«
»Also möchte sie es. Sie hat es für mich geschrieben, Rosa! Machst du uns einen Tee, Liebes?«
»Mama, willst du jetzt von alten Zeiten schwärmen?« Rosa war wieder aufgesprungen. »Wenn du das Haus verkaufen willst, müssen wir es wohl oder übel vorher ausmisten!«
Wollte ich mein Elternhaus wirklich verkaufen? Die vertraute Handschrift meiner Mutter versetzte mir einen merkwürdigen Stich. Nicht auszudenken, wenn Fremde dieses Büchlein gefunden hätten!
Neugierig blätterte ich hin und her. Die Kladde war vollgeschrieben bis zur letzten Seite. »Ich nehme Pfefferminztee, die Schachtel liegt da auf der Erde!«
»Jetzt?« Rosa sah mich an. »Du willst jetzt in dieser Kladde lesen?«
»Jetzt.« Ich hielt ihrem Blick stand. »Gehetzt und nach der Uhr gelebt habe ich mein Leben lang. Und jetzt gönne ich mir ein Lesestündchen. Vielleicht erfahre ich ja etwas über Oma Anna, was wir beide noch gar nicht wussten!« Und vielleicht ändere ich meine Meinung über den Hausverkauf!, dachte ich, sagte aber nichts.
Rosa musste lächeln. Sie stellte zwei dampfende Tassen Tee auf den Tisch, und ich sah ihr an, dass sie mit sich kämpfte, ob sie nun weiterputzen oder sich gemütlich neben mich setzen sollte.
»Komm, Schatz, wir schmökern ein bisschen darin. Leiste mir doch Gesellschaft! Die Zeit mit dir ist so kostbar für mich.«
Bald würde sie nur noch mit ihrem Fabian verreisen. Ich ahnte, dass dies unser letzter gemeinsamer Sommer werden würde – und selbst wenn wir gerade häufig stritten: Ich wollte ihn genießen und mit ihr noch mal nach Amerika reisen. Nur wir zwei.
Rosa ließ sich neben mich fallen und rührte in ihrem Tee.
»Okay. Dann lass mal hören. Vielleicht hatte Oma Anna einen heimlichen Geliebten!«
»Oma Anna doch nicht!« Ich warf ihr einen amüsierten Blick zu. »Oma Anna war die preußische Korrektheit und Anständigkeit in Person!«
»Oder sie hat irgendwo ganz viel Geld versteckt …«
»Also bitte, Rosa. Reicht es dir nicht, dass sie uns dieses Haus vererbt hat?«
»Oder sie hatte vor Opa Karl schon einen anderen Mann …«
»Wie kommst du denn darauf?«
»Steht doch da. – Nee. Echt?« Rosa beugte sich mit großen Augen vor und tippte mit dem Finger auf eine bestimmte Stelle. »Wie, sie hat 1944 Egon geheiratet? Wer war Egon?«
Das fragte ich mich allerdings auch. Von einem Egon hatte ich noch nie gehört.
2
ANNA
Auf einem Bauernhof in Pommern, 25. Juni 1943
»Wie, du heiratest Egon? Wer ist Egon?«
Vater saß in seiner bäuerlichen Arbeitskluft am Mittagstisch und ließ sich von Mutter mit der Holzkelle Suppe in den Teller schöpfen. Seine verdreckten Schuhe standen draußen vor der Stube, die ich eben noch ausgekehrt hatte. Trotzdem hatte er den starken Geruch nach Pferd und Landwirtschaft mit in die Stube gebracht.
»Vater, sei bitte nicht besorgt! Aber ich bin jetzt sechsundzwanzig und will keine alte Jungfer werden!«
Mit Herzklopfen drehte ich den Brief in den Händen, den Mutter mir ausgehändigt hatte.
Egon war im letzten Sommer Pensionsgast bei uns gewesen. Ein älterer Junggeselle aus Hannover. Schneidig, zackig, mit modisch kurzem Haarschnitt und angesagtem Schnauzbart. Er war Beamter bei der Post und hatte nie schmutzige Hände, dafür Ärmelschoner. Das hatte mich schwer beeindruckt.
Er hatte deutliches Interesse an mir gezeigt, und wir waren ein paarmal Tanzen gewesen.
»Egon schreibt, er hat eine Wohnung in Hannover für uns, und er mag auch nicht mehr warten. Man weiß schließlich nicht, was kommt, in diesen Zeiten. Er möchte ein tüchtiges, fleißiges deutsches Mädchen heiraten.«
Vaters Mund wurde zu einem schmalen Strich.
»Egon ist erstens viel zu alt für dich und wird zweitens sicherlich noch an die Front einberufen!« Verärgert zupfte er seine Brotscheibe in grobe Stücke und warf sie in die Suppe. »Als überzeugter Nazi.«
Mutter stand mit der Schüssel im Arm daneben und sah mich warnend an.
»Anna, wir sind im Krieg, und nachdem deine Brüder an der Front sind, brauchen wir hier auf dem Hof jede helfende Hand.«
»Ach. Und deswegen soll ich auf Mann und Kind verzichten.« Trotzig hielt ich ihrem Blick stand. Bis eben hatte ich noch unsere zwölf Kühe gemolken und deren Mist weggeschaufelt. In einer groben Schürze und mit Gummistiefeln. Am Nachmittag wartete der Kartoffelacker auf mich. Und am Abend wieder zwölf Kühe. Und so ging das jeden Tag.
»Alle sind verheiratet«, begehrte ich trotzig auf. »Meine Schwester Frieda hat schon zwei Kinder und meine Schwägerin Renate ebenfalls.« Ich schluckte die Tränen herunter. »Nur ich soll als einsamer Blaustrumpf vertrocknen und versauern. Aber das ist euch ja wohl egal.«
Vater schüttelte missbilligend den Kopf. Dieses Gesicht kannte ich aus meiner Kindheit: Immer wenn eines von uns sechs Kindern etwas angestellt hatte, überlegte er auf diese Weise, wie er reagieren sollte. Er war ein ruhiger, bedachter Mann, der selten aus der Haut fuhr.
Ich war das Nesthäkchen, der Nachkömmling, und mir sahen sie so manchen trotzigen Anfall nach. Meine Eltern waren beide schon fast siebzig und rackerten immer noch von früh bis spät.
»Renates Mann ist im Krieg, und Friedas Mann ist verwundet zurückgekommen«, murmelte Vater in seine Suppe hinein. »Der ist ihr im Moment mehr Last als Hilfe. Und mit sechsundzwanzig ist man noch lange keine alte Jungfer.«
»Aber Egon ist gesund und hat zwei Beine«, brauste ich auf. »Und er ist Beamter mit einem sicheren Einkommen. Ich will auch noch Kinder haben!« Selten hatte ich so energisch gegen meine Eltern aufbegehrt. Ich hatte das Gefühl, dass meine Zeit ablief, und das versetzte mich mehr und mehr in Alarmbereitschaft. Mit sechsundzwanzig lief man doch nicht mehr unverheiratet in der Gegend herum, außer man war hässlich wie die Nacht.
»So nimm dir doch wenigstens einen Mann aus unserer Gegend!« Energisch stellte Mutter die Suppenschüssel auf den Tisch, setzte sich und füllte ihren Teller.
»Dieser Egon ist uns einfach nicht sympathisch! Er ist Nationalsozialist, ein Büromensch, der gar nicht richtig zupacken kann. Eine Landwirtschaft ist nichts für den. Und er spricht auch ganz anders als wir. So hochgestochen, so näselnd.« Mutter setzte einen arroganten Blick auf und sprach mit gekünstelter Stimme: »Der stolpert übern spitzen Stein!« Das entlockte Vater ein harsches Lachen. »Recht hast du, Margret, genau. Der passt doch gar nicht zu uns. Er war bei uns Feriengast, und so wird er sich auch immer benehmen!«
»Ach. Nur weil er kein Bauer ist.« Meine Stimme wurde schriller als beabsichtigt. »Und wen bitte schön soll ich denn in dieser Gegend noch finden? Es sind doch alle brauchbaren Männer an der Front!« Und die Hinkebeine will ich nicht!, schoss es mir durch den Kopf. Ich will tanzen und schöne Blusen tragen!
»Du solltest mitten im Krieg überhaupt nicht ans Heiraten denken.« Vater schaufelte sich die eingeweichten Brotbrocken auf den Löffel. »Ihr Mädels müsst uns Eltern kräftig unterstützen, solange unsere Jungs im Krieg sind. Es fehlt doch jetzt jede Arbeitskraft. Und Frieda muss sich ja auch noch um ihre Kleinen kümmern.«
Ich presste die Lippen zusammen. So war das also. Mein Glück war nichts wert. Ich wurde als billige Arbeitskraft gesehen. Dabei war ich eine blühende junge Frau, die endlich mal wieder leben und Spaß haben wollte! Feriengäste kamen keine mehr. Nur polnische Fremdarbeiter. Bald würde ich verblühen! Und dann würde mich niemand mehr wollen. Warum verstand denn das keiner?
Meine Eltern hatten hier in einem winzigen Dörfchen im Kreis Köslin eine beachtliche Landwirtschaft erarbeitet. Sie waren sehr stolz auf ihren Besitz, denn sie hatten ihn durch jahrelange Entbehrungen vergrößert. Jedes Jahr war ein neues Kind dazugekommen; erst die vier Buben, die nun alle an der Front waren, dann Frieda und drei Jahre später schließlich ich, Anna, das Nesthäkchen. Das Wohnhaus und die Stallgebäude hatten meine Eltern zusammen mit meinen Brüdern im Lauf der letzten Jahre neu erbaut. Mit knapp siebzig wollten sie ihnen den Hof, die Landwirtschaft und die dazugehörige Pferdezucht übergeben und dann ihren wohlverdienten Ruhestand antreten, ihren Lebensabend sorgenfrei beschließen.
Aber dann war der Krieg dazwischengekommen. Und alle Pläne und Träume hatten sich in Luft aufgelöst. Ihre und meine. Und die von Millionen anderen Menschen auch. Hitler hatte Millionen von Männern nach Russland geschickt, wo sie »uns verteidigen« sollten. Damals ahnte noch niemand von uns, was für Dimensionen des Schreckens er und seine Gefolgschaft weltweit anrichteten. Am Ende würden weltweit über sechzig Millionen Kriegstote zu betrauern sein. Allein im benachbarten Polen sollte ein Sechstel der Einwohner getötet werden, sechs Millionen Menschen. Am schlimmsten erging es den Juden. In ihren Familien zählte man nicht die Toten, sondern die Überlebenden.
Aber all das wusste ich als junge Frau damals nicht. Das Einzige, was mich interessierte, war, bald zu heiraten und von dieser schweren körperlichen Arbeit wegzukommen. Ich träumte mich in ein Kleid und Seidenstrümpfe, ich träumte mich in eine Großstadt, ohne zu ahnen, dass Hannover schon bald in Schutt und Asche liegen würde.
»Wenigstens kriegen wir jetzt einen Polen als Zwangsarbeiter.« Vater schob den Teller beiseite. »Die Gauleitung hat uns schon einen zugeteilt. Im Dorf geht es zu wie auf dem Sklavenmarkt. Die anderen Bauern wollten unbedingt die Kräftigsten, für uns blieb nur ein schmales Kerlchen übrig, kaum siebzehn Jahre alt.«
»Warum kriegen wir nur einen, Walter?« Mutter zerknüllte die Serviette auf ihrem Schoß. »Nachdem unsere vier Söhne an der Front sind, sollten wir eigentlich vier kriegen!«
»Dafür kriegen wir noch eine Magd.« Vater wischte sich über den Mund. »Die schönsten Mädchen sind schon weg, aber unsere muss nicht schön sein, sondern anpacken können.« Fragend sah er mich an. »Ist was, Anna?«
»Ich bin keine polnische Magd.« Gekränkt stand ich auf, meine Lippen zitterten vor Empörung. »Und eben deswegen heirate ich den Egon.«
3
Hannover, Herbst 1943
»Mein Gott, wo bleibst du denn! Braucht die gnädige Frau eine Extraeinladung?« Mein Mann Egon riss an meiner Bettdecke und rüttelte mich grob.
Verschreckt fuhr ich aus dem Schlaf. Selbst das nächtliche Sirenengeheul hatte mich nicht aufwecken können. »Was? Wo bin ich? Wohin?«
Grelle Blitze durchzuckten die Nacht, unter schrillem Geheul gingen Bomben zu Boden, Fenster klirrten. Draußen brüllten und schrien die Menschen, und der Himmel war blutrot. Eine ungeheure Hitze erfasste unser Schlafzimmer, und ich hielt mir entsetzt die Decke über den Kopf.
»Mensch, Anna, alle sind schon im Luftschutzkeller, und du träumst hier vor dich hin!«
Egon zerrte mich an den Armen hoch. »Als Blockwart habe ich als Erster unten zu sein, ich habe dich überall gesucht! Meine eigene Frau fehlt! Das fällt alles auf mich zurück!«
»Ja, geh schnell vor, ich komme!« Schlaftrunken schlüpfte ich in meine Sachen, die wie jede Nacht neben dem Bett bereitlagen. Seit einiger Zeit hatten wir hier heftige nächtliche Luftangriffe, und Hannover lag unter einer blutroten Feuerdecke. Wenn mir nur nicht immer so schlecht wäre vor Angst! Seit Tagen musste ich mich ständig übergeben.
Panisch suchte ich nach dem Eimer, den ich vorsichtshalber bereitstehen hatte.
»Quatsch nicht rum, bequem dich endlich runter!« Egon scheuchte mich aus dem Schlafzimmer wie ein bockiges Kalb. Dass er mir nicht noch einen Fußtritt in den Allerwertesten gab, war alles. Ich würgte Galle hinunter und raste mit weichen Knien hinter Egon durchs bebende Treppenhaus, hinaus in den Hof.
»Das Eisenwerk brennt!« Die anderen Mieter und der Hauswirt kamen uns schon hustend entgegengerannt, die Gesichter schwarz vor Ruß.
»Kommt schnell, der Luftschutzkeller ist schon voll, wir müssen in den Keller der Nachbarn!«
Mit Entsetzen starrte ich auf die flüchtenden Menschen, die in Panik durcheinanderstoben.
»Wartet, ich muss mich erst übergeben …« Vor der Hecke würgte und kotzte ich mir die Seele aus dem Leib.
Unwirsch zog Egon mich am Arm. »Reiß dich zusammen, Anna!«
Direkt neben uns schlug eine Bombe ein, und die Fenster unseres Hauses zerbarsten klirrend. Die Tür zum Waschkeller flog auf, als ob ein Riese daran gezerrt hätte, und Ziegel ratterten vom Dach, einer nach dem anderen zerschellte direkt neben meinen Füßen. Mir war so schlecht.
»Egon, ich habe Angst!«
»Komm weiter und stell dich nicht so an!«
In ihrer Not suchten die Menschen Schutz im Keller, in den Egon mich jetzt zerrte. Frauen mit Kindern duckten sich im Schein der Flammen, die von draußen hereinzüngelten, Babys schrien, Frauen beteten und weinten, alte Männer schimpften. Junge Männer gab es keine. Die waren an der Front.
»Leute, bleibt ruhig, das geht vorbei. Der Führer hat alles im Griff, wir schlagen die Feinde zurück!« Egon schwang sich auf eine Kiste und hielt eine glühende Rede auf das siegreiche Deutschland, während Alte, Kranke, Mütter und Kinder sich panisch unter nassen Decken vor dem hereinbrechenden Feuer zu schützen versuchten. Gellendes Geschrei, Weinen und Stöhnen unterbrachen meinen Ehemann.
»Der Glaube an den Endsieg wird uns auch weiterhin die Kraft geben …«
Plötzlich malträtierte ein höllisches Krachen unsere Trommelfelle, wir wurden ans andere Ende des Kellers geschleudert. Stechender Qualm drang herein, und aus Angstschreien und Weinen wurde heftiges Husten. In mir zog sich alles zusammen, ich musste mich wieder übergeben, einfach auf meine Schuhe.
»Bringt mehr nasse Decken«, brüllte jemand, und ein paar Männer stürmten in den Hof, rissen Vorhänge und Gardinen von der Stange, tauchten sie in den Brunnen und warfen sie klatschend über uns. »Los, die Frauen und Kinder zuerst, raus hier!« Es stoben die Funken, der schwarze Rauch kroch in jede Ritze. Beißender Phosphor vergiftete unsere Lungen.
Egon stand immer noch auf der Kiste und schwang Reden über den glorreichen Führer, wurde aber einfach umgerannt.
Eine Nachbarin packte mich, und während ich mich im Laufen erneut übergab, zerrte sie mich hinter einen Johannisbeerstrauch. »Los. Duck dich. Atme. Immer schön gleichmäßig atmen.« Entsetzt starrte sie mich an. »Du bist doch nicht etwa schwanger, Anna?«
O Gott! Daran hatte ich noch gar nicht gedacht! Wie schrecklich, ausgerechnet jetzt … Das konnte doch nicht sein! Ich hatte längst gemerkt, dass ich Egon gar nicht liebte und dass die Heirat ein riesiger Fehler gewesen war. Ich wollte nur noch nach Hause, zu meinen Eltern.
Wie sehr hätte ich mir gewünscht, jetzt einen liebevollen Ehemann an meiner Seite zu haben, der mich tröstete und mir Hoffnung gab, doch er stieß wüste Drohungen aus: »Wer flieht, wird streng bestraft! Vaterlandsverräter werden im Hof an der Teppichstange aufgehängt!«
Von oben regnete es Brandbomben, wir sahen dem Tod ins Auge. Das Schrecklichste waren die Menschen, die auf dem glühend heißen Asphalt kleben blieben und lichterloh brannten. Manche versuchten noch, bis zum Maschsee zu kommen, um sich als lebende Fackeln dort hineinzuwerfen. Andere verglühten vor meinen Augen.
»Eure Wohnung brennt, Anna!« Die Nachbarin schrie es mir zu. Mit zusammengekniffenen Augen wagte ich einen Blick in den Bombenhagel: Ja. Es waren unsere Gardinen, die im dritten Stock brennend aus den Fenstern segelten, und es waren unsere Wohnzimmerbalken, die daraufhin über unserem Ehebett zusammenbrachen. Es krachte und donnerte, während sich in mir neues Leben regte! Das arme Kind würde das Licht der Welt niemals erblicken. Ach, wenn ich doch jetzt mit ihm zusammen sterben könnte!
»Vorschriftsmäßig löschen!« Egon knallte die Hacken zusammen und reckte den rechten Arm so zackig nach oben, dass es aussah wie sein üblicher Hitlergruß. Er konnte schon gar nicht mehr anders. »Laut Verordnung hat in jeder Wohnung Löschwasser zu stehen«, brüllte er die Nachbarn in militärischem Ton an, selbst die, die nur noch schreiend um ihr Leben liefen.
Als es hell wurde, sahen wir die unermessliche Katastrophe, die diese Nacht meiner neuen Heimat gebracht hatte. In unserer Wohnung stand knietief das Löschwasser. Fassungslos wateten wir darin herum und sahen nur noch durchnässte, verdorbene und verfaulte Dinge darin schwimmen. Der Rest war verkohlt, die elektrischen Leitungen waren explodiert.
»Kameraden! Schutt zusammenkehren, Fenster mit Brettern zunageln!«, schnarrte Egon im Hof. Alle, die noch halbwegs bei Sinnen waren, fingen sofort an, emsig zu arbeiten.
»Melde gehorsamst, die Wasserleitungen sind demoliert!«, verkündete jemand.
»Pumpen«, brüllte Egon ihn an.
Am Ende der Nacht waren es einundzwanzig Tote, die in unserem Hof und im Hof der Nachbarn lagen.
Herabgestürzte Giebel hatten Abdrücke in den Straßenbelag gebrannt. Erst am Morgen ließ die unerträgliche Hitze allmählich wieder nach.
Für die Feuerschutzpolizei gestalteten sich die Rettungsarbeiten als unmöglich; immer wieder explodierten Bomben, die mit Zeitzündern ausgestattet waren. Bis zu hundertzwanzig Stunden später gingen immer noch Granaten hoch. Die Alliierten hatten ganze Arbeit geleistet.
Das Wasserleitungssystem hatte schweren Schaden genommen; der Maschsee musste abgepumpt werden. Auch darin schwammen Leichen: Frauen, Kinder, Babys, aber auch verzweifelte Alte, die ihrem Leben auf diese Weise ein Ende gesetzt hatten.
Im Stadtzentrum hatten sich Flächenbrände ausgebreitet, die auf die letzten Häuser übergriffen. In den Luftschutzkellern waren Tausende von Menschen erstickt.
»Infolge des konzentrischen Angriffs und überaus dichten Teppichabwurfs wurde eine Fläche von zehn Quadratkilometern völlig vernichtet«, gellte es aus dem Radio. »Durch die heftige Bombardierung des Stadtkerns sind das Geschäftsleben und der behördliche Dienstbetrieb, das Gaststätten- und Beherbergungs-Gewerbe in Hannover völlig stillgelegt! Hannover liegt in Schutt und Asche!«
»Der Hauptbahnhof ist komplett abgebrannt! Anna, du musst den Bus nach Hildesheim nehmen! Von Hildesheim geht noch ein Zug nach Berlin. Wenn du rennst, erwischst du ihn noch!« Wenige Tage später half mir die Nachbarin, meinen Pappkoffer zu tragen, und eilte mit mir zur Bushaltestelle vor einer Ruine, die immer noch rauchte.
»Sag Egon, ich fahre zu meinen Eltern zurück!« Keuchend trabte ich auf braunen Halbschuhen neben ihr her. Mein Faltenrock spannte sich inzwischen schon über den Hüften.
»Anna, der wird dich nicht vermissen.« Die Nachbarin ließ ein Pferdefuhrwerk vorbei, das über das Kopfsteinpflaster holperte, und zog mich weiter. »Nur damit du kein schlechtes Gewissen hast: Der hat schon längst ein Techtelmechtel mit einer anderen.«
Warum überraschte mich das nicht?
»Woher willst du das wissen?«, schnaufte ich.
»Alle Welt weiß es! Sie heißt Mechthild und ist seine Sekretärin!« Die Nachbarin zog mich um eine zerbombte Häuserecke und stieg Hand in Hand mit mir über herumliegende Steinbrocken. »Vorsicht, hier soll es Minen geben!«
»Sag ihm, ich melde mich, wenn ich bei meinen Eltern angekommen bin. Falls ihn das überhaupt noch interessiert.«
Techtelmechthild würde ihn sicher über den ersten Verlustschmerz hinwegtrösten. Es war beschämend genug, dass ich auf einen waschechten Nazi hereingefallen war, der nur in Uniform mit Hakenkreuz am Ärmel seine Umwelt anbrüllen konnte. Warum sie Egon noch nicht eingezogen hatten, ließ sich nur mit seinem Alter erklären: Er war schon fünfundvierzig. Ein Beamter im Postwesen mit runder Nickelbrille über dem schwarzen Schnäuzer und akkuratem Mittelscheitel, der auch geholfen hatte, Juden ausfindig zu machen und abtransportieren zu lassen. Warum hatte ich nicht auf die mahnenden Worte meiner Eltern gehört? Ich kannte ihn doch kaum!
Meine Eltern hatten recht gehabt: Er passte überhaupt nicht zu mir! Warum ich ihn trotzdem geheiratet hatte, konnte ich mir nicht mehr erklären. Aber nun wuchs ein neues Leben in mir heran, und das wollte ich in Sicherheit bringen.
»Leb wohl, Anna, pass auf dich auf!« Die Nachbarin umarmte mich ein letztes Mal, und da knatterte auch schon der klapprige Überlandbus um die Ecke, in dem lauter verschüchterte Kinder und verstörte Flüchtlinge saßen. »Zum Bahnhof Hildesheim bitte!«
»Ja, da wollen sie alle hin. Wir können nur beten, dass die Gleise dort noch nicht zerstört sind!« Der Fahrer verlangte kein Geld von mir. Es herrschte Ausnahmezustand. Ich drängte mich in den überfüllten Bus und war froh, noch einen Stehplatz ergattert zu haben. Noch immer war mir schlecht, aber ich zwang mich, trotz des Gestanks nach Angstschweiß und ungewaschenen Menschen nicht zu kotzen. Tapfer klammerte ich mich an eine Schlaufe.
In Hildesheim stand tatsächlich noch ein Zug, in den sich die Leute panisch schoben. Ich schaffte es, mir eine ausklappbare Holzbank zu sichern, und atmete konzentriert am Fenster vor mich hin. Er stand und stand, kein Mensch wusste, warum er nicht losfuhr.
»Wahrscheinlich sind irgendwo Schienen zerstört«, mutmaßte jemand. »Bis die repariert sind, das kann dauern.«
Es war grauenvoll. Hunderte verängstigter Menschen ohne Heimat und ohne Plan saßen und standen eingepfercht in diesem Zug. Warum hatte ich mich nur in diese Hölle begeben, wo doch bei uns in Pommern die Welt noch in Ordnung war?
Stunden später atmete ich auf, als sich der Zug tatsächlich schnaufend in Richtung Berlin in Bewegung setzte. Auf den Bänken hockten verstörte Kinder, die noch im letzten Moment evakuiert werden sollten, ständig stiegen neue zu. Weinende Mütter und Väter standen an jedem Bahnhof und winkten, Tapferkeit und Zuversicht ins Gesicht gemeißelt. In Berlin »Zoologischer Garten« angekommen, heulten bereits wieder die Sirenen. Alle verließen den Zug und rannten um ihr Leben. Jetzt galt es, vom Bahnhofsgelände zu fliehen, denn der Bahnhof war das Hauptziel der Alliierten.
Hoch über der Stadt brummten bereits die Flugzeuge und warfen ihre tödliche Fracht ab. Mit meinem ungeborenen Kind im Bauch rannte ich quer durch die brennende Stadt, um den Ostbahnhof mit Zügen nach Pommern zu erreichen. Hoffentlich wurde der noch nicht bombardiert! Zwischen einstürzenden Häusern, sich aufbäumenden Pferden, schreienden Menschen, heulenden Rettungswagen und nach wie vor fallenden Bomben irrte ich weinend umher.
Hier wohnte doch irgendwo auch meine Schwägerin Renate, die Frau meines Bruders Werner, mit ihren Kindern Leo und Lilli! Sollte ich versuchen, sie zu finden? Aber die Straßen und Häuser waren nicht mehr zu erkennen. Bestimmt war sie mit ihren Kindern längst auf der Flucht. Die armen Kleinen! Wer konnte in dieser Hölle noch ein Kind in die Welt setzen?
Ich, natürlich.
»Papa! Mama!«, flehte ich. »Wartet auf mich, ich komme!« Und während ich mich unter einen Mauervorsprung duckte, versprach ich ihnen laut, sie nie wieder im Stich zu lassen. »Es tut mir so leid, ich war so eine blöde Gans«, wimmerte ich zähneklappernd. »Ich schwöre euch, ich werde an eurer Seite sein, bis dieser Krieg vorüber ist!«
4
Köslin in Pommern, zwei Tage später, Oktober 1943
»Kind, da bist du wieder! Wir haben uns solche Sorgen gemacht!«
Vater stand mit seinem Planwagen vor dem Bahnhof der kleinen Kreisstadt, als ich zwei Tage und Nächte später endlich wieder mit einem der letzten Züge in meiner geliebten Heimat ankam. Ich war der Hölle nur knapp entronnen.
Weinend fiel ich meinem geliebten Vater um den Hals. »Es tut mir so leid, Papa …«
Er hatte wieder diesen Strichmund, den ich von früher kannte. Aber diesmal verzog er sich zu einem winzigen Lächeln.
»Irren ist menschlich. Hauptsache, du bist wieder da.« Papa geleitete mich auf seinen Kutschbock. »Wir hatten schon Angst, du hättest den unsäglichen Egon auch mitgebracht!«
»Nein. Den nicht.« Ich strich mir unwillkürlich über den Bauch. »Dafür habe ich euch etwas anderes mitgebracht …« Schluchzend beichtete ich meinem Vater, dass ich inzwischen im vierten Monat schwanger war.
Vater reagierte ganz wunderbar: »Na, wo wir acht Mäuler satt kriegen, kriegen wir auch ein neuntes satt!«
Er schob sich die Mütze in den Nacken, schnalzte mit der Zunge und trieb seine Pferde an. Die zehn Kilometer nach Hause zu unserem Landgut fanden sie spielend allein. Vater hatte wunderbare Zuchtpferde, die sein ganzer Stolz waren, und sein vorbildlich geführter Hof war weit über die Grenzen des Landkreises bekannt.
Zu Hause angekommen, saß die Großfamilie Olschewski schon am Mittagstisch:
Frieda, meine ältere Schwester, mit ihrem Mann Ansgar, der versehrt von der Front zurückgekommen war: Mein Schwager hatte einen Bauchschuss erlitten und viel Blut verloren. Vorerst musste er nicht an die Front zurück. Meine Eltern freuten sich sichtlich über eine Arbeitskraft mehr. Ingrid und Günther, ihre beiden Kinder, acht und fünf Jahre alt, saßen strahlend mit dabei. Wir herzten und küssten einander.
Auf der anderen Seite des Tisches saß meine Berliner Schwägerin Renate, die Frau meines Bruders Werner, bei der ich noch hatte unterschlüpfen wollen.
Sie war auf dem gleichen Weg wie ich zu ihren Schwiegereltern geflohen.
»Seit wann seid ihr denn hier?« Auch ihre zwei Kinder, die achtjährige Lilli und den dreijährigen Leo, umarmte ich herzlich. »Na, ihr seid aber groß geworden!«
»Seit ein paar Tagen!« Schwägerin Renate putzte ihrem Dreijährigen die Nase. »Werner hat uns geschrieben, dass wir bei seinen Eltern sicher sind.«
»Sie haben sogar ihre Fahrräder und die Nähmaschine, Betten und Bilder, Geschirr und Töpfe per Post hergeschickt.« Mutter setzte sich schwungvoll neben mich. »Sie haben jetzt erst mal das Altenteilhaus bezogen, und wenn der Krieg vorbei ist und Werner wieder zu Hause, ziehen wir dorthin.«
Außer meinen Familienangehörigen saß auch noch Otto Braatz, der Ortspolizist, mit am Tisch. Mutter hatte ihn als Untermieter aufgenommen. »Diesen Krieg gewinnen die Deutschen nicht mehr«, verkündete er. Bis jetzt hatte er Radio gehört und mischte sich nun in das Gespräch ein.
»Die senden zwar dauernd tolle Erfolgsmeldungen über die Siege der Deutschen, aber das Volk wird vorsätzlich getäuscht. Die totale Niederlage der Deutschen in Stalingrad Anfang des Jahres spricht Bände!«
»Sagen Sie das mal lieber nicht so laut«, entfuhr es mir aus alter Gewohnheit. »Wenn das mein Mann Egon hören würde, hätte er Sie jetzt schon beim Gauleiter angeschwärzt.« Ich traute mich nicht zu sagen, dass er dann wahrscheinlich schon an der Teppichstange baumeln würde.
»Anna! Wir dürfen hier sagen, was wir denken«, sagte Vater streng. »Nach dem sibirischen Winter lassen wir uns keinen Honig mehr ums Maul schmieren. Unsere deutschen Soldaten haben getan, was in ihrer Macht stand, aber niemand war gegen solch arktische Temperaturen von minus dreißig bis vierzig Grad gewappnet.«
Mein Schwager Ansgar berichtete weinend, dass vielen Soldaten Hände und Füße abgefroren waren. Er hatte unendlich viele tote Kameraden zurücklassen müssen. »Ihr macht euch kein Bild von dem entsetzlichen Grauen dort ….«
»Ansgar! Bitte nicht vor den Kindern!« Frieda versuchte ihnen die Ohren zuzuhalten.
»Die Russen konnten stets neue, ausgeruhte Kampfverbände aufbieten, während wir Deutschen schlecht ausgerüstet und am Ende unserer Kräfte waren. General Paulus wollte deswegen auch kapitulieren, weil der Kampf völlig aussichtslos geworden war, aber Hitler hat verlangt, dass wir bis zur letzten Patrone kämpfen. Ich habe so manchen Deserteur erlebt, den sie auf der Stelle erschossen haben.«
»Das sind hier Erwachsenengespräche!« Frieda warf Ansgar strafende Blicke zu. Der Schwager war komplett traumatisiert, so kannte ich ihn gar nicht. Er nahm überhaupt keine Rücksicht mehr auf die Kleinen, die ihn mit offenen Mündern anstarrten. Die Jungen trugen Lederhosen, die Mädchen geblümte Schürzen über ihren Kleidchen. Ich atmete auf, dass sie bei ihren Großeltern auf dem Land Schutz gefunden hatten. Hoffentlich würde der Krieg uns hier verschonen, sodass es für sie bei den grausamen Märchen aus einer weit entfernten Welt blieb.
»Hitler ist ein Wahnsinniger«, entrüstete sich nun wieder der Dorfpolizist. Er wusste, dass er in unseren vier Wänden so reden durfte. »Die deutschen Soldaten wollten längst aufgeben, aber sie mussten sich fügen, obwohl sie von den Strapazen schon zermürbt waren. Jetzt können sie nur noch Alte und halbe Kinder an die Front schicken! Ihr werdet sehen, das wird ihr letztes Kanonenfutter! Tausende der besten Kampftruppen haben ihr Leben verloren, Abertausende sind in Sibirien in Arbeitslager verschleppt worden. Es wird kaum ein Mann lebend und unversehrt heimkommen, das sage ich euch.«
»Die Deutschen haben den Russen aber auch schreckliches Leid zugefügt«, stellte Vater klar. Er hatte wieder ganz schmale Lippen. »Die Rote Armee wird eines Tages mit aller Härte zurückschlagen! Wisst ihr, wie viele Millionen Menschenleben Hitler und seine Mörderbande auf dem Gewissen haben? An uns werden sie sich rächen, mit Recht! Aber dann gnade uns Gott.«
»Bitte, Walter! Mach uns nicht solche Angst!« Mutter klapperte besonders laut mit den Tellern, und die Kinder starrten Vater mit großen Augen an. »Wir haben vier Söhne an der Front und beten jeden Tag, dass wir sie lebend wiedersehen.«
Ich zuckte zusammen. In welche entsetzliche Welt würde mein Kind hineingeboren werden? Aus dem zerbombten Hannover geflohen, durch das brennende Berlin geirrt, hatte mich doch die Zuversicht in mein Elternhaus nach Pommern zurückgetrieben, um hier wieder gut aufgehoben, beschützt und behütet zu sein! Ich wollte auch alles dafür tun, dass unsere Familie in Frieden im hart erarbeiteten Wohlstand leben konnte. Gott, wie hatte sich mein Sinn gewandelt! Ich wollte Tag für Tag die zwölf Kühe melken, den Stall ausmisten und Mutter im Haushalt helfen. Nie wieder würde ich aufbegehren und von einer Heirat träumen!
»Wie geht es euch eigentlich mit euren polnischen Zwangsarbeitern?«, versuchte ich etwas ungeschickt das Thema zu wechseln.
»Unser Polenjunge ist faul wie die Nacht«, grunzte Vater. »Sonntags will er gar nicht arbeiten, aber zum Essen kommt er dreimal am Tag!«
»Walter«, rügte ihn meine Mutter wieder. »Er ist doch selbst noch ein halbes Kind! Dafür haben wir ein sehr fleißiges, liebes Polenmädchen«, wandte sie sich mir zu. »Die ist zumindest guten Willens.«
»Haben eure Polen auch Namen?« Ich zog die Augenbrauen hoch. Gerade noch hatte Vater sich über die Gräueltaten der Deutschen an den Russen ausgelassen, und ich wollte die jungen Zwangsarbeiter aus Polen wenigstens mit Namen ansprechen. Sie konnten ebenso wenig für diesen grauenvollen Krieg wie wir.
»Piotr heißt der Bengel und das Mädel Dorota.«
»Wir werden uns schon zusammenraufen.« Mutter räumte die Teller ab, und sofort sprangen auch Frieda, Renate und ich, ja sogar die kleinen Mädchen auf, um ihr zu helfen.
»Wenn wir alle zusammenhalten, werden wir diesen Krieg mit Gottes Hilfe schon heil überstehen. Und wenn der Frühling kommt, dürfen wir ein neues Familienmitglied willkommen heißen! Bis dahin ist der Krieg hoffentlich vorbei.« Sie lächelte mich an, das Tablett mit dem Geschirr in den Händen: »Möge dieses Kind unser kleiner Friedensengel sein.«
Vater stand auf, legte mir die Hand auf die Schulter und lächelte: »Willkommen, kleiner Maikäfer.«
5
PAULA
Bamberg, April 2004
»O Mama, wie süß ist das denn! Meinst du, deshalb steht da dieses Lied mit dem Maikäfer?«
Rosas Augen glänzten. »Die haben sich alle so auf dich gefreut!«
Ich nahm die Lesebrille ab und rieb mir die Augen. »Mutter hat mir nie von diesen ganzen Leuten erzählt. Das war ja eine richtige Großfamilie, und ich wusste nichts davon!«
»Wo sind die denn alle geblieben?«, wunderte sich Rosa. »Meinst du, die sind alle im Krieg umgekommen?«
»Mutter hat nie vom Krieg erzählt.« Ich wischte mir über die Stirn. »Wie oft habe ich sie danach gefragt, doch sie hat nur den Kopf geschüttelt und abgewinkt. ›Mit leichten Händen halten und nehmen, halten und lassen‹ oder so ähnlich hat sie immer gesagt. ›Und wer das nicht kann, den straft das Leben.‹ Sie wollte nicht mehr darüber reden, nur alles vergessen, und das wäre auch für mich das Beste.«
Rosa betrachtete mich mit einer Mischung aus Sorge und Neugier. »Meinst du, die ganzen schrecklichen Kriegserlebnisse stehen hier drin? Wollen wir uns das wirklich geben?«
»Meine Mutter hatte fünf ältere Geschwister«, staunte ich. »Und mir gegenüber hat sie immer so getan, als wäre sie ein Einzelkind.«
»Ja, sie hat doch immer betont, dass in unserer Familie nur Mädchen und nur Einzelkinder vorkommen, oder nicht?« Rosa war aufgestanden und setzte neues Teewasser auf. »Sie war ein Einzelkind und ein Mädchen, du warst eines, und ich bin es auch!«
»Und alle sind wir Lehrer geworden«, setzte ich die Familienchronik fort. »Darauf war sie auch immer so stolz.«
»Politisch unkorrekt«, tadelte mich Rosa sofort. »Lehrer*innen heißt das!«
»Ach Kind, was ihr heute für Sorgen habt …«
Rosa wirbelte herum und steckte die Hände in die hinteren Jeanstaschen.
»Das Krasseste ist ja wohl, dass Opa Karl laut Tagebuch gar nicht dein richtiger Vater ist, Mama! Denn der kommt ja bisher überhaupt noch nicht vor. Was sagst du denn dazu?«
Die Frage überforderte mich. Verwirrt starrte ich meine Tochter an und gab mir Mühe, nicht in Tränen auszubrechen. Erst unser hässlicher Streit um Opa Karls Unterbringung und jetzt, fast als Strafe des Himmels, die schreckliche Erkenntnis, dass er gar nicht mein leiblicher Vater war? Ganz so, als hätte sich Karl an mir gerächt.
»Natürlich bin ich Karls Tochter!«, stammelte ich. »Wie könnte es auch anders sein: Wir stehen uns doch so nahe und sind uns so ähnlich! Ich meine, ich bin in seine Fußstapfen getreten so wie du in meine …«
Rosa streichelte zärtlich meine Schulter. Fast so, als tröstete sie eine verwirrte Schülerin, die dem Unterrichtsstoff nicht mehr folgen kann.
Wieder fuhr ich mir mit dem Handrücken über die Augen. »Wir lieben uns doch so! Opa Karl ist doch mein Vater, immer gewesen! Er hat mich liebevoll erzogen, manchmal ein bisschen streng, aber das war ja damals so.«
»Und so einen steckst du ins Heim.«
Rosa sah mich eindringlich an. Mir war klar, dass sie eine Antwort von mir erwartete.
»Es tut mir so leid, Rosa! Aber er wäre doch allein in diesem Haus nicht mehr zurechtgekommen!« Ich kämpfte mit den Tränen. Wie einsam musste sich meine Mutter gefühlt haben, sechzig Jahre lang allein mit diesem Geheimnis? Hatte sie mich Karl untergejubelt? Das taten ja damals bestimmt viele Frauen, die während des Krieges …
Rosa stützte die Hände auf die Tischplatte.
»Mama, wir wollten doch sowieso noch zu Opa Karl ins Altersheim fahren. Warum fragen wir ihn nicht einfach? Er hat doch auch manchmal klare Momente.«
Es kostete mich Kraft, ruhig zu bleiben. »So kurz nach Mutters Tod? Sollten wir ihn nicht erst mal in Ruhe trauern lassen?«
Ich muss auch erst mal trauern!, dachte ich erschüttert. Wenn er wirklich nicht mein Vater ist, hat er mich sechzig Jahre lang belogen.
Die Stille, die nun eintrat, war fast schneidend. Nur das Ticken der alten Küchenuhr ließ mich spüren, dass das Leben weiterging. Aber es fühlte sich auf einmal so falsch an!
»Mama …?«
Erschrocken zuckte ich zusammen. »Was soll ich denn zu Opa Karl sagen? ›Du bist gar nicht mein Vater – wusstest du das?‹«
»Vielleicht bist du ein Kuckuckskind?« Dieser Gedanke schien Rosa zu amüsieren. »Und Oma Anna hat dich Opa Karl einfach so untergejubelt?«, sprach sie meinen Gedanken von vorhin aus. Sie lachte verlegen. »Dann wüsste Opa Karl es auch nicht. Das wäre natürlich krass, ihm das jetzt mit knapp neunzig vor den Latz zu knallen.«
»Nein, das machen wir nicht.«
Ich griff nach dem Fotoalbum, das immer noch auf dem Tisch lag.
Suchend blätterte ich darin. »Die Hochzeit meiner Eltern war im Sommer 1946, und da war ich schon zwei! Schau, da bin ich, auf dem Arm von Tante Martha, Opas jüngerer Schwester.«
»Aber hast du dich denn nie gefragt, wieso du auf dem Hochzeitsfoto deiner Eltern bist? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich …?«
»Ich habe immer gedacht, dass sie wegen des Krieges erst so spät geheiratet haben, schließlich war Vater ja in Russland an der Front, und mich haben sie vorher irgendwie … im Heimaturlaub oder so … Das war ja damals so. So ein Soldat bekam eine Woche Urlaub und zeugte in der Zeit ein Kind.« Ich kratzte mich verlegen am Kopf. »Und als er wiederkam, war das Kind längst auf der Welt. Da bin ich sicher nicht die Einzige.«
Rosa sah mich ganz merkwürdig an. »Aber laut diesem Tagebuch bist du das Kind von Egon! Sie schreibt es ja ganz klar!«
Ich starrte an die Küchenwand. Das musste ich erst mal sacken lassen. Mit knapp sechzig Jahren erfuhr ich aus diesem Büchlein, dass mein Vater gar nicht mein Vater war! Meine Mutter hatte ihn damals einfach verlassen, und das in diesen Zeiten!
»Warum hat sie mir das nie erzählt? Und warum hat auch Vater mir das nie erzählt?« Ich schüttelte immer wieder den Kopf. »Oder meinst du, auch Vater wusste nichts von Egon?«
»Opa Karl wird schon nach einem Erzeuger gefragt haben, oder nicht?« Rosa stützte das Kinn auf die Hände und sah mich halb belustigt, halb fasziniert an.
Ich rieb mir immer noch ungläubig die Augen. »Vielleicht hat meine Mutter ihm nie erzählt, was für ein … ähm …«
»Nazischwein.«
»… Mensch dieser Egon war.« Der Schock erwischte mich kalt.
»Dann habe ich also die Gene von diesem … ähm …«
»Nazischwein. Mama, beruhige dich: Die sind bei dir nicht durchgeschlagen.« Rosa nahm mich tröstend in den Arm. »Ich nehme gerade mit meiner Klasse als Referendarin die mendelschen Regeln durch. So was kann auch mal eine Generation überspringen.«
»Aber Rosa!« Perplex sah ich sie an. »Dann müsstest du ja diese schrecklichen Gene haben!«
»Bäh«, schrie Rosa und schüttelte sich. »Mama, sag sofort, dass ich nicht die Enkelin von diesem Egon bin!«
»Ich kann gerade nichts Gegenteiliges behaupten.«
Ratlos schob ich die schwarze Kladde auf dem Küchentisch hin und her. »Was birgst du noch für Geheimnisse, hm? Will ich das überhaupt wissen?«
»Doch, Mama. Jetzt willst du es erst recht wissen!« Rosa hatte sich schon wieder neben mich gesetzt, der Tee dampfte in den Tassen. »Und ich auch. Wo und wie bist du auf diese Welt gekommen?«
»In meinem Pass steht 12. Mai 1944. Köslin. Heutiges Koszalin in Polen.«
6
ANNA
Köslin, 10. Mai 1944
»Sie wünschen bitte?« Am Empfang des Krankenhauses spähte die Ordensschwester mit dem gestärkten Häubchen prüfend über ihre Brillengläser. Im neunten Monat schwanger war ich den ganzen Weg von zu Hause zu Fuß gekommen, da mein Vater unabkömmlich gewesen war.
»Heute ist der errechnete Geburtstermin meines Kindes.« Ich hielt mir mit beiden Händen den prallen Bauch. Mein Kind bewegte sich heftig. Es wollte auf die Welt kommen, auf diese schreckliche, aus den Fugen geratene Welt.
»Haben Sie Wehen?«
»Bestimmt sind das Wehen, es zieht so komisch im Rücken, und mein Bauch wölbt sich unter Krämpfen, ich kenne das von unseren Kühen und denke …«
»Wie oft?«
»Alle zehn Minuten etwa.«
Die Ordensschwester kam aus ihrem Glaskasten heraus und geleitete mich zu einem Stuhl im Wartebereich. »Dann machen Sie so schnell wie möglich, dass Sie wieder nach Hause kommen.«
Mein Mund war ganz trocken vor Angst. Wenn ich wenigstens einen Schluck Wasser bekommen könnte! Doch ich wagte nicht, danach zu fragen.
»Aber mein Kind will jetzt auf die Welt kommen.« Es zog wieder so merkwürdig im Rücken, als müsste ich dringend auf die Toilette. Waren das die Angst und die Aufregung, oder war mir nur schlecht? Vor Erschöpfung konnte ich mich kaum noch auf den Beinen halten.
»Junge Frau, so leid es mir tut: Wir dürfen keine Wöchnerinnen mehr aufnehmen. Die Betten bleiben für die verwundeten Soldaten reserviert, die von der Ostfront hergeschickt werden.« Die Ordensschwester machte eine ausholende Geste zu den armen Teufeln, die wimmernd und stöhnend auf dem Gang lagen: »Mit jeder Zugladung kommen Hunderte Neue, und die meisten von ihnen schaffen es nicht mehr bis nach Hause. Aber Sie! Sie schaffen es noch, wenn Sie sich beeilen!« Sie drückte auf meinen Bauch: »Kindsbewegungen sind deutlich zu spüren.«
»Ich bitte Sie, Schwester …« Flehentlich sah ich sie an. »Es ist mein erstes Kind, ich weiß doch nicht, was ich machen soll!«
»Das sage ich Ihnen: Laufen Sie nach Hause, so schnell Sie können. Wie weit haben Sie es denn?«
»Zehn Kilometer.«
»Na, das schaffen Sie ja noch. Sie sind doch kräftig und gesund. Gottes Segen!«
Die Schwester mit dem gestärkten Kopfputz malte mir ein Kreuzzeichen auf die Stirn und begab sich sofort zu einem schreienden Patienten, der um ein Schmerzmittel flehte. Allerdings konnte sie nur mit ihm beten, denn Schmerzmittel gab es keine.
Unverrichteter Dinge machte ich mich auf den beschwerlichen Heimweg. So schnell ich konnte, kämpfte ich mich wieder in mein abgelegenes Dorf zurück.
Mutter sah mich schon von Weitem kommen und lief mir besorgt entgegen.
»Kind! Da bist du ja wieder! Das ging ja schnell!« Sie zuckte zurück. »O Gott. Ist es etwa … noch drin?«
»Sie konnten mich nicht aufnehmen«, heulte ich verzweifelt. »Das Krankenhaus ist vollgestopft mit sterbenden Soldaten!«
Mutter schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Du bist ja vollkommen erschöpft! Hast du Fieber?«
Über eine steile Hühnerleiter bugsierte sie mich in das ehemalige Mädchenzimmer meiner Schwester Frieda unterm Dach und rief nach dem Polenmädchen: »Dorota, lauf schnell, hol die Hebamme!«
Die Achtzehnjährige rannte auch gleich los, hoffentlich in die richtige Richtung!
Nach meinem Fußmarsch setzten nun doch heftige Wehen ein. Sie zerrten an meinem geschwollenen Leib wie wilde Tiere. Wenn das Wehen waren, wie hatten das all die Frauen vor mir nur ausgehalten?
»Mutter, ich kann nicht mehr, ich glaube, ich sterbe!«
Inzwischen hatte meine Mutter meine Schwester Frieda alarmiert, die mit Mann und Kindern auf dem Nachbarhof wohnte.
»Frieda!«, brüllte Mutter aus dem Fenster. »Koch Wasser ab und bring so viel frische Handtücher, wie du finden kannst!«
In dem Chaos, das inzwischen bei uns herrschte, scheuchte nun Frieda auch noch ihre Kinder los: »Fragt die Nachbarin nach frischen Laken! Bringt Zwirn und die große Schere!«
Das »Polenmädchen«, wie meine Eltern es nannten, kam zurück und meldete, die Hebamme sei bei einer anderen Wöchnerin.
Inzwischen fieberte ich stark und fantasierte bereits zwischen den schrecklichen Wehen. Mein ganzer Körper war ein einziger Krampfschmerz. »Egon!«, schrie ich in meiner Not. »Hilf mir!«
»Ach, lass deinen Egon aus dem Spiel, der hat sich doch nie wieder gemeldet!« Mutter legte mir nasskalte Lappen auf die Stirn. »Den brauchen wir hier nicht!«
Das war wenig aufbauend. Wie mir zugetragen worden war, war er direkt nach meiner Abreise bei seinem Techtelmechtel eingezogen, einer überzeugten Nazi-Frau. Noch immer glaubten beide fest an den Endsieg und verleumdeten alle, die es wagten, daran zu zweifeln. Diese »Wehrkraftzersetzung« wurde hart bestraft, im schlimmsten Falle sogar mit dem Tod. An der Teppichstange in Hannover im Hof hingen zur Abschreckung mehrere solcher »Vaterlandsverräter«, wie Egon in seinem einzigen Brief, den er mir je geschickt hatte, stolz verlauten ließ. Da war ein Fünfzigmarkschein drin gewesen, für das Kind.
Dass ich in meinem Fieberwahn und meiner Not nach dem Vater meines Kindes rief, war mir nicht bewusst. Stunden über Stunden vergingen in diesem engen Dachkämmerlein, und es zerriss mich schier. Da polterte es auf der engen Holzstiege und dann an der Tür: Vater streckte den Kopf herein: »Die Hebamme ist da!«
Die alte Frau eilte mit ihrem braunen Lederkoffer herbei, entnahm ihm alle notwendigen Utensilien und schickte bis auf Mutter alle Helfer, auch die junge Polin, aus dem Zimmer.
Sie horchte meinen Bauch ab, in dem schon lange keine Kindsbewegungen mehr stattgefunden hatten.
»Wie lange rührt sich schon nichts mehr?«
»Seit Stunden.«
»Die Geburt muss in Gang gebracht werden, sonst haben wir ein totes Kind.«
»Aber …«
»Können Sie aufstehen?«
»Nein, ich …«
»Sie müssen. Los, reißen Sie sich zusammen, Mädchen!«
Mit unendlicher Kraftanstrengung und Mutters Hilfe stand ich auf.
»So. Und jetzt laufen Sie im Zimmer herum, so viel Sie können.«
Das versuchte ich, doch es tat sich nichts. Die Wehen hatten wieder aufgehört. In meinem Leib herrschte nichts als Stille. Dabei hatte sich das Kind doch immer bewegt! Seit Wochen, seit Monaten! Mir war ganz schlecht vor Angst, und ich war nach den zehn Kilometern viel zu erschöpft, um jetzt noch im Zimmer rumzulaufen! Ich wollte dieses Kind kriegen, und zwar sofort. Ich hielt es nicht mehr aus!
»Sie müssen einen Arzt holen!«
»Aber wie denn, wenn die gerade mit Verwundeten beschäftigt sind!«
Mutter schlug verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammen. »Kind, lauf weiter! Lass dich nicht hängen!«
Wie ein Flusspferd wankte ich in diesem Kämmerchen auf und ab, stöhnend und wimmernd vor Pein.
»Ich hole den Arzt, und wenn ich zum Mond fahren muss!« Vater lief los. Ich war schon fast ohnmächtig, aber unendlich dankbar.
Abends um neun kam endlich der Arzt. Ich lag schon weiß wie die Wand auf dem Bett und war nicht mehr ansprechbar. In Sekundenschnelle erfasste er die Situation und gab mir eine Spritze. Damit war die Geburt eingeleitet, und endlich, endlich ging es voran, und das Kind kam.
»Du hast ein kleines Mädchen …« Mutter strich mir etwas Flüssigkeit auf die ausgedörrten Lippen. »Die Kleine ist ganz wunderhübsch und sieht dir ähnlich! Sie hat deine schwarzen Haare und ganz graue, ernste Augen. So als wüsste sie schon, in was für eine Welt sie hineingeboren wurde.«
Das war alles, was ich noch vernahm. Anschließend bekam ich einen Blutsturz. Immer wieder verlor ich das Bewusstsein, fieberte, fantasierte tagelang. Der Arzt hatte der Hebamme Anweisungen gegeben, was sie tun musste, um mich am Leben zu erhalten. Alle zwei Stunden musste sie mir eine Spritze geben, auch nachts. Frieda und Renate schliefen abwechselnd auf dem Fußboden neben mir, um stets bei mir zu sein. Mutter kümmerte sich inzwischen um die Kinder und den Hof. Die zwölf Kühe mussten ja weiterhin gemolken werden, was sonst meine Aufgabe war. Es müssen vier entsetzlich harte Wochen für alle gewesen sein. Trotz allem hatten sie es geschafft, mir mein Töchterchen regelmäßig an die Brust zu legen, sodass der Milchfluss in Gang gesetzt wurde. Apathisch stillte ich mein Kind, das immer noch keinen Namen hatte. Aber …
»Sie muss ins Krankenhaus, sie stirbt uns hier unter den Händen weg!« Der Arzt, der nach Wochen wieder nach mir schaute, musste im Dachkämmerchen den Kopf einziehen. »Erhalten Sie der Kleinen die Mutter!«
»Aber dort nehmen sie keine Wöchnerinnen mehr …«
»Sie werden!« Mitsamt meinem Baby wurde ich in eine Kutsche gehievt und die zehn Kilometer ins Krankenhaus gefahren. Trotz der vielen Verwundeten, die hier Vorrang hatten, bekam ich angesichts meines jämmerlichen Zustandes sofort ein Bett, denn sonst hätte ich den Tag wohl nicht überlebt.