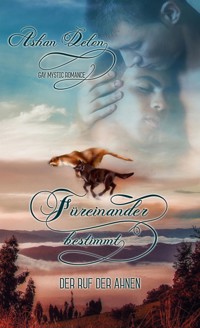
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Targh, ein mutiger Krieger vom Bergstamm des Welbvolkes, zieht aus, um sich den Traditionen gemäß eine Braut zu suchen. Eine Stimme aus seinen Träumen rät ihm, sich in Richtung Süden aufzumachen. Auf seiner Reise begegnet ihm Birjn, wie er ein Gestaltwandler, der ihn vom ersten Moment an fasziniert. Je näher sie sich kommen, desto mehr zweifelt Targh daran, dass er auf die Suche nach einer Frau geschickt wurde.
Zur gleichen Zeit hat der Schamane Oman, aus Birjns Stamm, Visionen, in denen eine unbekannte Macht ihr ganzes Volk auszulöschen droht. Er prophezeit, dass die zwei Männer nur vereint der bevorstehenden Bedrohung trotzen können. Gerade, als sie ihre zarte Liebe zueinander entdecken, brechen auch schon die Horden aus Omans Visionen über sie herein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Füreinander bestimmt
Der Ruf der Ahnen
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenFüreinander bestimmt - Der Ruf der Ahnen
Von
Ashan Delon
Gay Mystic Romance
Facebook: Ashan Delon
© Ashan Delon 2017
Cover: Caros Coverdesign
Unter Verwendung von folgendem Bildmaterial:
Paar: 50082/malestockphoto.com
Hintergrund: Pixabay
Gestaltwandler und Kapiteltrenner: Solveig Solly Frank
Kapiteltrenner Ziege: Pixabay
Korrektur: Ingrid Kunantz, Lotti Noctua
Vielen Dank an meine Beta-Gruppe:
Chrissy Burg, Karin Meier, Sarah Solas, Charlie Nebelstein u.a.
Für eure peniblen Argusaugen, eure einfallsreichen Kommentare und
Anregungen und die Zeit und Mühe, die ihr im Kampf gegen die Fehlerteufel aufgebracht habt. Dankeschön.
Sämtliche Personen, Orte und Begebenheiten sind frei erfunden, Ähnlichkeiten rein zufällig.
Der Inhalt dieses Buches sagt nichts über die sexuelle Orientierung der Covermodels aus.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder eine andere Verwertung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin.
Dieses Buch ist eine homoerotische Geschichte und beinhaltet daher explizite Darstellungen von sexuellen Handlungen zwischen Männern.
Fiktive Personen können darauf verzichten.
Im wahren Leben gilt:
Safer Sex!
1. Auflage/2017
1
»Und du bist wirklich fest entschlossen?«
Targh sah hoch und musste sogleich die Augen wieder zu einem schmalen Spalt zusammenkneifen, als er seinem jüngeren Bruder ins Gesicht und damit nahezu in die grelle Sonne blicken wollte. Sie stand knapp über den Zinnen des nahen Berggrades und linste dem jungen Mann, der unbemerkt herangekommen war, geradewegs über die Schulter.
Auch wenn Bartogh seine Frage nicht spezifiziert hatte, so wusste Targh doch genau, was er meinte. Denn dieser Punkt schwebte seit Tagen zwischen ihnen und keimte immer wieder von Neuem auf.
Vor einigen Wochen hatte Targh einen Entschluss gefasst, lange mit sich gehadert, nachgedacht und ihn vor wenigen Tagen schließlich der Familie vorgetragen. Es war eine Entscheidung gewesen, die sein ganzes bisheriges Leben gehörig auf den Kopf stellen würde. Für ihn war es selbstverständlich, sich an Traditionen zu halten. Seit jeher bestimmten sie das Leben in der großen, weitläufigen Talsenke. Wie der Krater eines längst erloschenen Vulkans schmiegte es sich in das Hochgebirge und verbarg sich somit weitgehend vor den Blicken und dem Treiben der übrigen Welt. Sie führten ein abgeschiedenes Leben, der Bergstamm, der zum Welbvolk gehörte, das über den gesamten Erdball verteilt war und dennoch von den Menschen strikt getrennt lebte. In kleinen, in sich geschlossenen Siedlungen verbarg sich dieses Volk vor den Augen der übrigen Menschheit. Beheimatet in den Tiefen von dichten Wäldern, nahezu unzugänglichen Gebirgsschluchten, auf Inseln weit im offenen Meer oder gar in den dunklen, kalten Wirren labyrinthartiger Höhlengänge erhielt es sich seine eigenen Traditionen. Manche der Stämme öffneten sich dem Leben, das auf der Erdkugel pulsierte, mehr, andere weniger. Der Bergstamm gehörte zu jenen, die sich jeglichem Einfluss durch die Menschenwelt, deren Entwicklungen, Fortschritte, Ideen und Denken verschloss, und sich strikt an eigene Überlieferungen und Gepflogenheiten hielt.
Ein solches Brauchtum war die Brautsuche.
Eine Tradition, die seit Generationen von den jungen Burschen an ihrem achtzehnten Geburtstag praktiziert wurde. Die meisten heranwachsenden Männer sahen sich aus Bequemlichkeit überwiegend in den umliegenden Dörfern in der Talsenke um, sodass sich deren Brautsuche weitgehend in Grenzen hielt. Targh hingegen weitete diesen uralten Brauch auf eine größere Umgebung aus. Er folgte einem Traum, in dem ihm eine Stimme riet, die Heimat zu verlassen und sich nach Süden aufzumachen, um seine Liebe zu finden.
Dieser Entschluss hatte nicht gerade für Begeisterungsstürme gesorgt. Normalerweise gab es für eine Familie kaum etwas Bedeutenderes, als wenn der Nachwuchs erwachsen wurde und eine eigene Familie gründete. Bei all den anderen Burschen war dies zumindest der Fall, wenn sie bekannt gaben, sich auf Brautsuche zu begeben. Meist gab es ein großes oder auch kleineres Fest – je nach Reichtum der Familie und Länge der Wegstrecke, auf die sich der Werber begeben würde. Ein weiteres wurde abgehalten, wenn er Stunden, Tage oder Wochen später mit einem jungen Mädchen zurückkehrte.
Targh würde länger unterwegs sein. Denn sich in den Süden aufzumachen hieß, das Tal und damit auch das Gebirge zu verlassen, in unbekannte Gefilde einzutreten, sich waghalsigen Abenteuern und vielleicht sogar tödlichen Gefahren zu stellen.
Seine Familie hatte den Entschluss akzeptiert, ohne ihn auch nur im Geringsten anzuzweifeln oder zu versuchen, ihn umzustimmen. Diese Brautsuche war eine feste, unumstrittene Tradition, wie weit der Werber die Suche auch ausdehnen wollte. Es stand ihm vollkommen frei. Der junge Targh war in der Geschichte des Bergstammes auch nicht der Erste, der seine Braut außerhalb des eigenen Stammes oder auch des Tales suchte. Insofern stellte es keine außerordentlich beunruhigende Besonderheit dar, eher eine unbedeutende Besorgnis, ein ungutes Gefühl, eine unangenehme Ungewissheit.
Denn trotz allem verließ selten einer vom Bergstamm das Tal – für was auch immer. Es war auch niemals notwendig gewesen, denn alles, was sie für ihr Überleben brauchten, befand sich innerhalb dieser Senke. Sie versorgten sich selbst, züchteten Tiere und Pflanzen und stellten alles eigenhändig her, was sie für ihre Annehmlichkeiten benötigten.
Doch der Traum hatte Targh nicht mehr losgelassen, seit er ihn zum ersten Mal geträumt hatte. Seitdem kehrte er beinahe jede Nacht zurück. Jedes Mal, wenn er am Morgen erwachte, hatte sich der Entschluss, sich Richtung Süden aufzumachen, noch mehr gefestigt – bis er sich schließlich seiner Familie und den Ältesten offenbarte.
Targh würde in wenigen Tagen, am Tag seines achtzehnten Geburtstages, das Tal für unbekannte Regionen verlassen. Keiner, der derzeit Lebenden, nicht einmal die Ältesten, wussten, was ihn hinter den Bergzinnen erwarten würde. Niemand war imstande ihm einen Rat zu geben, ihm zu sagen, wie er sich verhalten oder worauf er achten solle. Keine einzige Seele konnte ihm einen Reiseplan aufstellen oder ihn auf Gefahren hinweisen. Und kein einziger vermochte ihm wirklich zu beschreiben, wo genau sich die anderen Stämme des Welbvolkes vor den Augen der Menschen verbargen. Sobald Targh die Berggrade überschritt, war er auf sich allein gestellt.
Ein Gedanke, der ihn zwar mit Unbehaglichkeit erfüllte, jedoch auch mit einer gewissen Vorfreude. Sein Leben würde nicht mehr dasselbe sein, doch insgeheim freute er sich bereits auf die Abenteuer und die Dinge, die ihm auf seiner Reise begegnen würden.
»Mach dir doch nicht ins Hemd«, winkte Targh ab und grinste zu dem Jüngeren hoch. Er schob die Fische beiseite, die er soeben aus seinem Netz befreit und grob entschuppt hatte. Dann setzte er sich auf den Felsen neben dem gurgelnden Bach, der von irgendwo weiter oben dem Hang entsprang und sich in Jahrhunderten einen breiten Weg durch das Gestein gebahnt hatte. Dort oben gab es einen kleinen See, den einer seiner Urgroßväter mittels eines künstlichen Dammes angelegt und mit Fischbrut besetzt hatte, sodass man dort bequem fischen konnte. Hin und wieder verirrten sich einige der Fische den Bach hinunter, der über den Deich in den Überlauf floss und in den Bach mündete. Spannte man in den Wasserlauf ein Netz, so wurde man stets mit frischem Fisch versorgt.
»Es könnte auch gut sein, dass ich meiner Braut im Süden, am anderen Ende des Tales, über den Weg laufe und in vier Tagen wieder zurück bin.« Targh versuchte sich in einem besänftigenden Lächeln und wischte sich die schmierigen Finger an der Hose ab. »Das ist doch wirklich kein Beinbruch. Ich bin ja nicht für immer weg.«
»Aber vielleicht doch für sehr lange Zeit«, seufzte Bartogh und setzte sich neben seinen Bruder auf den Felsen, der ihnen ausreichend Platz für zwei bot. »Es gab schon lange niemanden mehr, der das Tal verlassen hat.«
»Dann ist es an der Zeit.«
Targh ließ den Blick über das Tal schweifen, das sich unter ihm ausbreitete, von seiner Position aus, zwei oder drei Handbreit in die eine und ebenso viele in die andere Richtung. Er befand sich in vielen hundert Metern Höhe und genoss von hier aus einen guten Blick über ihre Heimat. Unten angekommen, würde er vier oder fünf Wochen brauchen, um von einem Ende zum anderen zu gelangen – im Laufschritt und ohne Pausen. Um es einmal zu umrunden, wäre er doppelt oder dreimal so lange unterwegs. Eine Strecke, die er noch nie abgegangen war.
Sein Bruder seufzte abermals leise. »Gibt es denn hier kein Mädchen für dich?«, wollte er wissen.
Ein Lachen entkam Targh, obwohl er den absolut ernsten Ton seines Bruders wohl vernommen hatte. Er war der Einzige, der sich aufrichtig Sorgen um ihn machte. Keiner kannte die Gefahren, die ihn auf der Reise erwarten würden, wirklich.
Bartogh war selbst in dem Alter, in welchem er sich für das andere Geschlecht interessierte und auch schon einige Techtelmechtel aufweisen konnte. Ihren Traditionen gemäß blieb es jedoch bei kleinen Zärtlichkeiten, heimlichem Kuscheln oder verstohlenen Küssen. Es war verpönt, sich zu mehr hinzugeben, bevor man miteinander vermählt worden war. Da zeigten sich die Ältesten streng und duldeten keine Verstöße. Gegen harmlose Zärtlichkeiten und sehnsüchtige Blicke hatten sie jedoch nichts, und so wurde Bartogh bereits des Öfteren mit Mädchen erwischt.
Targh hingegen noch nie.
Es interessierte ihn nicht einmal. Tat es noch nie.
Keine einzige der jungen Frauen hatte seine Aufmerksamkeit je so sehr auf sich gelenkt, dass er sich auf mehr als Blicke und ein freundliches Lächeln eingelassen hätte. Dies war einer der Hauptgründe gewesen, warum er dem Traum folgen würde.
Für ihn gab es hier in diesem Tal keine Lebenspartnerin.
Die Sache war todernst, dennoch lachte Targh. Aus Frust oder aus Verunsicherung, oder doch, weil er wieder einmal erkannt hatte, dass er anders war, als all die anderen Jungs des Bergstammes, anders als sein eigener Bruder.
Wo fing er an aufzuzählen, was so anders an ihm war?
Eines war schon erwähnt worden. Ihn interessierten die Mädchen im Tal nicht im Geringsten. Das Zweite war sein magisches Tier.
Mit einem Bergwolf wollte niemand etwas zu tun haben, am allerwenigsten die jungen Frauen.
Jeder vom Welbvolk, ob vom Bergstamm, den Inselvölkern oder den Bewohnern von Höhlen oder Wäldern, besaß ein magisches Tier, in welches er sich zu wandeln vermochte. Welches, durfte man sich nicht selbst aussuchen. Im Allgemeinen kristallisierte es sich zu Beginn der Pubertät allmählich heraus. Dann konnte man sein Schicksal annehmen oder sein Leben lang damit hadern. In der Regel schätzten sich die meisten glücklich über das jeweilige Tier. Nur wenige zeigten sich enttäuscht, wenn sie zur Schlange, einem Vogel oder gar zu einfachen Ratten wurden. Weithin beliebt waren die Klettertiere wie Ziegen oder der Puma mit seinen scharfen Krallen und Fangzähnen. Als Ziegen besaßen sie lange Hörner und kräftige Hufe, mit denen sie sich sehr gut in einem Kampf behaupten konnten.
Sobald sich das magische Tier in einem herauskristallisiert hatte, maßen sich die jungen Leute aneinander in Wettkämpfen, um herauszufinden, welches das mächtigste Tier war.
Der Bergwolf war das Imposanteste und Stärkste unter ihnen. Allein schon deswegen wollte sich keiner der anderen jungen Männer und Frauen mit ihm messen. Ihre Niederlage war vorherbestimmt, noch bevor sie antraten.
Zudem gab es eine Legende über einen Wolf, der sich nicht entscheiden konnte, in der Steppe oder im Gebirge zu leben. Also teilte er sich und lebte fortan in beiden Gegenden. Doch die Hälfte, die in den Bergen lebte, wollte sich eines Tages nicht mehr mit nur einem Teil der Seele und Kraft zufriedengeben. Daher jagte er den Steppenwolf, tötete ihn und vereinigte sich mit der anderen Hälfte wieder zu einem Ganzen. Deswegen galt der Bergwolf als böses Tier. Der Grund, weswegen sich ihm niemand entgegenstellen wollte.
Die anderen Jungen hielten sich von ihm fern. Als Targh begriffen hatte, dass der Bergwolf sein Tier war, hatte er versucht, es so lange wie möglich zu verbergen, weil er wusste, was passieren würde. Doch irgendwann war es unumgänglich, sein magisches Tier vor der Dorfgemeinschaft zu präsentieren – eine weitere Tradition seines Stammes. Spätestens zum sechzehnten Geburtstag wusste jeder um sein Tier und hatte es in einem Ritual bekannt zu machen. Als sich Targh verwandelt hatte, herrschte lange Zeit angespanntes Schweigen. Bis die Ersten einfach aufgestanden waren und die Feierlichkeiten verließen.
Bereits vor diesem Zeitpunkt konnte Targh nicht unbedingt viele der jungen Männer zu seinen Freunden zählen. Aber an jenem Tag verlor er auch den Rest. Niemand wollte mehr etwas mit ihm zu tun haben.
Er hatte sich – zwei Jahre danach – seinem Schicksal gefügt. Ändern konnte er es nicht. Einzig seine Familie stand hinter ihm, obwohl sein Vater lange Zeit geschwiegen und ihn mit traurigem, beinahe leidendem Blick angesehen hatte. Auch er hatte nichts daran ungeschehen machen können. Das Schicksal spielte oft bizarre Spiele und bei Targh schien es sich regelrecht austoben zu wollen.
Nicht nur, dass ihn keines der Mädchen je in irgendeiner Weise erregt hätte, und er durch sein magisches Tier zum Geächteten geworden war, besaß er noch einen anderen Makel, von welchem allerdings nur er etwas wusste. Bei dem er jedoch keine Ahnung hatte, was genau da immer mit ihm passierte. Es beängstigte ihn stets aufs Neue, sodass er unablässig versuchte, es zu verhindern.
Er drehte sich um und blickte den Berghang hinauf. Dort oben war sein geheimer Platz, an den er sich verzog, wenn ihm nach Einsamkeit und Stille war. Dort oben, irgendwo zwischen scharfen Felsen und schmalen Graden, so hoch oben, dass die Vegetation hinter ihm zurückblieb. Wo die Steinadler ihre Nester bauten und er beinahe die Wolken berühren konnte. Dann saß er in seiner bevorzugten Nische, ließ den Blick über das Tal schweifen und seine Seele fand Ruhe.
»Wie lange wirst du weg sein?« Bartoghs Stimme drang in seine Gedanken ein und katapultierte ihn gnadenlos in die Wirklichkeit.
Targh zog die Schultern hoch. »Keine Ahnung. So lange es eben dauert?« Er rutschte ein wenig zur Seite, um sich eine bequemere Position zu suchen, denn der harte Fels drückte sich unangenehm in seinen Hintern. »Ein paar Monate vielleicht … Oder auch ein Jahr … Ich weiß es nicht.« Er seufzte leise. »Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet.«
»Kann ich dich begleiten?«
Wieder lachte Targh und rempelte seinen Bruder mit der Schulter gegen den Arm. »Glaubst du wirklich, deine süße Danne verzichtet ein ganzes Jahr auf die heimlichen Küsse hinter der Scheune?«
Augenblicklich lief Bartogh rot an und senkte den Kopf. Für Targh stand es bereits fest, dass die Brautsuche seines jüngeren Bruders gerade mal im Nachbarhaus enden würde. So oft, wie er die beiden schon dabei beobachtet hatte, wie sie hinter der Scheune zwischen ihren Häusern verschwanden.
»Mach dir keine Sorgen«, gab Targh unbekümmert von sich, obwohl in seinem Inneren das Unbehagen regelrecht wütete. Ihm war selbst nicht wohl dabei, doch der Entschluss stand bereits fest und er würde sich nicht davon abbringen lassen. Auch nicht von seinem Bruder, dem einzigen Verbündeten hier im Tal.
»Mach ich mir aber.« Bartogh schob trotzig den Unterkiefer hervor und stieß sich von dem Felsen ab. »Machen wir ein Wettrennen?«
»Du verlierst doch sowieso immer«, winkte Targh ab, erhob sich ebenfalls vom Felsen und sammelte die Fische vom Boden auf. Er hielt sie kurz hoch. »Außerdem muss ich die erst zu Mutter bringen.«
»Feigling!«, rief Bartogh und hieb ihm scherzend in die Seite.
Targh zuckte zusammen. Aber nicht, weil ihn sein Bruder, der ihm an Statur, Körpergröße und Kraft unterlegen war, so schmerzhaft getroffen hatte. Der Grund hierfür war, dass er sich auf der Stelle in sein magisches Tier verwandelte, um den ein Jahr jüngeren mit dem lauten Brüllen eines Bergwolfes zu erschrecken. Tatsächlich wich der Junge zurück, krümmte sich ebenfalls zusammen und machte wenig später – in Gestalt eines jungen, überschwänglichen Ziegenbocks – einen gewaltigen Sprung zur Seite.
Magische Tiere waren ihren natürlichen Brüdern sehr ähnlich, sodass man sie leicht verwechseln konnte. Sie unterschieden sich jedoch nicht unerheblich in Größe, Kraft und Erscheinung. Die echten Bergziegen, die in großen Gruppen über das Gebirge zogen, waren nur halb so groß wie der Bock, der nun mit sicheren Klauen über das Gestein sprang und dem auf gewaltigen Pfoten hinterher preschenden Bergwolf zu entkommen versuchte.
Würde ein Mensch das Geschehen beobachten, würde er behaupten, dass ein großer Wolf eine Ziege zu reißen beabsichtigte. In Wirklichkeit gedachte Bartogh, sich seinem Bruder in den Weg zu stellen, damit dieser nicht an ihm vorbeikam. Denn er wusste ganz genau, dass der Ältere ihm nicht nur an Stärke und Ausdauer überlegen war, sondern auch, dass er aufgrund seines Tieres nicht die geringste Chance besaß als Erster anzukommen.
2
Es war anstrengend, aber auf genau diesen Wettkampf hatten sie sich seit Monaten vorbereitet.
Birjn spulte sein Programm ab, bog den Rücken durch, sodass die Schultern fast den Hintern erreichten, und tauschte den Stand der Füße mit den Händen. Anschließend streckte er die Beine in einen akkurat gestreckten Handstand in die Luft. Dabei balancierte er auf dem Kopf seines Partners, der wiederum auf den Schultern eines anderen stand. Er fühlte das Zittern der angestrengten Muskeln unter sich. Jedoch waren sie ein so eingespieltes Team, dass sie genau wussten, wie weit sie gehen und wie lange sie noch durchhalten konnten.
In quälender Gemächlichkeit sanken seine gestreckten Beine zur Seite, bis er in einem perfekten Spagat verharrte. Dann nahm er eine Hand vom Kopf, reckte sie zur Seite, um den gegrätschten Handstand in vier Metern Höhe einhändig auszuführen. Dabei ließ er die Beine tiefer sinken, links und rechts an dem Arm vorbei, mit welchem er auf dem Kopf des anderen Mannes balancierte. In dieser Figur hielt er einen Moment inne, um die Beine dann wieder langsam zu einer makellosen Waage anzuheben. Nach ein paar weiteren Sekunden, in denen in dieser Position blieb, kam er in den einhändigen Handstand zurück.
Seine Muskeln zitterten vor Anstrengung, ebenso die der Untermänner. Doch ihr Programm war noch nicht zu Ende. Wenn ihnen in den letzten Minuten ihrer Darbietung nicht noch ein fataler Fehler unterlief, war ihnen der Sieg so gut wie sicher. Es gab nur noch eine Mannschaft, die ihnen die Medaille abspenstig machen konnte. Sie lagen beinahe gleichauf. Daher durfte kein Patzer passieren.
Birjn aktivierte noch einmal seine Kräfte und begann die letzte Übung. Ein weiteres Mal ließ er die Beine nach hinten sinken, stellte sie auf die Schultern des Untermanns ab und richtete sich gerade auf. Dann ging er leicht in die Knie und sprang in einem doppelten Salto auf den Boden. Um den Schwung abzufangen, rollte er sich sofort ab und stand einen Augenblick später bereits wieder auf den Beinen. Beinahe gleichzeitig war auch der nächste Turner abgegangen, jedoch in einem einfachen Salto und kam direkt neben ihm auf. Der dritte schloss mit einem engen Überschlag auf und blieb auf der anderen Seite stehen. Birjn packte die ihm dargebotenen Hände, ging in die Knie und ließ sich vom eigenen Schwung und dem seiner Partner nach oben in die Luft werfen. In luftiger Höhe absolvierte er einen doppelten Salto und landete an gleichen Stelle wieder auf dem Boden.
Anschließend vollführte er sofort einen rückwärts ausgeführten Flick-Flack. Seine Partner folgten ihm mit einem Radschlag und einem gesprungenen Rad und standen wieder neben ihm, um ihn abermals zu packen und in die Luft zu werfen. Diesmal drehte sich Birjn jedoch mehrmals längs um die eigene Achse wie ein wirbelnder Stab und wurde von seinen Partnern in der Waagrechten aufgefangen, um sogleich auf die Beine gestellt zu werden.
Die Sprünge und Würfe beherrschten sie perfekt. Jeder Griff saß. Alles ging federleicht und elegant vonstatten. Obwohl ihre Kräfte wegen der komplizierten Kür und den kräftezehrenden Balanceakten ziemlich aufgebraucht waren, gelang es ihnen, ihre Darbietung ohne einen Patzer, einen Wackler oder einen Fehlgriff zu absolvieren.
Der Beifall setzte ein, unmittelbar nachdem Birjn mit einem weiteren Salto und einer Hechtrolle in seine Schlussposition kam und dort schweratmend verharrte.
Sie hatten es geschafft.
Jetzt kam es auf die Punktrichter an.
Birjn war sich nicht sicher, ob bei einer der ersten Übungen alles glatt gelaufen war. Während der Kür versuchte er, nicht an die zurückliegenden Figuren zu denken, sondern mit seiner Konzentration stets in der Abfolge zu bleiben. Er hatte jedoch ein sehr gutes Gefühl.
Die drei Männer lösten sich aus ihrer Schlussposition und lachten beinahe gleichzeitig auf. Als einen Augenblick später die Punkte auf der großen Anzeigetafel erschienen, brachen sie in denselben Jubel aus, der auch um sie herum lostobte.
Sie waren bereits den ganzen Nachmittag als Favoriten gehandelt worden und enttäuschten die Zuschauer nicht. Ihre Darbietung war einwandfrei und fehlerlos gewesen und sie hatten daher die goldene Medaille zu Recht gewonnen.
Als sich Birjn wenig später von seinen Turnkollegen löste, noch immer im Freudentaumel schwelgend, mit einem Stück glänzenden Metall auf der Brust, stellte er sich in der Umkleidekabine ans Fenster. Gedankenverloren blickte er in den Regen hinaus. Die Tropfen prasselten nun schon den ganzen Tag lang unaufhörlich vom Himmel und verwandelten die Welt da draußen in eine regelrechte Schlammgegend. Er hatte noch nicht viel von dem miesen Wetter mitbekommen. Allerdings begleitete ihn das stetige Prasseln der Regentropfen auf das metallene Dach der Turnhalle bereits seit heute Morgen, als er mit der Mannschaft zum Wettkampf angetreten war.
Dieses permanente Rauschen schadete seiner Konzentration zwar nicht, dennoch fühlte er sich erschöpfter denn je. Sein Kopf war schwer und eine Andeutung von leichtem Kopfschmerz bahnte sich an. Der Wettkampf war wirklich anstrengend gewesen und alle drei hatten ihr Bestes gegeben. Trotz des miesen Wetters und des trüben Neonlichtes, das von der Decke auf die Turner herunterleuchtete und verzweifelt versuchte, den Tag etwas zu erhellen, fühlte er irgendwie Euphorie in sich aufkeimen. Die drückende, von Hunderten von Leuten verbrauchte Luft, die ihm das Atmen zusätzlich erschwerte, konnte nichts daran ändern. Sie hatten den Wettkampf gewonnen, waren nun Landesmeister und würden in ein paar Monaten zur internationalen Meisterschaft antreten. Und nächstes Jahr ging es zur Olympiade. Darauf freute er sich trotz allem ganz besonders.
Sie waren nur eine Hobby-Mannschaft, nahmen ihr Talent eigentlich nie so wirklich ernst, doch irgendwann war in ihnen der Wunsch aufgekommen, mehr aus sich zu machen. Birjn hatte anfangs noch etwas gezögert, denn er wollte ursprünglich nicht so intensiv in die Sportakrobatik einsteigen. Die Regionalmeisterschaften genügten ihm. Höher zu steigen, hieß mehr trainieren, mehr Zeit investieren, bessere Leistungen absolvieren und wiederum mehr Zeit und Kraft in das Training zu stecken.
Für Birjn war es stets ein netter Zeitvertreib gewesen, mit welchem er einigermaßen passable Erfolge erzielen konnte. Denn für Akrobatik besaß er ein ausgeprägtes Talent. Oft genug war er von Leuten angesprochen worden, die ihn für ihren Verein oder ihre Sportgruppe engagieren wollten. Doch Birjn lehnte stets ab. Denn dies hieß auch, dass er dann die volle Aufmerksamkeit auf seine Sportlerkarriere lenken musste.
Doch das konnte er nicht.
Denn er besaß ein Doppelleben.
Niemand, außer ein paar Turnkollegen wussten, wer er wirklich war.
Niemand, außer diesem kleinen, auserlesenen Kreis ahnte, dass er eigentlich kein Mensch war.
Er war ein Welb.
Nicht mehr lange und er durfte endlich in seine Welt zurückkehren. Die Zeit, die er zwischen den Wettkämpfen für sich in Anspruch nehmen konnte, war rar. Aber stets verbrachte er sie bei seinen Leuten, in den tiefen Wäldern seiner Heimat, verborgen vor den Blicken der Menschen. Fast verborgen, berichtigte er sich gedanklich.
Nur die Menschen, die am Rande des Waldes wohnten, ahnten von der Siedlung, die sich weit im Inneren befand. Denn einige von Birjns Volk arbeiteten in der großen Stadt und bewegten sich ebenso unerkannt unter ihnen, wie er es tat. Sie wussten jedoch nichts Genaueres über die Eigenbrötler, die dort hausten. Die Menschen kamen selten in den Wald. Ein magischer Schutzwall verhinderte, dass sie tief eindringen und das Dorf entdecken konnten. Die Magie sorgte dafür, dass sie es sich rechtzeitig anders überlegten und umkehrten. Nur Angehörige des Waldstammes vermochten den Wall zu durchdringen und solche, die von ihnen wussten und denen sie vertrauten.
In zwei oder drei Tagen würde er wieder in seinen Wäldern jagen können, dachte er sehnsüchtig und lehnte die Stirn gegen das kalte Glas. Draußen goss es noch immer in Strömen. Bereits als Kind hatte er es genossen, im Regen durch den Wald zu streifen und den Duft des nassen Waldbodens in sich aufzunehmen. Er liebte es, den Bäumen beim Wachsen zuzusehen und ihrem Rascheln zu lauschen, wenn sie sich mit dem Wind unterhielten. Er genoss es, das Knistern und Prickeln am eigenen Leib zu spüren, das von dem pulsierenden Leben unterhalb des Waldbodens kam.
Zwei oder drei Tage noch, je nachdem ob und wann das Flugzeug bei diesem Wetter starten konnte, würde er sich noch gedulden müssen. Dann durfte er in seine Heimat zurückkehren, zurück zu seiner Familie. Zurück zu seinesgleichen.
Obwohl er gerne tat, was er tat und sich auch wie selbstverständlich unter den Menschen bewegte, fühlte er sich bei seinem eigenen Volk wesentlich wohler. Nur sie konnten nachvollziehen, wie ihm zumute war. Nur sie spürten die Magie, die in jedem Mitglied des Welbvolkes pulsierte. Nur sie wussten, dass er eigentlich zwei, nein, drei Leben führte.
Als begabter Akrobat. Als Welbkrieger und als eine Feliskatze.
3
Zum wiederholten Male überprüfte Targh den Inhalt der Tasche, die er mit sich führen würde und in der sich nur die wichtigsten Dinge befinden sollten. Allem voran ein Messer, das er bei der Jagd ebenso gebrauchen konnte, wie um sich zu verteidigen. Ein Beutel mit getrockneten Gewürzen, die ihm seine Jagdbeute etwas schmackhafter machen würden. Ein Blasrohr, das in drei Teile zerlegt, bequem in die Tasche passte, und wenn er es zusammensteckte, so lang wie sein Arm war. Zudem ein dicker Beutel mit magischen Talgkügelchen, die er benötigen würde, falls ihn hinterhältige Zoten überraschten.
Zoten waren die einzigen wirklichen Feinde des Welbvolkes. Woher sie kamen, wusste niemand mehr so genau. Sie existierten jedoch schon seit vielen Jahrhunderten. Im Schutz eines gigantischen magischen Walles, der beinahe das gesamte Tal überspannte, lebten die Welb einigermaßen sorgenfrei und ohne Angst vor arglistigen Überfällen durch Zoten oder anderem Ungetier. Im Grunde waren es nicht wirklich Wesen aus Fleisch und Blut, sondern eher so etwas Ähnliches wie Rußfäden. Vergleichbar mit solchen, die von einer alten Kerze ausgingen und sich in dicken, schweren Schwaden an der Decke sammelten. Wenn man von ihnen berührt wurde, drang sofort eine Art Gift durch die Haut. Der Biss verursachte heftige Schmerzen, die rasch in einer Art Gefühllosigkeit übergingen, je länger er andauerte. Die Betäubung breitete sich rasch aus und je nachdem, wie stark und wie lange man von einer dieser schwarzen Nebelschwaden gebissen wurde, konnte das schnell in absoluter Lähmung ausarten. Für gewöhnlich neigten die Zoten dazu, sich hartnäckig in der Haut zu verbeißen und einem die Energie, die Lebenskraft und zusätzlich auch noch die Seele auszusaugen. Ihre Opfer konnten sich durch die ausbreitende Lähmung nicht mehr wehren, verloren an Kraft, und waren weiteren Attacken hilflos ausgeliefert, bis sie einer leeren Hülle gleich, seelenlos, mit starrem Blick starben. Wenn man Glück im Unglück hatte, vermochte man nicht einmal mehr zu atmen und erstickte innerhalb weniger Minuten. Bei einigen hatte der Todeskampf allerdings auch schon mehrere Stunden oder gar Tage angedauert. Daher musste man schnell sein. Selbst ein leichter Biss verursachte eine Entzündung, die gehörige, gesundheitliche Probleme bereitete.
Sein jüngerer Bruder Bartogh hatte die Zoten einmal als stinkender Furz der Unterwelt bezeichnet, worauf er von seinem Vater eine gehörige Standpauke und zwei Wochen verschärfte Strafarbeit aufgebrummt bekommen hatte. Diese Bezeichnung hielt sich jedoch noch immer beharrlich in den Köpfen der jungen Leute und nahm ihnen ein wenig den Schrecken und das Grauen vor diesen Wesen. Trotz allem hatten sie nicht den Respekt und die Achtung verloren, die ihnen das Überleben außerhalb des Schutzkreises sichern konnten.
Niemand vom Welbvolk war erpicht darauf, ihnen zu begegnen. Der Schutzwall umfasste den größten Teil des Gebietes, in welchem der Bergstamm lebte. Dennoch gab es Regionen innerhalb des Tales, in die die Zoten eindringen konnten. Dort wo der Wall wegen der Felsen oder Flüsse nicht stabil genug war, oder dort wo er schlichtweg nicht mehr hinreichte. Diese Gebiete waren jene, in die die jungen Männer und Frauen zogen, um den Kampf mit den Zoten zu erlernen. Natürlich nur unter den fachkundigen Augen der Älteren und dem Schutz von erfahrenen Kämpfern. Auch Targh hatte zahlreichen Zoten in den Randgebieten aufgelauert und sich im Gefecht mit ihnen gemessen. Er hatte seine Technik mit dem Blasrohr perfektioniert. Die Talgkügelchen waren mit verschiedenen Kräutern, Pulvern und einer Magie gefüllt, die den Zoten nicht bekam und sie in schwere, schwarze Schlacke verwandelte, die der nächste Regen einfach in den Boden wusch.
Ohne diese Kügelchen brauchte er gar nicht erst den schützenden Wall des Tales verlassen. Denn das Welbvolk war die Leibspeise der Zoten.
Mit einem Seufzen überprüfte er ein letztes Mal den Inhalt der Tasche, ehe er sie sich quer um den Leib hängte, sodass sie schwer an der Hüfte hing. Bevor er die Hütte verließ, tat er noch einen prall gefüllten Wasserbeutel dazu. Draußen warteten bereits seine Eltern, sein jüngerer Bruder, seine Schwestern und noch einige weitere Verwandte. Vom Rest des kleinen Dorfes war niemand gekommen.
Warum auch …?!
Sie waren vermutlich froh, dass er endlich ging. Denn aufgrund seines magischen Tieres und seines doch etwas anderen Verhaltens, sah ihn niemand als Freund an, den man schweren Herzens gehen lassen musste. Zumindest keiner, der ihn vermissen würde.
Targh hoffte, dass sich das alles änderte, sobald er mit einer Braut zurückgekehrt war, und dass er bald wie jeder andere im Tal leben konnte. Bisher war ihm dies nicht möglich gewesen. Nicht einmal sein Leben als Bergwolf hatte er ausgiebig auskosten oder gar mit ihnen teilen können.
Bergwölfe waren im Tal unerwünscht.
Mit einem weiteren Seufzer ging er zu ihnen, verabschiedete sich stumm von jedem, von seinem Bruder etwas ausgiebiger, denn der wollte ihn nicht loslassen. Er musste sich schon gewaltsam von ihm losreißen. Mit einem besänftigenden Lächeln nickte er ihm zu, drehte sich um und ging davon.
Mehr war für ihn einfach nicht drin.
Nicht für ihn. Nicht für den Bergwolf.
Andere junge Männer hatten eine ausgiebige Feier bekommen, wenn sie gingen. Eine weitere gab es bei ihrer Heimkehr. Targh bezweifelte, dass wenigstens bei seiner Rückkehr eine Feier abgehalten wurde. Dafür stand ihm sein Tier im Wege.
Er sah nicht mehr zurück, sondern marschierte weiter. Mit einem zermürbenden Gefühl in den Eingeweiden versagte er sich jegliche Reaktion. Dennoch war er überrascht, dass es ihm relativ wenig ausmachte, seine Familie, seine Welt, das ganze bisherige Leben einfach hinter sich zu lassen. Es war so leicht, einen Schritt vor den anderen zu machen, den fernen Gebirgsfuß immer näher an sich heranzuholen und nur nach vorne zu sehen.
An der Hüfte hing das neue Leben. Für die nächsten Wochen, Monate oder Jahre würde dies das Wenige sein, das für ihn noch Bedeutung besaß. Das Messer und das Blasrohr, wie auch die Kräuter und die Kugeln musste er mit seinem Leben beschützen. Es waren die einzigen Dinge, die ihm den Hals retten konnten und eine – wenn auch dünne – Verbindung zu seinem alten Leben aufrechterhielten.
Sein Weg würde heute nicht sehr weit führen, dieses hatte er vorab entschlossen. Für diesen Tag – es war bereits später Nachmittag – wollte er lediglich den geheimen Platz erreichen und dort oben die Nacht verbringen, ehe er den weiteren Aufstieg wagte und den Bergkamm überschritt.
Als er sich weit genug vom Dorf entfernt wähnte, blieb er stehen. Erst verharrte er bewegungslos, dann drehte er sich doch noch um und ließ seinen Blick über die Ebene schweifen. So idyllisch und ruhig sah es aus, so vollkommen und anheimelnd. Rauch stieg von den Kaminen der fernen Häuser auf. Hin und wieder drang der Laut eines Tieres zu ihm. Er vermochte jedoch nicht zu sagen, ob natürlichen oder magischen Ursprungs.
Es war sowieso egal.
Langsam wandte er sich wieder um und suchte in der Ferne, ganz weit oben jenen Platz, zu dem er an diesem Tag noch gelangen wollte. Mit bloßem Auge war er nicht zu erkennen. Er wusste dennoch, wo er sich befand. Auf zwei Beinen würde es ihm nicht gelingen, heute noch anzukommen. Auf vier Pfoten konnte er jedoch schnell den Rastplatz erreichen.
In einem pulsierenden Funken- und Lichterregen formierte er sich in seine Tiergestalt und stieß ein tiefes, kehliges Grollen aus. Auch wenn er sich in menschlicher Gestalt nicht gerade unwohl fühlte, so erfüllte es ihn mit einer gewissen Genugtuung und Ruhe, wenn er sich in den Wolf gewandelt hatte. Es schien, als wollte ihn diese Form noch zusätzlich besänftigen, trösten und schmeicheln.
Er sah sich noch einmal nach allen Seiten um, ließ den leuchtenden, grellgelben Blick des Wolfes über die Gegend schweifen und sprintete schließlich los.
Auch wenn er sich nur widerwillig verwandelte, verfügte er inzwischen über genug Erfahrung. Das Verwandeln in sein magisches Tier war wie das Einhüllen in eine andere Form. Alles, was fest am Körper anlag, wurde mit in die tierische Gestalt genommen und tauchte nach der Rückkehr ebenso wieder auf. Dazu brauchte es jedoch Übung, um die magische Hülle so weit aufzuplustern, dass noch eine Hose und ein Hemd und sogar auch eine Tasche darin Platz fand. Die Zeiten, in denen er beschämt in seinem Zimmer hockte und betete, dass niemand zur Tür hereinkam, waren längst vorbei. Zum einen wollte er den ungeliebten Bergwolf vor den Augen seiner Familie verbergen, solange es ging. Zum anderen brauchte er wie jeder frisch gezeichnete Krieger erst Zeit zum Üben und Festigen der Wandlerfähigkeiten. Am Anfang hatte er regelmäßig seine Kleidung zerrissen, wenn er sich in den viel größeren Wolf verwandelte. Es war überaus peinlich gewesen, fast nackt auf dem Bett oder dem Boden zu kauern, wenn er wieder die menschliche Gestalt angenommen hatte.
Auf vier Pfoten war er wesentlich schneller und wendiger unterwegs. Das unwegsame Geröll des Vorgebirges, die Felsen, Steinfelder und das von Wind und Wetter verharschte und spröde gewordene Schiefergestein machten ihm wesentlich weniger aus. In der menschlichen Gestalt hätte er viele Stunden, wenn nicht sogar mehrere Tage gebraucht, um zu dem Felsvorsprung zu gelangen, den er stets als seinen geheimen Platz bezeichnete. Die Sonne erreichte eben den Horizont der Bergkette, als er behände die letzten Felsen hochsprang und sich erschöpft und schwer atmend auf dem Felsvorsprung niederließ.
Die Zunge hing ihm aus dem Maul. Er hechelte hektisch, während er sich noch ein paar Meter weit schleppte und dann einfach niedersank. Noch im Hinlegen formierte er sich in die menschliche Gestalt zurück. Sein Kopf kam hart auf dem felsigen Untergrund zu liegen und die Augen blickten starr in den allmählich dunkler werdenden Himmel. Die ersten Sterne waren bereits zu sehen und der Mond hatte sich ebenfalls erhoben, um die Senke mit seiner magischen Ausstrahlung zu bedecken.
Lächelnd betrachtete er eine Weile den Mond. In Gestalt eines Wolfes kam ihm dieser helle Fleck am Himmel so herrlich und anziehend vor. Manchmal konnte er nicht anders, als ihn einfach anzustarren. Selbst in menschlicher Gestalt fühlte er die Magie, die vom Mond ausging, ihn einhüllte und jede Faser, jeden Nerv seines Körpers zum Kribbeln brachte.
Einige magische Tiere bezogen ihre Kraft aus dem Mond, so auch der Bergwolf. Den Unterschied zwischen Voll- und Neumond spürte Targh so deutlich am Leib, dass er jeden Monat sehnlichst auf den Vollmond wartete. Eine Zeit, in der er sich in der ganzen Fülle der Magie suhlte, die von dem Himmelskörper ausging. Er liebte es, in dieser Zeit durch die Gegend zu streifen. So manches Mal musste er sich am nächsten Tag, wenn er von den nächtlichen Streifzügen erschöpft, übernächtigt und unaufmerksam war, von seinem Vater etwas anhören.
Doch jetzt war er auf sich allein gestellt und konnte tun und lassen, was er wollte. Niemand würde ihn rügen, wenn er als Wolf durch die Gegend streifte und niemand würde sich an seiner Gestalt stören.
Zumindest solange er sich in diesem Randgebiet aufhielt, wo selten einer vom Welbvolk hinkam. Sobald er den Schutzwall durchdrungen und in die Welt der Menschen getreten war, musste er extrem auf sich achtgeben. Abgesehen davon, dass ihm jederzeit Zoten auflauern konnten, wusste er nicht, wie die Menschen darauf reagieren würden, einem leibhaftigen, riesigen Bergwolf gegenüber zu stehen.
Die magischen Tiere des Bergstammes bestanden ausschließlich aus Wesen natürlichen Ursprungs, wie die Bergziege seines Bruders, der Weißkopfadler seines Vaters oder der Schneehase seiner Mutter. Er wusste aber auch, dass es Stämme gab, in denen die Tiere magischen Ursprungs vorherrschten. Targh hatte jedoch bislang noch keines leibhaftig gesehen. Einer der Ältesten hatte ihm einmal von einem Sternvogel berichtet, dessen Flügel so hauchzart wie das Licht eines Sternes hoch am Himmel leuchteten, oder von einer feuerspeienden Schlange. Es waren für ihn stets nur Ammengeschichten gewesen, denn er konnte sich nicht vorstellen, dass solche befremdlichen Wesen überhaupt existierten, wenn auch lediglich als magische Tiere.
Dennoch wünschte er sich für seine Reise, dass er sich in ein Tier magischen Ursprungs verwandeln könnte. Denn dann blieb er vor den Augen der Menschen verborgen und bewegte sich unsichtbar zwischen ihnen hindurch.
Der Anblick eines Tieres magischen Ursprungs war den Menschen versagt. Sie konnten sie schlichtweg nicht sehen.
Den Bergwolf jedoch schon.
Daher musste er vorsichtig sein, wenn er sich in deren Welt begab. Aber anders gelang es ihm nicht, zu den anderen Stämmen des Welbvolkes durchzudringen.
~ * ~
Er setzte sich auf, trank einen tüchtigen Schluck aus dem Wasserschlauch und gönnte sich ein wenig vom Proviant. Gesättigt legte er sich wieder ausgestreckt auf den Vorsprung und starrte abermals in den mittlerweile schon ziemlich dunkel gewordenen Himmel. Die Sterne kamen immer mehr hervor und auch der Mond leuchtete heller.
Targh schloss seine Augen und versuchte, sich zu entspannen.
Er machte es nicht gerne, denn er wusste, was nun passieren würde. Meist geschah es, kurz bevor er einschlief und er schrak voller Entsetzen aus dem Dämmerzustand. Wenn möglich, versuchte er, sich darauf vorzubereiten und den kurzen Moment zu überwinden, in welchem es ihm stets passierte. Es war ein hauchdünner Augenblick, zwischen Wachsein und Schlaf, den er jedes Mal aufs Neue passieren musste, sobald er sich schlafen legte. Und wie jedes Mal, graute es ihm vor dem Einschlafen, aus Angst, dass es ihm wieder passierte.
Beinahe sein Leben lang.
Doch diesmal provozierte er es bewusst. Stets wenn er hier auf dem Felsvorsprung saß – oder besser gesagt lag, weil das für die körperliche Unversehrtheit vorteilhafter war – um alleine und ungestört zu üben.
Als seine Atmung geruhsamer und gleichmäßiger wurde, konzentrierte er sich darauf, sich noch mehr zu entspannen und noch ruhiger zu werden. Er konnte bereits die ersten Vorwehen spüren. Diese merkwürdige Begebenheit zerrte und rüttelte an ihm, gleichzeitig wie es auf der Innenseite seines Körpers gegen die weichen Wände der Haut polterte, als bitte es um Auslass. Und dann geschah es.
Langsam und wie auf einer schmierigen Schicht warmen, weichen Schlammes dahingleitend, verließ er seinen Körper.
Er wagte es nie, sich weiter zu entfernen, als dass er mit der imaginären Hand, die er mehr fühlte als sah, seinen scheinbar leblosen Leib berühren konnte. Er wagte es auch nicht, die Hand von dem Körper zu nehmen, aus Angst, dass er nicht mehr zurückfinden und dann für alle Ewigkeit als körperlose Seele dahinwandeln musste. Krampfhaft hielt er den Kontakt zu seiner eigenen Hülle, verkrallte sich geistig förmlich in dem groben Hemd und blickte auf sich selbst herunter.
Bleich und kraftlos lag er da. Das helle Haar zerstrubbelt und verschwitzt. Die Wangen leicht eingefallen. Die Augen geschlossen, als würde er schlafen. Er wusste es jedoch besser. Die Seele hatte den eigenen Körper verlassen. Er schlief nicht.
Mit der unsichtbaren Hand noch immer am Hemd hob Targh den Blick seiner Seele und ließ ihn in die Ferne schweifen. Auch wenn ihn dieser Zustand stets aufs Neue beunruhigte und sogar regelrecht Angst machte, so fühlte er sich nach der Rückkehr erfrischt und belebt. Ihm war, als würde ihn dieser Ausflug mit neuen Kräften auffüllen, voller Lebendigkeit und Zuversicht, so als könne er in diesem losgelösten Zustand sämtliche Energie und Lebenskraft aus der Umgebung in sich aufsaugen.
Und genau deswegen machte er es immer wieder.
Selbst auf die Gefahr hin vom eigenen Stamm, von seinem eigenen Volk für diese Fähigkeit bestraft, wenn nicht gar getötet zu werden. Denn Seelenwanderer, wie die Ältesten sie abfällig bezeichneten, waren für sie ein größeres Übel als die Zoten selbst.
Seelenwanderer, so berichteten die Alten, würden sich des Körpers eines anderen bemächtigen und dessen Seele töten. Es seien grausame Wesen, hatte man ihm erzählt, die kein Erbarmen kannten und nur darauf aus waren, sich den besten Leib zu Eigen zu machen.
Dass er ein Seelenwanderer war, war Targh schon vor vielen Jahren klar geworden, als er zum ersten Mal von ihnen gehört hatte. Doch er behielt es stets für sich. Dieses wohlgehütete Geheimnis kannte nicht einmal sein Bruder, mit dem er bislang jedes geteilt hatte.
Niemand.
Es wäre sonst sein Todesurteil gewesen.
Dieses Geheimnis war der dritte Punkt, warum er anders war, als die anderen Jungen im Bergstamm.
4
Endlich zu Hause!
Birjn warf den Koffer und die dicke, prall gefüllte Reisetasche einfach in den Eingang des eigenen kleinen Bereiches am Haus seiner Eltern, schloss die Tür und ging wieder. Auch wenn ihn der Flug und die lange Autofahrt vom Flughafen hierher die letzten Kräfte gekostet hatten, so lechzte er förmlich nach einem ausgiebigen Ausflug in den Wald.
Sein Vater und seine kleine Nichte kamen ihm entgegen, drückten ihn zur Begrüßung und ließen ihn ziehen. Sie wussten genau, dass er sich erst einmal ordentlich die Pfoten wundlaufen musste, ehe er wirklich wieder zu Hause angekommen war.
Sein Hemd platzierte er über dem Gartenzaun, dann krümmte er sich leicht zusammen und stand wenig später in Gestalt einer mächtigen Feliskatze an der Rückseite des Hauses, an welcher der Wald direkt angrenzte. Hinter sich hörte er das Kichern eines kleinen Mädchens. Vermutlich seine Nichte, die es lustig fand, wenn er sich in Luft auflöste, denn sie war zur Hälfte ein Menschenkind und somit nicht in der Lage, die Feliskatze zu sehen.
Feliskatzen waren magischen Ursprungs.
Mit einem Sprung war er bereits zwischen den Bäumen verschwunden und rannte sich fast die Lunge aus dem Leib. Der Wettkampf hatte ihn gefordert und ihm einiges an Kraft und Kondition abverlangt. Dennoch brauchte er nun genau dieses Laufen durch den Wald, um wieder zu sich zu kommen, zu Birjn dem Krieger aus dem Waldstamm des Welbvolkes. Denn das stellte er in Wirklichkeit dar.
Die Sportakrobatik war nur ein Zeitvertreib, ein Alibi, weil er sonst mit seinem Körper nichts anzufangen wusste. Schon als Kind hatte er eine bemerkenswerte Beweglichkeit an den Tag legen können und sie dazu genutzt, sich in alle möglichen und unmöglichen Positionen zu verbiegen. Die offenkundig angeborene Gelenkigkeit hatte er wahrscheinlich auch seinem magischen Tier zu verdanken, einer Katze, die, wie man es von den meisten Katzen kannte, wahre Meister im Verbiegen und Anpassen an extreme körperliche Anforderungen waren. Wenn er wollte, konnte er sich durch Gitterstäbe schieben, die gerade mal eine Handbreit auseinanderstanden. Er besaß beinahe von klein auf die Wendigkeit und die Geschmeidigkeit einer Raubkatze. Das Gymnastik-Training hatte seinen Körper zusätzlich gestählt, ihn noch beweglicher werden lassen und aus ihm einen wahren Gummimenschen gemacht.
Gummimensch, dachte er innerlich lauthals auflachend. Genau das war er.
Er musste sich wie Gummi in alle Richtungen biegen, in Richtung Waldkrieger, ebenso wie in Richtung Sportler. Eine weitere Option, zu der er seit frühester Kindheit hin erzogen worden war, entpuppte sich als Fehleinschätzung. Damit war er nun nicht mehr gezwungen, die Ausbildung zum Schamanen zu beenden. Für jemanden wie ihn, der im Jahr des Drachen geboren war, hätte es eigentlich keinen anderen Weg geben dürfen. Doch als er sich anstatt in Wind, Feuer oder Licht zu verwandeln oder mit dem Erdboden zu verschmelzen, eines Tages in eine Feliskatze formierte, war diese Möglichkeit für ihn gestorben. Schamanen verwandelten sich nicht in Tiere, sondern bildeten Gemeinschaften mit den Elementen.
Der Schamane Oman, der sein Lehrer gewesen war, hätte es eigentlich gleich erkennen müssen. Denn dem jungen Birjn, auf dessen Schultern Omans Hoffnungen gelegen hatten, schaffte es auch unter Mühen nicht, sich mit den Elementen zu verbinden. Er verbrannte sich am Feuer oder ertrank beinahe im See. Oder steckte fest, wenn er versuchte, dem Erdloch zu entkommen, das er in einem Akt der Verzweiflung selbst geschaufelt hatte, um dem Element Erde näher zu kommen. Alles vergeblich.
Als er dann eines Tages sein magisches Tier in sich entdeckte, war nicht nur Birjn enttäuscht gewesen.
Der junge Waldkrieger, der bis zu diesem Tag seine andere Leidenschaft, die Akrobatik, nur ausübte, um den Körper fit zu halten, stürzte sich daraufhin frustriert in den Leistungssport.
Jetzt hatte er seine Erfüllung gefunden. Im Sport, wie auch damit, sich mit der magischen Raubkatze zu identifizieren. So perfektionierte er auch dieses Spiel und trainierte die einzigartigen Fähigkeiten des Tieres beinahe ebenso akribisch wie die Übungen vor einem wichtigen Wettkampf.
Die Feliskatze war seine Verbündete, sein magisches Tier. Er war ein Teil von ihr, wie sie ein Teil von ihm war.
Er rannte tiefer und tiefer in den Wald. Dort wo es dunkel und unheimlich wurde, das Dickicht bis in die obersten Baumwipfel reichte und unten auf dem Erdboden stets Finsternis herrschte. Doch für ihn, der mit den Augen einer Raubkatze sah, erschien alles hell erleuchtet. Selbst der winzigste Lichtfunke genügte, um ihm die dunkelste Nacht zu erhellen. Er konnte die Konturen der Bäume, Büsche, Äste, Baumstümpfe und Erdhügel so deutlich sehen, als seien sie von blendend hellen Strahlern erfasst. Sogar die kleinen Erdwälle, die von den Köpfen der Pilze stammten, die sich aus dem Boden erhoben, schoben sich gut erkennbar in die Aufmerksamkeit seiner Betrachtung. Er konnte das winzige Leben auf der Unterseite von Blättern sehen, das Wuseln in den Moosflechten, das Wimmeln von Abertausenden von Lebewesen im weichen Untergrund des Waldes. Um ihn herum pulsierte pure Lebendigkeit, während er wie vom Teufel persönlich gejagt durch den Wald preschte, geschickt Hindernissen auswich oder einfach übersprang, und immer weiter und tiefer in den Wald rannte.
Er machte sich keine Sorgen darüber, dass er sich verlaufen könnte. Als Feliskatze besaß er einen bemerkenswerten Orientierungssinn. Dieser hielt ihn wie eine in seinen Kopf eingeprägte Landkarte oder dieses witzige Navigationsgerät im Fahrzeug seines Schwagers, ständig auf dem Laufenden, wo genau er sich befand. Dazu benötigte er weder Sonne noch Sterne, an denen er sich orientieren musste. Er brauchte dazu nicht einmal die Nase in den Wind zu halten, um zu wissen, in welche Richtung er wehte. Die Sinneshaare an der Schnauze wussten es und transferierten es in sein Gehirn, noch ehe er überhaupt hierüber nachdenken konnte.
Er liebte es, eine Feliskatze zu sein.
Und so rannte er stetig weiter in den Wald hinein. Eine Stunde, zwei. Seine Lungen pumpten mit hektischen, tiefen Atemzügen unaufhörlich Sauerstoff in den Körper, während die Nase alle möglichen Gerüche aufnahm.
Plötzlich sträubten sich seine Sinne und er wurde langsamer. Schließlich bremste er ab und blieb keuchend stehen.
Er hatte ihre Witterung aufgenommen.
Die Nase in den Wind haltend, drehte er den Kopf in die Richtung, aus der die Duftspur kam, und setzte sich wenig später in eben jene in Bewegung.
Die Menschen glaubten schon seit vielen Tausenden von Jahren, es gäbe keine Feliskatzen mehr. Tatsächlich waren sie aus der Welt der Menschen verschwunden, noch bevor diese angefangen hatten, logisch zu denken. Die Wahrheit aber war, dass es diese Tiere, die der einfache, unwissende Mensch leichthin mit einem längst ausgestorbenen Säbelzahntiger verwechseln konnte, doch noch gab. Im Wald gab es einige davon. Nur vermochten die Menschen sie nicht zu sehen, geschweige denn ihre Anwesenheit überhaupt zu spüren, denn sie waren der Magie nicht zugänglich. Anderenfalls hätte der Mensch ein Schreckgespenst mehr. Ein glücklicher Umstand, denn Feliskatzen waren ausgesprochen scheue und gefährliche Raubtiere und meistens hungrig.
Birjn schlich auf leisen Pfoten durch den dichten Unterwald, die Nase direkt in der Duftspur und folgte ihr verbissen. Wenig später entdeckte er sie dann zwischen den Bäumen – eine echte Feliskatze.
Er kannte sie. Ein Weibchen. Sie trieb sich schon seit einiger Zeit in der näheren Umgebung herum. Er war ihr bereits ein paar Mal begegnet und hatte so manches Spiel mit ihr gespielt.
Als Einzelgänger duldeten die magischen Raubkatzen kein zweites Exemplar ihrer Gattung in ihrer Nähe. Außer sie wollten sich paaren. Diese hier hatte ihn noch nie kaum näher als zehn Meter an sich herangelassen. Auch jetzt hob sie den Kopf, sobald sie Birjns Anwesenheit bemerkt hatte, und knurrte warnend.
Birjn verlangsamte seinen Schleichgang, ohne ihn jedoch abzubrechen. Er musste einfach dichter an sie heran. Denn nur so konnte er eine mentale Verbindung zu ihr aufnehmen, mit ihr verschmelzen, sich mit ihr austauschen und sich die Eigenschaften einer Feliskatze aneignen.
Jeder junge Welbkrieger stellte sich irgendwann dem echten Gegenstück seines magischen Tieres. Es gehörte zur Entwicklung und Perfektionierung dazu. Dabei hatten es diejenigen leichter, deren Tiere sich weniger gefährlich oder kontaktscheu zeigten. Die Feliskatze mochte es ganz und gar nicht, wenn sich eine andere Katze näherte, auch wenn es sich um ein Männchen handelte. Sie war nicht in Paarungsstimmung und knurrte daher eine weitere Warnung.
Doch Birjn wusste, wie weit er gehen durfte. So oft hatte er sich ihr genähert, versucht, sie mental zu beruhigen, damit er näher an sie herankam. Sie erkannte seinen Duft und er ihren. Er kannte ihre Reaktionen und wusste genau, wann sie genug hatte, ihn wütend anfauchte oder sogar angriff.
Sein Schleichgang wurde noch vorsichtiger. Er duckte sich tief, sodass sein Bauch beinahe über den weichen Boden schleifte. Seine Sinne waren hellwach und nur auf die Katze gerichtet.
Sie zog ihre Lefzen hoch, entblößte ihre beeindruckenden Fangzähne und fauchte ihm eine weitere Warnung entgegen. Ihr langer buschiger Schwanz wedelte dabei langsam und gleichmäßig hin und her. Noch ein Zeichen dafür, dass er sich gefälligst zu tummeln hatte, sofern er beabsichtigte, noch frecher zu werden.
Erst jetzt bemerkte Birjn, dass sie ein Tier gerissen und er sie offenbar gerade beim Abendessen gestört hatte. Damit rief er in ihr nicht nur den natürlichen Widerwillen gegenüber seiner Gesellschaft, sondern auch noch Futterneid hervor. Und das konnte ganz schnell eskalieren.
Er blieb stehen.
Vielleicht war es doch keine so gute Gelegenheit gewesen, sagte er sich und legte sich flach auf den Boden, die Vorderpfoten unter der Schnauze ausgestreckt. Er senkte seinen Kopf etwas tiefer, eine eindeutige Geste, dass er in friedlicher Absicht gekommen war und nicht gedachte, ihr die Beute abzunehmen.
Sie knurrte noch einmal, zog ein weiteres Mal ihre Lefzen hoch. Ihr Schwanz senkte sich jedoch nieder und schmiegte sich an ihr rechtes Hinterbein. Die freundschaftliche Geste hatte sie etwas besänftigt.
Eine Weile verharrte Birjn in dieser Stellung, geduldig darauf wartend, dass sie sich noch weiter beruhigte. Fürwahr schnaubte sie nach einigen Minuten nur noch protestierend. Schließlich löste sie sich aus dem schweigsamen Blickduell und widmete sich wieder ihrer Beute.
Birjn beobachtete sie interessiert. Er hatte ihr schon öfter dabei zugesehen, wie sie ihren Fang mit den gewaltigen Zähnen zerriss und große Stücke blutigen Fleisches einfach hinunterschlang. Ihre Fänge waren dafür gedacht, ihre Beute zu zerfetzen. Die flachen Backenzähne dienten gerade mal dazu, die Fleischstücke notdürftig zu zermalmen, um sie leichter hinunterschlucken zu können.
Als er sich gewiss war, dass sie seine Anwesenheit missbilligend tolerierte, wagte er es, noch ein Stück näher heranzukommen. Sie befand sich noch zu weit von ihm entfernt, mehr als zwanzig Meter. Er musste diese Distanz unbedingt verringern, wenn er sich mit ihr verbinden wollte. Nur so konnte er feststellen, wie sie sich gerade fühlte. Nur so vermochte er es, sein eigenes magisches Tier zu perfektionieren.
Seine Aktion weckte ihre Aufmerksamkeit wieder und sie knurrte eine weitere Warnung. Von ihrer Schnauze tropfte Blut. Sie leckte es rasch mit ihrer Zunge weg und entblößte warnend ihre Fangzähne, von denen ebenfalls Blut herunterperlte.
Birjn blieb abermals stehen, legte sich aber diesmal nicht hin. In einer der alten Schriften des Welbvolkes hatte er gelesen, dass Feliskatzen überaus intelligente Tiere waren. Sie zeigten sich durchaus in der Lage, soziale Bindungen einzugehen – wenn auch nur für kurze Zeiten – und auch eine gewisse Logik zu entwickelen. Von Jagdtechniken, bis hin zu Freundschaften zwischen einzelnen Tieren, die natürlich, da sie Einzelgänger waren, ihre eng gesteckten Grenzen besaßen. Einer Legende zur Folge, sollte einmal eine männliche Feliskatze eine innige Verbindung mit dem magischen Tier eines Welbkriegers eingegangen sein. Der Welbkrieger hatte, in Gestalt seines magischen Tieres, die echte aus einer lebensbedrohlichen Situation gerettet. Fortan streunte die Raubkatze ständig in der Nähe des Welbkriegers herum, ohne jedoch den direkten Kontakt aufrecht zu erhalten, war allerdings stets zur Stelle, wenn der andere in Gefahr geriet. Der Welbkrieger hatte bei ihrem ersten Zusammentreffen eine mentale Verbindung zu dem echten Tier aufgenommen und es damit offensichtlich so von sich überzeugt, dass eine wahre Männerfreundschaft entstanden war.
So etwas Ähnliches beabsichtigte auch Birjn mit der Katze vor ihm.
Nur dass es ein Weibchen war und sie sich überhaupt nicht glücklich schätzte, ständig von einem Männchen belästigt zu werden.
Birjn wagte den nächsten Schritt. Er war sich der Gefahr bewusst, in die er sich begab. Ein falscher Schritt, eine ungünstige Bewegung, ein fehlgedeuteter Blick und sie würde sich ohne zu zögern auf ihn stürzen. Dennoch schlich er noch etwas heran und verringerte den Abstand nun auf knapp zehn Meter. Eine Distanz, die sie offensichtlich noch akzeptierte, denn so dicht hatte er sich ihr schon öfter nähern können. Er gab sich jedoch nicht zufrieden damit und wagte einen weiteren Versuch.
Ein warnendes Fauchen entglitt ihrem Maul. Ihre Augen begannen förmlich zu glühen, als sie ihm mit einem gebleckten Grinsen ihre scharfen Fangzähne präsentierte. Der buschige Schwanz kam sogleich hoch und wedelte hektisch hin und her. Sie war hochgradig erbost und nervös.
Birjn musste auf der Hut sein. Er kannte die Anzeichen und bewegte sich noch vorsichtiger. Nun war die Distanz auf ungefähr acht Meter geschmolzen und er wagte sich mutig noch dichter heran. Am Rand seiner Wahrnehmung konnte er bereits ihr Bewusstsein spüren. Es pulsierte hektisch, aufgeregt, beinahe brennend vor Groll. Dennoch erdreistete er sich, noch ein Stückchen heranzukommen.
Sechs Meter.
Ihr Bewusstsein wurde deutlicher. Er konnte die Wut spüren, die in ihr kochte. Sie drang wie mit heißen Nadelstichen auf ihn ein, als wollte sie ihn auch auf mentaler Ebene davor warnen, ja nicht zu weit zu gehen.
Doch Birjn überging es, wischte mit einem Gedanken die lodernden Impulse von sich und wagte noch ein paar Schritte. Nun stand er ihr knapp fünf Meter gegenüber. So nah wie noch nie. Ihr Bewusstsein drang deutlich auf ihn ein. Er glaubte sogar, ihren raschen Puls in sich selbst zu spüren und den Zorn über den unverschämten Frevel, den seine Anwesenheit hervorgerufen hatte. Er versuchte, eine mentale Verbindung zu ihr aufzunehmen, wohlwissend, dass die Entfernung vielleicht noch zu groß war. Dennoch riskierte er den Versuch, schickte besänftigende Impulse zu ihr, beschwichtigte sie mit einem Gefühl von Ruhe und Frieden und hoffte, dass es auch so bei ihr ankam.
Doch damit war er offensichtlich einen Schritt zu weit gegangen oder sie hatte diese Impulse falsch gedeutet. Denn auf einmal befand sie sich in der Luft, zu einem Sprung auf ihn angesetzt. Birjn konnte sich gerade noch mit einem Satz zur Seite aus der näheren Reichweite ihrer Fänge bringen. Wenn sie ihn erwischt, sich in seiner Flanke verbissen oder ihm womöglich auch noch die gesamte Seite aufgerissen hätte, wäre es um ihn geschehen gewesen. Eine Pranke kratzte ihm schmerzhaft über das Gesicht. Die Kratzer waren nicht tief, denn durch seinen Sprung war er nicht mehr in ihrer direkten Griffweite. Dennoch hinterließen sie blutige Spuren auf seiner Wange, auch auf der des Welbkriegers.
Diese erste Zurechtweisung schien ihr genügt zu haben, denn sie verfolgte ihn nicht weiter, als er einige Meter zurückwich und dort stehen blieb, um sie mit aufgeregt klopfendem Herzen zu mustern.
Das war gerade noch einmal gut gegangen, sagte er sich erleichtert. Ein tiefes grollendes Knurren aus ihrer Kehle überzeugte ihn davon, dass er für heute sein Glück genug strapaziert hatte und er zog sich vorsichtig zurück.
Dennoch war er von einem Hochgefühl beseelt. So nahe war er ihr noch nie gekommen und das trotz der frisch geschlagenen Beute. Sie schien allmählich Vertrauen zu ihm zu fassen. Ein Gedanke, der sein Herz vor Begeisterung noch schneller schlagen ließ.
Irgendwann, wenn er geduldig genug war, würde sie ihn so nahe an sich heranlassen, dass er die mentale Verbindung vollenden und sich mit ihr vereinigen konnte.
Glücklich über diesen Fortschritt rannte er zurück.
~ * ~
Seine Familie hatte es sich bereits im großen Wohnraum gemütlich gemacht und unterhielt sich über die Geschehnisse der letzten Tage und Wochen. Daniel, sein Schwager und Untermann in der Akrobatik-Gruppe, präsentierte seine Medaille und ließ sie durch sämtliche Hände wandern. Birjn betrat eben den Raum, das Hemd über der Schulter, und begrüßte die Anwesenden mit einem glücklichen und stolzen Lächeln.
Die Kratzer auf seinem Gesicht fielen natürlich sofort auf.
»Wieder Zoff mit deiner Freundin?«, feixte Daniel amüsiert. Er war ein Mensch, jedoch durch die Ehe mit Birjns Schwester in alle Geheimnisse der Familie eingeweiht.
Birjn grinste breit. »War ein wenig zickig heute. Frauen eben.« Er warf das Hemd über die Stuhllehne, setzte sich auf seinen Stuhl und beugte sich zu seiner Mutter Kalja, um ihr einen Kuss auf die Wange zu hauchen.
Mit einem Blick über die Runde vergewisserte er sich insgeheim, dass alle Mitglieder seiner großen Familie anwesend waren. Feliskatzen waren Einzelgänger, Welbleute nicht.
Wann immer es ging, traf sich die Familie in dem großen Wohn-, Ess-, Empfangs- und Sozialraum, der beinahe das gesamte Erdgeschoss des Hauses ausmachte. Der übrige Teil bestand aus der Küche. Oben befanden sich die Schlafräume seiner Eltern und auch die ehemaligen Zimmer der Kinder. Birjn und seine Schwester Najome waren längst ausgezogen und hatten ihre eigene vier Wände bezogen. Najome mit ihrem Mann und ihren Kindern, ein Haus nur knapp zwanzig Meter vom elterlichen Heim entfernt. Birjns Behausung grenzte an das Elternhaus an, sozusagen wie ein Erweiterungsbau, nur wesentlich kleiner und gedrungener, da er nicht so viel Platz benötigte und sowieso die meiste Zeit bei seinen Eltern verbrachte. So besaß er zwar eine eigene Küche in seinem Anbau, jedoch hatte er sie noch nie benutzt. Sein Eigenheim war auch erst vor knapp zwei Jahren fertig geworden – also eigentlich noch gar nicht so lange. Junggesellen hielten sich eh viel lieber da auf, wo ihnen das Essen fertig auf den Tisch gestellt wurde, ihre Wäsche wie von selbst in der Waschmaschine verschwand und fein säuberlich zusammengelegt wieder auftauchte. Da unterschied sich Birjn in nichts von anderen.
Seine ältere Schwester Najome war nun bereits seit sechs Jahren mit Daniel verheiratet. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen, als sich die beiden bei einem Wettkampf, bei welchem Birjn und Daniel zum ersten Mal als Akrobatik-Gruppe auftraten, begegnet waren. Birjn, damals erst zehn Jahre alt, schmächtig und leicht. Daniel bereits sechzehn, ein stämmiger Bursche, durchtrainiert und voller Kraft und mit einem so umwerfenden Lächeln, dass er die junge Frau im Handumdrehen von sich überzeugt hatte. Es war für Daniel durchaus ein Schock gewesen, zu erfahren, dass die beiden Geschwister keine Menschen waren, sondern einem uralten Volk angehörten, das sich seit je her vor ihnen verborgen hatte und im Einklang mit Natur und Magie lebte.
Mit der Magie hatte er erwartungsgemäß so seine Probleme, doch Daniel hielt sich tapfer und akzeptierte die Ungereimtheiten, die ihm sein menschlicher Verstand einzureden versuchte, einfach vorbehaltlos.
Aus der Liebe zwischen seiner Schwester und seinem Turnpartner waren inzwischen drei süße kleine Mädchen entsprungen, eine niedlicher als die andere, wie Birjn jeden Tag aufs Neue feststellte. Die Älteste von ihnen, Lena – eigentlich Magdalena – fünf Jahre alt, war sein ausgesprochener Liebling. Denn sie hing auch wie eine Klette an ihrem Onkel und fand es faszinierend, wenn dieser sich vor ihren Augen einfach in Luft auflösen konnte. Die beiden jüngeren, Brigitt und Jasyn, waren noch zu jung, um zu erkennen, in welcher fantastischen Welt sie wirklich lebten.
Dann gab es da noch seinen Vater Holmjd, der den Traditionen gemäß sein schwarzes Haar lang über die Schultern wachsen ließ. Birjn war wegen des Sportes gezwungen, es absolut kurz zu halten. Er hatte sich lange dagegen gewehrt, sich die Haare, die ihm bis auf den Hintern gereicht hatten, abschneiden lassen zu müssen, doch irgendwann ging es nicht mehr anders. Sie waren immer im Weg, auch wenn er sie sich zu einem strengen Zopf gebunden hatte. Doch einen solchen bei Salti, Überschlägen und sonstigen Drehbewegungen ins Gesicht zu bekommen, war wirklich kein schönes Erlebnis, sodass sich Birjn zähneknirschend und mit blutendem Herz davon trennen musste.





























