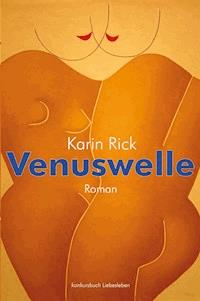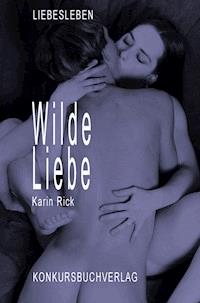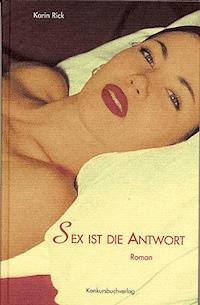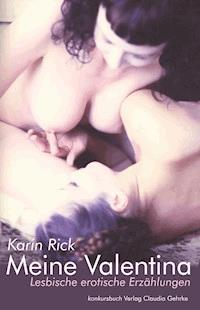Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Querverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Wienerinnen machen Urlaub in Skala Eressos auf der Insel Lesbos, dem lesbischen Ferienparadies. Heiße "Wet Pussy Pool Partys", abenteuerlustige Engländerinnen, ruhige Stunden am Strand - es hätte ein wunderbarer Lesbos-Aufenthalt für Klara, Livia und Gini werden können. Doch dann überschattet eine Reihe brutaler Überfälle die heitere Urlaubsstimmung. Auf offener Straße werden einheimische Männer von einer "weißen Gestalt" angegriffen und mit dem griechischen Buchstaben Sigma gebrandmarkt. Die drei Frauen gehen, ebenso wie Yakis, der Ermittler aus Athen, der Sache auf den Grund. Dabei stoßen sie auf die intriganten Machenschaften des Bürgermeisters Theofilos, der es als seine persönliche Vendetta ansieht, Skala Eressos von "den Weibern zu säubern". Aber er hat nicht mit den drei Wienerinnen gerechnet! Ein spannender Showdown ist vorprogrammiert!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Querverlag GmbH, Berlin 2004
Erste Auflage März 2004
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung einer Fotografie von Anja Müller.
ISBN: 978-3-89656-649-2
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH, Akazienstraße 25, D-10823 Berlin
http://www.querverlag.de
Für Sissi, Rudi, Vicky, Lisa und Simone
Kapitel 1
Benommen von Schlafmangel und der stehenden Hitze auf dem Rollfeld folgt Klara den anderen Passagieren in die Ankunftshalle des Mitilini Airport. Ein einziges Förderband läuft. Koffer, Reisetaschen und hastig zugeschnürte Pakete von mindestens drei Flugzeugen rattern in halsbrecherischem Tempo an ihr vorbei. Zwischen Klara und dem Band eine fest zusammengeballte Menge griechischer Familien.
Neben ihr steht die Germanistikstudentin aus dem Flugzeug, Livia Singer, die sich ausgesucht höflich mit ihr unterhalten hat. Auch sie kommt nicht an ihre Habseligkeiten heran. Die beiden Frauen schauen sich an und verdrehen genervt die Augen.
Es scheint aussichtslos zu sein, bis zum Band vorzudringen, an nassgeschwitzten Hemden fettleibiger Männer vorbei. Beim Anblick ihrer nun schon zum dritten Mal vorübergleitenden Tasche wird Klara ungehalten, lässt die Ellenbogen spielen und springt auf das Band. Sie ringt um ihr Gleichgewicht, packt die Tasche und macht todesmutig einen Satz zurück in die Menge, die angesichts des auf sie zugeflogen kommenden Gepäckstückes samt Besitzerin zurückweicht. Geschrei und Fluchen folgen, als Klara etwas weiter entfernt von Livia landet.
Ein Mann packt sie wütend am Arm und brüllt ihr ins Ohr. Klara schreit zurück und versucht, sich loszureißen, er aber hält sie weiterhin umklammert, während sie ihre Schritte aus der Menge heraus beschleunigt. Sein graues, von Falten zersägtes Gesicht mit den Zahnruinen kommt immer näher. In Klara braut sich diffuse Angst zusammen, sie verdreht das Handgelenk, um sich aus seinem Griff zu befreien. Gleich werden beide gegen eine Säule prallen, da wird Klara plötzlich von einem metallenen Strahl geblendet, der vom Glasdach der Halle zu kommen scheint. Reflexartig schließt sie die Augen. Der Mann stolpert nach vorne, lässt ihren Arm los und fällt der Länge nach hin. Mit einem Schmerzensschrei fasst er sich im Fallen an die Stirn, und alle Leute drehen sich zu ihnen um. Da liegt er zu ihren Füßen und wimmert, und Klara hat nicht einmal Zeit zu schauen, was passiert ist. Zwei Männer stürzen auf ihn zu, knien sich hin, andere wollen ebenfalls helfen oder einfach nur schauen. Klara wird weggeschoben und gestoßen, der Abstand zwischen ihr und dem Mann am Boden wird größer, und bald nimmt sie nur eine Traube teils kniender und teils gebückt gaffender Menschen wahr. Sie ist vor Schreck willenlos und starrt auf das Bild vor sich. Jetzt bemühen sich zwei der Anwesenden, den Verletzten zu stützen und aufzuheben. Sie hört ihn wimmern und kann gerade noch seine blutende Stirn erkennen.
„O mein Gott!“, stöhnt sie und sieht zu ihrer Erleichterung Livia auf sich zukommen. „Was ist da bloß passiert?“
„Ich weiß auch nicht“, sagt Livia mit ängstlicher Stimme. „Möchten Sie sich nicht lieber kurz hinsetzen? Sie sind ganz weiß.“
Klara lässt sich auf einen der Plastikstühle fallen. „Haben Sie das gesehen? Der ist gestolpert, und ich habe Schuld.“
„Ich habe absolut nichts gesehen. Nur einen Schrei gehört, und wie alle zu Ihnen gerannt sind.“
„Irgendetwas hat mich geblendet, und ihn auch, sonst hätte er mich nicht losgelassen. Jemand hat ihm vielleicht ein Bein gestellt. Aber warum blutet er so?“
Livia schaut sie ratlos an, anstatt zu antworten. Aus dem Augenwinkel sieht Klara Sanitäter mit einer Bahre kommen, niemand beachtet sie und Livia.
„Vielleicht hat er sich an einer Kofferkante aufgeritzt? Machen Sie sich keine Sorgen“, versucht Livia, sie zu beschwichtigen.
„Ich muss wissen, was er hat“, sagt Klara. „Könnten Sie bitte auf meine Tasche aufpassen?“
Dann geht sie den Sanitätern nach. Sie kommt aber nicht weit; zwei Beamte halten die Menge von dem Verunglückten fern, winken sie weiter.
Beunruhigt kehrt sie zu Livia zurück.
„Ich kann nichts erkennen, und das Komische ist, dass sie nicht an mir interessiert sind. Niemand fragt mich, ob ich etwas gesehen habe. Als ob ich nicht existieren würde. Oder als ob sie mit so etwas gerechnet hätten und es jetzt so schnell wie möglich vertuschen wollten.“
„Na, seien Sie doch froh“, sagt Livia jetzt. „Sonst hätten Sie vielleicht Scherereien. Gehen wir jetzt lieber.“
Sie schultert ihren Rucksack und zieht die Ärmel ihres Sweatshirts hinunter, als ob sie frösteln würde. Gemeinsam gehen sie in Richtung Ausgang.
Klara beobachtet ihre Begleitung bewundernd von der Seite. Livia ist klein, zart, aber kompakt, durchscheinend weiße Haut. In ihrem Gesicht ist außer Lethargie auch Wachsamkeit zu lesen. So, als wäre sie altersbedingt zwar weltoffen, aber zu weise, um noch überrascht zu werden. Jetzt lächelt sie Klara unsicher an.
„Viel seltsamer finde ich allerdings“, meint sie jetzt, „dass es auf diesem Flughafen offenbar eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt.“
Klara schaut verständnislos.
„Was heißt das denn?“
„Na, da gibt es einerseits die Familien. Die gehen durch den Ausgang EU-Bürger, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Und da sind dann noch die alleinreisenden Frauen, und die werden von den Beamten zu einer anderen Tür geschleust.“
„Was erzählen Sie da?“
„Das habe ich eben beobachtet.“
„Blödsinn, das bilden Sie sich nur ein.“
„Na gut“, sagt sie. „Sie werden schon sehen.“
Sie folgt Klara zu der Ausgangstür, über der das Schild EU-Citizens prangt. Neben der Tür ist ein Grenzbeamter postiert. Zwei Familien mit Kindern sind eben durchgegangen. Der Beamte lässt die beiden Frauen auf ein paar Meter herankommen, dann versperrt er ihnen den Weg. Klara deutet erstaunt auf das Schild hinter ihm, er weist aber auf eine Tür in der Ecke und bleibt breitbeinig stehen.
„Sind Sie auch beim Verlassen der Maschine fotografiert worden?“, fragt Livia.
„Da waren ein paar Beamte, die am Rollfeld fotografiert haben, aber muss das auf mich gemünzt gewesen sein?“
„Nicht nur auf Sie. Auf uns, würde ich sagen.“
Die Tür, die Klara öffnet, trägt keine Beschilderung.
Fast zur selben Zeit wie Klara und Livia kommt Yakis Kokounos auf Lesbos an, Ermittler aus Athen. Er hat gerade seine Reisetasche geschultert und wendet sich in Richtung Ausgang, als der Verletzte auf eine Bahre gelegt und zum Krankenwagen gebracht wird. Neugierig nähert er sich. Ein Beamter der Flughafenpolizei versperrt ihm den Weg. Yakis lässt sich jedoch nicht einschüchtern.
„Was ist hier los?“, fragt er.
„Ein Mann ist verletzt worden.“
„Wo und wie?“
„Sind Sie ein Verwandter? Wenn nicht, überlassen Sie das den Behörden.“
„Ich bin selber von der Behörde“, sagt Yakis bescheiden und zeigt seinen Dienstausweis.
„Sicherheitsbüro Athen. Aha. Na gut, aber für den Vorfall hier ist Mitilini zuständig“, meint der Beamte, wird aber zugänglicher und erzählt ihm, was vorgefallen ist.
„Könnte ich mit dem Arzt sprechen? Ich meine, es ist pure Neugier, ich weiß …“
„Ach, machen Sie nur. Mir ist das egal.“ Der Beamte lässt Yakis durch.
Es handle sich um eine tiefe Fleischwunde mit ausgefransten Rändern, erzählt der Bereitschaftsarzt. Außerdem Verdacht auf Nasenbeinbruch und Gehirnerschütterung. Der Verletzte sei ein Gemüsehändler aus Mitilini, der von einem Wochenendausflug in Athen zurückgekommen ist. Es ist noch nicht klar, ob er sich im Fallen verletzt habe oder angegriffen worden sei.
„Er behauptet, er habe einen scharfen Gegenstand ins Gesicht geknallt bekommen“, sagt der Arzt, der eben seine Instrumente wegpackt. „Er könnte aber auch bloß hingefallen sein.“
„Bloß hingefallen? Mit einer solchen Wunde?“, fragt Yakis.
„Na ja, vielleicht hat er die Kante des Förderbandes gestreift, die ist an manchen Stellen messerscharf.“
Yakis schaut reglos und gedankenverloren zu, wie die Türen des Rettungswagens geschlossen werden, und wundert sich über den Automatismus, mit dem hier alles vor sich geht. Da gibt es einen Verletzten, die Ursache des Unfalls ist nicht geklärt, und die Polizei lässt lediglich die Rettung kommen und entsorgt ihn, als handelte es sich um einen Sport- oder einen Verkehrsunfall. Warum kommt niemand auf die Idee, das Gelände abzuriegeln? Die Reisenden zu durchsuchen? Nach einer Waffe zum Beispiel. Nach Blutspuren an der Kleidung. Oder ist er nach zwanzig Jahren bei der Polizei so berufsgeschädigt, dass er solche Maßnahmen auch bei kleinen Zwischenfällen für notwendig erachtet?
Nun gut, es geht ihn wirklich nichts an. Er ist ja wegen eines explodierten Sprengsatzes in Skala Eressos auf Lesbos. Dennoch beunruhigt ihn, dass seine Ankunft von einem mysteriösen Zwischenfall begleitet wird.
Er geht zum Förderband zurück und fährt mit den Fingern sachte über die Metallkanten des Rahmens. Reichlich stumpf. Dafür sieht er verwischte Blutflecken am Boden, zu weit weg vom Band, um damit in Verbindung gebracht zu werden.
Stimmenlärm schlägt Klara und Livia entgegen. In einem engen Raum befinden sich an die sechzig Frauen, mehrere Gesichter kennt Klara vom Flugzeug. In Aufruhr reden sie in verschiedenen Sprachen auf eine uniformierte Beamtin ein. Diese steht ungerührt da und wiederholt immer wieder dieselben Sätze in gebrochenem Englisch, ohne einer der Anwesenden in die Augen zu schauen.
„Regen Sie sich nicht auf. Das ist nur zu Ihrer Sicherheit. Es hat Überfälle gegeben“, sagt sie. „Wir wollen Sie nur jederzeit erreichen können.“
Die Menge verdichtet sich vor einem Beamten, der an einem Schreibtisch sitzt und Pässe kontrolliert. Als Klara an die Reihe kommt und den Pass vorstreckt, verlangt er ihren Hotel-Gutschein, kramt in einem Karteikasten und zieht ein Polaroidfoto heraus. Die Entwicklerflüssigkeit kann kaum getrocknet sein, denkt Klara entsetzt, denn das Foto zeigt sie vor zwanzig Minuten beim Verlassen der Maschine.
„Reisen Sie allein?“
Sie nickt. Er notiert am unteren Rand die Adresse ihrer Pension und ihre Passnummer, dann legt er das Foto mit dem Rücken auf den Stapel und gibt ihr ein Blatt Papier mit ihrem Namen, einem Stempel und einer Nummer. Eine Bestätigung, dass ich erfasst worden bin, denkt Klara dumpf, als sie es wie in Trance in die Hosentasche steckt. Wozu? Es ist erstaunlich, dass in diesem Raum, unter den so kontrollierten und registrierten Einreisenden, kein einziger Mann zu finden ist. Die Frauen scheinen außerdem nicht zu den typischen Pauschaltouristinnen zu gehören.
Hinter dem Schreibtisch des Grenzbeamten steht eine Tür zu einem weiteren Büro offen. Heftiger, aggressiver Wortwechsel ist von dort zu vernehmen. Mit dem Rücken zu Klara sitzt eine breitschultrige Frau in einem schwarzen T-Shirt und verwaschenen, schwarzen Jeans. Hosenträger laufen über die Schultern, als ob sie den zur Ausuferung neigenden Körper in Form halten müssten. Das schwarze Haar steht in der Kopfmitte steif ab, ragt aus einem turbanartigen roten Tuch. Der dadurch freie Nacken gibt der Frau trotz ihres kräftigen Körperbaus etwas rührend Junges.
„Du meine Güte“, murmelt Klara, „die kenn ich.“
Die Stimme der Frau hat sich genauso erhoben wie die des Beamten, der ihr ein Springmesser unter die Nase hält und drohend fragt: „Wozu brauchst du dieses Messer?“
„Ich sagte Ihnen schon, das ist ein Geschenk. Zum Geburtstag.“
„Aber warum hast du es auf die Reise mitgenommen?“
„Um Obst zu schneiden.“ Sie macht ausgiebige, erläuternde Handbewegungen.
„Ich glaube dir kein Wort! Wenn du dieses Messer in der Hand hältst, was möchtest du dann am liebsten damit tun?“
Sie, langsam, als ob sie mit einem schwerhörigen Kind sprechen würde: „Wie ich Ihnen schon gesagt habe, ich nehme es, klappe es zusammen und stecke es in meine Tasche.“
Er, starrköpfig: „Nein, du brauchst es, um Männer zu bedrohen. Sag schon, was möchtest du damit tun, wenn du es in der Hand hältst?“ Er fuchtelt wütend mit dem Messer vor ihrem Gesicht herum.
Sie, lauter und mit Nachdruck, als ob ihr solche Situationen nicht fremd wären: „Es nehmen, schließen und in meine Tasche stecken.“
„Nein!“
„Ja!“
„Nein!“
„Ja!“
Ohne nachzudenken, nähert sich Klara der Tür. Bloß ein weiterer Vorfall in dieser schnell ablaufenden Kette von unverständlichen Ereignissen, denkt sie. Sie weiß nicht, ob sie den Namen der Verhörten rufen soll, ob es einen Sinn ergibt, sich einzumischen und nach ihrer akrobatischen Einlage auf dem Förderband, die einen Verletzten zur Folge hatte, ein weiteres Mal die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
„Du hast dieses Messer nur mitgebracht, um Männer damit zu bedrohen!“, behauptet der Beamte wieder. Die nächsten Worte hört Klara nicht mehr, weil die uniformierte Beamtin ihr die Tür vor der Nase zuschlägt und sie in die Menge zurückdrängt. So stellt sie sich neben Livia, die gleich nach ihr kontrolliert wird, als Letzte. Auf dem Foto, das von Livia gemacht wurde, trägt sie den schwarzen, breitkrempigen Hut, der nun an ihrem Rucksack befestigt ist. Livia lacht den Grenzbeamten an.
„Ja, das bin wirklich ich“, sagt sie und deutet auf den Hut. Er schaut zuerst misstrauisch auf, dann legt er den Kopf schief und lacht verständnisvoll und geschmeichelt mit, sein Gesicht verzieht sich dabei in unzählige Falten, die sich in die fettige Haut graben.
„Könnte ich etwas Wasser haben?“, fragt Livia, als er mit dem Schreiben fertig ist, mimt Trinken und deutet auf die Wasserflasche hinter ihm.
„Okay“, sagt er gönnerhaft, dreht sich um und zieht einen Becher aus dem Halter neben einem Waschbecken. Im selben Augenblick öffnet die Uniformierte eine Tür zur Straße, und die Frauen drängen hinaus. Livias kleine Hand liegt nun schwerelos auf dem Stapel Fotos. Sie hat den Rucksack auf den Schreibtisch gestellt, in dessen Schatten tasten sich ihre Finger unmerklich über die letzten beiden Fotos und ziehen sie vorsichtig in Richtung Schreibtischrand. Klara streckt geistesgegenwärtig die Hand aus. Währenddessen nimmt Livia dankend den Becher Wasser entgegen und strahlt mit dem eigentümlich frechen Charme einer Mittzwanzigerin, die noch nichts zu verlieren hat, in das Gesicht des Grenzbeamten.
„Efcharisto“, sagt sie.
Sie werden entlassen. Auf der Straße vor dem Flughafen stellt sich Klara zu einer Gruppe deutscher Frauen, die entrüstet diskutieren. Aufgebrachte Sätze, harsche Töne über Polizeischikanen sind zu hören. Als Österreich noch nicht in der EU war, denkt Klara, haben sie in Athen meine alte Olympia-Reiseschreibmaschine bei der Einreise untersucht und registriert, als ob sie eine Waffe wäre, während mein französischer Begleiter ungeschoren durch den EU-Ausgang geschlüpft ist. „Wir sollten uns zusammentun und uns beschweren. Gleich hier in der Hauptstadt, vielleicht gibt es ein Konsulat“, schlägt sie vor. Aber die Frauen verstummen, als wollten sie das nicht hören.
„Lass mal“, sagt eine Berlinerin. „Wir fallen besser nicht auf.“
Innerhalb von Sekunden ist Normalität eingekehrt. Reisebegleiterinnen nähern sich, Busse warten. Gastgeschenke werden verteilt, kleine Flaschen Olivenöl, und Broschüren in Vierfarbdruck über eine autonome Bäuerinneninitiative in der Nähe von Molivos. Klara aber geht zu der Beamtin zurück.
„Ich möchte auf die Frau warten, die noch drinnen ist.“
„Das geht nicht. Sie kommt nach. Keine Sorge.“
„Wann?“
„Später. Gehen Sie, gehen Sie jetzt endlich.“ Sie bugsiert Klara ungehalten zu den Bussen.
Aus dem offenen Fenster des Büros ist immer noch die aufgebrachte Frauenstimme im Wiener Tonfall zu hören: „Ich nehme das Messer, falte es und stecke es in meine Tasche!“
Der Fahrer nimmt Klara die Tasche ab und wirft sie in den Laderaum auf die anderen Gepäckstücke, dann schnalzt die Tür zu. Bald torkelt der Bus durch die Vororte der Hauptstadt, in deren gewundenen Straßen verwinkelte Villen mit Friesen über den Toren und dicht bewachsene Gärten zu sehen sind, bevor er sich in den ausgetrockneten, von Olivenbäumen spärlich bedeckten Hügeln verliert.
„Was halten Sie von diesen Kontrollen am Flughafen?“, fragt Klara die Reisebegleiterin.
„Ach, das ist inzwischen Routine.“
„Es sind aber nur Frauen kontrolliert und registriert worden.“
„Das muss sich um einen Zufall handeln.“
Klara will ihr das Blatt Papier mit Nummer und Namen zeigen, das ihr der Beamte in die Hand gedrückt hat, aber die Frau wehrt ab. Im Rückspiegel sind die neugierigen Augen des Fahrers zu sehen.
„Entspannen Sie sich“, sagt sie.
Livia und Klara haben durch Zufall dieselbe Pension und sitzen daher im selben Bus.
„Ich kenne die Frau, die wegen des Messers vernommen wurde“, murmelt Klara.
„Ich bin müde. Können wir vielleicht später darüber sprechen?“, antwortet Livia. Als ihr Kopf schlaftrunken gegen das Fenster sinkt, stopft Klara ihr in einem Anfall von Mütterlichkeit ein Sweatshirt in den Nacken. Dann schaut sie sich um und beobachtet die anderen Insassen. Vorwiegend Frauen im Alter ihrer Reisebekanntschaft Livia. Ob aus England, Deutschland oder Österreich, sie haben alle denselben Modegeschmack, denkt Klara. Da tanzt keine aus der Reihe. Eng anliegende Shirts, die oberhalb des Nabels aufhören, Hüftjeans mit Schlag im Stil der siebziger Jahre, kitschige, schmale Hüftgürtel mit Strasssteinchen oder Silberblättchen. Die Handgelenke sind ebenfalls mit Riemchen oder Kettchen geschmückt. Manche Frauen tragen kleine Tätowierungen auf den Schulterblättern oder im Kreuz, Klara glaubt am Rücken einer Frau einen Drachen mit mächtigen, ausgebreiteten Schwingen erkennen zu können. Livia trägt einen Gürtel aus feinem schwarzen Leder. Dazu passend ein Lederarmband mit Nieten in Form einer Schlange, deren Körper bis auf den Schwanz um den Kopf zusammengeringelt ist. Auffallend ist die Abwesenheit von Armbanduhren. Haarstil und Make-up sind einander über nationale Grenzen hinweg auch ähnlich. Livias Haare liegen wie nasse Vogelfedern um den Kopf. Ein blassviolettes Shirt mit dünnen Trägern klebt an ihrem Oberkörper, in dem sie auf unbarmherzige Weise schutzbedürftig wirkt.
Sandy, Schottin aus Edinburgh, dünn, drahtig, mit festen bronzefarbenen Locken, eigenbrötlerisch und verträumt, ist eben gelandet und muss dieselbe Zeremonie der Registrierung über sich ergehen lassen wie die Frauen vor ihr. Da sie aber im Vereinten Königreich des öfteren wegen irgendwelcher Genehmigungen, Dokumente oder auch nur Fahrscheine Schlange stehen muss, ist sie darüber nicht so irritiert wie die Wienerinnen und macht sich keine Gedanken darüber. Vielmehr verunsichert sie, dass dies seit Jahren ihre erste Reise allein ist. Sie fühlt sich verloren. Sofort nach der Landung dreht sie das Handy an, hört die Mailbox ab und liest ihre SMS. Danach geht es ihr besser. Ein Hotel-Shuttlebus ist in ihrer Buchung nicht inbegriffen. So hält sie nach einem Taxi Ausschau, aber die meisten Wagen sind schon weg. Der nächste Linienbus nach Skala Eressos geht erst morgen früh wieder, erfährt sie. Sandy steht leicht nach vorne gebeugt in der Hitze und überlegt, was sie nun tun soll. Eine Nacht hier in Mitilini bleiben? Wie öde.
„He!“, ruft eine Frauenstimme aus einem der Mietwagen, dessen Fahrer gerade angefahren war und wieder abbremst. „Magst du nicht mit uns fahren?“
Sandy läuft freudig auf das Taxi zu. Mit dieser Frau hat sie sich während des Fluges unterhalten. Eine spitznasige Blonde mit schnell umherwandernden hellblauen Augen. Neben ihr sitzen zwei andere im Fond.
„Das ist urnett von dir!“, sagt Sandy erleichtert, als der Fahrer aussteigt und ihr Gepäck einlädt. „Ich dachte schon, ich müsste hier übernachten.“
„Na, siehst du, das musst du nun doch nicht, und außerdem teilen wir nun den Fahrpreis durch vier“, sagt die Blonde zufrieden.
Da mischt sich der Fahrer ein.
„Eine Person mehr kostet auch ein Viertel mehr“, meint er in gebrochenem Englisch.
„Wieso? Sie fahren doch auf jeden Fall mit uns nach Skala Eressos.“
„Mit vier Leuten brauche ich auch mehr Benzin, und wenn’s Ihnen nicht passt, können Sie ja ein anderes Taxi nehmen.“
„Da ist ja kein Wagen mehr zu sehen.“
„Eben, dann ist es besser, Sie bleiben bei mir und zahlen den Aufpreis. Das bisschen kann für Sie ja nicht die Welt sein.“
Die vier Frauen stimmen zähneknirschend dem erhöhten Fahrpreis zu. Zorniges Schweigen während der Fahrt. Der Chauffeur versucht, seine Habgier durch ausgedehnte Erklärungen über die Insel wettzumachen.
„Sie brauchen jetzt nicht den Fremdenführer spielen“, faucht Sandy, die auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat. „Wenn Sie uns schon ausnehmen wie Weihnachtsgänse.“
„Ich weiß nicht, worüber Sie sich aufregen. In Ihrem Land würde ein Flughafentaxi das Zehnfache kosten.“
„Ich bin aber nicht in meinem Land.“
„Ich muss immerhin eine Familie ernähren. Was ich in einem Monat verdiene, kriegen Sie an einem Nachmittag.“
Nach eineinhalb Stunden steigen alle genervt in Skala Eressos aus, gerade als die Nachmittagshitze an ihrem Höhepunkt angelangt ist.
„In Edinburgh würden Fahrgäste nicht so gelinkt werden!“, zischt Sandy, als sie die Wagentür zuschlägt.
Yakis sitzt im Kafeneion neben der Mariana Bar und hat Tomi, einen älteren Polizisten, vor sich, dessen wichtigstes Transportmittel ein Fahrrad ist. Yakis ist schlecht gelaunt. Er bringt aus Athen den Eindruck mit, dass höheren Orts aus einer Mücke ein Elefant gemacht wurde, sprich, dass eine in der Hitze explodierte Propangasflasche auf dem Amtsweg zu einer Art Fliegerbombe mutiert ist und er aus einem nichtigen Anlass an diesen brütend heißen Strand, in einen Nullachtfünfzehn-Urlaubsort, beordert wurde. Also viel Lärm um nichts.
„Ja, vor vier Tagen. Ein Uhr nachts“, sagt Tomi gerade. „Keine Verletzten. Auch kein nennenswerter Sachschaden. Nur ein Krater neben dem Les… äh … dem Nudistenareal, rund drei Meter Durchmesser. Ein Pärchen als Augenzeugen war so spät noch am Meer. Die Personalien der … äh … beiden Frauen habe ich aufgenommen.“
Tomi ist das Gespräch sichtlich unangenehm. Er will keinen Fehler machen.
„Und irgendwelche Spuren? Sprengstoff oder Bombenteile?“
„Blechtrümmer lagen überall herum. Mit Coca-Cola-Aufschrift, die konnte man teils noch erkennen.“
„Finden Sie den Krater nicht etwas groß für eine Coladose?“
„Keine Coladose. Einer dieser Druckbehälter, wie sie für den Ausschank verwendet werden. Rund sechzig Zentimeter lang und zwanzig im Durchmesser. Fassungsvermögen zwanzig Liter. Damit kann man ein ganzes Haus wegblasen, wenn die Mischung stimmt. Was hier offenbar nicht ganz der Fall war.“
Tomi schaut etwas selbstsicherer drein, wohl ob der exakten Fakten, die er liefern kann.
„Also selbst gebastelt“, fasst Yakis zusammen. „Der Brisanz nach könnte es Unkrautsalz oder Stickstoffdünger gewesen sein. Werden wir noch feststellen. Die Frage des Zündmechanismus ist auch noch offen. Und wem so ein Behälter fehlt. So etwas liegt ja nicht in der Landschaft herum wie leere Bierflaschen. Was ich dann noch benötige, ist Einsicht in alle Protokolle zu den Vorfällen im September 1989.“
„September 1989?“ Tomi blickt ihn verzweifelt an, als ob ihm der Uniformkragen zu eng werden würde. „Was für Vorfälle sollen das sein?“
„Nun, da war die Verhaftung von vier Touristinnen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Das ist aber nur von sekundärem Interesse. Danach gab es Fälle von Brandstiftung und ebenfalls Sprengsätze am Strand.“ Yakis’ Ton wird eisig. „An eben demselben Strand, wie Sie sich vielleicht noch erinnern.“
„Ja, also das meinen Sie.“ Tomis Verlegenheit wird immer größer. „Da waren aber welche von denen da oben mitbeteiligt, wenn Sie wissen, was ich meine.“
Yakis schaut ihn kalt an. „Ich weiß nicht, was Sie meinen.“
Tomi zuckt mit den Schultern. „Ich zeig Ihnen alles, was Sie wollen. Aber den Bürgermeister sollten Sie nicht übergehen.“
Um halb sechs Uhr abends steht Livia vor Klaras Zimmertür. In ihrer distanzierten Höflichkeit fragt sie, ob sie den Abend mit ihr verbringen möchte, und scheint nicht anzunehmen, dass Klara ablehnt.
„Das ist ja eine ganz schön miese Absteige hier“, meint Klara, als sie sich zum Ausgehen fertig macht. „Die Schranktüren hängen schief, die Stühle haben ungleiche Beine, der Fliesenboden ist an manchen Stellen herausgebrochen, und die Küchenschubladen klemmen.“
„Ich frage mich, ob die die Zimmer überhaupt geputzt haben, bevor wir eingezogen sind“, sagt Livia.
„Sicher nicht. Ich hab der Wirtin das dreckige Bad gezeigt. Da hat die mich auf griechisch angeschrien, anstatt zu putzen.“
„Eine Frechheit!“
„Finde ich auch. Als sie wieder ging, wollte sie vor Zorn die Zimmertür zuknallen. Aber die schleift ja am Boden und ist wie eine Gitarrensaite zurückgewippt. Das war witzig.“
Sie kichern.
„Haben Sie sich wenigstens ein bisschen ausruhen können?“
„Danke“, antwortet Klara. „Ich habe etwas geschlafen, unterbrochen von Kindergebrüll. Und wenn die auf dem Nachbarbalkon die Möbel verschieben, klingt das wie eine Kreissäge.“
Livia lacht, und Klara ist froh, ihre ersten zögerlichen Schritte durch den Ort in ihrer Gesellschaft zu machen. Durch die glühende Luft zu gehen ist, als schlügen sie sich einen Weg durch ein brennendes Dickicht. Skala Eressos ist in den letzten Jahren angeschwollen; der verschlafene Platz am Meer, an dem einst nur ein Kiosk mit klebrigem Zuckerzeug gestanden hatte, unter zwei schmächtigen Tamarisken, ist randvoll mit den Stühlen diverser Bars und Restaurants und findet nicht einmal in den frühen Morgenstunden seinen Frieden.
„Das mit dem Mann am Flughafen geht mir nicht aus dem Kopf“, sagt Klara.
„Ja, das ist richtig unheimlich“, pflichtet ihr Livia bei.
„Überhaupt der helle Strahl, der mich und wahrscheinlich auch ihn geblendet hat.“
„Wie in einem Sciencefiction-Film“, vollendet Livia ihren Gedanken.
„Aber es hat nur ihn erwischt und nicht mich, als hätte es der Strahl auf ihn abgesehen.“
„Erfahren werden wir nie, was genau es gewesen ist“, seufzt Livia. „Vielleicht steht ja morgen etwas in den Zeitungen.“
„Und dann diese merkwürdige Registrierung. Dass wir die Fotos geklaut haben, nützt uns ja nicht wirklich“, sagt Klara. „Wenn die nachzählen und draufkommen, haben wir Ärger.“
„Wenn sie nachzählen! Wenigstens sind wir jetzt unter keiner Nummer registriert“, grinst Livia.
„Wozu diese Kontrolliererei gut sein soll?“
„Was weiß ich.“
Livia pfeift durch die Zähne, und Klara brütet im Gehen vor sich hin. Der Urlaub beginnt ja schön, denkt sie.
„Ich habe den Ort bereits ausgekundschaftet, während Sie geschlafen haben“, sagt Livia. Das Lokal, in das Livia sie führt, liegt neben vielen anderen direkt am Wasser. Dann nur noch Sand und Meer. Mit seinen Korbstühlen gehört es zu den schickeren im Ort und erinnert Klara, die nicht zum ersten Mal hier ist, vage an frühere Zeiten, an ihre stille, wehmütige Verzückung beim Anblick des glatten Meeres in der untergehenden Sonne. Heute ist ihr sogar diese Stimmung zu aufwühlend. Die Spiegelung des Wassers ist grell wie der Blitz; es ist unmöglich, dem blendenden Licht zu entkommen. Klara ist verschlafen und in sich gekehrt. Nur mit Mühe kann sie sich auf die Gegenwart konzentrieren. Dabei will sie doch Livia ihre ganze Aufmerksamkeit schenken. Sie ist erstaunt, die Neugier dieser jungen Frau geweckt zu haben, deren Schönheit sich durch das genaue Studium ihrer Gesichtszüge offenbart.
Sie setzen die Gespräche über Literatur fort, die sie im Flugzeug begonnen haben.
„Das letzte Seminar über Rilke war unglaublich dicht“, sagt Livia. „Eine ganze Woche in Gemeinschaft mit anderen Lyrikliebhaberinnen. Der Zusammenhalt in der Gruppe war enorm. Diese Erfahrung werde ich nicht so schnell vergessen.“
Livias Empfindungen und Urteile sind von einer Absolutheit, die Klara längst niemandem mehr abnimmt. Aber weil Livia so jung ist und diese Jugend sie an eine bedingungslose Dichte des Lebens gemahnt, die im Laufe der Jahre verschwindet, glaubt sie ihr. Und das erfüllt sie mit einem bereits verloren geglaubten Optimismus.
„Was ist eigentlich ein Gedicht?“, fragt Livia jetzt. „Ab wann würden Sie einen Text als Gedicht bezeichnen? Sie sind doch selbst Autorin.“
In ihrer Frage liegt eine mühsam unterdrückte Leidenschaft für Produkte der Fantasie, ihre Gestalt ist im Gegenlicht durchscheinender und unwirklicher als zuvor. Kleine Schweißperlen oberhalb ihrer Wangen. Klara, die selbst Jahre ihres Lebens mit Geschriebenem verbracht hat, taucht glücklich den Strohhalm in den dickflüssigen Café Frappé.
„Eine sprachliche Regelmäßigkeit im amorphen Ablauf der Zeit“, antwortet sie spontan. Das erheitert Livia.
Wie schön, rückwirkend gesehen, dieser erste Abend war, wie absichtslos und gefärbt vom bloßen Hiersein und Klaras unbändiger Freude darüber, Wien hinter sich gelassen zu haben. Nichts war dringlich. Noch gab es keine unerfüllbaren Wünsche.
„Wir könnten eigentlich ‚Du‘ zueinander sagen“, bietet sie der gut zwanzig Jahre Jüngeren an. „Warum machst du hier Urlaub?“
„Das lesbische Universum“, lacht Livia anzüglich. „Eine Art Psychohygiene.“
Ihre Füße sinken in den Sand ein, als sie den ortsfernen Strandteil anpeilen, denjenigen, den Lesben für sich beanspruchen. Sie brechen ins Nichts auf, gehen schwimmen. Der erste Kontakt mit dem kühlen, in der Dämmerung vor sich hin gluckernden Wasser ist gewöhnungsbedürftig und Sinnbild ihrer Begegnung. Langsam miteinander vertraut werden. Beide sind schüchtern. Livia, indem sie die Dunkelheit abwartet, bevor sie sich zum Schwimmen nackt auszieht, Klara, indem sie Erinnerungen verschweigt und damit verbundene Worte zurückhält.
In der beginnenden Dämmerung glaubt Klara, als sie vom Wasser kommt, eine uniformierte Gestalt wahrzunehmen, dort, wo der Sand in einer Reihe von Tamarisken endet.
Der Strand ist fast leer, keine einzige Frau außer den beiden hält sich zu dieser Zeit hier noch auf. Nur Klara und Livia liegen lange unter den Sternen, ihre verwandten Seelen scheinen einander gefunden zu haben, ohne viele Fragen zu stellen, warum und weshalb. Die Nachtluft ist immer noch hitzeschwanger; im Wasser schaukeln rosa und grüne Luftmatratzen, die die Frauen über Nacht schwimmen lassen, mit Steinen am Grund beschwert.
Klara hat auf einmal den Anspruch, Livia gegenüber verantwortlich zu sein, dafür, dass alles gut wird, oder für die späte Wärme, für die Stille trotz der plätschernden Wellen, für den Ort, der schmieriger ist, als Livia sich vielleicht erhofft hat. Diese Reise scheint auch für die Jüngere Freiheit von Zwängen in Wien zu bedeuten, ist Ausdruck einer gemeinsamen Leidenschaft: Frauen.
Die Brandung in Skala Eressos ist kaum der Rede wert. Ein knappes „Ritsch“ ist in Abständen von wenigen Sekunden zu vernehmen, wenn das Wasser sich in die Kiesel drückt. Sandy liegt neben den Tretbooten und bemüht sich, die Sterne nicht als feenhafte Lebewesen zu sehen. Oft geht die Fantasie mit ihr durch, und wenn sie, wie jetzt, allein in der Natur ist, stellt sie sich vor, die Umgebung sei bevölkert von Zaubergestalten. Ich habe zu viele Märchen gehört in der Kindheit, denkt sie und erinnert sich an die Stunden am Kamin, als ihr Vater zu erzählen anfing und sie und ihr Bruder die Geschichten weiterspinnen sollten.
Sie hat die Gruppe, mit der sie essen war, gerade verlassen und atmet die feuchte warme Luft der Nacht. Da klingelt das Handy in ihren Shorts. Ehe sie nachdenken kann, hat sie schon geantwortet.
„Und? Wie geht es meinem Liebling unter der griechischen Sonne?“, fragt eine dunkle, raue Stimme in herzlichem Tonfall.
Sandy fröstelt und zögert.
„Es war nicht ausgemacht, dass wir miteinander telefonieren“, sagt sie in vor Zorn belegtem Ton.
„Na und?“, ruft die andere zurück. „Wir haben beide gerade an dich gedacht. Ich finde das nett von uns.“
„Mir geht deine Art, alles zu bagatellisieren, auf die Nerven.“
„Sei doch nicht so kindisch nachtragend, Sandy. Also, wie ist das Wetter? Bei uns regnet es seit zwei Tagen.“
„Du hast dich vor meiner Reise auch wochenlang nicht gerührt. Insofern ist es unerheblich, wie das Wetter auf Lesbos ist. Ich lege jetzt auf.“
Nach diesem Gespräch ist die Welt nicht mehr im selben Maße friedlich wie bisher. Sandy schaltet das Handy ganz aus. Sie hadert mit sich, dass sie diesen Anruf überhaupt entgegengenommen hat. Ein Automatismus aus ihrer hektischen Berufswelt. Der Glaube, dass sie bessere Arbeit leistet, wenn sie immer erreichbar ist. Die Sterne sind in dem Nebel ihrer Wut fast ganz verschwunden.
Das Ende der Beziehung liegt schon Monate zurück, zumindest für Sandy. Die Ex-Geliebte interpretiert die Ereignisse aber wieder einmal nach ihren eigenen Wünschen, hat sie ja neben Sandy noch eine zweite Beziehung gelebt und war nicht bereit, diese Dreierkonstellation aufzugeben. Jetzt soll Sandy zurückbeordert werden, immer dann, wenn sie versucht, eigene Wege zu gehen.
In dieser Hinsicht ist die Reise nach Lesbos ein symbolischer Akt. Sandy will nicht nur den beiden entkommen, sondern auch deren Welt von Vorurteilen und Engstirnigkeit.
Sie hat sich für diesen Urlaub den Nacken ausrasieren lassen, nur die Locken in der Stirn sind geblieben, und damit deklariert sie sich endlich wieder offen als Lesbe, etwas, das ihrer Geliebten und deren Freundin immer zuwider gewesen ist. Jedes Outing, jedes Styling, jede extreme politische Äußerung haben die beiden, von Beruf Therapeutinnen, verachtet und für unnötig befunden. Sie waren für ein unauffälliges, bürgerliches Leben, in dem vergessen werden sollte, dass es sich um eine Frauenbeziehung handelte, die sie führten.
Auch Sex, seine unbändige Seite, die mit Auflösung und Unterwerfung zu tun haben könnte, mit der Hingabe an visuelle Reize und Inszenierungen, lehnten sie ab. Sandy, Anfang dreißig und um viele Jahre jünger als die beiden, hatte sich mit ihrer wilden Fantasiewelt, ihren Gedanken, die oft den ganzen Tag nur um Sex kreisten, immer einsamer gefühlt, fehl am Platz und unbestimmbar schuldig. Ihre Reise nach Lesbos ist ein Protest gegen dieses Leben, ist die Suche nach dem Ungestümen in ihr selbst.
Vielleicht wird sie hier eine Frau kennen lernen, vielleicht genügt es aber auch, sich allein vollwertig zu fühlen und dadurch auszuführen, was sie sich vorgenommen hat. Etwas längst Fälliges ist zu tun, das ihr einen würdigen Platz in der Reihe ihrer Vorfahren sichern könnte.
Als Klara und Livia zu ihrer Pension zurückgehen, kommen sie an einer Freiluftbühne am Meer vorbei. Offensichtlich ein Kulturprogramm für Touristen, aber auch Griechen sind gekommen. Von den Scheinwerfern geblendet, stoßen die beiden beinahe mit der Sängerin zusammen, die soeben das lange, krause Haar nach hinten wirft, das golddurchwirkte Gewand rafft und die Stufen erklimmt. Applaus summt aus den Reihen der hastig in den Sand gestellten Plastikstühle, die klatschenden Hände erzeugen ein rieselndes Geräusch, das immer stärker anschwillt. Livia und Klara lassen sich knapp vor der Bühne am Boden nieder, hinter ihnen scheint der ganze Ort versammelt zu sein, die Griechinnen mit Familien, die Lesben zumeist paarweise gekommen, beide Bevölkerungsgruppen einmütig, erwartungsvoll in den Stühlen sitzend.
Der Körper der Sängerin ist mächtig. Sie trägt eine dicke, schwarzumrandete Brille. Der vom Meer kommende Wind bläht ihr Goldkleid. Ihre Stimme donnert über den Strand und versetzt sie in ein Zwischenreich, fern von der Wirklichkeit, dort, wo die Fantasie zu reisen beginnt. Mehr noch als Klara ist Livia von ihren Liedern eingenommen. Sie geben die Melancholie wieder, die ihr Körper beherbergt.
Das Konzert ist zu Ende. Die Menge strömt in Richtung Ortschaft. Fackelalleen leuchten die paar hundert Meter Strand zwischen Bühne und Straße aus. Livia hockt versunken im Sand, überwältigt von der Musik. „Ich habe beim Zuhören geglaubt, die Sterne kommen näher“, sagt sie.
Langsam wird es still, und Klara will aufbrechen. Da hört sie den Motor eines herannahenden LKWs, Autotüren werden zugeschlagen. Der Wagen entfernt sich. Eine massige Gestalt kommt langsam auf die beiden zu. Durch das Gewicht ihres Rucksacks sinken ihre Füße tief in den Sand. Schatten und Licht der Flammen züngeln über ihr Gesicht.
Zuerst spürt Klara den Reflex, Livia zu packen und zurückzuweichen, in den Schutz der Bühne vielleicht, dann durchzuckt sie der freudige Schreck des Wiedererkennens, und sie fängt vor Erleichterung an zu grinsen.
„Livia“, sagt sie, „darf ich dir Gini Sedlak vorstellen, die Frau mit dem Springmesser.“
Klein, drall, hohe Backenknochen, Augen wie Tollkirschen, den hyperweiblichen Körper stets in verwaschenen Klamotten, die in ihrer Zusammensetzung seltsam, ja kitschig anmuten, und auf manche Teile dieses Körpers ausdrücklich hinweisen, auf den Busen beispielsweise, der ihrem Gegenüber meist blank entgegenragt, auf die Schultern, die mit Epauletten bestückt sind, auf die prallen Schenkel, oft nur von hauchdünnem Stoff umspannt. Jetzt schaut Gini müde aus, um die Augen tiefe Schatten, ausgelaugt, was sie nie zugeben würde. Sie und Klara begrüßen sich so überschwänglich, als wäre es ein Wunder, alte Bekannte aus Wien auf Lesbos zu treffen.
„Wie hast du den Beamten am Flughafen endlich abgehängt?“
„Ich hab ihm gesagt, wie arm ich bin, allein erziehende Mutter, lebt von der Sozialhilfe, braucht dringend Erholung. Das Messer habe ich dort lassen müssen.“
„Warum schleppst du so etwas auch in den Urlaub mit?“
„Es ist halt ein Talisman.“
Sie gehen zu dritt in das nächste Lokal. Es ist elf Uhr nachts, und die Tavernen wie ausgestorben. Sie sind die einzigen Gäste. Klara erzählt Gini von dem Vorfall am Flughafen: der Mann, der Blitzstrahl, das plötzliche Schreien und Zusammenbrechen ihres Angreifers, Behörden, die sich nicht um sie geschert haben, als hätten sie schon im Voraus gewusst, was passieren würde. Aber Gini hat für solche Erlebnisse nur mildes Erstaunen übrig.
„Griechen!“, sagt sie und zuckt mit den Schultern.
„Und die Kontrollen am Flughafen? Was sagst du dazu?“
„Imponiergehabe. Die wollen die Lesben loswerden, die hierher in Urlaub fahren. Jedes Jahr fällt ihnen etwas anderes dazu ein.“
„Das ist alles?“
„Fantasierst du einen Polizeistaat auf Lesbos? Eine rechte Enklave?“
„Na ja … nein, nie im Leben“, lacht Klara.
Livia schaut unbeteiligt auf die schwarze Wand der Nacht außerhalb der beleuchteten Terrasse, dort, wo das Meer liegt, dessen gelegentliches Knurren von der griechischen Hintergrundmusik des Lokals übertönt wird. Ein kurzes Schweigen entsteht. Gini dreht sich eine Zigarette.
„Komm schon“, sagt Klara, um die düstere Stimmung zu lockern, „erzähl doch mal, wie dich der Einsatzleiter der Wiener Polizei bei jeder Demo persönlich begrüßt: ‚Guten Tag, Frau Sedlak!‘“
Gini lacht verlegen, bevor sie anfängt zu erzählen. Breitbeinig sitzt sie da und amüsiert sich über sich selbst, halb naiv, halb gerissen. Altgediente Kämpferin, eine Art Faktotum der Polit-Szene in Wien. Anekdoten aus ihrem reichhaltigen, öffentlichen Leben folgen, Auseinandersetzungen mit Polizisten auf Demos, mit Drogenbehörden, der Staatspolizei, Bezirksrichtern. Ordnungshütern also, die andere Auffassungen von korrektem staatsbürgerlichen Verhalten hatten als sie. Sie erzählt im wegwerfenden Tonfall der Genugtuung, dabei schaut sie Klara unverwandt an und wartet auf immer neue Aufforderungen.
Da Klara und Gini einander so lange kennen, ja sogar dieselbe Ex-Freundin haben, herrscht zwischen ihnen die sinnlich aufgeladene Verbundenheit des Vergangenen. Es fiele ihnen schwer, einander nicht anzulachen, so als wären sie in diesem fremden Land ausgehungert nach Familiarität, eine, die sie bislang auch in Wien miteinander nicht gekannt haben.
Klara ist bürgerlicher als Gini. Aber beide verbindet eine ähnliche Energie, sexuell, kämpferisch, provokant. Wenn Klara als Schriftstellerin durch ihre Texte Menschen aus ihrer verschlafenen Angepasstheit aufrüttelt, tut dies Gini mit ihrem spontanen Aktionismus. Manchmal haben sie auch gemeinsam für Aufsehen gesorgt, in einer Frauenszene, die bieder vor sich hindöste.
Ginis Sorglosigkeit passt Klara diesmal nicht. Das heutige Verhör am Flughafen wegen ihres Springmessers verleibt Gini zu schnell in die Fülle persönlicher Erlebnisse ein, als wäre es bereits Geschichte.
Die Sperrstunde ist gekommen, einzige Beleuchtung ist die Neonlampe der Küchenvitrine. Als die drei Frauen aufstehen und gehen wollen, gesellt sich der Besitzer des Lokals zu ihnen. Es ist ihm anzusehen, dass er nicht weiß, welchen Ton er anschlagen soll.
„Ihr habt viel Spaß miteinander“, konstatiert er. Gini postiert sich vor ihm, drückt ihren Oberkörper mit den spitzen Brüsten heraus und schwingt die Hüften.
„Ja, und wir werden in den nächsten Tagen noch viel mehr Spaß haben!“, ruft sie aus und lacht. Es ist aber deutlich, dass er nicht mitmachen darf, dass er nicht im Geringsten damit gemeint ist. Sein Blick schwankt zwischen Unsicherheit und Ärger.
„Lachen Sie nicht so laut um diese Zeit, der Bürgermeister will das nicht“, sagt er schließlich.
„Wieso nicht?“, fragt Klara, die die Warnung als Scherz versteht.
„Er möchte absolute Ruhe im Ort. Auch die Lokale müssen um ein Uhr nachts zumachen, damit die Urlauber schlafen können.“ Gini starrt ihn offenen Mundes an.
„Keine Musik“, fügt er hinzu.
„Auch wir sind Urlauberinnen“, sagt sie irritiert.
Er zuckt mit den Achseln.
Wie bei den anderen Tavernen führen drei Stufen von der Terrasse in den Sand hinunter. Dunkelheit herrscht. Erst weiter weg durchstechen die Straßenlampen der Ortseinfahrt die Schwärze der Nacht.
„Moment, Livia haben wir vergessen“, sagt Klara und dreht sich zum Lokal um. Der Tavernenwirt bückt sich gerade und hebt etwas auf. Klara starrt in das schwach erleuchtete Viereck des Lokals, als würde sie auf etwas anderes warten. Da steht Livia auf einmal neben dem Wirt. Sie wechseln ein paar Worte miteinander.
„Wo warst du?“, fragt Klara sie, als sie zu ihnen stößt.
„Na, auf der Toilette, wo sonst?“, sagt Livia und schaut sie befremdet an.
„Klara, was ist los mit dir? Siehst du Gespenster?“, fragt die Sedlak.
„Ich weiß nicht. Ich bin bloß überreizt“, antwortet Klara.
„Wir haben heute einfach zu viel erlebt“, sagt Livia.
„Mädels, ich gehe“, ruft Gini.
„Wo wohnst du?“
„Am Strand.“
„Echt? Da war am frühen Abend Polizei.“
„Na und? Auch die schläft um die Uhrzeit, wie die Urlauber.“
„Sollen wir dich begleiten?“
„Das wäre ja noch schöner!“
Kapitel 2
Er zieht den Zipp hoch, schiebt sich den Hosenbund über den Bauch, räuspert sich und verlässt das Pissoir. Er ist untersetzt und an die sechzig Jahre alt. Sein Körper besitzt die typische Schwere eines Menschen, der alt geworden ist, ohne auf sich zu achten, der in dem Bewusstsein gelebt hat, dass ihm Genüsse zustehen und sich keine Folgen aus seinen Ausschweifungen ergeben. Viel ist es ohnehin nicht, was die Insel zu bieten hat. Fettes Essen und Zigarren, starker Kaffee, Alkohol und die Hitze machen das Fleisch zäh und plump, die Glieder schwer, gerben die Haut. Er musste sich nie bis zur Erschöpfung abrackern, nur zu Hause träge herumsitzen und zuschauen, wie die Frau ihn bedient, dann, als sie tot ist, die Tochter. Schon am Vormittag im Kafeneion hocken, und am späten Abend wieder, so wie heute auch. Den eigenen Machtanspruch nie in Frage stellen. Da wird der Körper derb und unbeweglich. Die Wangen sind mit Narben überzogen. Er trägt die undurchdringliche Verbohrtheit des südländischen Patriarchen ins Gesicht graviert.
Seit acht Monaten ist Theofilos Valiakos Bürgermeister von Eressos-Antissa, eine Zweitausend-Seelen-Gemeinde, der auch der Strandort Skala Eressos zugeordnet ist. Er wurde von wohlhabenden Grundbesitzern gewählt, die auf Touristen als wichtigste Einnahmequelle nicht angewiesen sind und auf Zucht und Ordnung achten. Die Sozialdemokraten erlitten mit Theofilos’ Wahl ihre erste Niederlage seit siebzig Jahren. Theofilos hat eine weit verzweigte Familie als Rückendeckung; von Molivos bis Mitilini reicht die Verwandtschaft. Er kennt jeden, der auf der Insel etwas zu sagen hat. Sein Sohn Gregorios ist Leiter einer Polizeieinheit in Mitilini.
Theofilos steht zu Frauen wie jeder andere Durchschnittsmann. Seine eingefleischte Verachtung für sie kommt dabei selten zum Vorschein. Lesben kann er nicht besonders leiden. „Diese Weiber“, sagt er dann zu seinen Kumpels, „sind wie die anderen Frauen nur zum Kinderkriegen und Putzen da. Was tun sie aber? Vergnügen sich nur miteinander, brauchen keine Männer dazu, das ist unbegreiflich, ja krank. Sie übernehmen selbst die Männerrolle, wenn sie geil aufeinander sind, und tun nicht nur so, als ob. Ein Mann wird genauso wahrgenommen wie ein Holzbrett, das an einem Baum lehnt und zu nichts nütze ist. Damit verhöhnen sie mich und dich und alle Männer persönlich.“
Früher hat Theofilos Lesben nie zur Kenntnis genommen. Als sie in den Siebzigern zu Hunderten auf der Insel landeten und jedes Flugzeug mehr und mehr von ihnen ausspuckte, dachte er, diese Heimsuchung würde bald vorbei sein. Seine selbstgerechte Überzeugung, den Abschaum vor sich zu haben, bestimmt seitdem sein Leben.
Gesindel, denkt er, auch wenn die Geld haben. Schlimmer als die babylonische Hure sind sie, denn die ist eine zwar verderbliche, aber vertraute Erscheinung. Vor Huren musst du dich hüten, aber sie stehen zumindest auf Männer und richten sich nach ihnen. Huren sind ein kalkuliertes Risiko.“
Seit Theofilos Bürgermeister ist, zermartert er sich den Kopf darüber, wie er mit Lesben umgehen soll. Sie wie Männer zu behandeln und ihnen den Krieg zu erklären, funktioniert nur in seiner Fantasie. Wenn man sie vor sich hat, sind sie dem Aussehen nach trotz alledem Frauen und wecken bei ihm instinktiv das Bedürfnis, sich so zu verhalten, wie er sich den anderen zahlenden Touristinnen gegenüber immer verhalten hat: gönnerhaft freundlich, weil sie harmlos und leicht einzuschüchtern sind. Oder abfällig, gerade so viel, dass sie es nicht merken. Autoritär väterlich, augenzwinkernd.
Angesichts der Horden von Mannweibern, die dreimal wöchentlich ankommen, will sich die gewohnte Haltung bei Theofilos nicht einstellen. Es fällt schwer, sie abschätzig zu behandeln, wenn zumindest ein Drittel unter ihnen den einheimischen Männern körperlich überlegen ist und ein Paar Radauschwestern immer wieder anklingen lassen, dass sie diesen Vorteil gegebenenfalls ausnützen würden.
Außerdem befinden sich Griechinnen unter ihnen. Viele der Frauen, die gegen sechs Uhr abends am Strand Volleyball spielen und ihre hüninnenhaften Leiber in Muscle-Shirts und schillernden Lyrca-Hosen dem Ball entgegenrecken, die verfilzten Rastalocken mit einem Stirnband mühsam gebändigt oder die Haare zu Stummeln abgeschnitten und hennagefärbt, die einander anfeuern, im Sand verfolgen und, wenn nötig, auch verprügeln, sind aus Athen, einige sogar von der Insel, die kennt Theofilos, seit sie Kinder waren. Maria, die marktschreierisch die Tickets für ihre wöchentlichen Beach-Partys verkauft, ist die Tochter der Gemischtwarenhändlerin in der Luviakou-Gasse, und der Kontakt zwischen Mutter und Tochter ist längst nur auf den minimalen Austausch von alltagsnotwendigen Phrasen beschränkt, seit Maria ihre Abnormität offen zur Schau trägt, aufgereizt von den Fremden.
Theofilos kommt vom Klo und setzt sich wieder an den Tisch zu seinen Freunden im Kafeneion. Dessen rudimentäre Ausstattung – am Abend beißendes Neonlicht und der kontinuierliche Lärmteppich krächzender Männerstimmen – ist ihm gerade recht. Keine einzige Frau zu sehen, statt dessen Männer in Massen, vorwiegend in jenem Alter, in dem sie beginnen, alle gleich auszusehen. Übergewichtig, großporige Haut, graues Haar und ein schwerer, wankender Gang. Nebenan ist das Mariana, die lesbische Cocktailbar, in die sich nur hie und da ein Heteropärchen verirrt, das die Verhältnisse noch nicht kennt. Normalerweise besteht eine Art unsichtbarer Glaswand zwischen den beiden Lokalen, zwei Welten, die miteinander nichts zu tun haben. Die Männer sind mit ihrer eigenen Überlegenheit und den Wortbrocken, die sie einander auch über größere Entfernungen zuwerfen, vollauf beschäftigt.
Heute ist es anders. Im Mariana ist eine Runde Frauen versammelt, die Geburtstag feiert, eine Torte mit dreißig schimmernden Kerzen ist auch vom Kafeneion aus zu sehen, und laute Gesänge machen ihren Weg durch die Nacht. Theofilos wetzt unruhig auf seinem Sitz hin und her und schaut wiederholt auf die Uhr. Der Zeiger nähert sich der vollen Stunde. Gleich ist es ein Uhr nachts, die Zeit des von ihm selbst verhängten Musikverbots. Die anderen Alten nehmen keine Notiz von seinem Knurren. Drüben wird ein neues Lied angestimmt, Gelächter. Theofilos wartet, bis es eine Minute nach eins ist, erhebt sich und turnt keuchend ins Mariana hinüber. Lautes Geschrei ist zu hören, dann Grabesstille. Theofilos kommt zurück, im Gesicht Genugtuung.
„Jetzt habe ich es ihnen gezeigt. Noch einmal lachen und die kriegen eine Anzeige“, faucht er. In diesem Moment zerreißt ein Schrei das Gemurmel im Saal und das Scheppern am Tresen. Er kommt von dem Platz neben dem Lokal. Die Stimmen verebben. Die Alten horchen auf und schauen in die Richtung, aus der der Schrei kam, als wäre es möglich, die Dunkelheit vor der Terrasse mit Blicken zu zerteilen.
Einige stehen auf und hasten hinaus, unter ihnen Theofilos. Neben dem Denkmal mitten am Platz liegt ein Mensch. Reglos. Theofilos kommt als Erster bei ihm an, beugt sich hinunter und schüttelt ihn an der Schulter. Als das keine Reaktion auslöst, kniet er sich hin und fasst nach dem Handgelenk des Mannes. Der Puls ist zu spüren. Der Mann ist bewusstlos, eine glänzende, schwärzliche Schicht auf seiner Stirn weist auf eine Verletzung hin.
„Den Arzt, schnell!“, ruft Theofilos, seine Hände beben. Er wagt es nicht, den Liegenden umzudrehen oder das Blut abzuwischen, aus Angst, etwas falsch zu machen. Stattdessen hält er ihm sinnloserweise die Hand. Natürlich kennt er den Mann, ein Olivenbauer in seinem Alter aus Eressos.
Haut und Fleisch an der Stirn sind bis zum Knochen zerfetzt, von einem Schlag, dessen Wucht ungeheuerlich gewesen sein muss. Theofilos läuft es kalt den Rücken hinunter.
„Dasselbe ist heute schon einmal passiert. Am Flughafen“, sagt eine Stimme neben ihm, die zu dem Dorflehrer gehört.
„Was heißt das?“
„Da ist einer in der Menge angegriffen worden und zu Boden gegangen. Blutige Stirn. Bewusstlos.“
„Warum hat mir das niemand erzählt?“
„Bis jetzt war es ja nicht von Belang.“
Theofilos erhebt sich ächzend, als der Bereitschaftsarzt aus der Klinik angelaufen kommt. „Wo ist eigentlich die Polizei?“, fragt er matt.
„Was meinst du mit Polizei? Tomi schläft wahrscheinlich schon“, sagt der Lehrer.
„Tomi mit dem Fahrrad? Sonst ist niemand da?“
„Der Einsatzwagen mit den zwei Jungen ist in Antissa. Wer rechnet denn schon damit?“
„Die sollen kommen und das hier aufnehmen. Ich will einen Bericht.“
Der Arzt sagt, es bestehe Verdacht auf Gehirnerschütterung, die Ohnmacht sei eine Folge eines Schlages. Mehr könne er erst einmal nicht sagen. Der Verletzte wird auf eine Bahre gehievt und in die Klinik ums Eck getragen.
Erst nach einer halben Stunde ist wieder Ruhe auf dem Platz eingekehrt. Einige der Lesben vom Mariana haben sich unter die Schaulustigen gemischt. Nach dem ersten Schock rannte der Bürgermeister aufgebracht rufend und gestikulierend herum, als ob er damit das Ereignis ungeschehen machen könnte. Erst nachdem der Verletzte bereits weggebracht worden war, kam die Polizei, zwei drahtige Jungs in ihrem Einsatzwagen, die zuerst nur unsicher herumstanden, und Tomi, das Faktotum, mit zitternden Händen und wackeliger Lenkstange, der von Theofilos zusammengestaucht wird, weil er nicht rechtzeitig da war, um die Tat zu verhindern. Niemand will etwas gesehen haben. Theofilos bestimmt, dass der Einsatzwagen sich auch morgen in Strandnähe aufhalten solle.
Endlich verläuft sich die Menge, und Theofilos kehrt nach Hause zurück, in sein Hotel, das gutes Geld einbringt und in dem er das Kommando führt. An der Rezeption jedoch wartet ein Fax auf ihn, das ihm zu einer weiteren Quelle der Unruhe wird. Die Behörden in Mitilini teilen mit, dass Athen einen Ermittler geschickt habe. Wegen des Sprengsatzes, der letzte Woche in Skala Eressos am Strand explodiert ist. Ein Bombenattentat, auch wenn es sich um ein kleines handelt, sei zu einer Frage der nationalen Sicherheit avanciert, steht in dem Schreiben.
Mitilini Stadt. Gregorios Valiakos, Sohn von Theofilos, des Bürgermeisters von Skala Eressos, erhebt sich und die Bettfedern krachen. Er tastet nach dem schwarzen Baumwollslip am Fußboden und zieht ihn sich flink, fast möchte man meinen, professionell über die Schenkel und das Gemächt. Er schiebt die Hüften vor und blickt auf seinen Körper herunter. Das verleiht ihm ein Doppelkinn. Dann fasst er auf Schwanz und Hoden, um beides zurechtzurücken. Die Hose folgt flugs. Er räuspert sich, geht zum Waschbecken, spült sich den Mund. Der Wasserhahn röchelt, und das gelbweiße Wasser schießt in unregelmäßigen Schüben hervor. Er fährt sich mit angefeuchteten Fingern über Gesicht und Kopf, dreht sich um und murmelt einige anerkennende Worte in Richtung Bett. Dann verlässt er die Wohnung und geht seinen Pflichten nach.
Auf Grund des Sprengstoffattentates in Skala Eressos hat sein Vater bei der Polizei in Mitilini Verstärkung der örtlichen Sicherheitskräfte angefordert. In den frühen Morgenstunden starten zwei Jeeps und ein Lastwagen mit insgesamt sieben Männern in Richtung Nordwesten. Gregorios ist der Leiter dieses Sonderkommandos. Ein Mann wie ein Schrank, Militärdienst bei den Natotruppen absolviert, ein Jahr in der Eliteausbildung der griechischen Ranger. Sein Haar ist zu einer Glatze geschoren, seine Augen verschwinden hinter einer schmalen, pechschwarzen Sonnenbrille, deren Rahmen sich zum Ohr hin verjüngt. So sieht es aus, als ob ihm ein Haarreifen auf die Nase gerutscht wäre. Die wulstigen Lippen und hohen Backenknochen geben seinem Gesicht etwas Sinnliches, das ihm sichtlich unangenehm ist, denn er versucht, den Mund stets fest verschlossen zu halten und so wenig wie möglich von diesem wild wuchernden Lippenfleisch zu zeigen.
Seine Sätze sind knapp. In den meisten Fällen handelt es sich um Befehle, die er, wie jetzt, in heiserem Stakkato von sich gibt, als die Lastwagen mit allerlei Rüstzeug beladen werden. Die Stimme bewegt sich auf einem einzigen, bei hoher Lautstärke markerschütternden Niveau, ebenso wie sich die Wahrnehmung und die Gedankenstränge von Gregorios auf einer einzigen unwandelbaren Bahn befinden. Gregorios ist seinem Vater hörig, dennoch ist ihr Verhältnis vom Machtbewusstsein des Jüngeren, von dessen sexualisierter Kälte, geprägt. Vieles bleibt ungesagt. Zum Beispiel, sein Zorn darüber, nach Skala Eressos berufen worden zu sein, um den Vater vor den Folgen merkwürdiger Ereignisse wie einer Explosion am Strand zu schützen. Gregorios ist schlecht gelaunt und erteilt seine Befehle brüllend, was wenig Wirkung zeitigt. Seine Untergebenen sehen die Welt gemächlicher als er.
Schon um diese frühe Zeit am Morgen ist die Luft viel zu stickig und dampfend, um sich schnell zu bewegen. Die meisten stehen bei den Verladearbeiten faul herum und ziehen nur hie und da an einem Hebel. Außerdem sind sie verstimmt, weil sie wegen dieses Einsatzes in Skala Eressos auf zwei Abende in den Discos und Nachtclubs von Mitilini verzichten müssen. Sie machen Gregorios dafür verantwortlich, obwohl er nur der Einsatzleiter ist und die Entscheidung nicht von ihm ausging.
Beim Stapeln von Metallgittern für Polizeisperren in den Laderaum des LKWs hat jemand vergessen, die Seitenverplankung zu schließen, und mit Getöse donnert die Ladung auf den Asphalt. Als der Junge, ein Zwanzigjähriger mit dem Namen Hellos, zur Seite springt, tritt er auf eine Winkelstange, die sich unversehens hebt und knapp am Hinterkopf von Gregorios vorbeischießt. Dieser macht brüllend einen Satz auf Hellos zu, packt ihn am Arm, rüttelt ihn und gibt ihm einen Stoß gegen die Schulter, so dass der Junge nach vorne stolpert, auf den Stapel fällt und mit blutender Nase und zerschundenen Handflächen wieder aufsteht. Die anderen schauen schweigend zu und hoffen, dass die Hitze Gregorios’ Wut zum Abklingen bringt.
Wenig später rollt diese Miniarmee auf Skala Eressos zu und kommt an, noch bevor das Strandleben sich wie gewohnt verschlafen aus dem Mantel der Nacht schält.
Draußen graut der Morgen. Grillen zirpen immer noch, und ein Kleinkind greint. Sandy ist früh munter, packt ein Badetuch und begibt sich an den leeren Strand. Bevor sie schwimmen geht, stellt sie sich mit ausgebreiteten Armen vor das Meer und beginnt ihre Gebete.
Gini liegt zusammengerollt unter einem Baum, auf dessen Stamm ein Schild mit „Campieren verboten“ genagelt ist. Als das Motorengeräusch von Gregorios’ Truppe näher kommt, murmelt sie etwas und verkriecht sich tiefer in ihren Schlafsack.
Livia hat das Fenster sperrangelweit geöffnet und schläft so tief, dass man sie wegtragen könnte.
Klara aber ist eben von einem Alptraum erwacht, zerrt mit bebenden Händen an der Balkontür und geht hinaus. Der Angstschweiß tropft zwischen ihren Brüsten zum Nabel hinunter. Vor ihrem Haus ein trockenes Flussbett, von Weiden und Tamarisken gesäumt, mit allerlei Gerümpel gefüllt. Zwei Wohnwagen am Ufer. Die Hitze ruht, bevor sie uns ihren stickigen Atem ins Gesicht haucht, denkt sie. Sie hasst sich dafür, dass sie von Unheil verheißenden Vorahnungen geplagt wird. Die Ereignisse am Flughafen, die Kontrollen, der Mann mit der blutigen Stirn, Ginis Ankunft in der düster flackernden Fackelallee – all das hat scheinbar einen größeren Eindruck hinterlassen, als sie dachte.
Wenige Stunden später hat die Sonne den Spuk der Nacht verscheucht. Auf der Straße zum Strand: Lesben. Am Balkon des gegenüberliegenden Hauses: Lesben. Hängen Handtücher auf, trinken Kaffee, spielen schon am Vormittag Karten. Auf der Strandterrasse des Hotels Sappho: Lesben.
Gierig verschlingt Klara sie mit den Augen. Auch Livia, die von einem inspirativen Spaziergang durch den Ort kommend bei Klara Halt macht, staunt. Ein solches lesbisches Überangebot ist ein ungewohnter Anblick. In stiller Selbstverständlichkeit trudelt ein Pärchen nach dem anderen auf der Strandterrasse ein. Die erlauchte, lärmgedämpfte Atmosphäre gehobeneren Lebensstils herrscht. Livia und Klara sitzen in hellblauen Holzsesseln, deck chairs würden manche dazu sagen, unter weißen, gewölbten Sonnensegeln. Zum Meer hin schwebt ein kreisrundes Mobile aus in Hanf verwobenen Muscheln, knapp über dem Horizont, und teilt das blaue Nichts. Daneben spielt der Wind in giftgrünen Yucca-Palmen.
Im Schutz vor der Sonne erschöpft sich die Bequemlichkeit auch schon, denn das Frühstück kommt eine Stunde nach Bestellung. Vom langen Warten und von der Hitze erdrückt, schleichen die beiden nachher wieder auf die Zimmer. Livia begleitet Klara zur Tür, will sofort wieder gehen, dann bleibt sie doch. Ihr entströmt müßiggängerischer Übermut.
Neugierig nimmt sie Klaras Habseligkeiten in die Hand. Da liegt eines der Bücher, die Klara geschrieben hat.
„Wieso nimmst du deine Bücher in die Ferien mit?“
„Hab ich mir so angewöhnt. Man weiß ja nie. Manchmal wollen die Frauen eines kaufen, wenn sie wissen, was ich beruflich mache. Es geht ja auch um Frauenliebe darin.“
Livia fängt an, in dem Buch zu blättern.
„Darf ich mir das ausleihen?“
Klara nickt verlegen. Es ist zufällig eine Geschichte, die die erste Liebe zu einer Frau beschreibt. Eine von Schmerz noch unbehelligte Geschichte überwältigender Zuneigung, wie Klara sie später nie wieder zustande gebracht hat. Dann durchforstet Livia Klaras CDs, begeistert sich spontan für die mitgebrachte Musik, hockt sich mit angezogenen Beinen gegen die Balkontür und wartet, was Klara auflegt. Sie hören Café del Mar und andere „Summer Cooler“.
„Seit wann bist du mit Frauen zusammen?“, fragt Livia.
„Noch nicht so lange, seit meinem dreißigsten Lebensjahr, ich musste erst ins Ausland fahren, um zu wissen, dass ich das will. Und du?“
„Ich habe mich mit sechzehn zum ersten Mal verliebt. Eine Schulfreundin. Wir waren ein Jahr lang ununterbrochen zusammen.“
„Was hat deine Mutter dazu gesagt?“
„Der war es lieber, ich schwänze wegen einer Frau die Schule, als dass ich Drogen nehme.“
„Wirklich? Das ist ja ungewöhnlich.“
„Die ist in Ordnung, meine Mutter. Die hat mich dabei nur unterstützt. Das Problem war die Mutter meiner Freundin. Wegen der war es auch eines Tages aus. Plötzlich hieß es, das, was wir tun, ist nicht okay.“
„Was macht deine Mutter beruflich?“
„Sie ist Heilerin“, sagt Livia, und als sie Klaras ratloses Gesicht sieht, „Energietherapeutin, wenn du so willst. Sie bringt die Energiefelder der Menschen wieder ins Gleichgewicht.“
„Aha“, sagt Klara nachdenklich. „Und das funktioniert?“
„Und ob!“, ruft Livia entrüstet aus. „Du weißt gar nicht, wie viele Krankheiten sie damit heilen kann.“
„Und dein Vater?“
Livias Gesicht verdüstert sich.
„Der ist Arzt. Chef einer Klinik. Meine Eltern haben sich scheiden lassen.“
Klara macht ein bedauerndes Gesicht.
„Ach“, ruft Livia aus, „der kann mir im Moment gestohlen bleiben mit seinem patriarchalen Geschwätz. Der denkt, er und seinesgleichen sind der Nabel der Welt.“
„Du siehst ihn also gar nicht mehr?“
„Doch. Und er liebt mich, aber glaubst du, der würde sich bemühen, irgendetwas an mir zu verstehen? Manchmal wird mir Wien zu eng, weil ich überall seine Gegenwart spüre. Dann muss ich die Stadt für kurze Zeit verlassen.“
Auf diesen Ausbruch weiß Klara nichts zu sagen. Beide schweigen. Dann erzählt sie Livia von ihrem Alptraum. Nicht gerade eine ideale Art, das Thema zu wechseln.
„Es war so, als ob ich verfolgt werden würde.“
Livia lacht auf, und ihre plötzliche Heiterkeit steckt Klara an.
„Mit einem einzigen Verfolger werden wir schon fertig“, sagt Livia. „Den kick ich nieder wie nichts.“
„Vollmundige Worte. Klingen wirklich umstürzlerisch“, lacht Klara.
Mit zwei Vergewaltigungen pro Saison ist Skala Eressos nicht frauenfeindlicher als jeder andere Ort der Welt. Wie aber kommt es überhaupt so weit? Das Interesse der Ortscasanovas hat sich wegen der lesbischen Invasion verlagert. Hat der junge Grieche vor einigen Jahren noch die willige Urlauberin in seinem Bett geohrfeigt, wenn er nicht abspritzen konnte, sie stattdessen Multiple hatte, so ist sein Ehrgeiz heute, Frauen zu vögeln, die sich nichts aus ihm machen. Da steht er ihm quasi von allein. Eine zu ihrem Glück gezwungene Lesbe zählt unter den Einheimischen mehr als die Scharen von Touristinnen, die freiwillig die Beine spreizen. Die bleiben ohnehin schon seit Jahren aus. Der Bürgermeister hat also Recht, wenn er die alten Zustände wieder herstellen und die Säfte in die richtigen Bahnen lenken will.
Ficken oder nicht ficken, diese beiden Optionen prägen auch die Geschäftskontakte zwischen Griechen und Lesben.
„You take the car or I fuck you“, sagt der Autohändler von Invar Car Rental zu Gini Sedlak, die den Wagen beanstandet, weil die unverdauten Speisereste des Vormieters noch auf den Sitzen kleben. Und dies ist nicht das erste Versprechen dieser Art, das er ausspricht.
„No, I fuck YOU!“, kontert die Sedlak, die einige Erfahrungen mit renitenten Männern gesammelt hat.
„I fuck YOU!“, wiederholt er stur.
„Fuck yourself!“, sagt sie.
Er erhebt sich wutschnaubend und kommt mit geballten Fäusten hinter seinem Schreibtisch hervor. Sie aber geht achselzuckend weg, und ihre Haltung zeigt, dass sie nicht im Mindesten annimmt, von hinten angegriffen zu werden. Gleich darauf hat sie das Erlebnis vergessen. Andere Frauen sind aber zarter besaitet, und so hängt von nun an ein Schild im Hotel Sappho, das ausdrücklich vor Invar Car Rental warnt.
Wie wird man Lesben wieder los? Diese Frage zieht sich seit Jahrzehnten durch alle Gemeinderatssitzungen in Skala Eressos, ohne viel Erfolg. Als die Lesben noch in selbst gebauten Schilfhütten am Strand wohnten, rückte der damalige Bürgermeister eines Nachts mit ein paar Jungs aus und fackelte die Stätten der Sünde einfach ab. Das hat ihm bis jetzt keiner nachgemacht, und dankbar haben ihm seine Anhänger ein Restaurant finanziert, das er immer noch führt. Heute wohnen die Frauen in Hotels, die neuerdings sogar Lesben gehören, der Fackelzug hat das Übel nur endemisch gemacht. Nicht, dass es in Skala Eressos leicht gewesen wäre, ein Frauenhotel zu bauen. Das Sappho hatte jahrelange Bauverfahren hinter sich. Andere Pensionen schlossen schon wieder, als das Hotel endlich seine Pforten öffnete und gleich darauf wegen eines unbestätigten Feueralarms unter Wasser gesetzt wurde. Auch wenn der Auslöser bloß aus der Küche kam, haben die Jungs von der Feuerwehr mit ihren Spritzen alle Zimmer inspiziert und vorsichtshalber eingenässt.
Jedes Jahr bringt auch neue, ungeahnte Schauplätze der Auseinandersetzung. Neulich das Musikverbot ab ein Uhr nachts. Betroffen sind die Bars Fuego, Mariana, die Zehnte Muse und das Sappho, alle an der Strandpromenade, alle vorwiegend von Frauen besucht. Nur die Hetero-Disco Naos an der Einfahrt von Skala Eressos hat eine Genehmigung dafür, dass sie bis vier Uhr früh den Ort bis zum Hügel hinauf beschallen darf.