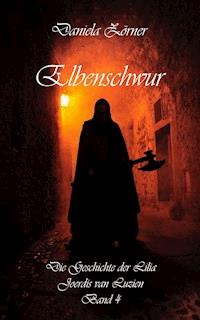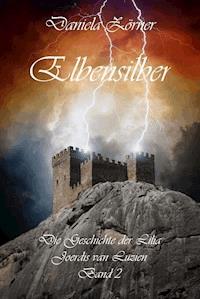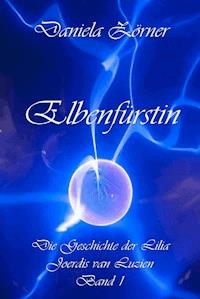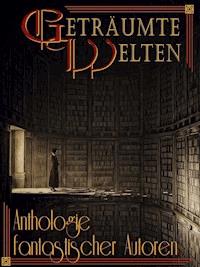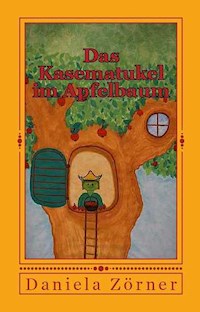Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lilia will sich nur ein paar Bücher für ihren Lesehunger besorgen. Eigentlich. Doch ihr Schicksalspfad nimmt an jenem Tag eine fatale Abzweigung. Mit geradezu Hirn verkleisternder Geschwindigkeit bricht die mysteriöse Welt von Lichtwesen über Lilia herein. Rebellisch versucht die junge Frau, sich gegen den erbarmungslosen Sog machtvoller Prophezeiungen zu stemmen. "Elben und Dämonen? Total durchgeknallt!" Dennoch, das gnadenlose Schicksal verlangt nach einer Kämpferin mit Herz, Power und Magie. Wird Lilia dieser übermenschlichen Aufgabe gewachsen sein? Das Licht stehe ihr bei!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1264
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniela Zörner
Fürstin des Lichts
Die Geschichte der Lilia Joerdis van Luzien, Gesamtausgabe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Epilog
Wunschzauberfluch
Geheimnisvolle Namen
Lilias Gedichte
Über die Autorin
Impressum neobooks
Inhalt
Daniela Zörner
Fürstin des Lichts
Die Geschichte der Lilia Joerdis van Luzien
Gesamtausgabe
Roman
Vorwort
Im Mittelpunkt meiner Urban Fantasy-Story steht das Schicksal von Lilia van Luzien, einer Halbelbe. Doch woher stammte Lilia ursprünglich? Wer waren ihre Eltern? Warum widerfuhr Lilia so spät der alles umwälzende Elbenkontakt? Seltsame Antworten darauf findet ihr am Ende des Werkes in „Wunschzauberfluch“. Viel Vergnügen!
Herzlichst
Daniela Zörner
Nur für dich werden die Buchstaben tanzen.
Elbenfürstin
Das ist mein Fenster.
Eben bin ich so sanft erwacht.
Ich dachte, ich würde schweben.
Bis wohin reicht mein Leben,
und wo beginnt die Nacht?
Rainer Maria Rilke
Kapitel 1
„Ich habe ja die Margarine vergessen!“ Darf eine Geschichte wirklich so banal beginnen? Wenn sie die reine Wahrheit erzählen soll, gibt es keine Gnade. Nochmals in die winterliche Eiseskälte hinaus zu müssen war Strafe für Schusseligkeit genug. Da drängte es sich mir geradezu auf, als kleine Belohnung einen Abstecher in Joschs Antiquariat dranzuhängen. Vielleicht wartete dort eine frische Ladung gebrauchter Bestseller, die für kleines Geld meinen ständigen Hunger nach gedruckten Schwarten stillen würden.
Der Laden lag in einer kleinen Seitenstraße, wo die Mieten günstig und Kunden rar waren. Josch glänzte, wie so oft, durch Abwesenheit, weshalb neben der abgeschlossenen Kasse eine Blechbüchse stand. Zu meiner großen Enttäuschung standen keine neuen Stöberkisten auf dem Boden. Das Suchen in den bis unter die Decke vollgestopften Regalen hatte ich längst aufgegeben. Josch behauptete zwar, die Bücher seien logisch einsortiert, aber er vertrat auch sonst sehr spezielle Ansichten. Doch in diesem Moment vor die Wahl gestellt, entweder den Rückweg durch den frostigen Berliner Winter anzutreten oder im Warmen die Regale zu durchstöbern, fiel meine Entscheidung schnell. Entschlossen pfefferte ich meine Vermummung aus Mütze, Handschuhen, Schal und Daunenjacke auf die speckig braune Ledercouch. Langsam suchend drehte ich mich um die eigene Achse, seufzte resigniert und ließ mich erst einmal auf die Couch plumpsen. Mein Blick folgte den Bücherreihen an der gegenüber liegenden Wand nach oben. Unter der vergilbten Altbaudecke flatterten dunkelgraue Spinnweben in der aufsteigenden Wärme. „Was für Bücher stehen dort oben eigentlich? Da gelangt doch niemand je hin!“
Plötzlich erschien das Bild einer alten Bibliothek mit reich verzierten, glänzenden Holzregalen vor meinen Augen. Schmale Holzleitern rollten auf unsichtbaren Schienen leise an den Regalen entlang. „Okay, hier und jetzt wenig hilfreich.“ Aber eine Leiter musste Josch dennoch irgendwo haben.
Sie stand, bekleckert mit diversen Farben, hinter dem Wandstück, das wohl irgendwann einmal von einem abgeteilten Hinterzimmer übrig geblieben war. Die Aluleiter wog zwar nicht sonderlich viel, hatte dafür aber die Größe XXL. Die unrühmliche Stelle, an der ich beinahe mit dem Hinterteil des Monstrums in ein Regal gekracht wäre, lasse ich hier lieber weg. Und natürlich wackelte die ausgeklappte Leiter auf den ausgetretenen Holzdielen, als ich vorsichtig mit dem Aufstieg begann. Argwöhnisch nahm ich zuerst mal die Spinnweben aus der Nähe unter die Lupe. Kein vielbeiniges Ekelpaket in Sicht. Dafür drehten mir uralte, muffig riechende Schinken ihre Rücken zu. Teils völlig zerfleddert, ließen sich ihre Titel kaum noch entziffern. Das reichte. Meine Vorliebe für Bücher beschränkte sich ganz klar auf solche Exemplare, deren vorheriger Gebrauch kaum auffiel.
Der Abstieg aus stickiger Höhe gestaltete sich jedoch spektakulärer als vorgesehen. Völlig darauf konzentriert, nach unten zu schauen und vor allem keine Schwingungen zu erzeugen, verhakte sich mein Wollärmel. Der unerwartete Widerstand brachte erst mich, dann die Leiter und wir gemeinsam das spillerige Bücherregal ins Wanken. Wo hätte ich mich auch sonst reflexartig festklammern sollen? Luft schnappen und Holzknarren wurden jäh von einem dumpfen Donnerschlag übertönt. Totenstille, ich wagte kaum mehr zu atmen. Immerhin keine Bücherlawine. Ächzend entwich die Luft aus meiner Lunge.
Nach einer gefühlten Ewigkeit schaute ich vorsichtig erst nach oben, wo nun in der obersten Regalreihe ein Loch klaffte. Dann hinunter auf den Dielenboden. Mein Blick haftete sofort an dem einen übergroßen Buch, das meine Odyssee unfreiwillig rabiat zutage befördert hatte. Die logische Frage, wieso aus einer vollgestopften Bücherreihe ein einzelnes Buch herausfallen konnte, kam mir nicht in den Sinn. Mit zittrigen Beinen gelang der Rückzug ohne weitere Zwischenfälle.
Ich ließ die Leiter einfach stehen und ging vor dem Buch in die Hocke. Merkwürdigerweise lag es keinesfalls wie nach einem, wahrscheinlich falsch geschätzten, vier Meter tiefen Sturz da. Vielmehr exakt so, als sei es vorsichtig abgelegt worden. Aber dieser Gedanke flatterte, weitestgehend ignoriert, in meinem Kopf davon. Denn das, was meine Augen sahen, beanspruchte vollste Aufmerksamkeit. Auf dem safranfarbenen Ledereinband lockte eine wunderschöne, zierlich geschwungene Schrift. Ganz offensichtlich in einer mir unbekannten Sprache verfasst, setzte ich mich dennoch neugierig mit dem Buch auf die Couch. Behutsam öffnete ich den Buchdeckel und blickte mit kindlicher Naschhaftigkeit auf exotisch anmutende Buchstaben, die mir ihre Geheimnisse ohnehin niemals verraten würden. Solch eine Schrift hatte ich nie zuvor gesehen und ihre Farbe schillerte, als ob sie in einem Regenbogen geschrieben wäre.
Kurzum, ich wickelte das Buch mangels Tüten in alte Zeitungen und zog mich an. Aber ich konnte Josch unmöglich bloß ein bisschen Kleingeld für dieses Prachtexemplar in die Dose stopfen. Vielleicht sollte ich eine Nachricht hinterlassen. „Auf der bitte was stehen soll? Habe ein Buch mitgenommen, Autor, Titel, Alter und Herkunft unbekannt?“, lästerte mein Alter Ego genüsslich. Nein, ich würde das Buch ganz einfach bei meinem nächsten Einkauf zurückbringen.
Zufrieden verschwand meine unsichtbare Zuschauerin, als sich die Ladentür bimmelnd hinter mir schloss. Der ausgelegte Köder war geschluckt.
Lange Zeit später fand ich im schottischen Kloster St. Ninian ein dickes Notizbuch mit dem Titel „Inghean“. Darin befanden sich Aufzeichnungen der Elbe Elin. Sie brachten hartes Licht in manche noch dunklen Ecken dieser wahrheitsgetreu zu erzählenden Geschichte.
Aus dem Buch „Inghean“
Wieviele Jahre sind nutzlos verronnen, seit ich mich zum letzten Mal diesem Menschenkind zeigte? Mir fehlt die Erinnerung. Graue Tage und schwarze Nächte vergingen, zu endloser Untätigkeit verdammt. Meine Seele schmachtet nach Rache an dem Einen. Nun jedoch wurde das Menschenkind abermals erwählt. Warum nur? Warum verschmäht die Fürstin unsere willigen Elbenseelen? Dienerin und Lehrerin zugleich werde ich jetzt sein, um den Kelch für die Ankunft meiner Fürstin zu formen. Das Licht stehe mir bei!
Das zauberhafte Buch lag auf dem Esstisch, während ich ungeduldig den sich träge erhitzenden Wasserkessel abwartete. Hier unter dem Küchenfenster fiel noch genügend trübgraues Winterlicht ein, um auf die Deckenlampe verzichten zu können. „Was hat dieses Buch nur an sich?“ Antiquitäten entzogen sich schon immer meinem Interesse. „Geheimnisvoll.“ Mir kam eine Idee und ich flitzte los zum Bücherregal im Wohnzimmer. Vielleicht fand sich im alten Lexikon eine Seite über Schriften.
Noch bevor ich den entsprechenden Band Sai - Suc aufschlagen konnte, pfiff mich der Wasserkessel zurück. Der Tee musste erst ziehen, also drehte ich mich wieder um. Das mitgebrachte Buch leuchtete! Das Lexikon geriet in Vergessenheit. Ein schmaler Lichtstrahl fiel auf die Schrift. Mein irres Glotzen dauerte exakt 2 Minuten und 40 Sekunden, bis das schrille Piepen der Tee-Uhr gnädig die entglittenen Gesichtszüge in Bewegung brachte.
Vielleicht wäre der Anfang für mich leichter geraten, wäre mein Blick diesem ersten Lichtstrahl nach draußen gefolgt. Nämlich in Erwartung einer Wolkenlücke, die der tief stehenden Wintersonne eine freundliche Chance gab. Denn da draußen gab es keine Lücke, keinen Sonnenstrahl, nur Einheitsgrau. Andererseits wäre der Anfang garantiert erheblich schlimmer missraten, hätte ich meine unsichtbare Untermieterin aus Joschs Laden zurückkehren sehen. Nachdem die Elbe Elin einst Wächterin über meine Kindheit war, startete mit dem heutigen Tag ihr Fulltimejob bei mir.
Was war zuerst da, das Summen in meinem Kopf oder das mich umhüllende Licht, als ich auf dem Küchenstuhl saß und mich über das Buch beugte? Keine Ahnung, die ersten Stunden und Tage wirken im Rückblick wie das Ergebnis eines übergeschnappten Schleudergangs in sämtlichen Gehirnwindungen.
Erfolglos drückte ich jetzt die Zeigefinger in beide Ohren. Aus der Wohnung stammte das Summen jedenfalls nicht.
„Es ist in deinem Kopf.“
„Einfach ignorieren und endlich das wundersame Werk bestaunen.“
Entschlossen richtete ich meine Aufmerksamkeit auf den Einband. Das Summen nahm zu. „Nein, kein Summen“, überlegte ich, „zumindest nicht wie ein Bienenschwarm“. Es klang eher wie ein von Windböen herbei getragenes Auf und Ab singender Frauenstimmen. Wahrscheinlich die Begleitmusik zu irgendeinem Spielfilm, die mein Gedächtnis aus welchem Grund auch immer gerade jetzt abspulte.
„Es ist real.“
„Quatsch.“
Vorsichtig klappte ich den Buchdeckel auf. Die Buchstaben tanzten vor meinen Augen, als wollten sie sich für mich neu ordnen. Ich blinzelte. Und las. Und lauschte.
„Seltsamer Traum.“ Aber warum lag ich nicht in meinem Bett und wo war ich überhaupt? Bleierne Müdigkeit blockierte vernünftige Informationen aus dem Gehirn. Die Augen ließen sich auch nur widerspenstig öffnen. „Aha.“ Der schräge Blickwinkel offenbarte, dass ich mit Kopf und Armen auf dem Küchentisch lag, folglich über dem Buch eingeschlafen sein musste. So etwas passierte mir sonst nie. „Und dieser Traum über Licht und Finsternis und ihren Kampf gegeneinander seit Anbeginn der Welt. Purer Fantasy-Stoff, darüber ließe sich glatt ein ganzes Bu…“ Ich erstarrte mitsamt meinem Gedankengang und weigerte mich, das Szenario in der Küche zur Kenntnis zu nehmen. Unmöglich, dies musste immer noch ein Traum sein. Draußen herrschte tiefe Nacht, hier drinnen brannte keine Lampe, aber um mich herum war Licht. „Der Mond, natürlich!“ Erleichtert über die simple Erklärung suchte ich den Nachthimmel ab. Kein Mond. „Ich träume, ganz einfach.Und wenn nicht?Dann drehe ich jetzt ein klein wenig durch.“
„Es ist wahr.“
Hatte ich das gedacht?
„Nein.“
„Aufwachen!“
„Du bist erwacht.“
Panik und Angst lieferten sich in Atem raubendem Tempo ein Kopf-an-Kopf-Rennen, brachten den Küchenstuhl zu Fall, ließen erst meine linke Schulter rücksichtslos gegen den Türrahmen krachen, wenige Schritte später das linke Schienbein gegen die Bettkante. Mit kindlicher Naivität sprang ich ins Bett und riss mir die Bettdecke bis über den Kopf. Dann flossen die Tränen. Erst zaghaft, bis schließlich verzweifeltes Schluchzen meinen ganzen Körper schüttelte.
Irgendwann war alles Elend dieser Welt, insbesondere das meinige, hinaus gespült und ich schlief ein. Den Strahl weißen Lichts, gekommen, um über mich zu wachen, verpasste ich.
Dröhnende Kopfschmerzen begrüßten mich am sehr späten Vormittag. „Welcher Tag ist heute?“ Wochentage, Geburtstage, Telefonnummern oder Adressen? Komplett unterhalb meiner Aufmerksamkeitsschwelle angesiedelt. Tatsächlich gehörte ich zu jenen bemitleidenswerten Kandidaten, die ihre Geheimzahlen in der Geldbörse aufbewahren mussten.
Übellaunig kletterte ich aus dem Bett, um gewohnheitsgemäß erst Tee zu kochen. Danach schlurfte ich ins Bad. Mein Spiegelbild präsentierte dick verquollene Augen. Eine saftige Ohrfeige hätte mein Erinnerungsvermögen kaum effektiver wachrütteln können. „Ganz ruhig, tief durchatmen.Ich bin keineswegs verrückt, sondern eine ganz normale Durchschnittsfrau im Durchschnittsalter mit Durchschnittsgewicht, die vorzugsweise Jeans, Baumwollpullover und bequeme Schuhe trägt.“ „Lenk jetzt nicht vom Thema ab“, protestierte mein Alter Ego. Ratlosigkeit schwappte heran. Diese träge, anspruchslose Empfindung vermittelte mir aus welchem Grund auch immer das sichere Gefühl, mit den nackten Füßen fest auf den kalten Fliesen zu stehen. Und wie lange, verdammt noch mal, wollte ich das Summen in meinem Kopf ignorieren?
„Was nun eigentlich, Summen oder Singen?“ Vorsichtig hörte ich genauer hin. Sphärisch schön, oh, aber unterirdisch schwer zu beschreiben. Das mag dieser klägliche Versuch verdeutlichen: Wie Polarleuchten über dem samtroten Sonnenuntergang der Karibik, begleitet von Kaskaden silbriger Sternschnuppen. Eine sanfte, vielschichtige, wärmende Harmonie, zugleich traurige, sehnsüchtige Frauenstimmen. Eindeutig nicht von dieser Welt. „Höre ich Worte?“ Ganz gewiss erst in dem Moment, da sich die Frage in meinem Kopf formulierte.
„Lilia, fürchte dich nicht.“
„Häh? Wieso Lilia? Wer bitte schön ist Lilia?“ Also doch Stoff aus irgendeinem Spielfilm. Obwohl „fürchte dich nicht“ mehr nach einem Psalm klang. Ja, im Analysieren war ich schon immer unschlagbar.
„Du bist Lilia, Lilia Joerdis van Luzien.“
„Nein, nein und nochmals nein!“, motzte ich mein Spiegelbild an. „Und ganz sicher werde ich niemals, ich betone, niemals wahnsinnig. Keine Fälle in der ausgestorbenen Familie bekannt. Basta!“
Fies kommentierte mein Alter Ego: „Deine Mutter war aber ziemlich wahnsinnig. Vergessen?“
„Schnauze halten im Hinterhirn!“
Die Wirkung meines Wutausbruchs glich einem zerschnittenen Band. „Gut so, Ruhe im Karton, Thema erledigt.“ Ganz bewusst richtete ich meine volle Aufmerksamkeit auf stupides Zähneputzen, Waschen und Anziehen.
Energisch betrat ich die Küche und klappte das Buch so zu, dass die Rückseite oben zu liegen kam. Schwacher Widerwille regte sich dagegen, weshalb ich genervt die aufgefüllte Teetasse ergriff und schleunigst ins Wohnzimmer verschwand. Plan A musste her, kurz und schmerzlos. „Also: Den Kopf bei einem Spaziergang zu Joschs Antiquariat gründlich durchpusten lassen, das Buch zurückgeben. Fertig.“ Samstags schloss Josch meist gegen 16 Uhr ab, mithin war noch reichlich Zeit. „Heute ist doch Samstag, oder?“ Ich ging in die Küche, um die Tasse aufzufüllen, und warf dabei einen Blick auf den Wandkalender. „Sonntag. Dann eben bloß der Spaziergang“, seufzte ich leise. Ein leichtes Unbehagen im Gefühlszentrum namens Bauch begann sich hartnäckig festzusetzen.
Frostige Kälte schlug mir ins Gesicht. Ziellos ließ ich mich durch die nahen Straßen treiben – und stand höchstens fünfzehn Minuten später wieder vor meiner Wohnungstür. Schlecht. „Ach was, mit mehr Tee, Frühstück und gutem Willen lässt sich jedes Problem lösen.“ Nüchtern betrachtet schmorte ich zu sehr im eigenen Saft und das hatte offensichtlich meine Nerven überreizt. Als ein von Natur aus eher ängstlicher, introvertierter Typ zeigte ich wenig Vorliebe für zwischenmenschliche Kontakte. Stundenlange Spaziergänge durch einsame Wälder oder entlang möglichst menschenleerer Küsten, klassische Musik und dicke Schmöker, sie entsprachen in meinen Augen grenzenlosem Freizeitglück. „Könntest du endlich mal zum Thema kommen?“, verlangte mein Alter Ego. „Das Buch?“ „Richtig.“ „Der Gesang?“ „Korrekt.“ „Das Licht?“ „Und so. Also tritt dich mal in deinen nicht mehr ganz so hübschen Hintern“, zeterte die Meckerecke vom Dienst.
Ungebeten bekam ich sphärische Unterstützung.
„Lilia, bitte hilf uns. Lies das Buch.“
Hatte ich doch schon, zumindest einen kleinen Teil davon. „Oder?“ Seltsamerweise wollte sich keine greifbare Erinnerung an den gelesenen Abschnitt einstellen. Mehr ein Gefühl von Bedrohung, Kampf und Verlust.
Mit jeder verstreichenden Minute schwoll der Sog des Buches an. Er war um ein Vielfaches stärker als jeder nervenaufreibende Thriller, bei dem man mitten im Showdown gezwungen wurde, ihn aus der Hand zu legen. Folgerichtig schaltete ich mechanisch die Esstischlampe ein und setzte mich abermals an den Küchentisch.
Auf seiner safranfarbenen Vorderseite starrten mich Hieroglyphen an. Zugegeben, augenblicklich breitete sich Enttäuschung in mir aus. Hartnäckig starrte ich zurück. Sie begannen ihren flirrenden Tanz. „Das Licht kann ohne Schatten nicht sein“ erschien vor meinen Augen. Enttäuschend unspektakulär, der Buchtitel, regelrecht banal. „Obwohl, eine alte, häufig benutzte Redewendung lautet doch: Wo Licht ist, da ist auch Schatten.“ Grübelnd griff ich nach meiner Tasse. „Wie geht noch gleich der andere Spruch?“, murmelte ich leise. „Gut und Böse liegen oft eng beieinander?“
„Lies das Buch, du wirst Antworten finden“, schmeichelten die Stimmen.
Allerdings war ich mir gar keiner gestellten Frage bewusst. Stattdessen stiftete ihr heikles Gequatsche meinen Dickschädel um Haaresbreite dazu an, ihr Buch aus dem Fenster zu pfeffern. Das schimpft sich geistige Selbstverteidigung.
„Das Licht kann ohne Schatten nicht sein“, Teil I:
Zu Anbeginn der Zeit gebar das Universum Zwillinge, das Licht und die Finsternis. Obwohl grundverschieden, verstanden die beiden einander gut. Doch als sie älter wurden, beanspruchte ein Jedes immer mehr Raum für sich. Sie drängelten und suchten, noch freundschaftlich, bis sie in die hintersten Winkel des Universums vorgedrungen waren. Derart mächtig und groß geworden, breitete sich nun Langeweile bei ihnen aus. Bald schon nahmen die Zwillinge getrennte Wege. Während das Licht mit den Sternen spielte, brütete die Finsternis übellaunig vor sich hin.
Ein Stern hatte es dem Licht besonders angetan, dort lebten Wesen in vielerlei Arten. Gerne wollte es diesen einen Stern für sich allein besitzen. So verdrängte es heimlich die Schatten der Finsternis von dort.
Grausam waren die Folgen! Das Wasser verdampfte, die Luft glühte, die Wesen litten schlimme Qualen und viele starben. Das Licht wich voller Entsetzen, Trauer und Scham zurück.
Der Finsternis war das heimliche Treiben beileibe nicht entgangen und das grausige Ergebnis verschaffte ihr große Genugtuung. Mit Macht breitete sie sich nun allein über den Stern aus.
Aber genau wie das Licht musste die Finsternis erfahren, dass der Stern unter ihrer Allmacht starb. Sie beobachtete das elendige Siechen mit unverhohlener Neugier. Endlich flehte ihr Lichtzwilling, dem Leid gemeinsam ein Ende zu bereiten. Die Finsternis gab nach.
Nun aber herrschte Misstrauen zwischen den Zwillingen, weshalb die Finsternis den kalten Mond um ewige Wacht bat. Das Licht hingegen wählte die wärmende Sonne mit ihren goldenen Strahlen.
Zwar gab sich die Finsternis fortan versöhnlich, schmiedete jedoch insgeheim Pläne. Es dürstete sie nach Vergeltung. Der Menschenseelen auf dem Stern wollte sich die Finsternis bemächtigen, jener einzigen Wesen, die ihr mit großer Furcht begegneten.
Obwohl das Licht dieses schreckliche Geheimnis gewahrte, zögerte es lange. Hatten doch die menschlichen Geschöpfe zuerst das Licht fürchten gelernt. Grausam wurden die Menschen in den brutalen Bann der Finsternis gezogen. Sie hetzten sich gegeneinander auf und führten Kriege. Denn Neid und Missgunst, Hass und Selbstsucht, Wut und Mordgelüste vergifteten ihre Herzen.
Da das Licht aus falscher Scham nichts dagegen unternahm, sprachen andere Sterne bekümmert zu ihm: „Wir wollen dir Sternelben geben, sie sollen die Menschen mit neuer Hoffnung und Freude erfüllen.“
„Bloß ein Märchen, unzählige Male in hundert verschiedenen Varianten erzählt. Was für eine Enttäuschung.“ Ich gähnte herzhaft.
„Lilia, das ist kein Märchen.“
„Na ja, Gut und Böse existieren natürlich wirklich. Und weil sich Menschen nun mal vor der Dunkelheit fürchten, verkörpert sie immer das Böse, logisch.“
„Sekunde mal“, stutzte ich. „Kleine Denkpause einlegen. Also dieser Chor in meinem Kopf, soll ich mich mit dem ernsthaft unterhalten? Ich könnte versuchen ihn auszutricksen, quasi den OFF-Knopf suchen.“ So wie ich manchmal gerne eine Fernbedienung für die nervende Dudelei in diversen Geschäften hätte.Oder sollte ich vielleicht mal im Lexikon unter dem Stichwort „Schizophrenie“ nachlesen? „Übertreib nicht.“ Dann also die hohe Schule der Konversation? Umgehend brach ein kämpferischer Schlagabtausch zwischen Kopf und Bauch los, den mein Hirn knapp für sich entschied. Tiefem Luft holen folgte ein trotzig gedachtes „Hallo“.
„Wir grüßen dich, Lilia.“
Unsortiert sprudelte ich los: „Warum nennt ihr mich Lilia und wer seid ihr und was wollt ihr in meinem Kopf und was hat es überhaupt mit dem Buch auf sich und das Licht habe ich das geträumt und – okay, so wohl eher nicht. Tschuldigung.“
„Keine Ursache.“
Aber anstatt noch einmal in Ruhe von vorne zu beginnen, führte die nervöse Zappeligkeit meines Denkorgans zu der restlos durchgeknallten Frage: „Könntet ihr etwas für mich tun?“
„Was immer du möchtest.“
„Schön, reich, gesund und berühmt sein! Nein, das Berühmtsein wieder streichen“, platzte es einfach dümmlich aus mir heraus. Purer, entlarvender Egoismus. Kein Weltfriede? Ende der Hungersnöte? Glück für jedermann auf Erden? Gedacht war gedacht, außerdem musste die ganze Geschichte möglichst schnell für mich überprüfbar sein. Schließlich pendelte mein Verstand ultimativ zwischen Klapse und Delirium. Diese ziemlich dürftige Rechtfertigung versetzte meinem Selbstwertgefühl einen deutlichen Knacks. Auf jeden Fall aber müsste sich schnellstens, wie ich hoffte, die Stunde der Wahrheit nähern. Nämlich der große Showdown mit dem Off-Knopf. Himmel, war ich damals naiv!
Montag, 7 Uhr. Dachte ich. Gähnend schleifte ich mich durch das morgenmuffelige Pflichtprogramm von der Küche ins Bad. Gut für die Nachbarn, dass der gellende Schrei von meiner eigenen Kehle erwürgt wurde. Auslöser: mein Spiegelbild – oder wessen? Zu Tode erschreckt wagte ich dennoch einen Blick hinter mich. Da stand niemand. Immerhin, ich fiel nicht in Ohnmacht. Was hätte das auch genützt? Aber mein Gehirn ratterte los wie ein PC beim Virencheck. „Schlafe ich? Träume ich? Spinne ich?“
„Guten Morgen, Lilia.“
„Bin, bin ich das?"
„Gefällt es dir?“
„Oh, äh, na ja, also ...“ Stammeln, mal ganz was Neues.
„Wir haben dir sämtliche Wünsche erfüllt.“
Dann wussten sie mehr über mich als ich selbst. Zeit für eine Bestandsaufnahme. „Na los, guck hin, ist doch sowieso nur ein Traum.“ Tiefblaue Augen, in denen sich eine Kakophonie widersprüchlicher Empfindungen spiegelte, blickten mir aus einem jungen, irgendwie zeitlosen Gesicht entgegen. Das engelhafte Mädel mochte höchstens 20 Jahre alt sein. Goldenes, gelocktes Haar fiel über schmale Schultern. Und da hatte ich geglaubt, ein Look à la Barbie wäre out. „Was, bitteschön, spricht denn gegen meine haselnussbraunen Haare?“ Trotzdem zog ich meinen Pyjama aus und schaute erwartungsvoll an mir hinunter. Um es klar zu betonen, in Erwartung meines eigenen Körpers. Will sagen, nicht mehr ganz straff, ein wenig Hüftgold, mit Muttermalen, Narben und sonstigen Spuren auf der Haut, die das echte Leben mit sich brachte. Stattdessen: Makellose, samtweiche Haut, eine traumhafte Taille, und … genug, Neid zu provozieren lag mir schon immer fern. Da huschte ein klitzekleiner, abscheulicher Gedanke heran. „Im Märchen hätte der Spiegel jetzt doch sagen müssen: Du bist die Schönste im ganzen Land.“ Augenblicklich stieg mir Schamesröte ins Gesicht. „Dies ist kein Märchen und du tätest gut daran, wieder kalte Fliesen unter deine süßen Füßchen zu bekommen“, appellierte ich streng an meine Moral. „Süße Füßchen? Geht’s noch?“, echote mein Alter Ego.
Die nüchterne Realität holte mich eine Minute später wieder ein, nur völlig anders als gedacht. Slip, T-Shirt, Hose, Pullover, alles schlabberte und rutschte an „mir“ herum. Die erste Tasse extra starker Tee war eindeutig überfällig.
Tränen tropften in die Teetasse, während zu viele Gedanken und unzählige Fragen durch meinen Kopf schossen. „Das ergibt alles keinen Sinn. Wie da wieder rauskommen? Alltag, geh einfach zum Alltag über. Konzentriere dich auf diejenigen Dinge, die normalerweise montags um 7.30 Uhr anstehen.“
„Lilia, heute ist Samstag.“
„Nein!“, bockte ich. Heute musste ganz eindeutig Montag sein.
„Du hast lange geschlafen.“
„Ich gehe jetzt zum Bäcker, wie immer montags.“
Drückte dieser Summsingsang etwa Stimmungen oder Gefühle aus? „Später – wenn überhaupt. Ab zum Bäcker, nein, erst einen passenden Gürtel für die Hose finden.“ Angesichts des plötzlichen Bekleidungsnotstands, aber vor allem, weil ich fest auf einen reinigenden Kälteschock für meinen Gedankenkorks setzte, zeigte ich ausnahmsweise Dankbarkeit für den frostigen Wintertag. Vermummung als bekleidungstechnische Notwehr, sozusagen.
Aus dem Buch „Inghean“
Meine Sternschwestern gaben dem Menschenkind wahrhaftig das Antlitz unserer Fürstin. Welch peinigender Schmerz.
Die Verkäuferin lächelte mich an. „Guten Morgen. Was darf es Schönes für Sie sein?“
Kaum zu glauben! Dieselbe olle, mürrische Verkäuferin, die niemals meinen Gruß erwiderte, nie die Zähne so weit auseinander bekam, um nach den Kundenwünschen zu fragen, und schon gar niemals ein „Tschüs“ über ihre harten Lippen brachte? Die konnte lächeln und sprechen? Im Augenwinkel registrierte ich den beunruhigenden Umstand, dass alle Leute in der Bäckerei mich lächelnd anschauten. „Oh nein, schneller Selbstcheck. Schlafanzug noch an? Nein. Puschen? Auch nicht. Zahncreme oder Seifenreste im Gesicht? Alles o.k. Meine Haare nicht gekämmt? Unsinn, wir sind hier in Berlin.“
Die Verkäuferin lächelte mich noch immer erwartungsvoll an.
„Reiß dich zusammen.“ Ich schluckte schwer, kratzte den letzten Krümel an Fassung zusammen. „Ein, nein, zwei Schoko-Croissants“, echte Nervennahrung musste her, „und zwei Sonnenblumenbrötchen, bitte“.
Selten hatte ich solchen Drang, um aus dem Laden zu stürmen und noch auf dem Gehweg das erste Croissant in mich hineinzustopfen.
Damit begann die Turbolektion, wie mittels elbischer Magie aus einer unauffälligen Raupenfrau in Nullkommanix ein neues Wesen hervorschlüpfte. Es rührte die Herzen der Menschen und weckte ihr Urvertrauen. Schwarze Seelen ausgenommen, versteht sich.
Die Redewendung „zittern wie Espenlaub“ passte perfekt, galt nur leider keineswegs dem Frost. Inzwischen saß ich am Küchentisch und beträufelte das zweite Croissant mit Salztropfen. „Alltägliches tun, erinnere dich an deinen Vorsatz. Mach weiter. Reiß dich zusammen.“„Das krönende Motto des Tages?“, spottete mein Alter Ego dazwischen. „Du gehst jetzt ins Einkaufcenter und kaufst passende Klamotten.“ „In welchen Größen?“, lästerte es genüsslich. Besser hätte ich mir von den Stimmen zuallererst eine gehörige Portion mehr Mut gewünscht. Zu spät, ab sofort zahlte ich Lehrgeld.
Volle drei Runden stapfte ich gesenkten Hauptes um den ausladenden Gebäudekomplex herum, in dem sich das Einkaufscenter befand. Zuletzt fühlte ich mich wie eine tiefgekühlte Flunder an. „Schluss damit, bring die Sache hinter dich.“ Durch die Drehtür begleitete mich die panische Vorstellung, als Schlafwandlerin mitten im Shoppingrummel aufzuwachen.
Kein Traum konnte so lange andauern, da war ich mir völlig, beinahe, ungefähr sicher. Umgezogen in Größe 34 Outfit hockte ich auf der Couch. Da kam ich auf die alberne Idee, sicherheitshalber in meinen Arm zu kneifen. „Tut weh. Gut.“ „Noch mehr solcher, oder eher besserer Ideen auf Lager?“, fragte das Alter Ego süffisant. Der Alltagstest hatte sich jedenfalls als grandioser Flopp erwiesen. „Aber das Summen ist fort!“ Wenn ich es recht bedachte, schon seit geraumer Zeit. „Besser.“ „Sicher? Da wären noch etliche Fragen offen.“ „Oh nein, bitte nicht.“ „Komm schon, gib zu, dass du ein klitzekleines bisschen neugierig bist.“ „Wie wäre es stattdessen mit etwas geistlos Praktischem, beispielsweise samstäglichem Putzen, Bügeln, Staubsaugen?“ „Du kneifst!“ „Und du nervst!“
Der interne Zoff endete mit dem Kompromiss, weiter in dem magischen Buch zu lesen. Es spukte ohnehin pausenlos im meinem Hinterkopf herum. Und angeblich war ja schon wieder Wochenende!
So einfach ging ich dem Zauber dieser märchenhaften Geschichte auf den Leim. Die Sternelben wussten ganz genau: Mindestens meine halbe Welt, und zwar die wichtigere Hälfte, bestand von Kindesbeinen an aus Fantasie.
„Das Licht kann ohne Schatten nicht sein“, Teil II:
Die Sternelben trugen das Licht zurück in viele Menschenseelen. So gewahrten die Erdbewohner den Unterschied zwischen Gut und Böse. Doch manche Seele blieb schwarz, manche beherbergte sowohl Licht als auch Schatten, andere wiederum waren von reinem Leuchten erfüllt. Den Sternelben aber gefiel es unter Menschen, Tieren und Pflanzen. Besonders die Blumen hatten es ihnen angetan. So verweilten etliche auf der Erde.
Zwischen den Zwillingen herrschte abermals das alte Gleichgewicht. Indes, die Finsternis gab keinen Frieden, sie missbilligte die Sternelben, fühlte sich, obwohl zu Unrecht, neuerlich hintergangen. Da flüsterte ihr der Mond zu, er könne Geschöpfe nach ihrem Geschmack erschaffen und unter die Menschen geleiten.
Bald schon krochen nachts üble Schattenwesen umher. Die meisten Menschen flohen voller Entsetzen vor ihnen und nannten sie fortan Dämonen. Die grausamen Geschöpfe der Nacht lechzten auch nach den Sternelben, konnten jedoch im Licht der Sonne nicht bestehen. Nacht für Nacht flüchteten die Sternelben vor den Dämonen in die hell erleuchteten Häuser guter Menschen. Und bedankten sich mit vielerlei Diensten für den sicheren Unterschlupf.
Die Finsternis grollte über das Versagen ihrer Diener und brütete einen neuen Plan aus. Dann befahl sie dem Dämonfürsten, das elbische Sternsilber zu stehlen. So kam es zum Krieg zwischen Sternelben und Dämonen. Mit magischen Blitzen und Feuern bekämpften sie einander im Zwielicht jahrelang. Unzählige kamen um, bevor der listige Diebstahl des machtvollen Elbenschatzes gelang. Ohne das Sternsilber jedoch waren die letzten Sternelben für alle Zeit an die Erde gebunden.
Auch bei den Menschen zeigte der Krieg schlimme Folgen. Viele erblindeten von den Blitzen oder verloren Hab und Gut durch die Feuer. So erkannten sie die unirdische Macht der Sternelben und fürchteten auch sie. Darüber herrschte große Trauer unter den Sternengeschöpfen. Schließlich verhüllten sie sich als unsichtbare Lichtgestalten. Seither wachen sie im Verborgenen über die Erde.
Ohne groß nachzudenken formulierte sich eine Frage in meinem Kopf. „Muss es nicht Dämonen und Engel heißen?“
„Du sprichst wahr, so wurden die Elben später von den Menschen genannt. Weißt du um das Wirken der Mönche in früher Zeit?“
„Ja, die Schriftkundigen unter ihnen stellten Kopien her, so blieb das Wissen über die Jahrhunderte erhalten.“
„Richtig. Doch nach den großen Kriegen existierte nur mehr eine einzige alte Abschrift über die Geschichte der Elben. Als in späterer Zeit davon eine Übersetzung angefertigt werden sollte, entzifferte der Mönch äußerst mühsam die kaum mehr lesbaren Schriftzeichen. Aus Elben machte er Engel und noch manch anderen Fehler. Bald darauf zerfiel die alte Schriftrolle zu Staub.“
„Tja, wenn banale kleine Dinge die Welt verändern. Und die Flügel?“
„Was meinst du, Lilia?“
„Hatten die Engel-Elben wirklich Flügel?“
„Nein, sie haben keine.“
Richtig, hätte ich an dieser Stelle ordentlich hingehört, dann wäre postwendend die Frage fällig gewesen: Wieso haben?
Von Natur aus mit genügend Intelligenz und einigem Geschick ausgestattet, nützten mir diese Fähigkeiten im Alltagsgeschäft herzlich wenig. Insbesondere beim Kontakt mit Fremden ging grundsätzlich jede Menge schief. Logisches Denken verabschiedete sich ebenso wie konzentriertes Zuhören oder eine sichere Hand. Umkippende Gläser, das Stammeln halber Sätze und darüber vergessend, was ich wollte, kein einziges Manko wurde im Laufe meines Erwachsenenlebens besser. Es machte mich menschenscheu. Manches Mal wünschte ich, anders geraten zu sein.
„Wir kennen deine Schwächen und wir kennen deine Stärken.“
„Meine einzige Stärke ist die Fähigkeit, komplett in einem Buch zu versinken“, seufzte ich.
„Wie möchtest du sein, Lilia?“, fragten sie ganz beiläufig. Eine rein rhetorische Frage, denn sie wussten präzise, wie sie mich haben wollten.
„Ein gutes Herz …“
„Du hast ein gutes Herz.“
„und ein liebenswertes Wesen sein …“
„Das bist du.“
Prompt keimten Zweifel in mir auf. Und die Frage, wie ich sein wollte, entpuppte sich bei genauerer Betrachtung als ziemlich schwierig. Beispielsweise wusste ich viel, zu viel, über Menschen, die mir begegneten. Ihre Gesichter präsentierten sich mir als offene Bücher ihrer Emotionen, ihres Charakters und so mancher Gedanken. Zwangsläufig empfand ich es als schlimme Belastung, ständig solch Übermaß an ungebetenen Einblicken aufzunehmen. Eine halbe Stunde in der vollen S-Bahn konnte mir ernsthaft den gesamten Tag versauen.
Nach reiflichem Nachdenken gab ich mich kopfschüttelnd geschlagen. „Ich bin nun mal ich!“ Plötzlich schoss durch meinen Kopf die alles entscheidende, hartnäckig abgeblockte Frage: „Was wollen sie von mir?“ Seltsamerweise überfiel mich bleierne Müdigkeit. „Morgen reicht ja wohl auch noch dafür.“
Weit nach Mitternacht wankte ich ins Schlafzimmer.
„Lilia, lass die Vorhänge offen, damit wir wachen können.“
„Wieso wachen?“ Langsam entwickelte ich mich zur Quizkönigin der unbeantworteten Fragen.
Ein herrlicher Tag! Dick eingepackt genoss ich die Sonne bei einem ausgiebigen Spaziergang an der Spree. Träge trieben Eisschollen den Fluss hinunter. Nachdenklich ließ ich die Ereignisse der letzten Tage en detail Revue passieren. Mein Gehirn hatte die körperliche Verwandlung, ehrlich betrachtet, weder verdaut noch akzeptiert. Vor dem Badspiegel wütete regelmäßig das Ignorantentum. „Verfluchte Wünsche!“ Verdrossen stürzte ich mich auf das Auge des Wirbelsturms, die unheimlichen „internen“ Gesänge. „Nein, ach nein, der Brocken ist eindeutig zu groß.“ Mit fest umklammerter Gedankenbremse blockte ich den Angriff des riesigen Fragengeschwaders ab. „Plan B, bitte.“ Vielleicht ließen sich nachher im Internet ein paar hilfreiche Informationen über Elben recherchieren. Prompt motzte mein Alter Ego: „Sicher doch, immer hübsch vom Thema ablenken.“ „Gar nicht wahr, in Geschichte bin ich schon immer eine Niete gewesen. Und über Elben sollte ich besser mehr in Erfahrung bringen.“ „Na gut, gewonnen – vorerst.“
Endlich bemerkte ich es. „Wieso ist es dermaßen still in meinem Kopf?“ Anscheinend hörte ich die Geistgäste ausschließlich in meiner Wohnung. Hieß das etwa, wenn ich das magische Buch beseitigte, würde ich in meinem alten Leben aufwachen? Wollte ich das? Kläglich leise Ja-Rufe scheiterten gnadenlos am Nein-Orchester aus der Neugierzone.
Zurück daheim, suchte ich Literatur über Elben. Neben zahllosen, erwartbaren Treffern bei Sagen, Märchen und Fantasy existierten kaum Einträge zu wissenschaftlichen Abhandlungen.
Die wenigen Sachbücher wollte ich gerade bestellen, als sie Einspruch erhoben.
„Dort wirst du keine Weisheiten finden.“
„Was erwartet ihr von mir?“ Das hatte ich in diesem Augenblick doch ganz bestimmt nicht wirklich gefragt, oder? Und ob!
Ihr sprachloses Singen klang beinahe schüchtern. Ich wartete. Die Zeit schlich laut meinem Bauchgefühl in Zeitlupe dahin, während mein realer Magen unbekümmert Übelkeit produzierte.
„Lilia, deine Urmutter war eine Elbenfrau“, stimmten sie ihren Gesang an.
„Aber meine Mutter war eine Drachenhexe“, warf ich ohne Nachdenken dazwischen.
„Wohl wahr! Sie tat berechnend Böses, um dich zu verderben.“
„Ja, sie brachte mir nichts als Neid, Kälte und Hass entgegen.“ Alte, tief vergrabene Wunden platzten in mir auf. Krampfhaft klammerte ich mich gedanklich an die dubiose Elbenfrau im Stammbaum. Kein Stück einfacher.
„Möchtest du mehr erfahren?“
„Mach schon, gib dir einen Ruck. Ja!“
„Kennst du die Kirche Santa Christiana in der Krongasse?“
„Äh, nein. Wieso?“ Meine Verwirrung war komplett.
„Bitte begib dich dorthin.“
Kapitel 2
Mit Hilfe eines zerfledderten Stadtplans, S-Bahn und Bus gelangte ich fast bis vor die Tür von Santa Christiana. Vielleicht sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass ich zwar eine Niete in Geschichte war, dennoch alte Gemäuer innig liebte. Ganz einfach, weil Schlösser, Speicher, Wohnhäuser, Kirchen oder andere erhaltene Bauwerke mit etwas Fantasie greifbare Geschichten erzählten.
Santa Christiana lag, teils umrahmt von hohen Pappeln, etwas zurückversetzt. Davor befanden sich Parkplätze, nebenan das Pfarrhaus. Zwar erwartete ich keinen Dom, aber auch keine fast winzige, spätgotische Kirche mit schlichten Glasfenstern. „Wie alt mag sie sein, vierzehntes Jahrhundert?“
Entschlossen ging ich zur Eingangstür und drückte die Klinke herunter. „Offen, prima.“ Dämmriges Licht herrschte im Innern. Meine Augen brauchten einen Moment, bis sich links der Kirchenraum und rechts der Altarraum herausschälten. Die Orgel vermittelte bei meinem Rundgang einen ziemlich mitgenommenen Eindruck, wie überhaupt die gesamte Einrichtung. Abgewetzte Bänke, verstaubte Holzskulpturen und rissige Gemälde boten ein Bild der Verwahrlosung.
„Was jetzt? Hallo, ich bin da!“ Wenn das jetzt nicht völlig durchgeknallt war, was dann?
Durch das Fenster, welches der linken Hälfte des Altarraums etwas Tageslicht spendete, fiel ein Sonnenstrahl hinein. „Nein“, meldete sich mein Verstand, „unmöglich um diese Uhrzeit“. Behutsam trat ich näher. Das Licht fiel in einem Kegel genau auf jene zwei Stufen, die den Altar umgaben.
„Lilia!“
Heftig erschrocken fuhr ich zusammen. Warum erschallten sie plötzlich in dröhnendem Dolby Surround?
„Weil dies ein uralter, heiliger Ort ist, wie ihr Menschen es nennt. Bitte setz dich.“
„In das Licht?“
„Bitte.“
Wäre es um einen stockdunklen Flecken gegangen, hätte ich mich glatt geweigert. So aber setzte ich mich mutig auf die oberste Stufe. Sehr grelles, weißes Leuchten. Meine Augen bereits zugekniffen, spürte ich sogleich ein leichtes Kribbeln auf meiner Haut.
„Seid ihr Heilige?“, fragte ich mangels gescheiter Ideen, obwohl ich deren Existenz stark anzweifelte.
„Wir sind Sternelben, die Gesandten des Lichts.“
Normalerweise würde jedes Gehirn diese Information unverdaut wieder ausspucken. Wohl infolge der bisherigen Erlebnisse verweigerten meine grauen Zellen keineswegs die Annahme ihrer ungeheuerlichen Behauptung.
„Du machst Fortschritte, Lilia.“
„Warum nennt ihr mich so?“
„Lilie und Elischeba, äußere Schönheit und innere Vollkommenheit, spiegeln sich in deinem Namen.“
„Schönheit und Vollkommenheit – ich? Absurd!“
Die Sängerinnen gingen über meinen Einwurf hinweg. „So wurde es prophezeit: Das Böse gebiert ein Lichtkind. Dieses Kind wird erwachen, bevor die Finsternis abermals alle Menschen verschlingt.“
„Aber woher wollt ihr wissen, dass ich damit gemeint bin? Außerdem heiße ich doch ganz anders“, beharrte ich hilflos.
Sie antworteten mit schwellendem Gesang: „Nur, weil sich deine Mutter dem Licht verweigerte!“
„Lasst sie verdammt nochmal aus dem Spiel! Niemand hat das Recht, meine Vergangenheit aufzuwühlen! Niemand!“, brüllte ich, dass es im Kirchenraum widerhallte. Darüber heftig erschrocken, kauerte ich mich zusammen und hielt den Atem an.
Meine Giftmischerin von Mutter war auf dem Höhepunkt ihrer höllischen Karriere aufgeflogen und der Polizei umstandslos durch Selbstmord entwischt. Diese einmalige Chance hatte ich, obwohl noch minderjährig, genutzt, um spurlos in Berlin unterzutauchen.
Die Ignorantin in mir, immer den drohenden Wahnsinn im Visier, siegte nach langen Minuten des Schweigens. Keinerlei Nachfragen an die Stimmen zu Prophezeiung und Finsternis. Stattdessen abrupter Themenwechsel, alles auf Anfang. „Diese Kirche, warum ist sie wichtig für euch?“
„An diesem Ort opfern und verehren Menschen seit Urzeiten. Es begann mit einer Kultstätte für die Sonne, später folgten Tempel für verschiedene Gottheiten. Schließlich eroberte das Christentum den Platz. Selbst diese Kirche ist nicht die erste, an ihrer Stelle stand vormals eine Kapelle. Nur hier währt schwach der reine Urglauben an das Gute, genährt von unzähligen Menschengenerationen über Jahrtausende hindurch. Deshalb können wir dir nah sein.“
Amüsiert registrierte ich erstmals den sprachlichen Mischmasch aus teils antiquierten, teils modernen Wörtern.
„Wir lernen genauso wie du.“
„Was soll ich lernen?“
„Zunächst einmal müssen sich deine Eigenschaften und Fähigkeiten voll entfalten, bevor du lernst, sie zu gebrauchen.“
Obschon keinen Plan, wovon genau sie da summten, entgegnete ich lapidar: „Das ist alles?“
„Unterschätze die Aufgabe nicht.“
„Ich habe so viele Fragen!“
„Genug für heute, Lilia. Du musst dich sputen, die Dunkelheit naht.“
„Och, die Nacht macht mir keine Angst.“
Komisch, sie summten wirr.
Den Heimweg verbrachte ich traumduselig, bis mein Alter Ego loslegte: „Aber klar doch, typisches Erzählmuster von Fantasystories. Irgendwann taucht irgendwo ein unscheinbares Persönchen auf, in dem sich aus unerfindlichen Gründen ein mysteriöses Erbe verbirgt. Tse! Könntest du dir eventuell mal ins Gedächtnis rufen, dass außerhalb von Büchern eine stinknormale Realität existiert?!“
Der Besuch in Santa Christiana hatte selbstverständlich von Anfang an einen tieferen Sinn für die Sternelben gehabt. Nebenbei versuchten sie, meinen Charakter insgeheim nach ihren Plänen zu formen. Dass solche Veränderungen durchaus unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringen könnten, ging ihnen erst reichlich spät auf.
Tatsächlich Montag. Der Wecker piepte unerbittlich. „Ich muss arbeiten“, war der erste Gedanke.
„Guten Morgen, Lilia. Du wirst nie mehr arbeiten“, säuselten die Sternelben.
„Aber … Wieso das?“
„Nach deinem Tee mehr.“ Das klang fast wie amüsiertes Lachen.
So rasch der Morgenmuffel in mir es erlaubte, brachte ich Tee kochen und Badbesuch über die Bühne. Noch knurrig nach der Barbiepflege, setzte ich mich an den Küchentisch.
„Bitte geh an deinen Schreibtisch.“
„Okay.“ Vorsichtig die Tasse balancierend, durchquerte ich das Wohnzimmer und blieb vor dem Schreibtisch stehen.
„Schau dir deine Papiere an.“
Die Kontoauszüge hatte ich bei meinem Horrortrip ins Einkaufscenter noch gezogen, wie immer unbesehen eingesteckt und hier mitsamt den Kassenzetteln hingeworfen. „Was soll das werden?“ Hektisch wühlte ich im Durcheinander.
„Fünf Millionen Euro! Aber, woher?“
„Ein Präsent für dich.“
„Natürlich, ein Wunsch lautete ja, reich zu sein“, erinnerte ich mich unbehaglich. Solch eine aberwitzige Summe schien mir nun das nächste fiese Lehrgeld für Unbedachtheit. „Was soll ich denn mit so viel Geld?“
Auf Sparsamkeit war ich von Kindesbeinen an gedrillt worden. Nie überzog ich das Konto, die luxuriösen Auslagen der Geschäfte ließen mich kalt. Einzige Ausnahme, wie schon erwähnt: gedruckte Bücher. Das Regal im Wohnzimmer nahm eine komplette Wand ein und platzte, wie man so schön sagt, aus allen Nähten. Egal ob Küche, Flur oder Schlafzimmer, überall standen kleinere, volle Regale, dienten selbst Kommoden als Ablageflächen.
„Wir möchten, dass du ein Haus erwirbst.“
Ungläubig stierte ich weiter auf das Papier, dann endlich fiel der nächste Hammer in mein Blickfeld. Kontoinhaberin war Lilia Joerdis van Luzien. „Was habt ihr getan?“, schrie ich in Gedanken. Doch ohne ihre Antwort abzuwarten, schwante mir Ungeheuerliches. „Wo steckt meine Geldbörse?“ Sie lag genau vor meiner Nase. Von dem herausgezogenen Personalausweis guckte mir mein neues Ich entgegen, neuer Name, neues Geburtsdatum.
Feierlich schmetterten sie: „Joerdis van Luzien bedeutet ‚Schwert der Göttin des Lichts‘.“
Mir schwindelte und doch blieb der innere Aufruhr mäßig.
Elin, meine so unbekannte wie unsichtbare Untermieterin, hatte ganze Arbeit geleistet.
Die cleveren Lichtwesen ließen mich das Ganze erst einmal in Ruhe verdauen.
Während sich die Teekanne langsam leerte, dachte ich irgendwann auch über ein Haus nach. Das wollte mir keinesfalls in den Kopf. „Was soll ich allein damit?“
„Dort wirst du Ruhe finden und es ist sicherer.“
„Aber die Gegend hier ist ruhig und sicher. Gerade deswegen entschied ich mich vor einigen Jahren für diese Wohnung.“
„Möchtest du keinen schönen Garten?“
Oh, jetzt packten sie mich beim Schlafittchen, davon träumte ich in der Tat in manchem Sommer.
„Heute findet die Besichtigung statt. Es handelt sich um ein Gartenhaus in der Rosenallee.“
„So schnell schon?“, sendete ich ebenso verzagt wie überrumpelt.
Punkt 14 Uhr klingelte ich an dem herrschaftlichen Vorderhaus. Ein schmucklos klotziges, lang gezogenes Gebäude aus der vorigen Jahrhundertwende, mit schmutzig weißem Anstrich. Offensichtlich war dem Haus jede Liebe zum schmückenden Detail verweigert worden.
„Ihnen scheint mein Haus zu missfallen.“ Der Mann, der nun die Haustür öffnete, hatte mich bereits beobachtet.
„Guten Morgen, ja, Sie haben recht“, gab ich ebenso direkt zurück. „Ich interessiere mich für das Gartenhaus.“ Und hoffte inständig, der auf Anhieb unsympathische Kerl und das Gartenhaus würden mich möglichst flott mit ihrer Schokoseite überraschen.
So unverhohlen skeptisch wie der Eigentümer mich von oben bis unten musterte, standen zumindest in seinem Fall die Chancen dafür schlecht. „Es steht zum Verkauf“, sprach er betont deutlich aus, „für zweieinhalb Millionen“.
Mit einem Kostüm von Chanel statt Jeans und Steppjacke sowie einem hinter mir geparkten BMW, so dämmerte es mir, stünden meine Karten jetzt besser.
Ich lächelte süßlich. „Möchten Sie die Summe in bar, falls mir das Haus zusagt?“
Ah, die Sprache verstand er, ein Grinsen zuckte über sein hartes Gesicht. „Ich hole die Schlüssel.“
Der Knilch bat mich trotz klirrender Kälte nicht hinein. „Idiot!“
Wir gingen einen Kiesweg hinunter, rechts und links mit Buchsbäumchen bepflanzt. Auf der linken Seite erstreckte sich hinter dem Haupthaus ein verschneiter Park. Alte Eichen, Buchen und Nadelbäume reckten ihre Äste weit in den Himmel, dazwischen blitzte eine Eisfläche auf.
„Der Park ist von etwaigen Sommerpartys strikt ausgenommen, das wird im Kaufvertrag festgehalten.“
„Was für ein Fiesling.“ Unser Weg schwenkte leicht nach links und gab den Blick frei auf einen herrlichen Brunnen. „Und was für ein Haus!“ Die Fassade im warmen Ockergelb gestrichen, mit großzügigen weißen Sprossenfenstern, zwei Säulen umrahmten den Hauseingang.
Der Eigentümer schritt die Stufen empor und öffnete neben der doppelflügeligen, weißen Holztür ein eingelassenes Metallkästchen.
„Ich habe das Haus mit dem modernsten Sicherheitssystem ausrüsten lassen. Nur mit der richtigen Zahlenkombination und dem dazu passenden Schlüssel gelangt man hinein.“
Da er dies mit sichtlichem Stolz verkündete, rang ich mir ein „sehr schön“ ab. Heftig fieberte ich nun dem Inneren entgegen.
Die Eingangshalle war beinahe rund, durchbrochen von einer Freitreppe.
„Früher logierten hier die Gäste unserer Familie.“
Zuerst ließ er mich das Gäste-WC besichtigen, dann die traumhaft geräumige Küche. Der Clou war ein nachträglich daran angebauter Wintergarten.
„Mit Fußbodenheizung, wie übrigens im ganzen Haus.“
Im Wohnzimmer, „selbstverständlich mit Kamin“, reichten die Fenster auf der Terrassenseite fast von der Decke bis zum Boden. Ein heller, riesiger Raum mit üppig hohen Stuckdecken. Es würde einige Mühe kosten, dem eine gemütliche Atmosphäre zu geben. „Ganz alleine hier leben?“, ging es mir durch den Kopf, „auf über zweihundertvierzig Quadratmetern?“ Konnte das gutgehen? Ergab das Sinn?
Danach stiegen wir ins Obergeschoss. Rechts führte die erste Tür ab.
„Dahinter befindet sich jetzt eine kleine Gästewohnung, sie liegt über den ehemaligen Ställen“, beschied er mich mit der Stimme eines Zahnarztes, der mit seinem Bohrer vor einem zugekniffenen Mund herumfuchtelt.
Der Mann bereitete mir wachsendes Unbehagen. „Konzentriere dich auf das Haus“, zwang ich meine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung.
Urgemütlich mit ihren Schrägen und Erkern, bestand die Gästewohnung aus einem langen Wohnraum und dem dahinter liegenden Bad.
Zurück auf dem Flur, folgte die Besichtigung weiterer Zimmer mit Bad. Währenddessen textete er mich mit Details aus der Sanierung des Gartenhauses zu, die mich nicht die Bohne interessierten. Er brüstete sich, als wären die Arbeiten von ihm eigenhändig ausgeführt worden. „Wer’s glaubt“, dachte ich und gab trotzdem, fleißig lächelnd, Laute scheinbarer Bewunderung von mir.
Das Sahnehäubchen, sofern es dessen überhaupt noch bedurfte, verbarg eine Wendeltreppe. Flink ergatterte ich den Vortritt, erklomm vorsichtig das Rondell und schritt wenige Sekunden später in einen achteckigen Raum.
„Dort befand sich das Observatorium meines Urgroßvaters“, tönte er von der Treppe.
Wände und Kuppel bestanden komplett aus Glas. „Nachts muss es herrlich sein, hier einfach auf dem Boden zu liegen und in die Sterne zu schauen.“ Schon als Kind konnte ich mich in der Betrachtung des Sternenhimmels verlieren, seine Unendlichkeit schreckte mich nie.
„Hrmmrmmh.“ Dem Räuspern folgte seine drängelnde Ansage: „Sie sollten noch den Keller, die Garagen und die Außenanlage begutachten.“
Während wir gemeinsam das Haus umrundeten, fiel mir eine dezente Hecke auf. Unverblümt fragte ich danach.
„Sie markiert die Grenze Ihres Grundstücks, auf dem Sie selbstverständlich tun und lassen können, was Sie möchten.“
„Meines Grundstücks? Na bitte!“ Selbstbewusst verkündete ich: „Ich kaufe das Gartenhaus.“
Er streckte mir seine Hand entgegen, ich schlug ein.
„Unsere Anwälte regeln dann die Formalitäten.“
„Sag ihm jetzt bloß nicht, dass du gar keinen Anwalt hast.“ „Einverstanden“, gab ich zurück.
Zu der ungestümen Freude über das Haus gesellte sich große Erleichterung, endlich aus dem Dunstkreis des Ekeltypen zu gelangen.
Obwohl erschöpft von meiner Besichtigungstour zuhause angekommen, gönnte ich mir beim mittäglichen Frühstück keine Denkpause. Viel größere Sorge als die Abwicklung des Kaufs bereitete der neue Nachbar in spe. „So ein eiskalter, bornierter Widerling“, schüttelte es mich.
„Darüber mach dir bitte keine Gedanken, das Problem wird in naher Zukunft verschwinden“, brausten sie.
Ausdrücklich wollte ich keinesfalls wissen, wie und warum. „Das Haus ist so groß, nachts werde ich mich dort bestimmt fürchten“, gab ich kleinlaut zu bedenken.
„Was hast du in dem Haus gefühlt?“
Verblüfft ging ich der seltsamen Frage nach. „Der Mann, irgendwie fühlte sich seine Nähe falsch an, dunkel, jede Empfindung in dem Gebäude überschattend.“ Dann dachte ich an das Observatorium. „Ja, ein wunderschöner Moment reinen Glücks!“
„Du wirst in dem Haus glücklich sein, das versprechen wir dir.“
Nicht jedes zukünftige Ereignis steht in den Sternen, wie ich später auf die harte Tour lernen musste.
Ausgeschlafen startete ich in den Dienstag. Langsam wurde mir klar, was mit dem Haus alles auf mich zukam. Umzüge empfand ich, wie wohl viele Menschen, grundsätzlich als Albtraum. Diesmal musste obendrein ein riesiges Haus mitsamt Küche eingerichtet werden. Das klang nach einem Fulltimejob. „Echt ein Segen, keinen Job mehr zu haben.“ Bei diesem Gedanken fiel mir zum ersten Mal auf, dass niemand vorbeikam, anrief oder Emails schickte, niemand mich vermisste. Warum war mir das entgangen? Haltlose Leere kaperte mein Herz, noch bevor mein Verstand harten Gesangsunterricht verpasst bekam.
„Lilia, die Menschen, die du kanntest, gehören der Vergangenheit an.“
Mein Magen begriff schneller als mein Verstand, beförderte den Tee knapp, aber wenigstens in die Spüle. Heftiger Schwindel ließ mich den Beckenrand umklammern. Mit Gummiknien schleppte ich mich schwer atmend zum Küchenstuhl hinüber. „Aber meine Freunde… Ihr könnt doch nicht einfach mein Leben zerstören!“
„Du wirst neue Freunde finden“, flötete ihr Chor.
Das traf mich steinhart. Wenn auch wenige an der Zahl, hing ich unendlich an ihnen. Tränen schwammen in meinen Augen und ich versuchte, gegen meinen rebellischen Magen anzuschlucken. Tief greifender Abschiedsschmerz, mindestens wie bei einer Beerdigung, presste mein Herz zusammen.
Die Sternelben versuchten singend Trost zu spenden.
Sämtliche Brücken in die Vergangenheit kippten wie Dominosteine. „Bin ich wirklich bereit, alles und vor allem mich selbst aufzugeben?“
„Du gibst dich nicht auf, du bist auf dem Weg zu dir selbst.“
„Mein Selbst entwickelt sich zu einer absolut Fremden“, erwiderte ich tonlos.
Wie hoch würde der Preis dieser mysteriös-verrückten Geschichte steigen? Unruhig tigerte ich durch die Wohnung, mochte mich für keinen nächsten Schritt entscheiden. Echt paradox, dass mich das beiderseits herrschende Schweigen nervös machte. „Am besten raus hier und einen ersten Streifzug durch Möbelhäuser unternehmen.“
Echter Widerstand ging anders.
Im Möbelhaus kam ich nie an. In beunruhigend verworrene Gedanken versunken, fand ich mich vor Santa Christiana wieder. Dummerweise war die Tür diesmal verschlossen.
„Hallo, möchten Sie in die Kirche?“ Von dem Pfarrhaus kam ein Priester herüber und sah mich neugierig an.
„Ja, das wäre schön. Ich dachte, sie sei immer offen“, antwortete ich und blickte ebenso neugierig zurück.
Der Priester musste etliche Jahre jünger als ich sein. „Nein stopp, jetzt natürlich etwa fünfzehn Jahre älter.“ Sein freundliches, offenes Gesicht, mit den Lachfältchen um seine Augen, flößte mir ansatzweise Vertrauen ein.
„Ich bin Lilia.“
Er ergriff die ausgestreckte Hand. „Pater Raimund. Kommen Sie, ich schließe auf. Schätze dürfen Sie in unserer bescheidenen Kirche allerdings kaum erwarten.“
Ehrlich währt am Längsten. „Nein, ich weiß, mir geht es um die Stille.“
In der Kirche empfing uns bittere Kälte. War mir das bei dem ersten Besuch entgangen?
„Leider hat unsere Heizung einen Totalschaden, deshalb war auch zugesperrt. Unsere Gemeinde muss bis zum Frühling in der Nachbarkirche unterschlüpfen.“
Das war allzu offensichtlich nur die halbe Wahrheit.
„Dauert der Einbau einer neuen Heizung denn dermaßen lange?“, lockte ich ihn aus der Reserve.
„Nein, nein“, lachte er bitter, „wir sind einfach pleite, das ist der Grund. Aber nun lasse ich Sie allein, anstatt Sie mit meinen Sorgen zu belasten.“
Kaum hatte der Priester die Kirche verlassen, strebte ich auf den Altar zu und hockte mich auf dessen Stufen. Ihr Licht erschien zu meiner großen Erleichterung. Im Geist formulierte ich eine Frage mit dem frechen Hintergedanken, mein Konto möglichst rasch mit Hilfe sinnvoller Investitionen zu leeren. Die Sternelben freuten sich über meine Idee. Später am Tag musste ich lediglich noch herausfinden, wie man eine anonyme Spende über fünfzigtausend Euro hinbekam. Die Aktion war nicht völlig ohne Hintergedanken, schließlich vermutete ich vage, noch häufig an diesen Ort zu kommen.
„Pater Raimund wird dir ein wahrhaft guter Freund sein, Lilia.“
„Das wäre schön! Aber noch schöner fände ich es, wenn ihr mir jetzt verraten würdet, wozu ihr mich braucht“, drängelte ich.
Erst weit später, dennoch schneller als von den Sternelben erwartet, sollte ich ein bedeutendes Stück der schaurigen Wahrheit erfahren: Die Dämonen hatten, angetrieben durch ihren irdischen Fürsten, eine Möglichkeit gefunden, sich Menschen gefügig zu machen. Daher drohte ein Ungleichgewicht des Bösen.
Hier in der Kirche aber erklärten sie mir nur einen scheinbar harmlosen Teil des Problems. „Wir selbst können die Menschen nicht beeinflussen, weil uns kein wahrer Glaube mehr aneinander bindet. Deshalb wünschen wir uns, dass du diese Aufgabe löst.“
„Was genau meint ihr damit?“, hakte ich irritiert nach.
„Immer mehr Böses geschieht, ohne dass wir einzuschreiten vermögen. Wenn du dazu bereit bist, gibst du unser Wissen an die Menschen weiter, warnst sie vor Gefahren.“
„Wer würde ausgerechnet mir zuhören? Ich kann wohl kaum einfach losrennen und den Leuten sonst was Apokalyptisches erzählen. Die würden mich glatt für verrückt halten!“, protestierte ich geschockt. Der Plan sprengte mein Vorstellungsvermögen.
„Unterschätze niemals unsere Macht, Lilia. Wir werden dir helfen. Doch zuvorderst benötigst du göttliches Licht.“
„Wozu ist das gut?“ Das mitschwingende Misstrauen hielt sich in engen Grenzen.
„Du hast bemerkt, dass du uns nur in der Nähe des Buches und in dieser Kirche hören kannst. Nimmst du jedoch das Licht in dir auf, ist dies möglich, wo immer nötig.“
„Klingt fast wie Zauberei. Und wie funktioniert das?“
„Du spürst es bereits.“
„Das Prickeln auf meiner Haut?“
„Ja. Lege deine geöffneten Hände mit der Innenseite nach oben in deinen Schoß.“
Still saß ich lange so da und lauschte entrückt ihrem Gesang.
Die Sternelben verschwiegen mir, dass das aufgenommene Licht später vor allem als tödliche Waffe gegen Dämonen dienen würde. Und indem ich das Licht speicherte, wurde ich ganz nebenbei für die schrecklichen Wesen der Finsternis so sichtbar wie ein Komet in der Nacht. Auch diese Kleinigkeit unterschlugen sie. Doch die eigentliche Gefahr lag noch weit vor mir, und sie sollte gigantisch sein.
Anschwellender Gesang schreckte mich aus meinen fantastischen Träumereien hoch. „Lilia, genug für heute. Bevor du gehst, noch eines. Der Priester hat dich im Licht gesehen, als er nachschauen wollte, ob du bereits gegangen bist.“
„Oh shit! Und jetzt?“
„Jetzt hat er etwas, worüber es sich nachzudenken lohnt“, riefen die Sternelben lachend.
Kichernd begab ich mich auf den Weg zu meiner Wohnung. Unterwegs fand ich plötzlich die bloße Vorstellung, einen Priester als Freund zu bekommen, ziemlich skurril. Mit Kirche und Co. hatte ich noch nie was am Hut. Warum also hatte ich Begeisterung bekundet? Schwach! „Ein Freund, wie schö-ön“, mokierte sich mein Alter Ego „Nächstens steigerst du dich dann garantiert zu: ‚Ganz zauberhaft, meine Lieben, ganz zau-ber-haft‘!“ „Grrrrh.“
Am nächsten Tag wollte ich telefonisch einen Umzugsunternehmer organisieren, damit zumindest das Packen der geschätzt achtzig Bücherkartons bald starten konnte. Doch die Lichtwesen stoppten mich.
Kurz darauf klingelte es. Ein Fahrradkurier kam die Treppe hoch geflitzt und drückte mir wortlos ein großes Kuvert in die Hand. Als Absender prangte der Stempel einer Anwaltskanzlei.
In dem Umschlag befand sich nicht nur der Kaufvertrag für das Gartenhaus, sondern bereits die Schlüssel dazu. „Unglaublich!“ Logischerweise hatte ich erwartet, das Prozedere würde viele Wochen verschlingen.
Eindeutig, die Lichtwesen kicherten. „Lilia, sicher möchtest du gleich zu deinem Haus fahren. Vorher musst du Folgendes wissen: Dort erwartet dich eine Elbe, Elin ist ihr Name.“
Mir blieb die Spucke weg. Hatten sie wirklich gerade „Elbe“ gesungen? E-L-B-E? „Eine, aber, was, wieso das, tut sie denn da …?“, stotterten meine Gedanken ohne geistreiche Anweisungen.
Sie schwiegen taktvoll.
„Und wie verhält man sich gegenüber Elben?“
„Genauso herrlich respektlos, wie du uns begegnest. Sei einfach freundlich. Sie wird dir helfen und Rat erteilen, wenn du darum bittest.“
Gespannt wie ein Flitzebogen, zugegeben auch hochgradig nervös, marschierte ich zur S-Bahn. Dann ging es los. „Eine Elbe? Ernsthaft?“ Prompt spulten Filmsequenzen aus J. R. R. Tolkiens „Herr der Ringe“ in meinen Kopf ab. „Du spinnst doch total! Elben? So ein Blödsinn!“, schimpfte mein Alter Ego. „Du meinst, die machen einen Scherz?“„Was denn sonst? Oder bist du jetzt etwa rationalamputiert?" Als Reaktion auf unseren internen Schlagabtausch startete mein Verstand den kurzen Versuch, eine lupenrein rationale Erklärung für sämtliche Vorgänge abzuliefern. Demnach musste ich seit Wochen – wahrscheinlich nach dem Sturz von Joschs XXL-Leiter – im Koma liegen und ungebremst vor mich hin spinnen. „Wie die Elbe wohl aussieht?“, machte meine Fantasie kurzen Prozess.
Die Fahrt zum Gartenhaus dauerte diesmal gefühlt ewig. Unruhig rutschte ich in der S-Bahn auf meinem Sitz herum.
Mehr schlitternd als gehend hastete ich das letzte Stück über vereiste Wege bis zum Gartentor. Der fiese neue Nachbar schien verreist zu sein, unberührter Neuschnee lag vor seinem Haus wie auf dem Weg zum Gartenhaus. Die geräumten Treppenstufen vor dem Eingang fielen daher sofort ins Auge. Dickes Fragezeichen! Den Geheimcode für die Alarmanlage hatte mein Gehirn unverständlicherweise sofort abgespeichert. Kurz schüttelte ich irritiert den Kopf über mich.
Leise schloss ich die Tür auf – und bekam tellergroße Augen. „Der Flur ist bereits eingerichtet!“, rief ich voller Staunen aus. Gläserne Bodenvasen mit Rosen darin, die ihren sanften Duft verströmten, standen rechts und links der Freitreppe. Dann erblickte ich sie. Elin. Ein weiß schimmerndes Lichtwesen, halb menschlich und halb überirdisch anmutend. Ihre grazilen Bewegungen ließen schwache Blautöne über das lange weiße Gewand gleiten. Etwas kleiner als ich, wirkte sie zart, fast zerbrechlich unter ihren weißblonden, üppig langen Haaren. Im krassen Kontrast dazu baumelte ein silbernes Schwert an ihrer Hüfte. Graublaue, geheimnisvolle Augen betrachteten mich ernst. Unwillkürlich verglich ich ihre Erscheinung mit der Elbe Galadriel. „Irgendwie ähnlich und doch sehr anders.“
Später gewahrte ich den bedeutenden Unterschied. Bei Elin fehlte die offensichtliche Ausstrahlung von Macht.
Überraschend erklang Elins melodische Stimme in meinem Kopf: „Ich grüße dich, Lilia, willkommen in deinem Heim.“
Etwas unsicher, ob meine Gedanken von ihr ebenso gehört würden, versuchte ich: „Hallo, Elin, ich freue mich, dich kennen zu lernen.“
Sie lächelte bestätigend.
Plötzlich überwältigte mich eine fremde, völlig unbekannte Empfindung. Als ob ein Wimpernschlag zwei Teile zusammengefügt hätte, fühlte es sich wie die Rückkehr eines verloren geglaubten Zwillings in mein Innerstes an.
Elin nickte. „Ein Teil deiner Seele, in dem sich das Vermächtnis der Elben befindet, ist erwacht und erkennt mich. Das ist ein gutes Zeichen. Komm nun, alles ist bereit. Sieh selbst, ob es deinen Wünschen entspricht.“
Kaum hatten wir unseren gemeinsamen Rundgang begonnen, kapitulierte ich jedoch. In der Küche, als spontan gewählter Zufluchtsort, ließ ich mich auf einen Stuhl fallen. Alles war zu viel. Mein Inneres gab sich heftig aufgewühlt, eine Dosis, die bereits völlig ausgereicht hätte. Obendrein befanden sich im Haus keineswegs ausschließlich neue Möbel. Um mich herum standen, lagen und hingen Dinge aus meiner Küche, da war ich mir sicher. Und im Wintergarten standen eindeutig meine Zimmerpflanzen. Großes, erschöpftes Fragezeichen.
Elin trug ein Teetablett herüber. „Ja, mit meinem heiß geliebten blauen Teeservice.“ Ich schloss meine Augen und genoss das beruhigende Getränk.
Gerade als ich die Elbe fragen wollte, wie meine Sachen hierher gekommen waren, erklang ihre Stimme. „Ich kann über Gegenstände wirken.“ Sie lächelte abermals. „So musst du nicht mehr umkehren.“
„Aber ich kann es auch nie mehr“, dachte ich mit hochbrodelnder Panik. „Und all der Aufwand, bloß damit die Menschen ein paar Nachrichten von den Sternelben erhalten?“ Sollte ich eher an ihnen oder an mir zweifeln?
Nachdem die Teekanne keinen Tropfen mehr hergab, wollte ich den Tisch abräumen.
Elin erschien. „Lass mich das erledigen.“
„Aber nein, du bist doch keine Dienerin“, wehrte ich entgeistert ab.
„Es verursacht keinerlei Mühe.“ Mit einer kaum wahrnehmbaren Bewegung ihrer Hände verschwand das Teeservice.
Jetzt war ich restlos platt! „Das ist doch mal eine echt praktische Fähigkeit“, platzte ich laut heraus. „Entschuldige.“
Die Elbe bedachte mich mit einem unergründlichen Blick. Eindeutig war ein heißes, entspannendes Schaumbad überfällig. Im Hinausgehen wagte ich noch einen kurzen Blick in den riesigen Kühlschrank. Voll bis oben hin mit Leckereien. Gab es irgendetwas, das sie noch nicht über mich wussten? Meine hyperaktive Zweifelecke konnte ich erst in der Badewanne ruhigstellen.
„Weiß und blau. Mitternachtsblau, azurblau, blaugrün, blaugrau, aber keine hellblaue Kleidung. Das wäre auch wirklich das Letzte!“ Der begehbare Kleiderschrank enthielt keineswegs meine alten, übergroßen Klamotten, sondern wunderschöne neue Hosen, Pullover und Unmengen weiterer Sachen. „Wieso Kleider? Trage ich doch nie. Weiß und blau, hmmh.“ Da kein Kommentar in meinem Kopf erklang, musste ich halt später nachfragen. Mangels Pyjamas schlüpfte ich in ein langes Nachthemd aus weißer Seide und ging hinunter in die Küche.
Keine Spur von Elin, inzwischen herrschte draußen Dunkelheit. Vom Esstisch her duftete es verführerisch nach Tomatensuppe, meiner Leibspeise. Ein Salatteller und ein Schälchen mit Zitronencreme ergaben mein köstliches Abendessen. „Woher weiß die Elbe all diese Dinge über mich?“, bedrängte mich abermals eine besorgte innere Stimme auf meinem Weg ins Schlafzimmer. „Hier fehlen aber noch Vorhänge oder Rollos an den Fenstern. Ach nein, sie wollen ja bestimmt wachen.“ Und damit schlief ich ein.
Aus dem Buch „Inghean“
Ahnt der schwarze Fürst die bevorstehende Rückkehr seiner ärgsten Feindin? Seine Sklaven kriechen durch die nächtlichen Straßen. Mir scheint, es werden immer mehr.
Einige Tage später befand sich mein Innenleben wieder einigermaßen im Gleichgewicht. Das Wetter tendierte in den letzten Februartagen zu matschiggrau. Hoffentlich kam bald der Frühling. Jedenfalls wollte ich an diesem Tag unbedingt Santa Christiana besuchen, die Kirche fehlte mir seltsamerweise. Seit dem Vortag stand ein funkelnagelneuer Kleinwagen in der Garage, die Sternelben wollten es so. Allerdings verspürte ich keine Lust, damit durch die Stadt zu fahren. Ein eigenes Auto hatte ich nie zuvor besessen. Wozu sollte man so was in Berlin auch benötigen, außer um unnötig viel Zeit im Stau zu vertrödeln?
Auf dem Weg zur S-Bahn ging ich im Kopf den Fragenberg durch, der sich zwischenzeitlich dank unserer stillschweigend vollzogenen Kommunikationspause angesammelt hatte.
Die Kirchentür stand offen, drinnen sah der Priester nach dem Rechten.
„Hallo, Pater Raimund“, grüßte ich ihn.
„Hallo, Lilia! Wie geht es Ihnen?“
„Gut, zumindest wenn Sie mich nicht rausschmeißen“, erwiderte ich keck.
„Um Himmels Willen, warum sollte ich.“ Er zögerte. „Hätten Sie später vielleicht Lust auf einen Kaffee, wenn Sie in der Kirche genug gefroren haben?“
„Sag zu“, riet elbischer Gesang.
„Gute Idee. Aber noch lieber auf Tee.“
Das Licht umarmte mich, während ich mit geschlossenen Augen horchte. Die Lichtwesen sangen mir ein Lied über die Elben aus längst vergangener Zeit vor und erinnerten mich auf diese Weise an meine Aufgabe. In den vergangenen Tagen hatte ich keinen einzigen Gedanken daran verschwendet.
Umgehend bekam ich ein ordentlich schlechtes Gewissen. „Bitte sagt mir, was ich für euch tun kann.“
Erfreut gaben sie Auskunft. „Lilia, um das Tun und Lassen der Menschen begreifen zu können, musst du ihre Gefühle und Empfindungen verstehen, ihre Seelen hören lernen.“
Statt einer Antwort schickte ich ausgiebiges Seufzen gen Himmel. Die alte Abneigung gegen Kontakte zu meinen Mitmenschen meldete sich. Tatsächlich hielt ich mich bei dieser Aufgabe für die ungeeignetste Person in ganz Berlin.
Mit großem Ernst riefen sie mich zur Ordnung. Die Sternelben hofften, ich würde rasch jene tiefgreifenden Veränderungen meiner Persönlichkeit akzeptieren und nutzen, die sie nach ihren speziellen Wünschen vorgenommen hatten. Zu mir meinten sie nun lediglich: „Dir mangelt es an Selbstvertrauen.“
„Dann bitte ich euch darum, sonst werdet ihr nur weiter enttäuscht.“
Sie schienen besänftigt.