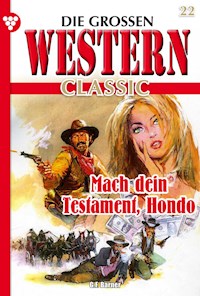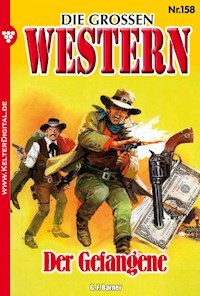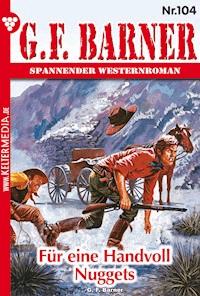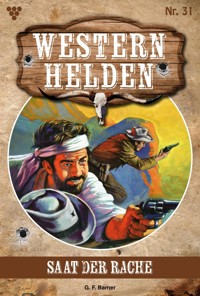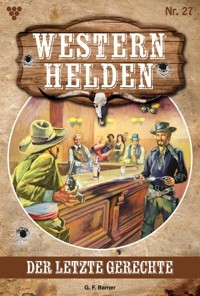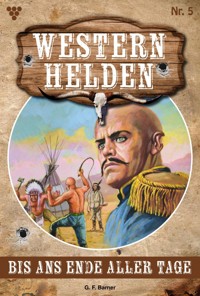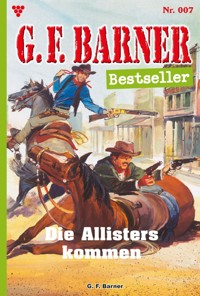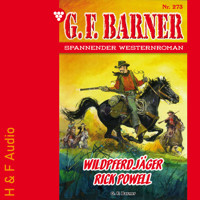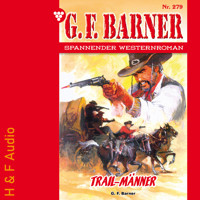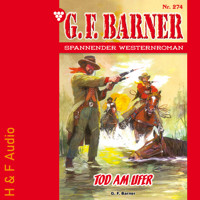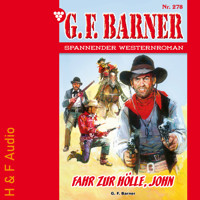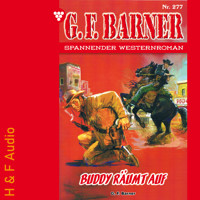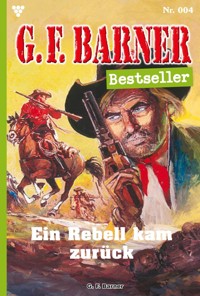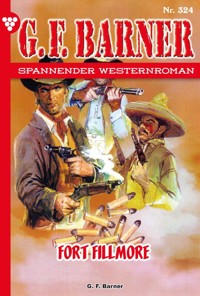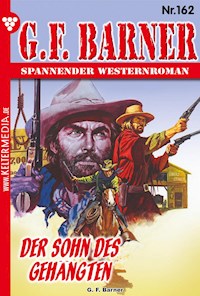
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. Es geht so schnell, dass selbst ein Mann wie Mahoney, der es gewohnt ist, auf jede Bewegung seines Pferdes zu reagieren, zu spät abspringt. Die Halde, die steil nach unten in das Tal führt, gerät urplötzlich in Bewegung. Auch wenn Mahoney vorsichtig gewesen wäre, diesen Sturz hätte er nicht voraussehen können. Das Geröll gibt jäh nach, dann stürzt Mahoneys Pferd schon und schleudert Mahoney aus dem Sattel. Zwar kann sich Jona noch etwas abstoßen, aber der Stoß hat nicht genügend Kraft. Jona fliegt auf das Geröll. Er versucht sich zu halten. Das Pferd, das unmittelbar neben ihm auf die Beine zu kommen versucht, bringt durch sein Gestampfe die ganze Fläche aus Steinen und Staub ins Rutschen. Mahoney wirft sich lang hin und breitet die Arme aus. Der Halt, den Mahoney auf dem lockeren Geröll zu finden hofft, ist in wenigen Sekunden nicht mehr da. An Mahoney stürzt das Pferd vorbei den Hang hinab. Es lässt eine Riesenlawine aus Geröll hinter sich hochprasseln. Er prallt mehrmals heftig auf. Seine Hüfte sticht, seine Kniescheiben scheint jemand mit einem Hammer bearbeitet zu haben. Um ihn ist wildes Gerassel und Getöse. Dann prallt er irgendwo auf. Der Schmerz geht wie ein Hieb durch seinen Kopf, läuft blitzschnell über den Nacken und endet irgendwo in seinen Rückenwirbeln. Er wird durch das klagende Wiehern seines Pferdes munter. Sein Pferd muss verletzt sein. Er hört sein Pferd wieder, sieht es aber nicht, sondern schätzt, dass es hinter Büschen liegen muss.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Barner – 162 –Der Sohn des Gehängten
G.F. Barner
Es geht so schnell, dass selbst ein Mann wie Mahoney, der es gewohnt ist, auf jede Bewegung seines Pferdes zu reagieren, zu spät abspringt.
Die Halde, die steil nach unten in das Tal führt, gerät urplötzlich in Bewegung. Auch wenn Mahoney vorsichtig gewesen wäre, diesen Sturz hätte er nicht voraussehen können.
Das Geröll gibt jäh nach, dann stürzt Mahoneys Pferd schon und schleudert Mahoney aus dem Sattel. Zwar kann sich Jona noch etwas abstoßen, aber der Stoß hat nicht genügend Kraft. Jona fliegt auf das Geröll. Er versucht sich zu halten. Das Pferd, das unmittelbar neben ihm auf die Beine zu kommen versucht, bringt durch sein Gestampfe die ganze Fläche aus Steinen und Staub ins Rutschen.
Mahoney wirft sich lang hin und breitet die Arme aus. Der Halt, den Mahoney auf dem lockeren Geröll zu finden hofft, ist in wenigen Sekunden nicht mehr da. An Mahoney stürzt das Pferd vorbei den Hang hinab. Es lässt eine Riesenlawine aus Geröll hinter sich hochprasseln.
Er prallt mehrmals heftig auf. Seine Hüfte sticht, seine Kniescheiben scheint jemand mit einem Hammer bearbeitet zu haben. Um ihn ist wildes Gerassel und Getöse.
Dann prallt er irgendwo auf. Der Schmerz geht wie ein Hieb durch seinen Kopf, läuft blitzschnell über den Nacken und endet irgendwo in seinen Rückenwirbeln.
Er wird durch das klagende Wiehern seines Pferdes munter.
Sein Pferd muss verletzt sein.
Er hört sein Pferd wieder, sieht es aber nicht, sondern schätzt, dass es hinter Büschen liegen muss.
Mühsam stemmt er sich hoch. Sein Rücken fühlt sich an, als hätte ihn jemand mit einer Peitsche bearbeitet.
»Du großer Gott«, sagt Mahoney stöhnend und wankt lahm auf die Büsche zu.
In diesem Augenblick sieht er auch schon sein Pferd. Er erkennt den herabhängenden linken Vorderhuf und bleibt erstarrt und entsetzt stehen.
»Das hat noch gefehlt«, sagt er endlich mühsam und stolpert weiter. »Vier Jahre habe ich dich. Oh, verdammt!«
Ihm wird fast übel, als sein Pferd bei seinem Anblick leise schnaubt Und aufzustehen versucht. Der Vorderhuf aber verhindert es, das Pferd fällt zuckend auf die Seite und prustet klagend.
Mahoney kniet neben dem Hals seines Pferdes, sucht dann in seinen Taschen nach dem harten Braunzucker, von dem er immer etwas bei sich hat, und steckt seinem Pferd zwei Stückchen ins Maul.
Die großen braunen Augen sehen ihn an, er schluckt zweimal heftig und blickt auf den Hang und das Ende des Gerölls, das fast das Pferd erreicht.
Er hat nun die schwere Waffe in der Hand, wendet den Kopf, nachdem er die Waffe angesetzt hat und drückt ab.
Der Knall ist nicht einmal sehr laut. Mahoney kauert am Boden, er sucht erst nach zwei, drei Minuten nach seinem Gewehr, dessen Lauf aus dem Geröll wenige Schritte weiter ragt. Dann macht er sich daran, den Sattel und den Packen abzuschnallen. Neben seinem Pferd hockend verbindet er sich, spült den Mund mit dem Rest Kaffee aus, den er noch in der Metallflasche hat und steht dann ächzend auf.
Vorsichtig holt er sein Gewehr, lädt es durch und blickt durch den Lauf. Der Lauf ist zwar von einem Schleier Staub überzogen, doch kann er durchaus schießen. Ruhig, seine Sachen trägt er vorher davon, lädt er und visiert dann die obere Kante des Hanges an. Es genügen ein halbes Dutzend Schüsse, dann gerät der Hang in Bewegung. Langsam, wie zähflüssiger Brei, schiebt sich das Geröll tiefer und tiefer. Mahoney hängt Sattel und Packen an das Gewehr, schultert die Waffe und geht los.
Er kann nur hoffen, dass hinter diesen Bergen oder zwischen ihnen irgendwo eine Ansiedlung ist.
Er geht mit sturer Gleichgültigkeit den Weg durch das Tal. Die erste Stunde macht ihm nicht viel aus, seine Stiefel sind nicht besonders hochhackig. Sie drücken kaum und sitzen fest. Es wird erst schlimm, als die Sonne immer höher steigt. Er kommt in eine Landschaft von langgestreckten Hügeln, aber er entdeckt nirgendwo Rauch. Zwar findet Mahoney Wasser, doch sind die Wasserstellen fast ausgetrocknet. Es ist kein Land für Rinder, denn es ist trocken und sein Gras ist verdorrt.
Mahoney geht in den Mittag hinein.
Er macht Rast, kocht sich Kaffee und steigt danach auf den Hügel rechter Hand, der ihm noch am höchsten erscheint. In der klaren Luft zeichnen sich rechts steilere Kämme ab. Er glaubt blaue Waldschatten zu erkennen und zwischen den zwei Bergrücken eine dünne Rauchfahne in den Himmel steigen zu sehen.
Langsam bricht er auf. Er sieht nach einer Weile den Rauch deutlich, aber er muss mehr als zehn Meilen entfernt sein.
Jona Mahoney geht stur weiter, Sattel und Packen auf dem Rücken.
Der Packen wird schwerer, die Sonne sticht.
Dann verschwindet der Rauch, aber Mahoney kennt die Richtung.
*
Er weiß nur, dass er sich getäuscht haben muss. Das Licht vor ihm ist mindestens noch zwei Meilen entfernt. Es ist nicht mehr als ein kleiner Lichtpunkt in der Dunkelheit, auf den er zutorkelt. Die Mattigkeit und Müdigkeit in ihm ist so groß, dass er bereits mehrmals den Wunsch gehabt hat, sich einfach hinzuwerfen und zu schlafen. Er stolpert öfter, aber das Licht ist wie ein Magnet, es zieht ihn an.
Es muss nach neun Uhr sein, als er auf der Höhe steht und an dem kleinen Waldstück vorbei auf das Licht hinabblicken kann. Es sind zwei Lichter, zwei Fenster, die erleuchtet sind.
Mahoney stolpert den Hang hinab und ist nicht mehr als hundert Schritte vor dem Zaun, der sich als dünner Strich in der Dunkelheit abzeichnet, als er den Hund bellen hört.
Der Hund stimmt ein wütendes heiseres Gebell an. Das Licht im Haus erlischt, noch ehe Mahoney am Zaun ist, und eine Tür klappt irgendwo vor ihm. Dann schweigt auch der Hund. Das Mondlicht hebt Mahoneys Schatten gegen den Zaun ab. Er geht an ihm entlang, bis er den Durchlass findet. Zwei Zäune, eine Gasse zwischen ihnen, die genau auf den Hof des Anwesens zu führen scheint. Vor ihm liegt jetzt – er kann es jetzt besser sehen – ein großes Haus und zwei Ställe oder Schuppen. Es muss eine Ranch sein, jedoch sind beide Zäune rechts und links reparaturbedürftig.
Die Latten sind zerbrochen oder hängen herab. Ganz links kann er undeutlich einige Pferde in einem Corral erkennen.
Und dann, er ist nun nicht mehr als dreißig Schritte von dem großen Stall oder Schuppen entfernt, klickt etwas und der Hund bellt zweimal.
Die Stimme aber sagt aus dem tiefen schwarzen Schatten des Stalles heraus: »Stehen bleiben, Mister!«
Es ist eine Frau, das erkennt Mahoney sofort. Er bleibt gehorsam stehen, die Last seines Sattels und des Packens hat ihn niemals so gedrückt wie jetzt.
Und die Frau sagt scharf:
»Nehmen Sie die Hände hoch!«
»Die Hände, nun gut«, erwidert Mahoney undeutlich und lässt Sattel und Packen fallen. »Hören Sie, ich habe mein Pferd verloren. Es hat sich den linken Vorderhuf gebrochen und musste erschossen werden. Mein Name ist Mahoney, Jona Mahoney, ich habe keine feindlichen Absichten.«
Der Hund knurrt, die Frau scheint zu zaudern, aber sie muss ihn gut sehen können, denn der Mond scheint Mahoney ins Gesicht.
»Machen Sie Ihren Gurt auf und werfen Sie ihn hin, Mister«, sagt sie dann ruhig. »Tun Sie es nicht, dann nehmen Sie Ihre Sachen und verschwinden Sie wieder. Nun los, worauf warten Sie?«
Vielleicht würde Mahoney unter normalen Umständen sich eher von seinem letzten Hemd als von seinem Revolver trennen, aber die gewisse Gleichgültigkeit, die in ihm seit dem Nachmittag ist, lässt ihn den Gurt aufmachen.
»Werfen Sie ihn zur Seite, Mann!« Er wirft ihn fort und nimmt die rechte Hand wieder hoch.
»Kommen Sie langsam her.« Mahoney geht los, er sieht jetzt undeutlich die Frau und auch den Hund, einen großen, scheckigen Bluthund, den die Frau bis jetzt gehalten hat.
»Der Hund wird Ihnen nichts tun, wenn Sie mich nicht angreifen«, sagt sie dann und lässt den Hund jäh frei. »Pass auf, Earl.«
Der Hund kommt, und Mahoney, der ihn hecheln hört und seine Größe sieht, wird leicht übel. Es ist seltsam, er hat sein ganzes Leben vor Hunden Angst gehabt, seitdem ihn einmal als Kind ein Straßenköter gebissen hat. So steht er still, die Hände erhoben und wagt nicht sich zu rühren.
Der Hund umstreicht ihn, bleibt dann vor ihm stehen und blickt zu ihm hoch. Die Frau kommt, hat kein Tuch umgeworfen, trägt ein einfaches Kleid, und hat helles Haar, auf dem sich das Mondlicht wie auf dem Lauf der Winchester bricht, den sie auf Mahoney gerichtet hält. Sie ist nicht sehr groß, schlank und sehr jung. Erst in seinem Rücken dreht sie sich und sagt kurz:
»Gehen Sie voraus in den Hof, und versuchen Sie nichts. Der Hund springt jeden Mann sofort an.«
Schöne Sache, denkt Mahoney und ist bereit, wieder wegzugehen, bloß um dieses grässliche Ungetüm von Bluthund nicht mehr neben sich zu wissen.
Er geht los, der Hund immer zwei Schritte neben ihm und die Frau mit dem Gewehr hinter ihm.
»Ich habe keine feindlichen Absichten«, sagt er heiser. »Madam, ich bin müde, ich wollte nur um ein Nachtlager bitten und um ein Pferd, wenn Sie eins zu verkaufen haben. Ich kann bezahlen.«
Er kommt jetzt in den Hof vor das große Haus. Es ist ein beachtlich großes Haus für diese einsame Gegend. Das Haus hat ein zweites Geschoss, und das Dach des Vorbaues dient wohl als Balkon.
»Jetzt bleiben Sie stehen, Mister!«
Er gehorcht. Die Frau geht nun hinter ihm her zum Vorbau und blickt ihn von dort aus an.
»Ich hole die Laterne, Mister, und Sie bleiben besser an diesem Fleck stehen, sonst könnte der Hund springen. Pass auf, Earl.«
Das Ungeheuer von Bluthund knurrt einmal und beginnt Mahoney zu umschleichen. Mahoney schielt dem Riesenvieh nach, das ihn umrundet und ihn nicht aus den Augen lässt. Dann wird es auch schon hell hinter der Tür. Die Frau kommt mit einer Blendlaterne heraus, stellt sie auf den Vorbau und richtet den Schein auf Mahoney.
»Sehen Sie ins Licht.«
»Hören Sie«, sagt er halb verwundert, dass auf einer so großen Ranch kein Mann sein soll. »Ich will ein Pferd kaufen, Madam, weiter will ich nichts. Nun, kann ich die Arme herabnehmen? Ich bin viele Meilen zu Fuß gegangen.«
»Das sieht man jetzt«, erwidert sie kühl. »Wo haben Sie Ihr Pferd verloren?«
Er beschreibt ihr die Stelle, sie kraust die Stirn und nickt dann.
»Ich weiß schon. Ich werde meinen Bruder schicken, der nachsehen kann, ob Sie die Wahrheit gesagt haben.«
Einen Augenblick fühlt Mahoney Zorn in sich. Was denkt sich diese junge Frau eigentlich?
»Ich möchte nur ein Pferd«, erwidert er heiser. »Was soll das, wozu soll Ihr Bruder noch nachsehen, Madam? In einigen Stunden bin ich schon weiter.«
»Vielleicht«, gibt sie zurück. »Nehmen Sie die Laterne und gehen Sie in das Haus, der Hund kommt mit. Linker Hand am Ende des Ganges ist die Küche, Sie werden sie schon finden. Ich bin nichts als vorsichtig, Mahoney, das ist doch Ihr richtiger Name?«
»Ich habe nie einen anderen besessen.«
Er sagt es ziemlich barsch und fragt sich, warum diese Frau so vorsichtig ist. Sicher, die Gegend ist einsam, aber eigentlich müsste sie sehen können, dass er kaum noch stehen kann.
Dann geht er los, nimmt die Laterne und stolpert ins Haus. Der Gang ist breit und gleicht mehr einer Halle. Rechts führt eine Treppe in das Obergeschoss, hinten links steht eine Tür offen. Es ist die Küchentür. Der Hund knurrt ihn an, bleibt mit halb geöffnetem Fang am Herd stehen und beobachtet Mahoney, der die Lampe auf den Tisch stellt.
Die Frau kommt jetzt sorglos in den Raum, steckt die Wandlampe an und lehnt sich dann an den Schrank. Erst jetzt erkennt Mahoney ihr Gesicht richtig. Es ist ein etwas blasses, aber gut geschnittenes Gesicht. Über der Nase hat sie einige Sommersprossen, und ihr Mund ist voll und fest.
»Ich bin Anne Beckenridge, Mahoney«, sagt sie, nachdem sie sich gegenseitig genau gemustert haben. »Mrs Anne Beckenridge. Setzen Sie sich auf die Bank.«
»Besten Dank«, erwidert Mahoney brummig. »Dieser Bursche da passt aber scharf auf.«
»Ja, Mahoney. Er ist ein Geschenk meines Mannes und hilft mir, wenn ich mal allein bin. Unerwünschter Besuch oder durchziehende Reiter kommen hier nicht herein. Sie sehen aus, als wenn Sie einen Hang hinabgestürzt wären.«
»Das bin ich auch. Ich habe nichts als Glück gehabt, dass mich das Geröll nicht unter sich begraben hat.«
Er hat Mühe zu sprechen, setzt sich und lehnt seinen Kopf an die Wand. Die Müdigkeit in ihm wird immer größer. Er sieht die Frau zum Herd gehen und zwei Stücke Holz in das noch brennende Feuer nachlegen.
»Ein paar Eier und etwas Speck mit Kartoffeln können Sie haben, Mahoney. Ich dachte, mein Bruder würde bis zum Abend hier sein, aber wahrscheinlich …«
Er glaubt aus ihrem Tonfall etwas wie Ärger herauszuhören. Es ist ihm jedoch ganz gleich, ob der Bruder nun kommt oder nicht kommt, er möchte nichts als schlafen.
»Ich bin nur müde«, sagt er seufzend. »Sie brauchen sich keine Arbeit zu machen. Wenn ich im Stall schlafen kann …«
»Sie essen etwas, dann können Sie schlafen, oben stehen einige Zimmer leer, Mahoney. Sie können aber auch weiterreiten. Tolhard nimmt Sie sicher auf.«
»Tolhard?«, fragt er und hat das Gefühl, dass sie ihn bei der Nennung des Namens scharf angesehen hat. »Wer ist das? Ihr Nachbar?«
»Ja«, antwortet sie kurz. »Haben Sie nichts von ihm gehört?«
»Ich komme aus Wyoming, aus der Gegend zwischen Torrington und Lusk.«
»Nun«, murmelt sie. »Ich dachte, Tolhard ist ein bekannter Mann.«
»Ich kenne ihn nicht.«
Sie schlägt schweigend einige Eier in die Pfanne, in der der Speck schon brutzelt und Kartoffeln sind.
»Was haben Sie in Wyoming gemacht, Mahoney?«
»Für eine Ranch Pferde zugeritten, Madam.«
»Und wohin wollen Sie jetzt?«
»Ich will mir eine andere Arbeit suchen.«
»Zum Herbst wird das nicht ganz leicht sein, Mahoney, fürchte ich.«
»Ich bin nicht wählerisch, gute Zureiter braucht man immer.«
Sie hantiert schnell und geschickt.
Die Pfanne ist so groß, dass sie in ihr noch auf der freien Fläche die Kartoffeln braten kann. Dann holt sie einen Zinnteller, füllt ihm die Kartoffeln und die Eier auf und lehnt sich wieder an den Schrank.
»Was, schon satt?«, fragt Anne kurze Zeit später.
»Ja, ich sagte doch, ich bin nur müde. Danke, dass Sie mich aufgenommen haben. Wo kann ich schlafen?«
»Kommen Sie nur mit. Komm, Earl!«
Sie geht mit der Lampe vor, der Hund ist genau hinter Mahoney und folgt ihm die Treppe hinauf.
Oben führt ihn Anne Beckenridge den Flur entlang bis zur letzten Tür und stößt diese auf.
»Hier haben manchmal unsere Gäste geschlafen«, sagt sie kurz. »Die Tür neben dem Fenster führt auf das Vorbaudach, aber gehen Sie besser nicht hinaus, das Dach ist brüchig. Ich fürchte, ein so großer Mann wie Sie könnte durchbrechen.«
Sie geht hinein, stellt die Lampe auf den Tisch und öffnet ein Fenster. Es ist ein längliches Zimmer mit einem weißen Bettgestell, einem genauso gestrichenen Schrank und einer Waschkonsole. »Ich bringe Ihnen gleich Wasser, Mahoney.«
»Ich kann es auch selbst holen«, sagte er langsam. »Meine Sachen …«
»Bleiben Sie nur hier, Wasser ist zwei Zimmer weiter. Und Ihre Sachen hole ich schon.«
Sie geht schnell hinaus. Er hat einen Augenblick das Gefühl, dass sie ihn nicht an seine Waffen kommen lassen will und starrt auf die Tür. Kaum hat er die Weste aus, als sie wieder hereinkommt, einen Krug mit Wasser hinstellt und ein Handtuch zurechtlegt.
»So, das ist alles. Und nun schlafen Sie«, meint sie ruhig. »Es kann etwas laut werden, wenn mein Bruder mit meinem Vetter nach Hause kommt, stören Sie sich nicht daran.«
Dann klappt die Tür hinter ihr. Mahoney ist allein, streift sein Hemd ab, wäscht sich und legt sich dann hin.
Er hört kein Geräusch mehr im Haus und schläft innerhalb weniger Minuten ein.
*
Als Jona Mahoney aufwacht, scheint ihm die Sonne mitten ins Gesicht.
Unter ihm bellt der Hund, ein Hammer fällt klingend auf einen Amboss und der Himmel, den er mit zurückgelegtem Kopf erkennen kann, zeigt keine Wolke.
Dem Stand der Sonne nach muss es etwa neun Uhr sein. Mahoney steht auf, schüttelt sich und fragt sich, warum er so lange geschlafen hat, denn er wacht sonst beim ersten Morgenrot auf.
Er sucht sich ein frisches Hemd heraus, wickelt die Leinenstreifen von seinen Knien und wäscht sich dann.
Erst danach geht er zum Fenster.
»Seltsam«, sagt er nachdenklich, »das alles ist in einem Zustand, als würde hier kein Mann Hand anlegen, als würde niemand daran denken, etwas auszubessern. Die Tür …«
Sie fällt ihm nicht entgegen, obwohl er es beinahe erwartet hat, als er sie aufzieht und vorsichtig auf das Vorbaudach tritt. Er erkennt den Balken an der Nagelreihe und hält sich auf dem Balken, bis er das Geländer erreicht hat und in den Hof blicken kann.
Sein erster Blick trifft den Stall, dessen Dach einige Löcher hat, der aber sonst stabil gebaut ist. Nur das Tor hängt schief in den Angeln. Die Scheune sieht nicht viel besser aus. Im Bunkhaus, einem langgestreckten Bau, in dem sicher Platz für ein Dutzend Männer sein wird, sind zwei Fenster zerbrochen und einfach mit Latten vernagelt worden.
Unter dem Dach links am Schuppen aber steht jemand, dessen Hosenbeine er gerade noch sehen kann. Aus dem kleinen Essenschornstein neben dem Schuppenanbau steigt etwas Rauch. Das Klingen des Hammers auf dem Amboss kommt wieder. Der Hund streicht um die Scheune, sieht zum Vorbaudach und bellt.
Die Hosenbeine unter dem Dach bewegen sich jetzt. Der Mann will wohl nachsehen, warum der Hund den Vorbau anbellt.