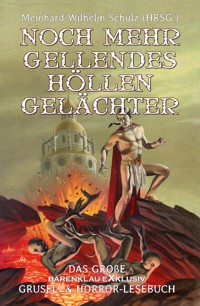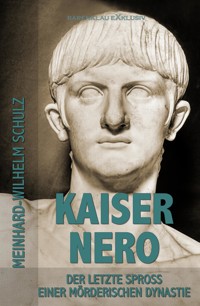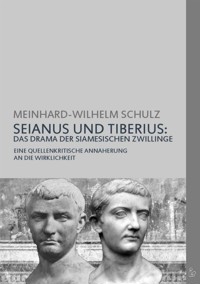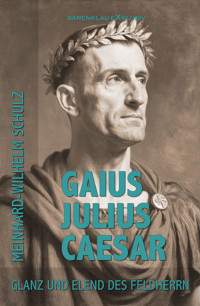
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Caesars Kriegsführung erfreut sich bis heute größter Bewunderung. Seine ‚Milde‘ ist Legende. Er ist Star der Comic-Serie Asterix & Obelix. Ist sein Ruhm aber auch berechtigt?
Schulz hat sich jahrelang mit ihm auseinandergesetzt, drei umfangreiche Bände und etliche Aufsätze zu ihm publiziert. Sein Studium ließ ihn zu Urteilen gelangen, die sich mit der Tradition nicht vereinbaren lassen: Caesar verdankte sein Überleben nämlich bereits im ersten Kriegsjahr und danach wiederholt anderen.
Schulz weist Caesars Fehler nach, die dazu führten, dass, vollkommen vermeidbar, der Alexandrinische, Afrikanische und Spanische Krieg mit Zehntausenden von Toten geführt wurden. Sie ließen einen ratlosen Sieger zurück, der kaum noch ein Jahr am Leben blieb.
Das aktuelle Buch ist zwar wissenschaftlich geschrieben, aber auch für interessierte Laien gedacht. Es bietet einen genauen Überblick über die Karriere des Feldherrn, über seine Stärken und Schwächen, über sein Versagen und seine unbeschreibliche Unmenschlichkeit. Sämtliche Quellen wurden ins Deutsche übertragen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Schulz, der auch als Autor von Venedig-Krimis bekannt ist, verspricht neue Erkenntnisse innerhalb von spannender Lektüre, auch wenn das Werk von epischer Länge ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Meinhard-Wilhelm Schulz
Gaius Julius Caesar
Glanz und Elend
des Feldherrn
Impressum
Copyright © by Author/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer mit eigenen Motiven von edeebee, und Bärenklau Exklusiv, 2025
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau (OT), Gemeinde Oberkrämer. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
www.baerenklauexklusiv.de
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Gaius Julius Caesar
Glanz und Elend des Feldherrn
Vorwort: Warum dieses Buch?
Grundlegendes
1. Die Germanenfrage
2. Das Germanenthema von Tacitus zu Prokopios
3. Kleine Reitkunde
4: Das Pferd der Germanen
5: Zur Psychologie des Pferdes
6. Ross und Reiter in Rom
7. Die Reiterei bei Caesar
7. 1: War Caesar ein Reiter? Seine Reisetätigkeit (58 – 49)
7. 2: Caesars Reiterei nach SCHAMBACH
7. 3. TAUSEND zur Herkunft von Caesars germanischen Reitern
7. 4: Die Reiterei der Bataver in den ›Historien‹ des Tacitus
7. 5: Chariovalda, eine batavische Reiterlegende
7. 6. Waren die Bataver bereits in »Oberhessen« beritten?
Hauptteil
1. Teil: Das erste Jahr des ›Gallischen Krieges‹
1. 1: Der Beginn des Werkes ›Über den Gallischen Krieg‹
1. 2: Der Kriegsverlauf in Buch I. des ›Gallischen Krieges‹
2. Teil: Das zweite Jahr des Gallischen Krieges
3. Teil: Das dritte Jahr des Gallischen Krieges
4. Teil: Das vierte Jahr des Gallischen Krieges
5. Teil: Das fünfte Jahr des Gallischen Krieges
6. Teil: Das sechste Jahr des Gallischen Krieges
7. Teil: Das siebte Jahr des Gallischen Krieges
8. Teil: Das achte Jahr des Gallischen Krieges
9. Teil: War Caesar der größte Feldherr Roms?
10. Teil: Germanische Reitkunst und Kurioses
11. Teil: Das erste Buch des Bürgerkrieges
11. 1: Vorbemerkung
11. 2: Caesar in Spanien
12. Teil: Das zweite Buch des Bürgerkrieges
12. 1: Die Belagerung von Massilia (Marseille)
13. Teil: Curios Glück und Ende
14. Teil: Curios Tod, eine ›griechische‹ Tragödie?
15. Teil: Curio und die Wirklichkeit
16. Teil: Die Katastrophen der Cassius Longinus und Gaius Antonius
17. Teil: Der Tod des Sabinus; Caesars erste ›griechische‹ Tragödie
18. Teil: Das dritte Buch des Bürgerkriegs
19. Teil: Die Reiterei als bindendes Glied der Kommentarien?
20. Teil: Nochmals: Caesar, größter Feldherr?
21. Teil: Ergänzung: Ross und Reiter in der ›Germania‹ des Tacitus
22. Teil: Von Pharsalos nach Alexandria
23. Teil: Caesars Alexandrinischer Krieg
24. Teil: Caesar und Labienus im Afrikanischen Krieg
25. Teil: Der Zweite Spanische Krieg
26. Teil: Eingesehene Literatur
Das Buch
Caesars Kriegsführung erfreut sich bis heute größter Bewunderung. Seine ‚Milde‘ ist Legende. Er ist Star der Comic-Serie Asterix & Obelix. Ist sein Ruhm aber auch berechtigt?
Schulz hat sich jahrelang mit ihm auseinandergesetzt, drei umfangreiche Bände und etliche Aufsätze zu ihm publiziert. Sein Studium ließ ihn zu Urteilen gelangen, die sich mit der Tradition nicht vereinbaren lassen: Caesar verdankte sein Überleben nämlich bereits im ersten Kriegsjahr und danach wiederholt anderen.
Schulz weist Caesars Fehler nach, die dazu führten, dass, vollkommen vermeidbar, der Alexandrinische, Afrikanische und Spanische Krieg mit Zehntausenden von Toten geführt wurden. Sie ließen einen ratlosen Sieger zurück, der kaum noch ein Jahr am Leben blieb.
Das aktuelle Buch ist zwar wissenschaftlich geschrieben, aber auch für interessierte Laien gedacht. Es bietet einen genauen Überblick über die Karriere des Feldherrn, über seine Stärken und Schwächen, über sein Versagen und seine unbeschreibliche Unmenschlichkeit. Sämtliche Quellen wurden ins Deutsche übertragen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Schulz, der auch als Autor von Venedig-Krimis bekannt ist, verspricht neue Erkenntnisse innerhalb von spannender Lektüre, auch wenn das Werk von epischer Länge ist.
Gaius Julius Caesar
Inhaltsübersicht
Vorwort: Warum dieses Buch?
Grundlegendes
1. Die Germanenfrage
2. Das Germanenthema von Tacitus zu Prokopios
3. Kleine Reitkunde
4: Das Pferd der Germanen
5: Zur Psychologie des Pferdes
6. Ross und Reiter in Rom
7. Die Reiterei bei Caesar
7. 1: War Caesar ein Reiter? Seine Reisetätigkeit (58 – 49)
7. 2: Caesars Reiterei nach SCHAMBACH
7. 3. TAUSEND zur Herkunft von Caesars germanischen Reitern
7. 4: Die Reiterei der Bataver in den Historien des Tacitus
7. 5: Chariovalda, eine batavische Reiterlegende
7. 6. Waren die Bataver bereits in „Oberhessen“ beritten?
Der Hauptteil
1. Teil: Das erste Jahr des Gallischen Krieges
2. Teil: Das zweite Jahr des Gallischen Krieges
3. Teil: Das dritte Jahr des Gallischen Krieges
4. Teil: Das vierte Jahr des Gallischen Krieges
5. Teil: Das fünfte Jahr des Gallischen Krieges
6. Teil: Das sechste Jahr des Gallischen Krieges
7. Teil: Das siebte Jahr des Gallischen Krieges
8. Teil: Das achte Jahr des Gallischen Krieges
9. Teil: War Caesar der größte Feldherr Roms?
10. Teil: Germanische Reitkunst und Kurioses
11. Teil: Das erste Buch des Bürgerkrieges
12. Teil: Das zweite Buch des Bürgerkrieges
13. Teil: Curios Glück und Ende
14. Teil: Curios Tod, eine „griechische“ Tragödie?
15. Teil: Curio und die Wirklichkeit
16. Teil: Die Katastrophen der Cassius Longinus und Gaius Antonius
16. 1: Versagen und Tod des Quintus Cassius Longinus
16. 2: Die vergessene Katastrophe des Gaius Antonius
17. Teil: Der Tod des Sabinus; die erste ‚griechische‘ Tragödie
18. Teil: Das dritte Buch des Bürgerkriegs
19. Teil: Die Reiterei als bindendes Glied der Kommentarien?
20. Teil: Nochmals: Caesar, größter Feldherr?
21. Teil: Ergänzung: Ross und Reiter in der ‚Germania‘ des Tacitus
21. 1 Vorbemerkungen
21. 2: Ein Überblick
21. 3: Die Reiterei in Kapitel 6 der Germania
21. 4: Das sechste Kapitel der Germania (1. Teil)
21. 5: Die taciteische Sprache
21. 6: Das sechste Kapitel der Germania (2. Teil)
21. 7: Prokopios und die Reiter der Goten und Vandalen
21. 8: Niketas Choniates und der alamanische Ritter
22. Teil: Von Pharsalos nach Alexandria
23. Teil: Caesars Alexandrinischer Krieg
24. Teil: Caesar und Labienus im Afrikanischen Krieg
25. Teil: Der Zweite Spanische Krieg
26. Teil: Eingesehene Literatur
26. 1: Texte und Kommentare
26. 2: Weitere Literatur zu Caesar und Tacitus
26. 3: Lexika und Handbücher
26. 4: Sekundärliteratur
Gaius Julius Caesar
Glanz und Elend des Feldherrn
Vorwort: Warum dieses Buch?
Zweifellos ist Caesar eine der bekanntesten Gestalten der Weltgeschichte. Seine Karriere hat mich von Jugend auf in den Bann geschlagen. Die Früchte jahrzehntelanger Beschäftigung mit ihm waren zwei Caesar-Lektüren für den Schulunterricht, einige Aufsätze in Fachzeitschriften und drei umfangreiche wissenschaftliche Bände (ca. 1.000 Seiten; s. Bibliografie); von daher die Frage:
Genügt das nicht? Die Antwort muss lauten: leider nein! Alle obigen Werke sind nur in gedruckter Fassung erschienen. Um sie zu lesen, ist inzwischen der Gang zu einer Bibliothek erforderlich. Um jetzt dem Bedürfnis des modernen Lesers entgegenzukommen, habe ich mich daher entschlossen, all mein Wissen samt der weltweit geäußerten Kritik in einer digitalen Version zusammenzufassen.
Nun zur Frage, warum ich den Bericht mit Caesars Gallischem Krieg beginne. Die Antwort ist einfach: Ohne seine Karriere als Feldherr wäre Caesar als eine Gestalt dritter oder vierter Ordnung in die Geschichte eingegangen. Kaum etwas wüsste man von ihm. Alles, was er ist, ist er als Krieger. Nach dem Blutbad des Bürgerkriegs scheiterte er in der Errichtung einer persönlichen Diktatur. Erst durch die Adoption seines Großneffen ›Augustus‹ gab er der römischen Geschichte die entscheidende Wende. Doch davon, dass sich der junge Mann in einem noch mörderischeren Krieg durchsetzen würde, um dann die ›Kaiserzeit‹ einzuläuten, konnte er nichts wissen.
Ohne seine selbst oder von seinen Generälen verfassten Berichte über sein Wirken in Gallischen Krieg und danach im Bürgerkrieg wüssten wir nur einen Bruchteil dessen, was wir über ihn zu wissen glauben. Diese autobiografischen Werke werden daher im Mittelpunkt der Betrachtung stehen und sollen, was den Gehalt an Wirklichkeit angeht, auf Herz und Nieren geprüft werden.
Nebenbei bemerkt: Die unten folgende Abhandlung zu Caesar widmet sich ausführlich auch dem in allen Werken (außer meinen eigenen) fehlendem Thema ›Reiten, Pferde, Kavallerie‹. Indem es von den reiterlichen Laien einfach übergangen oder nur gestreift wurde, konnte man Caesars Kriegsführung nur lückenhaft wiedergeben. Die wenigen zu diesem Thema erschienenen Werke werden unten nacheinander besprochen und bewertet. Als gelernter Reiter mit einigen Jahrzehnten Erfahrung im Umgang mit dem Ross wage ich es, mir in dieser Frage das Urteil ›kompetent‹ zuzuschreiben.
Grundlegendes
1. Die Germanenfrage
Caesar schreibt im ersten Kapitel seiner Kommentarien über den Gallischen Krieg (1, 1,3-4):
»Von allen (Galliern) sind die Belger die tapfersten, (…) weil sie den Germanen am nächsten sind, die über dem Rhein wohnen, mit denen sie ständig Krieg führen. (4) Aus dem gleichen Grund übertreffen auch die Helvetier die übrigen Gallier an Tapferkeit, weil sie in fast täglichen Kämpfen mit den Germanen fechten: Sie wehren diese entweder von ihrem Land ab oder führen selbst in deren Land (über dem Rhein) Krieg.«
Mit diesen absichtsvoll voran gestellten Worten erinnert er den römischen Leser an den nur rund fünfzig Jahre zurückliegenden Sturm der vom rechten Rheinufer her ins Imperium eingebrochenen Kimbern, Teutonen und Ambronen, derer man nur Dank einem General Gaius Marius hatte Herr werden können. Im »Gallischen Krieg« 1, 33,4 vergleicht er nämlich den Einfall der Krieger des Ariovistus mit dem eben dieser einstigen Kimbern und Teutonen.
In Kapitel 1, 37,3 berichten ihm dann (angeblich) die Treverer, weitere Germanen unter den Brüdern Nasua und Cimberius (!) »versuchten, den Rhein zu überqueren.«
Im zweiten Buch (2, 29) des »Gallischen Krieges« hören wir, dass gewisse Atuatuker zur Nervierschlacht (2, 21-28) zu spät gekommen seien. Zu ihrer angeblich gut befestigten Stadt lenkt nun Caesar seine Armee, um sie zur Kapitulation zu zwingen. In diesem Zusammenhang berichtet er folgendes (§ 4):
»Diese (Atuatuker) selbst stammten von den Kimbern und Teutonen ab, die, als sie in unsere Provinz (Gallia Narbonensis, die heutige Provence) und Italien einmarschierten, (…) diesseits des Rheines (…) sechstausend Menschen zurückließen.«
Inzwischen waren daraus sage und schreibe 50.000 Atuatuker geworden. Caesar verkaufte diese »echten« Nachkommen der Kimbern und Teutonen nach ihrer Kapitulation gnädig in die Sklaverei (2, 33,7) anstatt sie zu töten. Indem er aber oben »diesseits des Rheines« schreibt, betont er indirekt, dass die Germanen stets von »jenseits des Rheines« her nach Gallien vordringen. Mit solchen oft wiederholten Worten hat er die Situation meisterhaft und für den antiken Leser leicht nachvollziehbar verdeutlicht.
Mangels anderer aussagekräftiger Quellen ist es bis heute nicht gelungen, den Germanen-Namen zu entschlüsseln. Nur einige Deutungen seien hier genannt: a.) germani (barbari), die wasch-echten Barbaren (LUND 1998); b.)lateinisch ›germani‹, was wortwörtlich entweder aus dem Gallischen oder dem Germanischen ins Lateinische übersetzt (worden) ist und die Bedeutung von »die leiblichen (Brüder)«, die »Brüder« hat (BIRT, SCHULZ und STÄDELE).
Hierbei bleibt ungewiss, ob sie von den Galliern so genannt wurden, als sie den Rhein überschritten hatten, oder ob sie sich selbst bereits schon vorher »Brüder« nannten. c.) Vielleicht ist der Name tatsächlich germanischen Ursprungs. Bewiesen werden konnte bisher keine der genannten Theorien. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass es sich beim Germanenbegriff um eine Erfindung handelt.
So aber definiert Caesar den Unterschied der Menschen beiderseits des Rheines: Links wohnen die Gallier, die schon erste Strahlen der griechisch-römischen Kultursonne verspüren, der aus römischer Sicht einzigen, insbesondere natürlich in der Provence, wo die Griechen der Zivilisation schon zum Einzug verholfen hatten, als Rom noch ein Bauernnest war. Aber auch im übrigen Gallien sind Ansätze der Kultur nicht zu leugnen. In dem im hohen Norden liegenden Land der Belger gibt es aber kaum Kultur (»Gallischer Krieg«, 1, 1,3), »weil (…) dorthin nur äußerst selten Kaufleute kommen und das, was die Leute verweichlichen lässt, importieren.«
Caesar stellt also ein stetes Kulturgefälle von Süd nach Nord fest, und weiter als bis kurz vor das Gebiet der Belger kommen keine Boten der römischen Lebensart mehr. Jenseits des Rheines, so muss es der antike Leser verstehen, leben nur noch unkultivierte Wilde, deren König Ariovistus (aus gallischem Munde) bei Caesar so charakterisiert wird: selbstherrlich, grausam, foltert brutal, ist »ein jähzorniger unberechenbarer Barbar« (»Gallischer Krieg«, 1, 31,12 f.): Hier gilt naturgemäß: ›ut rex ita grex‹ – wie der König, so die Herde.
Zunächst definiert Caesar in Buch 1, 1 die geographischen Umrisse seines Galliens. Es sind natürliche Grenzen: das Meer; Pyrenäen und Alpen; der Rhein. Er beschreibt dabei den Unterschied zwischen Kelten und Germanen. Welche Ausdehnung Germanien nach Norden und Osten hat, weiß er (noch) nicht. Spätestens seit den Feldzügen der Drusus, Tiberius und Germanicus (um die Zeitenwende herum) öffnete sich der Blick nach Osten. Tacitus beschreibt es in seiner um das Jahr 98 n. Chr. abgefassten »Germania« in Anknüpfung an Caesar so: Rhein und Donau; das Nordmeer; die offene Grenze im Osten (»Germania« 1); zurück zu Caesars Germanen:
In Buch 1, 1, 3 f. behauptet er, Belger und Helvetier seien tapferer als die sonstigen Gallier, weil sie weiter von der römischen Kultur entfernt und Nachbarn der Germanen seien. Daraus ergibt sich, dass Caesar den römischen Leser von der Gefährlichkeit der Germanen überzeugen will, was er durch folgende Wiedergabe der Worte von »Experten« zu untermauern versteht (»Gallischer Krieg« 1, 39); Caesar sagt, sie behaupteten, »die Germanen seien von riesiger Körpergröße, unglaublicher Tapferkeit und Übung in den Waffen.«
Nach dem anschließenden Sieg über ihre Armee unter Ariovistus (1, 52 f.) wendet sich Caesar wieder den Belgern zu. Die übrigen Gallier, so Caesar, meinten (2, 4,2), »die meisten Belger seien germanischer Abstammung und einst über den Rhein geführt worden.«
Unter ihnen gibt es, so Caesar, die kleineren Stämme der Kondruser, Eburonen, Kaeroser, Kaemanen, »die mit dem gemeinsamen Namen als Germanen (!) bezeichnet werden / sich selbst bezeichnen«. Hier bleibt unklar, ob sie sich selbst so nennen oder nur so genannt werden. Es ist also, von dieser Stelle ausgehend möglich, aber nicht sicher, dass Caesar bei ihnen den Germanen-Namen erstmals gehört und dann in erweitertem Umfang angewendet hat.
Zurück zu den Belgern: Unter allen Belgern sind die Nervier die tapfersten, wie Caesar in der Beschreibung der berühmten Nervierschlacht noch unter Beweis stellen wird. Caesar hört über sie (2, 15,4 f.), »Kaufleute hätten bei ihnen keinen Zutritt. Sie duldeten es nicht, dass Wein und andere Luxusartikel bei ihnen eingeführt würden. Sie seien Menschen von großer Tapferkeit.« Soweit zu den Germanenberichten in Caesars Buch 2.
In Buch 3 setzen die Germanenberichte vorübergehend aus, um in Buch 4 (4, 1) wieder einzusetzen: Plötzlich überschreiten die »die Germanen(stämme) der Usipeter und ebenso Tencterer« den Rhein: Caesar hebt bewusst (schulmeisterlich) den Namen »Germanen« hervor. An sich hätte es genügt, zu sagen, die Usipeter und Tenctherer seien »über den Rhein« gekommen. Aus der Heimat wurden sie (so er) von den Sueben vertrieben.
Caesar nutzt die Situation, hier eine Sueben-Ethnographie zu liefern, die er im sechsten Buch (6, 21-28) auf alle Germanen zur Anwendung bringt: Sie sind der größte und kriegerischste Stamm der Germanen, dem Tacitus 150 Jahre später die Kapitel 38-45 seiner »Germania« widmet. Caesar schreibt (4, 1,8): »Sie leben nicht viel vom Getreide, sondern zum größten Teil von Milch und Vieh (Fleisch) und sind viel auf der Jagd.«
Er charakterisiert sie (übrigens irrig) als Hirten und Jäger, die nebenbei mit dem Getreideanbau (»agricultura«) beginnen; immerhin spricht er ihnen die Sesshaftigkeit nicht mehr ab. Durch diese »barbarische« Lebensweise, so er, wüchsen sie zu gewaltiger Größe heran. Sie hätten sich daran gewöhnt, trotz Kälte nur im Lendenschurz herumzulaufen oder sich in eisige Flüsse zu stürzen (4, 1,9 f.). Natürlich ist den Kaufleuten der Zutritt auch ins Suebenland verwehrt, wo sie doch noch nicht einmal zu den Nerviern vordringen dürfen (4, 2,1). Der Grund ist seit Buch 1, 1,3 bekannt: Kultur lässt verweichlichen. Den Wein, ein entscheidendes Merkmal der mittelmeerischen Kultur, lassen sie schon gar nicht ins Land und saufen naturgemäß nur das barbarische Bier.
Nach den britannischen Abenteuern (Buch 4, 20 ff. Buch 5, 12 ff.), wo Caesar erneut seine ethnographischen Fähigkeiten unter Beweis stellt, fügt seinen Kommentarien die berühmten Exkurse über die Gallier (6, 1 ff.) und Germanen (6, 21 ff.) ein:
Was er oben den Sueben zugeschrieben hat, bringt er jetzt mit Ergänzungen auf alle Germanen in Anwendung: wilde Jäger; riesige Körper; baden in Flüssen; im Lendenschurz; Agrarkommunismus; Krieger, ständig auf Beutezügen unterwegs; neu: Führer und Gefolge; Gast ist heilig; im Herkynischen Wald leben »Einhorn« (nicht mit unserer Vorstellung zu vergleichen, da sich sein einziges Horn oben verzweigt), gelenkloser Elch und fast elefantengroßer Auerochse, den die Jugend mit besonderem Eifer jagt, und aus dessen erbeuteten (riesigen) Hörnern sie sie bei Gelagen betrinken.
Zu Beginn des siebten Kriegsjahres gerät Caesar in eine verzweifelte Lage, weil die Gallier unter Vercingetorix reiterlich drückend überlegen sind: Seine Lösung sieht dann so aus (7, 65, 4):
»Er schickt Boten über den Rhein nach ›Germania‹ (…) und holt von ihnen Reiter.«
Wie wir bei der Besprechung von Buch 7 sehen werden, war er mit ihrer Hilfe im Stande, Vercingetorix zu schlagen.
Im achten Buch ergänzt stellvertretend für Caesar der schriftstellerisch minderbegabte General Aulus Hirtius noch einiges über die Germanen, diese ruhelosen Gesellen, die sich notfalls von beiden Seiten anheuern lassen, um dann als Söldner gelegentlich gegen Ihresgleichen fechten. Damit enden die Berichte über die Germanen in den Kommentarien.
Unter Kaiser Augustus, Caesars Adoptivsohn, begann der Versuch, die Wildnis zwischen Rhein und Elbe zu erobern und zu romanisieren vielversprechend. Doch nach der Niederlage des Varus (9 n. Chr.) legte der Kaiser diesen Plan »ad acta«. In den Germanenkriegen, die mit den Feldzügen des Germanicus Caesar (Neffe des Augustus; Adoptivsohn des Tiberius) zu Beginn der Regierungszeit des Kaisers Tiberius fortgesetzt werden, um dann in Domitians Chattenkrieg und der Errichtung des Limes ihr Ende zu finden, lernen diese Wilden, dass sie einen gemeinsamen Feind haben:
Domitianus gelang die Eroberung der rechtsrheinischen Gebiete zwischen Rhein und Limes. Im Jahre 85 ließ er Münzen schlagen, mit der verlogenen Inschrift »Germania capta = Germanien ist erobert.« Publius Cornelius Tacitus war Zeitzeuge des Chattenkrieges. Man kann vermuten, dass er u.a. dadurch zum Publizieren seiner »Germania« im Jahre 98 n. Chr. angeregt wurde, denn fürs Erste war der Krieg ein Erfolg. Dann aber musste der stolze Römer zähneknirschend feststellen, dass es zugleich der letzte gewesen war und man nicht weiterkam.
Während der Germanenkriege begreifen die rechtsrheinischen Barbaren, dass Rom sie summarisch als »Germanen« bezeichnet. So nennen sich denn in der Zeit der Bedrohung die westlichen »Germanen« sogar selbst so, bis allmählich die Gefahr schwindet. Jetzt verliert der Name Sinn und Existenz. Die alte germanische Uneinigkeit bricht wieder hervor und vernichtet jede Solidarität. Arminius, »zweifellos Germaniens Befreier«, wie Tacitus (Annalen 2, 88) ihn nennt, wird von Landsleuten ermordet.
So viel scheint fest zu stehen: Caesar begründet seinen gallischen Eroberungsfeldzug mit der Begründung, Rom bedürfe eines Bollwerkes gegen die kaum zu besiegenden Germanen.
2. Das Germanenthema von Tacitus zu Prokopios
Auch Tacitus betont (»Germania« 2, 3), der Name »Germania« sei frisch und ihnen erst kürzlich gegeben worden. Seine weiteren Erklärungsversuche am Ende des zweiten Kapitels der »Germania« sind dunkel und vieldeutig. Nicht einmal in der Übersetzung der Stelle ist man sich einig. Viele Forscher haben sich an der bereits in der Textüberlieferung umstrittenen Stelle versucht. Kein einziger Satz der Literatur wurde häufiger kommentiert: Es gibt über 100 Einzelbeiträge; dazu die Lösungsvorschläge in den Germania-Kommentaren. Man wird davon ausgehen müssen, dass wir nie in der Lage sein werden, über mehr oder weniger fundierte Spekulationen hinauszukommen. Es handelt sich um eines der ungelösten und unlösbaren Rätsel der Literatur-Geschichte. Die weitere Ethnographie in der Germania ist nicht mehr unser Thema, aber es sei ein kleiner Seitenblick in die »Historien« des Tacitus gestattet:
Er berichtet (in 4, 59,2), der Bataverführer Civilis wolle ein »ein Gallisches Reich« errichten und fordere die Germanen auf, darunter auch die mittlerweile romtreuen Ubier (bei und in »Köln«), sich dem echten Germanen anzuschließen.
Die Bezeichnung »Germanen« war demnach rund 120 Jahre nach Caesar beiderseits des Rheines allgemein üblich. Daraus lässt es sich schließen, dass man den Germanenbegriff zunächst nur bei den oben genannten linksrheinischen Stämmen vorfand, ihn dann als auf alle rechts des Rheines lebende Barbaren ausweitete und so der römischen Propaganda den nötigen Begriff geliefert hat.
Weiterhin lässt die obige Stelle die Vermutung zu, dass die späteren »Germanen«, zumindest in der Nähe zum Imperium Romanum, diese Bezeichnung übernahmen und bei entsprechender politischer Lage zur Betonung der Gemeinsamkeiten anwendeten.
Wie weit der Name nach Norden und Osten vordrang, entzieht sich unserer Kenntnis. Im fernsten Skandinavien (Rom hielt es für eine Insel, die »insula Scandia«), wo man von Rom kaum etwas wissen konnte, war er gewiss nicht in Benutzung.
In den Jahrhunderten nach Tacitus findet sich in den Quellen kein Hinweis mehr auf Herkunft und Namensgebung der Germanen. Das lässt darauf schließen, dass man Caesar und Tacitus nichts hinzuzufügen imstande war. Umso gespannter darf man auf die Berichte des Historikers Prokopios sein, der über die (nach moderner Definition »ost-germanischen«) Völker der Goten und Wandalen sogar als Augenzeuge berichtete:
Prokopios von Kaisareia (um 500 bis nach 562) glaubt, »Germanen« sei ein ehemaliger Name für »Franken« (»Vandalenkrieg« 3), während er über andere germanische Völker folgendes schreibt: »Goten, Westgoten, Vandalen und die anderen gotischen Völkerschaften (…) wurden in früheren Zeiten auch Skythen (das ist die uralte Bezeichnung für die Osteuropäer) genannt.« (»Gotenkrieg« 4, 5). Wenig später betont er noch einmal, dass er Franken und Germanen gleichsetzt (»Gotenkrieg« 4, 20):
»Jedes dieser Völker, die schon immer zu beiden Seiten des Rheines (er widerspricht damit Caesar) gewohnt hatten, hatte seinen eigenen Namen. Nur eines hieß Germanen. Gewöhnlich bezeichnet man aber mit Germanen alle zusammen.«
Der Grieche Prokopios aus Kaisareia (heutiges Kaysari in der Westtürkei) hat also weder Caesars noch Tacitus’ Germanenberichte gekannt bzw. deren Germanenbild in seine Werke einfließen lassen:
Er war wohl inzwischen untergegangen bzw. bei der griechischen Geschichtsschreibung, die selber auf die Römer als Barbaren herabblickte, gar nicht erst zur Kenntnis genommen worden; und die alte Einteilung der Griechen war ziemlich leicht nachvollziehbar:
In Nordwesten die »Keltoi« (Kelten; Gallier); im Nordosten und Osten die »Skythen«; die (von Caesar) dazwischen geschobenen Germanen als eine eigene Völkerschaft fanden in der griechischen Geschichtsschreibung kaum oder gar keinen Widerhall.
Auch heute ist die gesamte, oben angesprochene Diskussion nur möglich, weil uns der Zufall Caesars »Gallischen Krieg« sowie die taciteische »Germania« erhalten hat: Ohne diese beiden wüssten wir über die antiken Germanen so gut wie nichts. Ohne das Wissen über sie hätte sich die moderne Forschung andere Definitionen als die heute üblichen suchen müssen.
Dieser Aussage widerspricht auch die Archäologie nicht, denn Funde (wie Keramik; Kunstwerke usw.) sagen nichts über das dahinterstehende »Volk« aus, wenn es nicht zusätzlich schriftliche Quellen gibt; ein Beispiel mag dies erläutern: In einem atomaren Krieg ist unsere Zivilisation untergegangen; einige Tausend Jahre später entdecken »Forscher« gotische Bauwerke in ganz Mittel- und Westeuropa; können sie damit auf ein bestimmtes »Volk« schließen?
3. Kleine Reitkunde
Der folgende Abschnitt hat seine Wurzeln in meinem ursprünglich geplanten Buch zum germanischen Pferd. Bald aber stellte sich heraus, dass es dazu ein breites Angebot von Beiträgen aus der Feder führender Prähistoriker und entsprechender Biologen gibt. Dennoch sollte man an dieser Stelle nicht ganz auf entsprechende Information verzichten. Für Prähistoriker mag der unten folgende Beitrag zu oberflächlich und zu kurz geraten sein; aber sie mögen sich auch nicht als Zielgruppe dieses Abschnittes ansehen. Mein Beitrag ist zur raschen Information reitunkundiger Leser gedacht.
Viele Jahrtausende lang waren das Pferd und Esel Begleiter des Menschen, bis die Motorisierung eine nachhaltige Entfremdung bewirkte. Auch wenn der Reitsport und das Freizeitreiten (beides wird nur von einer Minderheit ausgeübt) das durch Maschinen ersetzte Pferd bei uns vor dem Aussterben bewahrten, wissen doch nur noch wenige über Ross und Reiter Bescheid. Das hat dazu geführt, dass sich vor meinen Arbeiten kein Althistoriker mit dem reiterlichen Hintergrund bei Caesar und Tacitus beschäftigt hat. Die kleine Reitkunde ist daher zum Verständnis der folgenden Untersuchungen nützlich, insbesondere, da sie stets auf unser Thema hin zugespitzt ist.
Zur Evolution der Equiden
Vor 50 bis 35 Millionen Jahren findet sich die erste Spur der Equiden. Im Messeler Urpferdchen (ca. 25-45 cm groß) wird man das heutige Tier kaum erkennen: Erst vor 11-12 Millionen Jahren hatte sich die mittlere Zehe des amerikanischen (!) Pferdes allmählich verstärkt. Eine Gruppe dieses »Hipparion« (»Pferdchen«) wanderte über Landbrücken nach Eurasien und Afrika und starb dort wieder aus.
Inzwischen lief das in Amerika verbliebene Pferd nur noch auf der Mittelzehe (die anderen Zehen verkümmerten zu den festgewachsenen »Griffelbeinen«) und wurde zum Stammvater aller Equiden, der Einhufer: Seine Nachkommen sind (mit Unterarten) Esel, Halb-Esel, Zebra und das eurasische Pferd, von dem alle heutigen Haus-Pferde-Arten abstammen, auch das amerikanische Pferd, denn in seiner Stammheimat war es aus unbekannten Gründen längst ausgestorben, als europäische Siedler die Neue Welt betraten.
Alle Einhufer sind auch heute noch so eng miteinander verwandt, dass Kreuzungen jeder Art möglich sind. Die Produkte dieser Kreuzungen gelten als unfruchtbar, was aber im Einzelfall nicht gelten muss, denn der Versuch hat belegt, dass Maultierstuten (Mutter: Pferd; Vater: Esel) von Pferde-Hengsten gelegentlich erfolgreich gedeckt werden können, wie es ausführlich schon in Brehms Tierleben (IV, 101) geschildert wird. Heutige Züchter lassen es erst gar nicht so weit kommen, und im »finsteren Mittelalter« erschlug man solche Fohlen als »Hexenwerk« (Brehm ebd.).
Alle heutigen Haus-Pferde sind nur durch Auslese des Züchters entstanden. Sie sind Spielarten desselben Lebewesens und (zumindest theoretisch) miteinander zu kreuzen. Dabei könnte der Unterschied zwischen einem Kinderpony (Schulterhöhe bis zu 80 cm.) und dem britischen Kaltblüter (Shire Horse; bis 200 cm.) nicht größer sein.
Das vom Menschen noch nicht beeinflusste Pferd hat es vielleicht (Theorie) in folgenden Unterarten gegeben: dem Urpony; dem Tundrenpony; dem Ramskopfpferd; dem Urvollblüter, aus dem später das arabische Pferd, eine der ältesten Hauspferdearten, gezüchtet wurde. Das naturbelassene Pferd hat etwa die Größe heutiger »Kleinpferde« (Schulterhöhe bis 145 cm.) erreicht. Darauf reiten die Völker der Antike, die Araber und die Freunde des arabischen Pferdes sowie Mongolen, Isländer und viele Freizeitreiter noch heute.
Wie bestimmt man die Größe des Pferdes (oben war schon von »Schulterhöhe« die Rede)? Der Kopf kann von jedem Vierfüßler hoch und tief getragen werden. Also ist der maßgebliche Messpunkt der Schulterbereich, wo die nach oben gerichteten Dornfortsätze die höchste Stelle des Rückens, den ›Widerrist‹ bilden. Da ein Bandmaß, um den Leib des Tieres gelegt, ungenau wäre, benutzt man das ›Stockmaß‹, eine senkrechte Latte mit einer Skala und einem waagerecht angebrachten, verschiebbaren Querstab. Der korrekte Fachbegriff lautet also ›Widerristhöhe‹ (WRH). Reiter sagen jedoch lieber ›Stockmaß‹ dazu. Damit ist aber dasselbe gemeint.
Zur Domestikation des Pferdes
In dem unten folgenden Bericht gebe ich (mit Ergänzungen) die Forschungsergebnisse von Günther NOBIS wieder, der stets auch die Resultate seiner Fachkollegen berücksichtigt; weitere Literatur in REISS, WALKER und WIECOREK; s. Literaturverzeichnis.
Es liegen Beweise dafür vor, dass die Erstdomestikation des Pferdes in den Steppen diesseits und jenseits des Ural bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. erfolgte. Die europäische Domestikation fand auf dem Gebiet der Ukraine und in Südrussland statt. Dabei sind insbesondere die Funde von Dereivka am mittleren Dnjepr zu berücksichtigen:
Der osteologische Befund zeigt auf, dass das Pferd dort mit einem Anteil der Haustiere von ca. 74% vertreten war. Die C-14-Datierung verweist auf die zweite Hälfte des 4. und das beginnende 3. Jahrtausend v. Chr. Daraus ergibt sich folgendes:
Erstens war das Pferd das bevorzugte Schlachttier der Steppenbewohner. Zweitens dürfte es als Zugtier verwendet worden sein, da man es in der dortigen Ebene als Tragtier nicht benötigt (anders als z.B. im Gebirge, wo man den Wagen weniger gut verwenden kann).
Drittens ist damit der Beweis erbracht, dass es damals bereits geritten wurde, weil »sich eine Pferdeherde gar nicht anders als von Rücken eines Pferdes aus zusammenhalten lässt« (NOBIS 2000, 21).
Nobis weist darauf hin, dass man daselbst aus Hirschhorn geschnitzte Trensen gefunden hat: »Der frühe Gebrauch der Trense zeigt dies (sc. dass geritten wurde) zusätzlich an« (ebd.).
Aus genanntem erstem Ort der Domestikation gelangte das Hauspferd in alle Richtungen zu den anderen Kulturen. Im 4. Jahrtausend ist es schon im Karpatenbecken und Anatolien nachweisbar. Wenig später findet es in ganz Europa sein Zuhause:
»Die Domestikation des Pferdes gewann für die Menschheit auf vielen Gebieten rasch an Bedeutung. (…) So schuf sich der Mensch mit dem Pferd als Zug- und Reittier zum ersten Mal in seiner Geschichte ein Transportmittel, dessen Geschwindigkeit seine eigene weit übertraf« (Nobis ebd. 23). Dadurch war ab sofort derjenige im Krieg überlegen, der das Pferd einsetzen konnte. Dies geschah im 2. Jahrtausend v. Chr. im alten Orient:
Dort wurde ein kleines »Pferd« schon zwischen 1.900 und 1.700 v. Chr. vor den Kampfwagen gespannt, wie man der »Standarte von Ur« entnehmen kann. Die darauf abgebildeten Zugtiere sind wohl keine Pferde, sondern eher ›Halb-Esel‹ (asiatischer Einhufer, der im Exterieur dem Przewalski-Wildpferd nähersteht als dem Esel. SANDERSON (266) sagt dazu:
»Den Halbesel haben wahrscheinlich die Sumerer vor 5.000 Jahren als Zugtier gezähmt.«
Man könnte dieses Tier ebenso gut als ›Halb-Pferd‹ bezeichnen. Sogar seine Stimme schwankt zwischen dem Wiehern des Pferdes und dem i-a-Schrei des Esels. Er wurde zur gleichen Zeit wie das eigentliche Pferd domestiziert.
»Das militärische Reiten bürgerte sich erst später ein, etwa ab 1.200 v. Chr.« (Nobis, ebd. 23).
Hier darf aber auch der bereits erwähnte Esel nicht vergessen werden, das meistgenannte Tier der Bibel. Obwohl er kleiner, dafür aber zäher und anspruchsloser als das Pferd ist, kann er als ausdauerndes Reittier aus der Geschichte der Menschheit nicht weggedacht werden: Mose und Jesus sind die berühmtesten Eselreiter der Geschichte. Doch auch im Mittelalter war der Graue hinter dem Haus das Pferd des kleinen Mannes. In Sizilien oder Ägypten reitet man bis heute auf ihm und darf das auch ohne schlechtes Gewissen tun, so zäh und kräftig ist das Tier.
Seinen Ruf als »störrischer dummer Esel« verdankt er nur der Züchtung und traditionell sehr grausamen Behandlung durch den Menschen, von der man im Eselsroman des römischen Autors Apuleius (»Metamorphosen«; 3. Jh. n. Chr.) einen unvergesslichen Eindruck erhalten kann. Der Wildesel in freier Natur hingegen ist ein intelligentes, wieselflinkes, trittsicheres Tier, kaum kleiner und kaum weniger ›edel‹ als das antike Pferd. Der Bericht des Xenophon (4. Jh. v. Chr.) in seiner ›Anabasis‹ ist sprechend dafür. Halbverhungert versuchen die unter seiner Führung stehenden Krieger vergebens, solch einen Leckerbissen zu fangen.
Seit alters züchtet man das Maultier (Mutter: Pferd) und den Maulesel (Mutter: Esel). Diese sind aus Pferd und Esel gekreuzte ›Bastarde‹, die als zähe, trittsichere Reit- und v.a. Tragtiere bis heute Verwendung finden; legendär die Maultierabteilungen der italienischen Alpini (Hochgebirgstruppe).
Von großer Bedeutung für unser Thema sind die Funde, die der Hippologe VITT im Altaigebirge machte (5. bis 1. Jh. v. Chr.). Hier zeigt der osteologische Befund Widerristhöhen von bis zu 170 cm, also bereits die heutiger Großpferde. Die Züchter im Mittelmeerraum brachten es nur auf Höhen von bis zu 150 cm. mit einem Mittelwert von ca. 140 cm, kleiner als ein heutiger Haflinger.
Das Pferd ist aus der Geschichte der Etrusker – viele Darstellungen in Tarquinii – und der Römer ebenso wenig wegzudenken wie aus dem Leben der alten Griechen (vgl. Xenophons Pferdebuch; 4. Jh. v. Chr.). Im antiken Hellas zeugen Dutzende von Namen, die mit Hippo- bzw. Hippe- beginnen oder mit -ippos bzw. -ippe enden von der überwältigenden Wertschätzung des Pferdes (griechisch: ›hippos‹), die ihre Dokumentation in nie mehr erreichtem Niveau auf den Reliefs des Athener Parthenonfrieses erfährt.
Die schönheitsbesessenen Griechen züchteten ihr Idealpferd hart am Rande der Inzucht: NOBIS weist auf dortige Pferdeskelettfunde mit Schädel-Degeneration hin. Auch im germanischen Raum verbreitete sich die Pferdezucht in den Jahrhunderten v. Chr. Weil man das Ross im rauen Klima ganzjährig draußen ließ (wesentlich kostengünstiger), verzwergte es, wurde kompakt und wetterfest und war schließlich noch kleiner als das mediterrane.
Insgesamt gesehen ist folgendes zu beachten: Das Pferd wird seit fast 6.000 Jahren gezüchtet, als Militärpferd aber offenbar erst seit gut 3.000 Jahren. In Europa blieb es über das ganze Mittelalter dem ritterlichen Adel vorbehalten. Erst in der neueren Geschichte gelang es reicheren Bauern, es zum wuchtigen Ackergaul umzuzüchten, während die deutschen Kleinbauern noch bis in die fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts mit Kühen arbeiteten, denn die wiederkäuenden Rinder mit ihrem mehrteiligen Magen sind bessere und damit wirtschaftlichere Futterverwerter als das Pferd, das demnach auch noch in der Neuzeit eher ein Kamerad des Menschen bzw. vor der allgemeinen Motorisierung sein Statussymbol blieb.
Aus den schweren Pferden der Landwirtschaft wurde dann durch Vollbluteinkreuzungen (arabisches Pferd) das moderne Sportpferd (bei uns v.a. der Hannoveraner, Holsteiner, Oldenburger, Trakehner, Westfale und Württemberger; das hessische Landesgestüt Dillenburg wurde leider geschlossen) gezüchtet.
Für das Militärpferd gilt naturgemäß damals folgendes: Die Kavallerie ist der teuerste Truppenteil. Dies hat folgende Gründe: Der Reiter benötigt die gleiche Verpflegung wie der Infanterist. Das Pferd frisst Berge von Heu oder Gras, säuft eimerweise Wasser und benötigt bei großer Zahl zusätzlich Stallungen samt Stallknechten.
In Caesars Werk sind überall, wo er eine Rast einlegt, die »pabulatores« (Futterholer) unterwegs, um Reit-Pferde und Tragtiere, oft genug Maultiere, zu verpflegen. Dazu benötigt man Reitknechte, die nicht zur kämpfenden Truppe gehören und dennoch ernährt werden müssen. Weiterhin ist zu beachten, dass man Reservepferde braucht, insbesondere, weil das Ross aufgrund des nicht erfundenen Hufeisens nur begrenzt einsetzbar ist und in Abständen geschont werden muss, damit das Horn nachwachsen kann. Andernfalls geht es auf dem von Huf umschlossenen ›Strahl‹ und lahmt.
Im Mittelalter war das Kampfpferd im Rücken so hart, dass der Ritter größere Strecken auf seinem ›Zelter‹ (Tölter) zurücklegte und das Turnierpferd oder Schlachtross als Handpferd am Strick mitnahm. Hier war der Aufwand noch größer.
Weiterhin braucht man Sattler, die das Zaumzeug und die Satteldecken/Sättel in Schuss halten. Schließlich darf nicht vergessen werden, dass Wasser das wichtigste Nahrungsmittel ist. Pferde verbrauchen davon Unmengen. Heutige Stallpferde erhalten sogar im Winter allein abends bis zu 10 Liter: Wehe, wenn kein Bach oder Fluss in Lagernähe war! Dann konnte man die Kavallerie vergessen, sie das durch Wassermangel verursachte Desaster der Kreuzfahrer bei den ›Hörnern von Hattin‹ zeigt.
Insgesamt gesehen kann man sagen, dass der Reiter das Vielfache des Fußsoldaten kostet und beim Transport zu Wasser zusätzliche Probleme bereitet, weil für einen Reiter der mehrfache Transportraum gegenüber dem Fußsoldaten bereitgestellt werden muss.
Daher ist es verständlich, wenn es Caesar jahrelang versucht, mit einem Minimum an Reitern auszukommen. Schließlich fügt er sich ins Unvermeidliche und gewinnt seine Schlachten nur noch mit Hilfe der Kavallerie.
In seinem Werk »Der Bürgerkrieg« (1, 39, 2) gibt er die Größe seiner Kavallerie mit 6.000 Mann an. Hinzu kommt noch seine reiterliche Garde von 900 Reitern (1, 41,1).
Zu Beginn seines ›Ersten Spanischen Krieges‹ verfügte er also über rund 7.000 Reiter. Zu versorgen waren gewiss über 10.000 Pferde, 7.000 Reiter und vielleicht 3.000 Mann zur Betreuung. Daraus kann man entnehmen, vor welche Probleme ihn diese Truppe stellte und welch immensen Wert er inzwischen der einst als Stiefkind seiner Armee behandelten Abteilung zumaß.
Die Gangarten des Pferdes
Auf der Weide geht das Pferd gemächlich grasend in der Gangart Schritt. Die Fußfolge ist diese: hinten links – vorne links; hinten rechts – vorne rechts. Der Schritt ist bequem zu sitzen, aber man kommt nicht schneller als ein tüchtiger Fußgänger voran, besonders auf Kleinpferden, deren Beine nicht länger als die des Menschen sind. In der Antike war es also üblich, dass die Reiter einträchtig mit der Fußtruppe marschierten und dabei das Pferd führten, insbesondere schon deshalb, weil sie die mangels Steigbügel herunterhängenden Füße beim Reiten nicht ausruhen konnten und froh sein konnten, absteigen zu dürfen.
Der Trab gilt als mittleres Tempo, kann aber bis zum Renntrab gesteigert werden: Jeweils zwei Hufe setzen diagonal auf: hinten rechts mit vorne links – mehr oder weniger kurze Schwebephase – hinten links mit vorne rechts usw.; bevorzugt beim Aufmarsch der Kavallerie anlässlich einer Parade.
Der Trab ist ein Zweitakter: Der Rücken des Pferdes wird bei jedem Sprung diagonal nach oben gewölbt. Dabei wird der ungeübte Reiter geworfen, d.h. er hebt bei jedem Trabsprung ab und fällt dann in den Sattel bzw. dem Pferd ins Kreuz.
Bei kleineren Pferden kann dies der Reiter ohne Steigbügel, ja sogar ohne Sattel auch auf Langstreckenritten aushalten, ohne sich – wie bei den härteren modernen Großpferden – an der Wirbelsäule des Pferdes ein blutiges Gesäß zu holen. Das antike reine Reit- und Reise-Pferd kam seit dem 16. Jahrhundert aus dem Mittelmeerraum nach Amerika. Es hat eine ungebrochene Tradition und geht weiche Gangarten, die unser Turnierpferd nicht kennt.
Insgesamt gesehen ist der ausgesessene Trab auch auf Kleinpferden weniger angenehm. Man entging ihm in Antike und Mittelalter mit bequemeren Gangarten, gewöhnlich mit dem jetzt aus Island zurückgekommenen ›Tölt‹ oder den gebrochenen Trab, ›Trabtölt‹ genannt. Der weltberühmte Mark Aurel auf dem römischen Kapitol reitet im Trabtölt (SCHULZ 2012). Beide sanfte Gangarten hat man in der Antike geschätzt und schätzt sie bis heute in Lateinamerika und den US-Südstaaten. Beim ›Trabtölt‹ setzt das Ross die Hufe zwar diagonal auf, aber nicht synchron wie beim echten Trab, sondern nacheinander. So bleibt der Rücken wunderbar weich und schwingend für seine Majestät, den Kaiser.
Heutige Reiter der britischen Reitschule, die aus der Kavallerie der Neuzeit hervorging, die nur Rösser mit einer Widerristhöhe ab 165 cm. zulässt, entgehen der Härte des Trabes durch das Leichttraben, d.h. durch rhythmisches Aufstehen in den Steigbügeln.
Da der Steigbügel auch in Roms kaiserlicher Kavallerie noch unbekannt war, steckte der Reiter zwischen vier Hörnchen auf dem Sattel fest und versuchte damit, im Gefecht oben zu bleiben. Für den mittelalterlichen Recken bauten man den ›Stecksattel‹ zu einem Ungetüm mit Rückenlehne aus, damit er nicht von der gegnerischen Lanze vom Ross gefegt werden konnte. Solch mächtige Sättel waren noch in der Renaissance in Mode, wie man am Monument des Colleoni zu Venedig sehen kann.
Wenn das Pferd übrigens nur im gemächlichen Trab geht, wie das auf langen Strecken erforderlich ist, geht es nicht schneller als ein geübter Läufer. Mit Pferden Vertrauten ist es ein Vergnügen, neben dem trabenden Pferd im Takt mit den Vorderbeinen des Pferdes einher zu joggen. Pferde mögen das. Daraus folgt für den Militärhistoriker, dass eine im Laufschritt vorrückende Armee mit der Kavallerie (mit kleinen Pferden) ohne Weiteres Schritt halten konnte.
Die variabelste Gangart des Pferdes ist der Pass: Er ist dem Pferd z.T. angeboren, z.T. anerzogen. Die Chinesen kannten schon im 1. Jahrhundert v. Chr. Passrennen, wie sich aus dem ›fliegenden Pferd‹ aus dem Distrikt Kansu schließen lässt (BASCHE S. 86 f.).
Wie der Trab kann auch der Pass vom Schritt-Tempo über eine mittlerer bis zur Renngeschwindigkeit gesteigert werden. Der Passgang und seine Varianten waren und sind nicht im militärischen Gleichschritt ausführbar. Sie sind mit der modernen Kavallerie unvereinbar und wurden daher bei uns ausgemerzt. Das spanische Ross der ›pura raza‹ z.B. wird ›bestraft‹ (geschlagen), wenn es in Pass oder Tölt übergeht, bis es diese Gangarten vermeidet.
Wie der Trab ist auch der Pass eigentlich ein Zweitakter, aber die Beine werden diesmal lateral bewegt: hinten links mit vorne links – hinten rechts mit vorne rechts usw. Der reine Pass ist noch unbequemer als der Trab. Im Unterschied zum ihm lässt sich seine Härte kaum vermeiden. Ferner ist das Pferd dabei langgestreckt, leicht schaukelnd, aber manchmal noch schneller als im Galopp, wie man bei amerikanischen Passrennen (Fahrer im Sulky) oder beim rasanten isländischen Rennpasser sehen und erleben kann.
Wer aber bequem – ohne den Luxus von Sattel und Steigbügel – reisen wollte, benutzte früher neben dem bereits genannten ›Trabtölt‹ des Mark Aurel den ›gebrochenen Pass‹, der unter verschiedenen Namen verbreitet ist. Er ist – vergleichbar dem gebrochenen Trab – ein bequemer Viertakter. Die Fußfolge ist diese: hinten links – vorne links – hinten rechts – vorne rechts usw. geht es im Stakkato, eins, zwei, drei, vier usw. Der Reiter wird sanft geschüttelt, ja, schwebt geradezu daher, ganz gleich, ob er gemütlich reitet oder mit Renngeschwindigkeit davon prescht, vom Schritt-Tempo bis zur Geschwindigkeit von ca. 50 km/h, ideale Gangart für Ungeübte und vor allem sattellos Reitende, darunter naturgemäß die Reiter der Antike, welche nämlich, wie sämtliche Darstellungen zeigen, steigbügellos und ursprünglich auch sattellos ritten. Sie tölteten oder trabtölteten, in Nord und Süd, auch im gesamten Mittelalter noch.
Das seit rund tausend Jahren rein gezüchtete Islandpferd geht diesen den ›Tölt‹ und hat ihn auf dem europäischen Kontinent wieder heimisch gemacht. Inzwischen gibt es aber auch die luxuriösen Tölter aus Amerika, wie die einst berühmten Fernseh-Rösser Black Beaut, Flicka und Fury.
Als schnellste Gangart gilt der Galopp, den auch die antiken Reiter zum Angriff benutzten, wie zahllose Monumente des triumphierend über einen Barbaren hinweg sprengenden römischen Reiters zeigen (SCHLEIERMACHER passim):
Man unterscheidet in Rechts- und Linksgalopp. Die Fußfolge des Rechtsgalopps ist diese: hinten links (Absprung) – hinten rechts gemeinsam mit vorne links – vorne rechts; beim Linksgalopp: hinten rechts (Absprung) – hinten links gemeinsam mit vorne rechts – vorne links. Der Galopp ist ein Dreitakter und trotz großer Geschwindigkeit sogar vom sattellosen Reiter recht gut auszusitzen. Gute Reiter mit guten Pferden können aber auch eindrucksvoll langsam im ›versammelten Galopp‹ reiten.
Der Sattel
Ein Pferd ohne Sattel mit daran hängenden Steigbügeln ist für reiterliche Laien unvorstellbar. Und dennoch war es ein weiter Weg bis zum modernen auf den jeweiligen Zweck zugeschnittenen Sattel. Es lässt sich leicht vorstellen, dass Sattel und Steigbügel das Reiten erleichtern. Der Sattel samt Steigbügel soll eine Erfindung der Skythen (legendäres östliches Reitervolk) sein:
»Die berühmte Vase von Tschertomlyk zeigt auf einem Bildfries (…) ein Pferd, das einen Sattel trägt, an dem ein Riemen hängt, der an seinem unteren Ende in eine Schlaufe einzumünden scheint. Diese Darstellung wird auf etwa 300 v. Chr. datiert und lässt sich als ältestes Zeugnis für den Steigbügel (…) interpretieren« (BASCHE 102).
Wie das Wort sagt, diente der Steigbügel (in Deutschland früher auch ›Stegreif‹ genannt) ursprünglich als Hilfe beim Aufsteigen, denn ohne Steigbügel muss der Reiter aufs Pferd springen oder benötigt eine Treppe bzw. ein Podest, um hochzukommen, wenn ihm niemand hilft.
Bei Langstreckenritten konnten sich die Beine in den Lederschlaufen ausruhen, wodurch die bei steigbügellosen Reitern besonders von Abnutzung betroffenen Hüftgelenke geschont werden. Beim Kampf wurde aber auf diese instabile Hilfe verzichtet. Die Gefahr, sich darin zu verwickeln und bei einem Sturz vom in Panik flüchtenden Pferd zu Tode geschleift zu werden, war viel zu groß. Hübsch hier die griechische (namensgebende) Sagengestalt des Lysippis, d.h. ›der vom Pferd (zu Tode) Geschleifte.
Das neben den Skythen zweite antike Reitervolk, die Sarmaten, war nach unseren Quellen stark gepanzert und kämpfte in Formation, wie ein Vorbote der schweren Reiterei der byzantinischen Spätantike und des Mittelalters, allerdings offenbar ohne Schild, um die Lanze beidhändig zu führen. Tacitus (Historien 1, 97, 1-4) berichtet über die sarmatischen Rhoxolaner im Gefecht gegen die Römer:
»Umso kühner konnten die Rhoxolaner, ein sarmatischer Volksstamm, der im Winter zuvor zwei (sc. römische) Kohorten niedergemacht hatte, voller Hoffnung in Mösien (südlich der Donaumündung) einfallen, an die 9.000 Reiter stark (…). Bei den Römern war (aber diesmal) alles zum Kampfe gut vorbereitet. So kam es, dass die in ihrer Beutegier weit verstreuten (…) Sarmaten, deren Pferde auf den schlüpfrigen Wegen ihre sonstige Behändigkeit verloren, gleichsam festsaßen und zusammengehauen wurden.
Es ist nämlich merkwürdig, wie die ganze Tapferkeit der Sarmaten mit dem einzelnen Mann eigentlich nichts zu tun hat. Im Einzelkampf zu Fuß gibt es nichts Feigeres als sie. Wo sie aber in Schwadronen (d.h. in fester Formation) heran geritten kommen, gibt es wohl kaum eine Kampflinie, die ihnen standhielte. Aber damals herrschte regnerisches Tauwetter. So konnten sie weder ihre Lanzen noch die übermäßig langen Schwerter, die sie beidhändig führen, gebrauchen, denn ihre Pferde glitten aus, und sie selbst waren durch das Gewicht des Schuppenpanzers belastet.
Dieser (…) aus Eisenblechstücken und sehr hartem Leder zusammengefügte Waffenrock ist zwar hiebfest. Doch den (…) zu Boden geworfenen Leuten war er beim Aufstehen hinderlich. (…) Der römische Infanterist aber (…) durchbohrte (…) mit seinem Leichtschwert im Nahkampf die (…) durch keinen Schild gedeckten und daher wehrlosen Sarmaten.«
Tacitus führt uns hier das Bild einer den Römern, Galliern und Germanen unbekannten ›Kataphraktenreiterei‹ vor Augen, abgeleitet von griechisch »katáphraktos = gepanzert«. Der Einzelne ist nichts, gemeinsam sind sie unaufhaltsam. Was er als Feigheit ausgibt, ist nur die Unfähigkeit der schwer gepanzerten Krieger, zu Fuß kämpfen zu können. Im Nahkampf unter Fußsoldaten – Brust an Brust – ist das überlange Reiterschwert vollkommen unbrauchbar, weil als Stichwaffe zu lang. Wenn der Krieger damit aber beidhändig vom galoppierenden Pferd herunter zuschlägt, verheerend.
Die antiken Römer übernahmen zögerlich nur den Sattel. Steigbügel kannte auch ihre kaiserliche Reiterei, wie gesagt, noch nicht. Man gab sich mit dem ›Hörnchensattel‹ zufrieden, der alle Tests bei HYLAND und JUNKELMANN bestanden hat. Die Germanen hingegen benutzten nach Caesar nicht einmal einen Sattel bzw. Pferdedecke. Dazu meint Junkelmann (II. S. 111) kennerisch:
»Am angenehmsten ist das Reiten ohne Sattel und Steigbügel (gemeint: auf Kleinpferden mit schwingendem Rücken). Eine Satteldecke sollte allerdings sein, um den Pferdeschweiß abzuhalten.«
Nur unter gleich guten Reitern, so Junkelmann, sei der im Sattel sitzende dem sattellosen leicht überlegen. Im Übrigen hat der experimentierfreudige Historiker auch das ›römische‹ Reiten ohne Sattel und ohne Hosen ausprobiert und empfand es als angenehm. Er hätte es noch viel angenehmer empfunden, wenn er einen Tölter geritten hätte; eine Lücke in seinem großartigen Werk.
Einen solchen Tölter sehen wir z.B. schon auf der Münze eines Aemiliers (RRC 419/1) aus dem Jahre 61 oder 58 v. Chr. Das Pferd des im Stuhlsitz hockenden Reiters, der eine Satteldecke unter sich hat, geht konzentriert, energisch und raumgreifend von links nach rechts. Drei Hufe sind (scheinbar) am Boden. Das linke Vorderbein zuckt hoch. Die Gangart ähnelt dem amerikanischen ›Flat-Foot-Walk‹, wie sie noch heute bei den Rangern üblich ist. Allerdings ist dem Künstler das linke Hinterbein zu lang geraten, ein Fehler in der Anordnung der Perspektive, wohl, um alle drei Hufe auf einer Linie unterzubringen. Außerdem ist der Hals des Pferdes für einen Tölter zu weit nach hinten gebogen. Der Kopf wird zu tief heruntergezogen. Dies geschieht wohl, um Ross und Reiter harmonisch im Rund der Münze unterzubringen. Caesar berichtet, die Germanen hätten kein »ephippium« (Pferdedecke) benutzt. Er wertet das so:
»Nichts ist ihrer (der Germanen) Meinung nach schändlicher und fauler, als eine Satteldecke zu benutzen. Daher wagen sie es auch, eine unbegrenzt hohe Zahl von Reitern mit Satteldecken anzugreifen, selbst wenn sie nur wenige sind.«
Solches Reiten war freilich nur möglich, weil sie (wie bei Reitervölkern üblich) im Unterschied zu Caesars Legionären Hosen trugen. Dennoch sind Zweifel an Caesars Darstellungen angebracht:
Nach einem energischen Ritt hätte der Germane seine vom stinkenden Pferdeschweiß völlig durchnässten Hosen in getrocknetem Zustand an die Wand lehnen können, so vollgesogen wären sie gewesen. Selbst die von CATLIN authentisch beschriebenen Indianer schnallten dem Ross ein Fell um.
Die Hosen haben im Laufe der Zeit übrigens sämtliche römischen Legionäre der im kalten Norden stationierten Armeen – Infanterie wie Kavallerie – von Germanen und Galliern übernommen und besonders im Winter schätzen gelernt.
Die Trense
Der Pferdekopf ist stark in die Länge gestreckt. Vorne im Maul stehen die Schneidezähne, mit denen es das Gras abbeißt. Dann kommt eine Gebisslücke vor den Mahlzähnen, über der die Mundwinkel liegen. Wer den Einfall hatte, dem Pferd hier einen Strick und irgendwann einen knöchernen oder später metallenen Querstab hineinzulegen, bleibt ein Rätsel. Wenn nun diese ›Trense‹ (meist zweiteilig mit Gelenk über der Zunge) in zwei Ringen ausläuft, kann sie leicht mit Riemen am Kopf befestigt werden (Trensenzäumung). Von jedem Ring seitlich des Pferdemaules läuft ein weiterer Riemen oder einfach ein Strick zur Hand des Reiters. Dieser kann durch Ziehen an diesen ›Zügeln‹ auf die empfindlichen Mundwinkel des Pferdes einwirken. Scharfe Trensen sind insbesondere für den Krieger notwendig, um das Pferd ›halten‹ zu können, damit es nicht in Panik davonläuft oder kopflos in den Feind stürmt. Ansonsten wird der gute Reiter möglichst wenig Gebrauch von der Trense machen und das Pferd eher durch Gewichtsverlagerung und Schenkelhilfen lenken, um es nicht abzustumpfen: ›Hilfen‹: Schenkelhilfen; Zügelhilfen; Hilfen durch Gerte; durch Sporen; Paraden = kurzes oder verstärktes Annehmen der Zügel = halbe bzw. ganze Parade, um das Pferd a.) aufmerksam zu machen; b.) um es anzuhalten.
Wenn ein Reiter denkt, ›das Pferd macht nicht, was ich will‹, heißt das nichts anderes als, ›ich war nicht in der Lage, dem Pferd per Hilfen meinen Willen mitzuteilen. Pferde durch Zureden zu bestimmten Manövern zu bewegen, ist kaum möglich: Der Krieger muss im Gefecht auf die Zügelhilfen ganz verzichten, um beide Hände zum Kampf freizuhaben.
Über die Ausrüstung der germanischen Pferde, von der angeblich fehlenden Pferdedecke abgesehen, schweigt Caesar. Dazu könnte man zwei Erklärungen anbringen:
Entweder ist ihm nichts Besonderes aufgefallen, oder es handelte sich um reittechnische Dinge, die auch in Rom vorausgesetzt wurden und daher von den antiken Ethnographen übergangen werden konnten: Zweiteilige Ringtrensen waren schon seit der Bronzezeit in Mittel- und Osteuropa üblich. Auch die Germanen benutzten diese bis heute verbreitete Art, die aber von Roms Kavallerie zum komplizierten Hebelstangengebiss weiterentwickelt wurde.
Reitersporn und Gerte
Das Pferd kann von Natur aus nicht so leicht wie z.B. der Hund auf bestimmte Zurufe reagieren. Also muss es zu allen Gangarten und Bewegungen hauptsächlich durch reiterliche Einwirkungen (Hilfen; s.o.) veranlasst werden. Damit es voran geht, muss es der Reiter ›treiben‹. Dies geschieht durch Schenkel- und Absatzdruck. Die Wirkung des Absatzes, insbesondere bei ›faulen‹ Pferden lässt sich durch Anschnallen eines Sporns am Reitschuh steigern:
Der Sporn ist ein von Absatz aus nach hinten gerichtetes Metall. Es kann spitz oder stumpf sein, je nach Bedarf. In Mittelalter und Neuzeit kommen noch drehbare Sterne oder Rädchen am Sporn-Ende hinzu, um die Wirkung zu steigern; für das Pferd mit gelegentlich sogar blutiger Quälerei verbunden. Heutige Sporen sind breite, stumpfe Eisen; jetzt aus Kunststoff bzw. hartem Gummi. Der Freizeitreiter benutzt sie überhaupt nicht.
Dem Pferd ist der Sporn (Plural: die Sporen; sing. lat. calcar) unangenehm. Deshalb wird der Reiter die Sporen maßvoll einsetzen, damit das Pferd nicht abstumpft und eines Tages auf den Einsatz der Sporen nicht mehr reagiert.
Gleiches gilt für die Reitgerte, die ursprünglich nichts anderes ist als eine biegsame Weidenrute. Das Pferd fürchtet die Gerte und wird schon auf Antippen mit Gehorsam reagieren. So gehört auch die Gerte im weiteren Sinn zu den Hilfen: Indem das Pferd bereits feinem Druck mit ihr ausweicht, zeigt es sich gehorsam. Beim Kampf ist der Krieger auf den freien Gebrauch beider Hände angewiesen. Er muss freihändig reiten. Der Einsatz der Gerte wird schwierig. Die Indianer hatten sie am Handgelenk befestigt (s. CATLIN, 1844).
In germanischen Fürstengräbern fanden sich – im Gegensatz zu Tacitus’ Behauptung (Germania 27, 1) »dem Leichen-Feuer mancher Krieger wird auch das Pferd beigelegt«, – überhaupt keine Pferde, aber »Sporen aus Gold und Silber« (WENSKUS 425). Sie beweisen, dass die Adeligen, denn wer sonst konnte sich ein Ross leisten? beritten waren, ja, dass sie das Reiten als typisch für ihren Stand empfanden. Man vermutet, dass sie die Sporen von den Kelten übernommen haben. Eine besondere Kleidung und Bewaffnung des germanischen Reiters ist nicht nachweisbar, und seine Gerten sind zu Staub zerfallen. Die ›Germanen‹ waren kein Reitervolk.
Übrigens kannten die Völker der Antike noch kein Hufeisen. Der Pferdehuf ist aber nach innen und im hinteren Teil offen. Der aus Horn bestehende Teil des Hufes ist selbst hufeisenförmig und entspricht in seiner Rundung unserem Nagel des Mittelfingers bzw. der Mittelzehe. Wenn er sich auf hartem Untergrund abnutzt, geht das Pferd nicht mehr schmerzfrei, denn der ›Strahl‹, das weiche Innere des Hufes, ist nicht mehr geschützt. Das Pferd muss außer Dienst gestellt werden, bis genügend Horn nachgewachsen ist. Umgekehrt sollte der Reiter mit einem entsprechenden Messer den Huf zurückschneiden oder mit einer Feile abraspeln, wenn das Tier zu lange im Stall gestanden hat, wie es bei der Kavallerie der römischen Armee im Winter der Fall war, damit das Ross auf den zu lang gewachsenen Hufen nicht umknickt. Auf dem damals meist weichen Geläuf wurde der Huf übrigens nicht so rasch abgenutzt, wie das heute (Asphalt; Beton; Schotter) der Fall wäre.
4: Das Pferd der Germanen
Die Prähistoriker der Biologen sind aufgrund der Knochenfunde in der Lage, das germanische Pferd zu rekonstruieren. Dabei sind je nach Methode Schwankungen möglich (Details dazu in: Ambros-Müller; Driesch; Lvine; Bökönyi; Vitt; McFadden; Meadow-Uerpmann; Mennerich; Nobis 1955 – 1984 und 2000 in Thein; Reichstein Bd. 1.; Reichstein, in: RGA 23, 2003, 29-34; Uslar; Waldmann; alle im Literaturverzeichnis).
Von Bedeutung sind v.a. die Auswertungen der Knochen von der Wurt ›Feddersen Wierde‹ bei Cuxhaven: Früher gab es keine Seedeiche. Bei Flut wurden weite Landstriche überschwemmt. Das Anlegen von Straßen war sinnlos. Die Priele (Wasserläufe, die ins Binnenland reichen und sich bei Flut füllen) waren die wichtigsten Verkehrswege. Um dort leben zu können, legten die Bewohner erhöhte Siedlungsplätze an, die ›Wurten‹. Deren berühmteste ist die ›Feddersen Wierde‹. Im Schlamm konserviert fanden sich dort nämlich die Fundamente eines germanischen Dorfes. Schon Plinius d. Ä. (23-79 n. Chr.) wusste von den Wurten der Chauken im heutigen Ostfriesland zu berichten (Nat. Hist. 16, 2-4).
Besonders auf der Feddersen Wierde konnte nachgewiesen werden, dass sich die Pferde in Norddeutschland i.W. nicht von den skandinavischen unterschieden und man daher durchaus von einem ›germanischen‹ Pferd sprechen kann:
Der Prähistoriker REICHSTEIN (I., 169 und 174) folgert daraus, dass die Germanen an der Nordseeküste bewusst keine Römerpferde importierten, denn sie konnten mit ihrem wetterfesten Pferd zufrieden sein und hätten bei der dort üblichen Freilandhaltung nichts vom klimaverwöhnten mediterranen Ross gehabt.
Die typischen Pferde der Feddersen Wierde hatten eine durchschnittliche Widerristhöhe von 128, 8 cm, fast 10 cm. weniger als das Römerpferd (REICHSTEIN I. S. 162 f.). Demnach können wir uns das ›Nordpferd‹ gut in Gestalt eines kleineren heutigen Islandpferdes vorstellen, das ohne Stall den eisigen Winter der Insel besser verträgt als die Wärme Italiens. Sein Winterfell wirkt so isolierend, dass ihm der Schnee auf Rücken und Mähne liegen bleibt, ohne zu schmelzen. (Hier sei ergänzend gesagt, dass der Isländer aus den verschiedensten Typen, gerade wie ihn der Nordmann mitbrachte, ›zusammengerasst‹ ist. Dabei formte das Klima eine neue Pferdeart, die den Winter auf der Insel verträgt, ganz von selbst.
Das ursprüngliche Pferd in Gallien und Britannien (den klassischen Ländern der Kelten) war noch kleiner (REICHSTEIN I. S. 164 f.) als das Nordpferd, viel kleiner als der Isländer, das heutzutage kleinste noch von Erwachsenen gerittene Ross. Doch zu Caesars Zeiten hatten die Kelten, den Römern benachbart, schon größere Pferde importiert, während die germanische Zucht unverändert blieb und aus den oben genannten Gründen bleiben musste.
Auch für die späteren Jahrhunderte ändert sich der Befund kaum: Im Gebiet östlich der Elbe untersuchte man die Pferdeknochen aus der Zeit zwischen dem vierten und zehnten Jahrhundert. Für die früheste Gruppe (4./5. Jh.) ermittelte man eine durchschnittliche Widerristhöhe von 135,5 cm. Auch im zehnten Jahrhundert hatten die Pferde im ehemals urgermanischen Bereich nur ein Stockmaß von ca. 138,6 cm, woraus auf keine zielgerichtete Pferdezucht zu schließen ist. Wenn man sich also die Bronzestatuette Karls d. Gr. anschaut (aus Metz; jetzt im Louvre), stellt man fest, dass der nach seinem zeitgenössischen Biographen Einhard (Eginhard) großgewachsene Herrscher aus unserer Sicht auf einem ›Pony‹ töltet:
Der Bildhauer hat, falls es wirklich Karl d.Gr. sein sollte, keinen Fehler gemacht, sondern alles authentisch dargestellt, denn die Pferde des frühen Mittelalters hatten gerade erst die Größe der antiken römischen sowie die Größe des heutigen Isländers eingeholt.
Römer- Gallier- und Germanenpferde fanden nach der blutigen Bataverschlacht (die Bataver lebten im Rheindelta und galten als gute Schwimmer; sie erhoben sich 69/70 gegen Rom und wurden besiegt) ein gemeinsames Grab, das man bei Krefeld-Gellep entdeckte und Günther NOBIS (Köln) erforschte:
Der osteologische Befund weist Tiere von 117 bis satte 154 cm Stockmaß auf, mit der Gemeinsamkeit, dass sie alle Hengste waren, die im Dienst des Menschen den Tod auf dem Schlachtfeld gefunden hatten. Hengste sind aggressiver als Stuten, daher im Krieg besser zu verwenden. In der Nähe von Stuten können sie allerdings aufgrund ihres Imponiergehabes unberechenbar werden. Daher kann man im Kampf keine gemischte Herde einsetzen. Wallache (kastrierte Hengste) haben in der Antike offenbar nur die in der östlichen Steppe lebenden Sarmaten eingesetzt. JUNKELMANN hat bei seinen Epoche machenden Versuchen meist Hengste verwendet und mit ihnen bessere Erfahrungen als mit Wallachen gemacht.
Von den einunddreißig Gelleper Pferden waren nur drei sehr klein. Wer welche Pferde ritt, war jetzt die Frage, die unbeantwortet bleiben musste. Jedenfalls sind die gefallenen Römerpferde in der Überzahl. Es wird sich aber mangels Quellen nicht ermitteln lassen, ob die Bataver mehrheitlich zu Fuß kämpften oder ob sie die besseren Reiter waren und daher geringere Verluste erlitten oder ob sie von einer durch importierte Pferde veränderten Zucht profitierten. Die Knochen geben keine Auskunft darüber. Bemerkenswert ist freilich, dass die Bataver nicht im ›Freien Germanien‹ mit seiner konservativen Pferdezucht lebten, sondern schon seit Generationen im römisch-gallischen Grenzland und den Römern Reiter stellten.
Insgesamt gesehen hat die moderne Biologie keine Zweifel daran, dass es schon im Altertum im gesamten Norden des europäischen Kontinents ein Pferd gab, das dem Klima gut angepasst war und sich bei Wind und Wetter, Sturm, Frost und Hitze ganzjährig im Freien aufhalten konnte: das bereits genannte Nordpferd (VOLF S. 577). Es stellte dort das einzig wirkungsvolle Verkehrsmittel dar, und für entlegene Gebiete Norwegens mit seinem Fjordpferd gilt dies noch heute. Der Einwohner der Insel Island seinerseits ist mit seinem Pferd so verbunden, dass ›Isländer‹ maskulin den Menschen, feminin das Pferd bedeutet, wie mir der dänische Freund Allan A. Lund aus Kopenhagen schrieb.
Die skandinavische Prähistorie führt in diesem Zusammenhang auch das ›Gotlandperd‹ an, benannt nach der Insel Gotland in der Ostsee (alle Daten nach BASCHE S. 519): Zusammen mit dem britischen Exmoorpferd dürfte es zu den urtümlichsten Hauspferderassen zählen. Ähnliche Tiere hat man aus dem Gletscher-Eis geborgen (bis ca. 40.000 Jahre alt). Es hat einen geraden, mittellangen Kopf, leichten Hals, deutlich aufragenden Widerrist, eine abgeschlagene Kruppe (d.h. Gesäßbacken schräg abwärts geformt), feine, aber feste Beine und erreicht ein Stockmaß von bis zu 120 cm. Es ist meist dunkelbraun, kennt aber auch andere Farben und kann einen erwachsenen Reiter tragen.
Auch das britische Exmoorpferd stammt von eiszeitlichen Vorfahren ab und gilt als bis heute rein erhalten (?). Skelettfunde zeigen, dass es sich in den letzten 10.000 Jahren kaum verändert hat. Es besitzt einen kleinen Ponykopf, kleine Ohren, einen kurzen kräftigen Hals, wenig Widerrist, einen kräftigen Rücken (guter Lastenträger), eine abgerundete Kruppe, tiefe, breite Brust, starke Beine mit harten, kleinen Hufen. Im Stockmaß differiert es zwischen 115 und 130 cm. Es gilt als robustes Kleinpferd, auf dem auch normalgewichtige Erwachsene ohne schlechtes Gewissen reiten dürfen. Hier sollte auch noch das hübsche irische ›Connemara-Pferd‹ erwähnt werden, dessen Zucht ebenso alt ist.
Die hier angeführten Pferdearten führen uns vor Augen, auf welchen keineswegs minderwertigen Tieren Gallier und Germanen daher sprengten oder genießerisch die bequemen, der modernen Reitschule abhanden gekommenen Gangarten genossen, denn »im Laufe der Kriegsgeschichte hat es sich gezeigt, dass kleine unscheinbare Pferde in mancher Hinsicht großen überlegen waren, vor allem was Ausdauer, Genügsamkeit und Wendigkeit anbetrifft. Kleine Pferde sind nicht nur zäher als große, sie gewähren dem Reiter auch einen angenehmeren Sitz in allen Gangarten.
Wenn die Germanen zur Zeit der Römer ein auch für damalige Verhältnisse kleines Pferd ritten, so ist es dennoch ein weit verbreiteter Irrtum, wenn es heißt, sie hätten eine ›Wildpferdeart‹ benutzt, denn es bedarf generationenlangen Züchterfleißes, bis ein Hauspferd entsteht. Der Hinweis auf das leicht zu zähmende ›Mustang‹ ist leicht zu widerlegen: Als die Europäer nach Amerika kamen, war das Pferd dort ausgestorben. Das neue ›Wildpferd‹ rekrutierte seine Mitglieder aus entlaufenen europäischen Hauspferden.
Das Germanenpferd war also ein vielseitig verwendetes Haustier, das seinen mannigfaltigen Aufgaben sowie dem Klima gut angepasst war. Man züchtete es als Tragtier, zum Reiten, als Opfertier, und – wenn man Appetit darauf hatte – schlachtete und verzehrte man es ohne Gewissensbisse. Vor Wagen und Pflug spannte man aber die erprobten Ochsen. SCHMIDT (S. 259) schreibt dazu:
»Dabei zeigt sich, dass unter den Schlachttieren (der Germanen) das Pferd mit 12,7 % (…) vertreten war. Auffällig war bei diesen eine hohe Quote der Jungtiere.«
Der moderne Leser stutzt und staunt. Ausgerechnet die Germanen verzehrte jede Menge an Pferdefleisch?! Zum Leidwesen heutiger Deutscher, die sich vor Pferdefleisch ekeln, ohne es probiert zu haben, war es tatsächlich so, und vor allem die Nordmänner auf Island kannten nur Pferdefleisch, da Ziegen, Rinder und Schweine dem Klima dort nicht gewachsen waren.