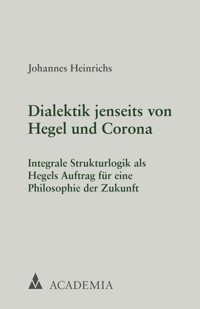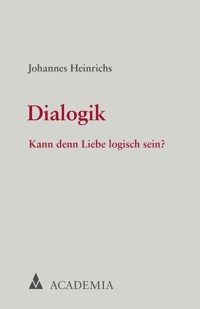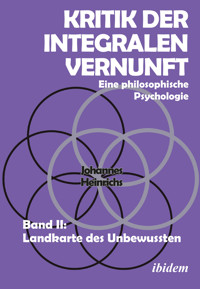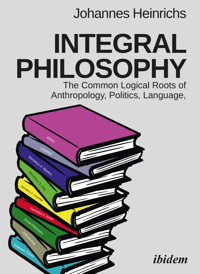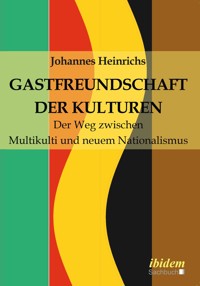
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In keinem anderen europäischen Staat ist die Debatte um die eigenstaatliche kulturelle Identität so schwierig zu führen wie in Deutschland. Vor dem Hintergrund des Narrativs des Multikulturalismus unternimmt Johannes Heinrichs gegen Parteipolitik, gegen politisches Lagerdenken und gegen die allgemeine Hysterie den Versuch einer nüchternen, dem Denken verpflichteten Untersuchung dessen, was eine deutsche Primär- oder gastgebende Kultur ausmacht. Dabei stellt er als Thesen auf, für die er eine genaue Begründung bietet: · Multikulturelle Gesellschaft im Sinne einer völligen Parität verschiedener Kulturen unter Aufgabe von Sprachgebieten ist weder realistisch möglich noch eine wünschenswerte Form menschlichen Miteinanderlebens. Multikultur ohne die Unterscheidung von gastgebender Kultur und Gastkultur wäre in Kürze eine Unkultur. · Ein vertieftes, aufgeklärtes Bewusstsein kultureller Identität hat mit Nationalismus nichts gemeinsam. Im Gegenteil, es ist Voraussetzung für Multikultur. Eine gastgebende Kultur, derer sich die Gastgeber bewusst sind, ist nach Heinrichs sogar Voraussetzung für die Integration von Immigranten einschließlich ihrer je eigenen (Gast-)Kulturen. Das Bewusstsein um die Rolle der gastgebenden Kultur bedeutet dabei keineswegs ein nationalistisches Überlegenheitsgefühl, sondern schlicht den unerlässlichen Gemeinschaftsgeist, der sich in Sitten und Gebräuchen äußert, zuerst und zuvörderst in der Verwendung einer gemeinsamen Sprache. Von Einwanderern ist daher auf Dauer eine kulturelle Integration zu verlangen – was jedoch nicht bedeutet, dass sie ihre mitgebrachten Kulturen zu verleugnen bräuchten. Diese genießen als Sekundärkulturen Gastrecht in der gastgebenden Primärkultur, auch wenn die Einzelnen als solche nicht bloß Gäste bleiben. Solche sich aus der Vernunft ergebenden Grundregeln werden sowohl von linken Multikulti-Ideologen wie von rechten Nationalisten missachtet – aber zugleich auch von Mitte-Politikern noch immer ignoriert. Das vorliegende Buch stellt die zweite, um zwei Essays und ein Resümee erweiterte Neuauflage der Erstausgabe von 1994 dar, die so klar- und weitsichtig verfasst wurde, dass sie in beinahe schon unheimlicher Weise aktuell ist, nicht zuletzt durch die Migrationskrise. Johannes Heinrichs' Analyse von kultureller Identität, in der er den Begriff einer gastgebenden Primärkultur Jahre vor der Leitkulturdebatte einführte, leistet einen grundlegenden und wichtigen Beitrag zu einer Versachlichung der Diskussion um Einwanderung und »Leitkultur«. Als Ergänzungen sind folgerichtig beigefügt · der Aufsatz Kulturelle Solidarität – der unerkannte Kern des Migrationsproblems, in welchem Heinrichs Pflichten zur sowie Bedingungen und Voraussetzungen für kulturelle Gastfreundschaft analysiert, · ein kritischer offener Brief an Bassam Tibi anlässlich der aktualisierten Neuauflage von Tibis Buch Europa ohne Identität (2016), mit dessen Erstausgabe dieser im Jahr 1998 den Begriff der Leitkultur geprägt hat, · ein Resümee »Ergebnisse und Ergänzungen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I. Gastfreundschaft der Kulturen Multikulturelle Gesellschaft in Europa und deutsche Identität. Eine aktuelle Einmischung (1994)
1. Der aktuelle Zwang zur Selbstbesinnung
Die Situation und an wen sich diese Schrift wendet
Das Problem deutscher Identität
Die Rolle des Denkens
Ein Blick in die »Aufklärungs«-Literatur
2. »Politische Kultur« und »Verfassungspatriotismus«
Habermas' Genügen an »politischer Kultur«
Dahrendorfs Unterscheidung von »Bürgernation« und »Volksnation«
3. Systemtheoretische Grundlagen
Die Unterscheidung der Subsysteme Wirtschaft, Politik, Kultur, Weltanschauung
Die traditionelle Integration der Gemeinschaften im Religiösen und ihre Überwindung in der Moderne
Nationale Integration allein durch Politik?
Abschaffung der nationalen Identitäten?
Herkunft – Sprache – Geschichte – Kultur
4. Zur Deutung deutscher Identität
Goethe neben Schiller und Fichte: prophetische Aktualität und Defizite
Hegel vor Marx: der tragisch verleugnete Denker Deutschlands
Hölderlin vor Heine: »So kam ich unter die Deutschen ...«
Die Spannungseinheit von Klarheit und Tiefe: Heideggers »Fall« und Jaspers Klarsicht
Sri Aurobindos Zeugnis aus indischer Sicht
5. Bedeutungen von »multikultureller Gesellschaft« (Thesen)
Die Thesen in Übersicht
Zu These 1: Nationale Identität als Kulturfrage
Zu These 2: Nation in der Nation aufgrund von Abstammung und/oder Religion?
These 3: Selbstaufgabe der deutschen Kultur?
Zu These 4: Die notwendige Unterscheidung von gastgebender (primärer) Kultur und Gastkulturen (sekundären Kulturen)
Zu These 5: Parität verschiedener Kulturen auf demselben Gebiet?
Zu These 6: Bewusstsein kultureller Identität als Voraussetzung für Gastfreundschaft
Zu These 7: Multikultur als paritätische Begegnung der Nationalkulturen.
6. Ausblicke: »Integration-durch-Differenzierung«
Festung Deutschland und Europa?
Demokratie als kommunikative Gesellschaft
II. Kulturelle Solidarität – der unerkannte Kern des Migrationsproblems
»Hereinlassen des Anderen« als ontologische Struktur der Kommunikation
Die Bedingtheit der Gastfreundschaft
Menschenliebe und Verantwortung als ethische Grundlage der Gastlichkeit
Notwendige Unterscheidungen
Erwartungen an Immigranten
Unklarheit von »multikulturell«
Moderne Nation: Kulturgemeinschaft, nicht primär Abstammungsgemeinschaft
Das systemtheoretische Raster
Differenzierung als Spezifikum Europas
Folgerungen für eine Gastfreundschaft der Kulturen
Das Doppelspiel der Halb-Immigranten
Fazit in einigen Leitsätzen
III. Gastgebende Primärkultur versus Leitkultur Ein Offener Brief an Bassam Tibi
Ist die derzeitige Zuwanderung der Flüchtlinge echte Einwanderung?
Ethnisch-abstammungsmäßiges Nation-Verständnis in Deutschland vorherrschend?
Autobiografische Einbettung eines kulturellen Nationenbegriffs
Das existentielle Erleben der Staats-Kirche-Verquickung in Deutschland
»Gastfreundschaft der Kulturen«: Gastgebende Kultur und Gastkulturen
Ihr Sprachgebrauch von »jüdisch«
Unbeachtete kulturelle Okkupation im Namen des bloß politischen Nationenbegriffs
Fazit zur »Leitkultur«
IV. Ergebnisse und Ergänzungen
Das unverzichtbare systemtheoretische Raster
Die Unterscheidung von gastgebender Primärkultur und Gastkulturen
Der Zirkel von Anerkennungserwartungen und »Bringschuld« der Migranten
Transkulturalität? Zum Beitrag von Seyran Ateş
Die Bedeutung der Reflexions-Systemtheorie für die Europa-Politik
Impressum
Vorwort
Der ibidem-Verlag bringt dankenswerter Weise als ersten Teil des vorliegenden Buches mein Bändchen Gastfreundschaft der Kulturen inunverändertem Nachdruck, das 1994 im Verlag Die Blaue Eule (Essen) erschienen ist. 1994 wurde besonders die Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen der »gastgebenden Kultur« und den »Gastkulturen« der Migranten in ihren Konsequenzen hervorgehoben – 4 Jahre, bevor Bassam Tibi den Begriff der »Leitkultur« in einem ganz anderen, von Politikern wie Friedrich Merz gründlich umgedeuteten Sinne in die deutsche Diskussion brachte.
Obwohl das Buch damals an maßgebende Politiker verschickt wurde und die Politik sich »naturwüchsig« in etwa in die Richtung des hier Vertretenen, nämlich gegen ein gedanken- und kulturloses Multikulti entwickelte, fand es kein Echo in der großen Presse. Dies trotz der damals schon gegebenen brennenden Aktualität des Themas. Dieses hat durch die sprunghaft zugenommene Zuwanderungsbewegung mit dem vorläufigen Höhepunkt 2015 enorm an öffentlicher Beachtung gewonnen. Es ist die Hoffnung des Autors, das fast traumatische Erlebnis des gänzlichen Ignoriertwerdens seiner Positionen zu einem so wichtigen Thema im Klima des angeblich »herrschaftsfreien Diskurses« durch diese Neuausgabe überwinden zu können. Wobei es nicht um persönliche Befindlichkeiten geht, sondern um allgemein relevante Erfahrungen mit der Herrschaft des Zeitgeistes, der sich derzeit als ein Geist der Vorurteile, der Denkfaulheit und des Durcheinanders zum Schaden unseres demokratischen und kommunikativen Gemeinwesens erwiesen hat.
Auf die (bis auf wenige Zusätze und die Streichung des so nicht mehr aktuellen damaligen Kapitels 6) wortgetreue Dokumentation des Textes von 1994 folgen: ein Artikel Kulturelle Solidarität – der unerkannte Kern des Migrationsproblems von 2016 aus »Aufklärung und Kritik« (1/2016) und ein Offener Brief an Bassam Tibi anlässlich der Neuauflage seines Buches Europa ohne Identität?, ebenfalls aus dieser Zeitschrift (2/2017). Ein für dieses Buch neu geschriebenes Schlusskapitel versucht nochmals die wichtigsten Aspekte der im Grunde einfachen Unterscheidungen und doch sehr komplexen Thematik auf den Punkt zu bringen.
Zur Erläuterung des Titels sei gegen ein Missverständnis hier schon betont: Nicht die einzelnen Migranten sollten Gäste in unserem Land bleiben (wie B. Tibi es von sich sagt), sondern die mitgebrachten Kulturen als solche. Das Prinzip der wechselseitigen »Gastfreundschaft der Kulturen«, bei jeweiliger Unterscheidung von Gastgebender Kultur (als feste Wortprägung groß geschrieben) und Gastkulturen, erlaubt Buntheit und ermöglicht Freundschaft – doch ohne die letztlich kulturlose Nivellierung des faktischen oder gewollten, meist undefinierten Multikulti.
»Alle Häuser würden nur Gräber sein, wären sie nicht für Gäste.«
So ist es auch mit den Nationen. Das Buch The Prophet von Khalil Gibran, aus dem die Worte stammen, wurde mir von meinem muslimischen Freund Ali geschenkt, bevor wir in Jerusalem auseinandergingen. Dieser moderne, liberale Student lehrte mich, wie einfach der Islam doch sei oder vielmehr sein könne – »im Unterschied zu dem, was ihr Christen alles glauben müsst«. Als ich nach dem Abschied im Flugzeug saß, begann der Krieg von 1973. Jüdische und muslimische Freunde sollten sich plötzlich als Feinde betrachten. Sollte ich Ali Klaibo, der damals aus dem umkämpften Gebiet in die USA auswanderte, je wiedertreffen, werde ich ihm dieses Buch als späte Gegengabe schenken. Es sei ihm und unserer Gastfreundschaft gewidmet.
Duisburg, am 20. Juli 2017Johannes Heinrichs
Editorische Hinweise:
Literaturangaben ohne Namensnennung stammen vom Verfasser.
Pfeile vor einzelnen Stichworten wollen auf definitionsartige Einführung bzw. Abwandlung dieser Begriffe aufmerksam machen.
I. Gastfreundschaft der KulturenMultikulturelle Gesellschaft in Europa und deutsche Identität. Eine aktuelle Einmischung (1994)
»Was deutsch ist, das ist zusammengehalten nur durch die deutsche Sprache und das sich in ihr kundtuende geistige Leben ( ... ) Das Politische ist darin nur eine Dimension, und zwar eine unglückselige, von Katastrophe zu Katastrophe gehende Geschichte. Was deutsch ist, das lebt in dem großen geistigen Raum, geistig schaffend und kämpfend, braucht sich nicht deutsch zu nennen, hat keine deutschen Absichten und keinen deutschen Stolz, sondern lebt geistig von den Sachen, den Ideen, der weltweiten Kommunikation. Wie darin etwas Haltbares und wahrhaft Politisches möglich sei, das hat sich im Mittelalter gezeigt in der im Abendland verbreiteten Freiheit.«
Karl Jaspers, 1953
Alle Verkürzung der Vernunft ist Verlängerung der Gewalt.
J. H.
1. Der aktuelle Zwang zur Selbstbesinnung
»Die multikulturelle Gesellschaft hat zur Voraussetzung nicht nur Multi, sondern auch Kultur. (...) Internationale Kultur gibt es nur in Addition und Potenzierung je eigener nationaler Kultur« (Günther Nenning, Die Nation kommt wieder, Osnabrück 1990).
Die Situation und an wen sich diese Schrift wendet
Durch Deutschland geht eine Welle von Gewalttaten. Kein vernünftiger Mensch kann sie gutheißen, diese mörderischen Ausschreitungen von Hünxe, Hoyerswerda, Rostock, Mölln, Solingen, neuerdings Magdeburg usw. Die Tage, an denen ich diese Überlegungen zur »multikulturellen Gesellschaft« und zur deutschen Identität zu schreiben beginne, sind von sich täglich mehrenden Schreckensnachrichten über Brandanschläge auf Häuser und Wohnungen »ausländischer« Mitbürger verdüstert. Wohin soll das führen? Die ausländische Presse wittert ein Neuerwachen alter »deutscher« Geister – oder gibt vor, sie zu wittern. In anderen Ländern mögen Hunderte oder Tausende aus »rassischen« Gründen bedroht, gefoltert und ermordet werden, gar von Staats wegen. Geschieht in Deutschland eine einzige Brandstiftung aus ausländerfeindlichen Motiven durch die Hände von halbmündigen Randalierern, ist dies eine Witterungsgelegenheit für die Artikelschreiber der ganzen Welt.
Den meisten Deutschen sind die Vorgänge peinlich. Viele möchten am liebsten von ihrer deutschen Identität ganz abrücken und sich aus dieser unangenehmen Schicksalsgemeinschaft davonstehlen. Ihnen würde Deutschland als Wohlstandsparadies vollauf genügen. Doch sie, wir alle, gehören dazu und zwar natürlicherweise, d.h. vor jeder persönlichen Wahl und beinahe unabhängig von dieser. Das gibt es sonst nur noch als Mitgliedschaft in einer Großkirche, aber mit viel fraglicherem Recht und mit der Möglichkeit des Austritts als Erwachsener. So wie wir als Babys nicht gefragt werden konnten, ob wir Deutsch oder vielleicht Englisch oder Chinesisch lernen wollten, so auch nicht, ob wir Mitglieder dieser nationalen Schicksals- und Kulturgemeinschaft werden wollten. Dabei sehe ich jetzt noch von den in Deutschland geborenen oder lange hier lebenden »ausländischen« Mitbürgern ab.
Während sich bei der großen Mehrheit Beschämung ausbreitet, gibt es ein Feld von »Sympathisanten«. Der Ausdruck war Ende der siebziger Jahre für das soziale Umfeld des RAF-Terrorismus üblich. Zweifellos ist das Sympathisanten-Umfeld der Attentäter auf Asylbewerberheime und türkische Wohnungen bedeutend größer. Die Republikaner und ihre potentiellen Wähler können als solche Sympathisanten angesehen werden. Das heißt etwa ein Zehntel der wahlberechtigten Bevölkerung. Ist diesen nun sämtlich zu bescheinigen, dass sie nicht zu den »vernünftigen« Menschen gehören? Es ist schwer, sich vorzustellen, dass von diesem Zehntel der wahlberechtigten Bevölkerung auch nur wenige Prozent aktiv Verbrechen an ausländischen Mitbürgern begehen würden. Es scheint aber durch Umfragen und Hochrechnungen ermittelt worden zu sein, dass die Hälfte dieser »Sympathisanten« den Verbrechen mehr oder weniger bewusst zustimmt. Doch das unbewusste Gewährenlassen und Im-Grunde-gut-und-verständlich-Finden – das ist es, was den weiteren Begriff des Sympathisanten ausmacht. Bei den Jugendlichen scheint die Zustimmung oder Akzeptanz der Verbrechen noch höher zu sein.
Mir persönlich bleibt unverständlich, warum gewisse rechtsradikale Vereinigungen, die eindeutig gewalttätige Gesinnungen fördern, nicht »großzügiger« verboten und ihre Versammlungen unterbunden werden. Das Fernsehen zeigt Bilder von offensichtlichen Schlägertrupps oder Teilen davon, die unter Polizeiaufgebot vor den Autonomen sowie den aufgebrachten, verängstigten »Ausländern« geschützt werden. Muss das Recht wieder einmal zur Unterhöhlung demokratischer Umgangsformen dienen? Wo bleibt die vielbesungene »wehrhafte« Demokratie gegenüber einer verschwindenden Minderheit von Rechtsterroristen, die nicht weniger gefährlich ist als die einstigen Linksterroristen? Dies ist das einzige Mal, wo ich der Einfachheit halber selbst die Nicht-Begriffe »rechts« und »links« ungeschützt verwende. Ich halte diese Alternative heute für den Ausdruck von Denkfaulheit.
Unsere persönliche Wahl besteht hauptsächlich in geistiger und seelischer Stellungnahme, bei den meisten fast rein emotional. Bei einigen hat zugleich Denken, wahrhaftig kein Feind der Emotionen, eine Chance.
Emotionen müssen genauso kritisch betrachtet und korrigiert werden wie Gedanken. An solche, die Kopf und Herz (mit Gefühlen und Intuitionen) in Verbindung zu bringen vermögen, wendet sich diese Schrift. Denn die ganze Diskussion um die Ausländerfrage ist so emotionalisiert und polarisiert, dass dies allein schon einen Missstand darstellt: Es gibt anscheinend nur Ausländerfreundliche und Ausländerfeindliche. Auf beiden Seiten scheint alles klar zu sein. Bezieht man eine differenzierte, im Grundton ausländerfreundliche, doch zugleich national- und kulturbewusste Position, setzt man sich zwischen die Stühle und erntet beiderseits Unverständnis. Ich spreche aus leidiger Erfahrung, auch aus Erfahrung mit Zeitungsmachern und Verlegern. Nur in echten Diskussionen, etwa mit Studenten, die noch denkoffen sind, stellt sich oft nach heißer Debatte eine weitgehende Übereinstimmung über den eigentlich ganz klaren, fast selbstverständlichen »goldenen« Mittelweg heraus. Aber Goldgräberarbeit ist schwer heutzutage, inmitten von journalistischer und intellektueller Ramschware.
Das Problem deutscher Identität
Das Problem liegt selbstverständlich viel tiefer, als Polizeimaßnahmen reichen können. Weit über die Prozentzahlen hinaus ist festzustellen: Es gibt ein alle betreffendes Problem deutscher Identität, das heißt deutschen Selbstverständnisses und deutscher Kultur. Sonst würden wir uns nicht so schwer tun mit »Multikultur«, was immer das unklare Schlagwort bedeuten mag. Die aktuellen Ereignisse zwingen uns in vielleicht heilsamer Weise zur Selbstbesinnung. Wo findet öffentliche Selbstbesinnung wirksam und qualifiziert statt, über Betroffenheitsbekundungen und Interessenäußerungen hinaus? Wo? Die Frage ist eine der dringlichsten für eine demokratisch sein wollende Republik.
Die These dieser Schrift ist: Es handelt sich weder um »rassische« Probleme noch um wirtschaftliche noch um religiöse Probleme (sofern wir davon ausgehen können, dass auch der Islam – wenigstens in nicht-islamischen Ländern – allmählich eine Aufklärung durchmacht, das heißt die für »Modernität« und Demokratie unerlässliche Differenzierung von Religion, Kultur und Politik akzeptiert). Es handelt sich um ein Kulturproblem, um kulturelle Identität.
→ Kultur ist nicht bloß ein schöngeistiger, ideologischer Überbau (wozu sie oft missbraucht wird), sondern prägt tiefgreifend das gesamte Alltagsleben, auch das der Skinheads. Gemeinsame Kultur bildet den Rest an Gemeinschaftlichkeit in unserer pluralistischen Gesellschaft. Gemeinschaft besagt Geborgenheit und Selbst-Identität. Das Bedürfnis danach ist so legitim wie nur irgendetwas. Es rangiert auf Platz 1 aller Lebensqualitäten, nach dem zum physischen Überleben unbedingt Notwendigen.
Das Problem des Umgangs mit Ausländern wird nicht als kulturelles erkannt, trotz der Rede von »Multikultur«. Man denkt in wirtschaftlichen, in ethnischen, allenfalls in politischen, untergründig oft noch in religiösen Kategorien, am liebsten aber alles durcheinander. Von Kultur als solcher, unterschieden von den anderen Ebenen, ist nicht die Rede. Deshalb wird nirgends ernsthaft die Frage gestellt und behandelt, wie und in welchem Sinne ein Miteinander an sich gleich gewerteter Kulturen in einem sprachlich-kulturellen Raum möglich ist, in welchem Sinne Kulturen an Regionen, also vor allem an Sprachregionen, gebunden sind – und wie das ganze zum Begriff der Nation steht.
Meine These lautet: der Gesichtspunkt Kultur, unterschieden von den anderen, ist der entscheidende für die Diskussion über Multikulturalität. Und dies ist beinahe das einzig Stimmige an diesem viel missbrauchten Begriff.
Ich werde ein Modell der völligen Parität von Kulturen in derselben Region als illusorisch verwerfen und das Modell der Gastfreundschaft entwickeln. Diese Unterscheidung habe ich nirgends klar gefunden. Sie erfordert ein gewisses Maß an Denken, um hinter die Oberfläche der gesellschaftlichen Erscheinungen zu dringen.
Die Rolle des Denkens
Die simple Alternative von »ausländerfreundlich oder ausländerfeindlich« geht hochideologisch am Kern der Fragen vorbei, wie es meist die sogenannten ethischen Appelle an den einzelnen tun, die strukturelles Bedenken und Lösen objektiv vorhandener Probleme ignorieren.
»Nehmet einander an«, das Motto des Evangelischen Kirchentages von München 1993 zum Beispiel, auf dem ersten Höhepunkt der neuen Ausschreitungswelle, ist ein sicher wohlgemeinter moralischer Appell, doch an sich nicht wirksamer als die alljährlichen Friedensansprachen des Papstes. Geleugnet wird durch sie stillschweigend die Notwendigkeit struktureller Einsichten und Folgerungen, also konkreter Regelungen, wodurch Gerechtigkeit im Verhältnis zwischen Deutschen und »Ausländern« ermöglicht wird. Niemals wurde und wird soziale Gerechtigkeit, als Grundlage für Frieden, durch moralische Appelle herbeibeschworen, wenn strukturelle Grundsatzfragen ungeklärt bleiben. Für strukturelle Fragen ist Denken am Platz.
Zusatz 2017: Die Begriffe »ethisch« und »moralisch« werden an dieser Stelle nicht unterschieden. Später, so im Ethik-Kapitel von Integrale Philosophie (2014) verwende ich →ethisch für die ausdrückliche Reflexion auf moralische Fragen, →moralisch für die gelebte Moralität.
Im Denken sollten wir Deutschen von unserer besten Tradition her eigentlich Weltmeister sein. Auch hiermit möchte ich vorwegnehmend eine These aussprechen: Von unserer kulturellen Besonderheit und besonderen Berufung her sind wir eine Denker-Nation, mehr noch als eine Musik-Nation. Wobei das Denken zwar in der Philosophie seine Brunnenstube hat, doch alle Gebiete des Lebens ergreift, nicht zuletzt Naturwissenschaft und Technik. Der alte Schmeichelitel »Volk der Dichter und Denker« rührt wahrscheinlich aus dem von Napoleon verbotenen Buch der Germaine de Stael (1766–1817) Über Deutschland (De l‘Allemagne) her, worin sie von dem unter französischer Hegemonie stehenden Deutschland provozierend als dem »Heimatland der Dichter und Denker« spricht. Damals gab es einen, den klassischen und romantischen Höhepunkt deutscher Dichtung. Insofern war Madame de Staëls Begeisterung verständlich. Dennoch, nicht das Dichterische, aber sehr wohl das Denkerische wird in aller Welt als eine spezifisch deutsche Vorzugsstärke erkannt. Die meisten Deutschen wissen nicht, in welchem Maße die deutsche (deutschsprachige) Philosophie ein Exportartikel ist, ähnlich wie die Musik Beethovens oder Mozarts. Was der Hitlersche Rassen- und Welteroberungswahn zerstört hat, ist gerade die wissenschaftliche Führungsposition der deutschen Kultur, die sie zwar schon vor dem Krieg mit den (etwa zur Hälfte teilweise »deutschstämmigen«1) Amerikanern zu teilen begonnen hatte, die aber gerade in den denkerischen Grundlagendisziplinen damals noch bestand.
»Deutsche Gründlichkeit« bezog sich jahrhundertelang weder auf bürokratische Tugenden noch auf Zerstörungswut, sondern auf eine unabdingliche Qualität des Denkens. Und diese ist eine, mit der Sprache verbundene, kulturell gewachsene Qualität, nichts Rassisch-Biologisches.
Nichts gegen Fußball-Weltmeisterschaften, doch die einseitige Verlagerung »sportlichen« Ehrgeizes und edlen Wettstreites der Nationen von lebensnotwendigen geistigen Leistungen und seelischen Haltungen auf so etwas Spezielles wie Fußball oder Tennis finde ich schon bedenklich.
Die Rolle des grundlegenden, nicht von vornherein fachspezifischen, nicht alle möglichen »Selbstverständlichkeiten« und Wertentscheidungen schon voraussetzenden Denkens für das soziale Miteinanderleben wird in unserem Gemeinwesen in einer sträflichen Weise vernachlässigt. Das gilt für unsere Demokratie allgemein, die sich aus dem unerhörten Vorgang entwickelte – soweit sie überhaupt schon eine entwickelte Demokratie und nicht ein Embryo oder bestenfalls ein Baby auf dem Weg zu ihr selbst ist –, dass sich in der französischen und amerikanischen Revolution ein »Volk auf den Kopf, das heißt auf den Gedanken stellte« (HegeI). Unsere Intellektuellen lassen – mit Einzeldisziplinen und Expertenkenntnissen (»Fachidiotie«) bzw. modischem Bewandertsein jeweils vollauf beschäftigt – eine ernste überdisziplinäre Grundlagendiskussion über Demokratie und deren institutionelle Weiterentwicklung weitestgehend vermissen. Bei einem Antrag für Forschung über Grundlage und Weiterentwicklung politischer Institutionen (grundlegende Fragen der Gewaltenteilung und der Systemdifferenzierung betreffend), den ich unlängst bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sogar auf Ausschreibung hin, stellte, wurde mir das erschreckend deutlich: Alles war bereits lobbyhaft für Spezialexpertisen innerhalb der bestehenden Strukturen verplant. Keine Chance für innovatives Grundlagen-Denken.
Zu den anstehenden Grundlagenfragen gehören das Verhältnis von Kultur und Politik sowie die Frage nach kulturellen Identitäten überhaupt. Beides spielt für eine vernünftige Verständigung über »multikulturelle Gesellschaft« eine fundamentale Rolle. Ohne entsprechende Klärungen müssten sich Wissenschaftler schämen, den Mund aufzutun.
Fast können wir von Glück sprechen, dass wir auch ohne weltweite Erschütterungen und trotz Missachtung der Erschütterung, die vom jugoslawischen Bürgerkrieg auch ins Denken über Nationalitäten übergehen müsste, durch die genannten Ereignisse zur Besinnung gezwungen werden.
Ein Blick in die »Aufklärungs«-Literatur
Ich habe versucht, zum Thema und Begriff einer »multikulturellen Gesellschaft« etwas grundlegend Klärendes, über emotionale Äußerungen und die Artikulation scheinbarer Selbstverständlichkeiten oder allzu »praxisnaher« Spezialfragen Hinausgehendes zu finden. Es ist mir nicht gelungen. Das Informativste, was ich nachträglich fand, ist der Beitrag eines jungen Essener Pädagogen, Wolfgang Nieke.2Dieser unterscheidet »zwei verschiedene Bedeutungen« von multikulturell. Im Grunde ist es aber dieselbe Bedeutung, die er meint, die nur einmal beschreibend-analytisch, ein andermal wertend als Zielbegriff verwendet wird – soweit da wegen der Unschärfe des Begriffs überhaupt Selbigkeit auszumachen ist:
»Multikulturelle Gesellschaft wird als beschreibender, analytischer Begriff verwendet, um den Sachverhalt zu benennen, dass in die Bundesrepublik Deutschland Zuwanderer gekommen sind, die sich weder umstandslos assimilieren lassen und anpassen wollen noch in absehbarer Zeit wieder in das Land ihrer Herkunft zurückkehren wollen. Damit existieren neben den Lebenswelten (Kulturen) der Einheimischen zunehmend mehr Kulturen von Zuwanderern« (a.a.O., 114).
Als Zielbegriff verwendet, wird dies nicht nur wertneutral festgestellt, sondern als etwas Positives begrüßt. Die ungeklärte, scheinbare Selbstverständlichkeit liegt in dieser »Definition« in dem Nebeneinanderexistieren. Ich werde die Fragwürdigkeit dieser »Definition« aufzeigen und behaupte, dass sie weit davon entfernt ist, eine gültige Tatsachenbeschreibung zu sein, geschweige denn eine allgemein akzeptierte Wertentscheidung. Unbestreitbarer, weil unschärfer ist eine programmatische Definition von Beate Winkler:
»Multikulturelle Gesellschaft heißt: Mehrheit und Minderheit leben gleichberechtigt zusammen in gegenseitiger Achtung und Toleranz für die kulturell unterschiedlich geprägten Einstellungen und Verhaltensweisen der jeweils anderen.«3
Die Unangreifbarkeit dieser »Definition« beruht auf ihrer völligen Unklarheit: Wer ist gleichberechtigt? Die der Mehrheit und den Minderheiten angehörigen Personen – oder ihre jeweiligen Kulturen im Sprach- und Kulturgebiet der Mehrheit? Hier liegt der Punkt der allgemeinen Denkverwirrung. Und Denkverwirrungen führen in dieser Sache geradewegs zu sozialen Konflikten.
Das meiste an Literatur ist – bei mancher interessanten Einzelinformation, wie sie sich in der Presse nur im zeitlichen Nacheinander finden – unter der Rücksicht von Begriffsklärungen und Grundsatzfragen kaum der Erwähnung wert, auch und gerade wenn es von professionellen Politologen stammt. In dem vielgekauften Sammelband Multikulti4 wird vom Herausgeber ebenso ausdrücklich wie schlicht vorausgesetzt, dass wir bereits eine multikulturelle Gesellschaft im Sinne eines »Vielvölkerstaates« haben. Das einzige Problem sei offenbar, diese Tatsache zu akzeptieren und ihr in der Gesetzgebung Rechnung zu tragen. So einfach ist das also. Wir können zur sogenannten »Alltagspraxis« übergehen. Als müssten Politologen und Soziologen nicht wissen, wie tiefgreifend die anscheinend theorielose Praxis von mehr oder weniger ungeprüften Vorurteilen oder einfach geglaubten Überzeugungen geprägt ist. Als wäre hier nicht zum Greifen, dass der soziale Zündstoff geradezu von den wissenschaftlichen Theorieversagern gestiftet wird!
Dementsprechend werden in jenem Buch noch so notwendige Unterscheidungen durch den polemisch-aggressiven Ton derer, die Aufklärung für sich gepachtet zu haben glauben, ersetzt. Eine recht unaufgeklärte Vorgehensweise, in emotionaler Übereinstimmung allerdings mit den sich fortschrittlich und »aufgeklärt« dünkenden Intellektuellen und Studenten. »Aufklärung« ist heute weitgehend das emotional beanspruchte Etikett für Verdunkelungs- und Vernebelungskampagnen. Jedenfalls findet sich im Zusammenhang mit »multikultureller Gesellschaft« keine Spur von eigentlichem Problembewusstsein, an dem es wirklichen Aufklärern liegen müsste: Bewusstsein dafür, dass hier nicht allein die Fragen unserer glaubwürdigen Gastfreundschaft und Humanität auf dem Spiele stehen, sondern gleichzeitig die Frage des Sinnes von kultureller, also nationaler Identität, dass es um eine Deutung deutscher Identität (und der jeweils anderen Identitäten) geht, um das künftige Europa einer Vielfalt lebendiger Nationalkulturen und bei allem natürlich um realistische Alltagslösungen. Hier müsste die Links-Rechts-Besserwisserei doch einmal halt machen und überparteiliche Selbstbesinnung eine Chance bekommen. Vom Grundauftrag her wäre das Sache der Universitäten. Doch die dort Beamteten schwanken zwischen trockenem Expertenturn und Partei- bzw. Schulpolemik wie in jenem Buch.
Vielleicht kommen wir mit einiger ruhiger Überlegung zu der Wertoption, dass kulturelle und nationale Identitäten, ob einer kroatischen oder deutschen, einer türkischen oder französischen, keinen geschichtlichen Sinn und Wert mehr haben oder dass speziell die deutsche Identität ein Lebensrecht aufgrund des nationalistischen Ausbruchs in der ersten Jahrhunderthälfte verwirkt hat. Vielleicht sind wir dagegen der Meinung, dass nationale Kulturen und Identitäten sich erhalten können, auch wenn man vom Regionalprinzip eines Sprach- und Kultur-Gebietes abgeht. Doch sollten wir dergleichen überlegt tun, mit Verantwortung vor unseren Nachfahren, vielleicht auch Vorfahren. Ich finde diese Grundsatzfragen nirgends adäquat behandelt. Nicht einmal das Problem eines Regionalprinzips (Cuius regio et lingua regionalis, eius cultura, um es in Anlehnung an das viel problematischere Prinzip des Augsburger Religionsfriedens von 1555 zu formulieren5) wird öffentlich anerkannt und diskutiert.
Die gegenwärtige Rede von multikultureller Gesellschaft ist bisher in hohem, ja erschreckendem Grade unüberlegt. Der unklaren good-will-Emotionalität der einen Seite steht die artikulationsunfähige und daher versteckte bad-will-Emotionalität gegenüber, die – wie wir leider sehen – leicht bis zur Kriminalität gehen kann. Politologen und Soziologen sollten sich gerade hier einmal in Werturteilsfreiheit üben und nach den Gründen fragen, die eben nicht bloß individuell sind und individual-pädagogisch appellierend angegangen werden können. Vielleicht werden sie auf einmal feststellen, dass sie aufgrund ihrer Unklarheiten im Kopf mit im kollektiven Bad sitzen.
Die Diskussion leidet nicht nur in der Presse und von daher in alltäglichen Unterhaltungen, sondern auch in Soziologenschriften unter einer unerträglichen Vieldeutigkeit oder aber unter einer ebenso unreflektierten Eindeutigkeit. Ich gebe hauptsächlich ein prominentes Beispiel von einem unserer deutschen Meisterdenker.
1 »Über 45 Millionen US-Bürger gaben in der 2015 durchgeführten American Community SurveyGerman als ihre Hauptabstammung an. Damit sind die Deutschamerikaner die größte ethnische Bevölkerungsgruppe in den Vereinigten Staaten« (Wikipedia, Artikel Deutschamerikaner). »Teilweise deutschstämmig« wird oben in einem weiteren, über die Hauptabstammung hinausgehenden Sinne verwendet.
2 In: Leben und Lernen in der multikulturellen Gesellschaft. 2. Weinheimer Gespräch, hg. von Peter E. Kalb, Christian Petry, Karin Sitte, Weinheim 1993, 110–153.
3 Beate Ulbrich, Kulturpolitik für eine multikulturelle Gesellschaft, in: Stefan UIbrich (Hg.), Multikultopia. Gedanken zur multikulturellen Gesellschaft, Vilsbiburg 1991,293–297.
4 Claus Leggewie (Hg.), Multikulti. Spielregeln für die Vielvölkerrepublik, Berlin 31993. Ähnlich äußerte sich Leggewie in: Elke Ariëns/Emanuel Richter/Manfred Sicking (Hg.) Multikulturalität in Europa. Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft (unter Mitarbeit von Eva Onkels und Philip Röhr), Bielefeld 2012. –Von einem »rechten« Pamphlet zum Thema, das hauptsächlich wirtschaftlich (und dazu falsch) sowie untergründig rassistisch argumentiert, möchte ich mich ebenso absetzen: Erik Zimmer, Multikultur – der Weg ins Verhängnis, Fürth 1992.
5»Cuius regio, eius religio« lautete damals die Formel, wodurch die spätere (in Deutschland noch immer nicht geglückte) Trennung von Staat und Kirche wenigstens insoweit vorbereitet wurde, als im Reich als solchem keine einheitliche Religion mehr galt, wohl aber noch innerhalb der einzelnen Fürstentümer.
2. »Politische Kultur« und »Verfassungspatriotismus«
»Der Irrtum des Intellektuellen besteht darin, zu glauben, dass man wissen kann, ohne zu verstehen und insbesondere ohne zu fühlen ( ...) Der Irrtum der Intellektuellen besteht darin, zu glauben, dass er ein Intellektueller sein kann – und nicht nur ein Pedant –, wenn er vom Volke und von der Nation geschieden und getrennt ist« (Antonio Gramsci).
Habermas' Genügen an »politischer Kultur«
Erfreulich eindeutig ist die jüngste Stellungnahme des Frankfurter Sozialphilosophen Jürgen Habermas. »Die Zeit« veröffentlichte in Ausgabe 22/1993 den Vorabdruck seines Beitrags zu einem inzwischen erschienen Sammelband von Charles Taylor und anderen.1Der Artikel trägt die Überschrift: »Die Festung Europa und das neue Deutschland«. Weil bei Habermas ein hohes wissenschaftliches Niveau oder zumindest der Schein davon aufrechterhalten wird, möge meine damalige Replik darauf, die bezeichnenderweise von der angeblich liberalen »Zeit« nicht angenommen wurde, zur Einstimmung in die ganze Problematik dienen. Auf manches wird dabei in Kürze vorgegriffen, auch auf meine Hauptthese zur multikulturellen Gesellschaft und die dabei wichtige Unterscheidung. Es geht mir darum, bei denkwilligen Lesern ein Problembewusstsein anzuregen, bei solchen also, die nicht bloß Aufgeklärtheit beanspruchen, sondern dieses Herausgehen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit (Kant) auch in Form von Distanz gegenüber modisch-emotionalen Vorurteilen und unaufgeklärten Schlagwörtern beweisen. Leser, denen der Jargon zu fachlich ist und die nicht unter dem Eindruck des »größten deutschen Philosophen der Gegenwart« (so die Presse zum 65. Geburtstag Habermas' im Juni 1994) stehen, können gleich zum nächsten Kapitel übergehen.
Jürgen Habermas will in seinem Artikel zuerst »aus normativer Sicht« beantworten, ob eine Politik der Abschottung gegen Emigranten gerechtfertigt sei, »ob nicht der Wunsch nach Immigration eine Grenze findet am Recht eines politischen Gemeinwesens, die eigene politisch-kulturelle Lebensform intakt zu halten«? Das scheint eine vernünftige Fragestellung, wenngleich der Bindestrich zwischen politisch und kulturell aufhorchen lässt. Denn gerade im Verhältnis zwischen dem Staat als politisch-rechtlich organisiertem Gemeinwesen und einer nationalen Kultur liegt das Problem. Es wird aber nach Art einer vollendeten Zirkelargumentation vom Tisch gefegt, wenn Habermas dann weiter doktrinär-normativ befindet: »Nun muss im demokratischen Rechtsstaat die Ebene der politischen Kultur, die alle Bürger umfasst, von der Integrationsebene der verschiedenen innerstaatlichen Subkulturen entkoppelt bleiben. Er darf deshalb von den Einwanderern nur die politische Akkulturation fordern ( ... ) Auf diese Weise kann er die Identität des Gemeinwesens wahren, die auch durch Immigration nicht angetastet werden darf; denn diese hängt an den in der politischen Kultur verankerten Verfassungsprinzipien und nicht an den ethischen Grundorientierungen einer im Lande vorherrschenden kulturellen Lebensform.«
Erstens wird schon vorausgesetzt, was gerade einmal offen zu diskutieren wäre und was ich zum Beispiel (ohne in eine rechte Ecke gestellt werden zu können) vehement bestreite: Dass nationale Kultur primär politische Kultur ist und dass es lediglich um die Identitätswahrung unserer demokratisch-politischen Institutionen geht. Ich bin im Gegenteil der Überzeugung (und hierin vermutlich mit Günter Grass einig), dass nationale Kultur primär auf der Gemeinsamkeit einer Sprache und einer in ihr artikulierten Geschichte, einschließlich der Geistesgeschichte, beruht und dass die politischrechtlichen Formationen (also Staatsbildungen) im kulturellen Sinn sekundär sind. Gerade für Deutschland ist die Nation im kulturellen Sinn selten mit ihrer politischen Institutionalisierung als Staat zusammengefallen, vielleicht nur in den zwölf Jahren der Nazi-Herrschaft. Denn das mittelalterliche Reich lässt sich eher als eine kulturelle und allerdings zugleich religiöse Einheit interpretieren denn als machtpolitische Einheit.
Wenn die Unterscheidung von Kultur und Politik ernstgenommen wird, könnte Verständnis dafür wachsen, dass eine zunächst bewusstseinsmäßige, auf Dauer auch real-institutionelle Entmachtung und Entlastung der politisch-rechtlichen Ebene zugunsten der kulturellen Systemebene als notwendig und angemessen ansteht. Das hieße, dass die Politik und ihr Personal in eine stärker dienende Rolle gegenüber den Kulturnationen im Sinne der eigentlichen »societal community« (Talcott Parsons) zu treten berufen wäre, statt das Ganze einer nationalen Gemeinschaft zu verwalten (zu beherrschen) und repräsentieren zu wollen.
Bei Habermas erscheint dagegen die eigentliche Kultur, fälschlich noch gleichgesetzt mit Ethik, als Subkultur des politischen Systems oder der »politischen Kultur«, womit er offenbar nicht mehr als das Funktionieren einer demokratischen Verfassung meint! Solcher »Verfassungspatriotismus« würde uns alle unmittelbar zu Bürgern einer europäischen oder euroamerikanischen Superdemokratie machen. Von Gebilden wie Deutschland oder anderen Nationen würden gute Verfassungspatrioten nicht mehr reden, es sei denn nostalgisch oder überheblich als etwas von gestern.
Zweitens wäre der Sinn von »multikulturell« offen von den verschiedensten Parteien darzulegen. In Habermas' Artikel gewinnt er – wie naiv und selbstverständlich – blitzartig Profil: Es gibt künftig nur »verschiedene innerstaatliche Subkulturen«, Reste früherer Nationalkulturen, aber keinerlei einheitliche Kultur mehr, es sei denn die »politische Kultur«. Wo ist über diesen Sinn von »multikulturell« eigentlich je deutlich diskutiert, geschweige denn Konsens erzielt worden? Es erscheint mir offensichtlich, dass die große Mehrheit der Bevölkerung dieses Verständnis der multikulturellen Gesellschaft ablehnen würde – wenn es nur einmal klar auf den Tisch käme. Jeder unterstellt derzeit dem ungefähren Schlagwort einen von ihm diffus bejahten, doch keineswegs klaren Sinn. Deshalb kann es so unproduktiv bzw. gefährlich grassieren. Sind die diffusen Mehrdeutigkeiten beabsichtigt, sind sie bewusste Taktik? Es gehört offenbar zur Taktik auch von »Diskurstheoretikern« à la Habermas, Schlagwörtern einen Konsens nach ihrem Belieben zu unterstellen (denn mit dem ebenso mehrdeutigen »Diskurs« klappt es ohnehin nicht bei gesellschaftlichen Wertentscheidungen).
Ein alternatives Verständnis von multikultureller Gesellschaft sieht ganz anders aus, und ich finde, bedeutend realistischer und konsensfähiger: In einer staatlich organisierten Kulturgemeinschaft (→Nation) – möglicherweise in mehreren Staaten organisiert, wie es bei der deutschsprachigen Kulturgemeinschaft der Fall war und auf absehbare Zeit bleiben wird – gibt es eine Primärkultur, deren Interaktionsmedium die gemeinsame Sprache ist (wie für die Wirtschaft das Geld), und auf dieser Grundlage gibt es Recht und Möglichkeit sekundärer Kulturen, seien es italienische, polnische, türkische Sprachgruppen oder andere.
Dieses Verständnis von multikultureller Gesellschaft erfordert Erlernen von Sprache und Kultur der Gastnation – was nicht Aufgeben einer eigenen, zweiten kulturellen Identität besagt. Wenn ich mich in Frankreich, Spanien oder in der Türkei ansiedele, gehe ich ebenfalls davon aus, Sprache und Sitten des Landes zu erlernen, selbst wenn ich zusätzlich eine eigene deutsche Identität beibehalte, wahrscheinlich auch meine Kinder.
Dieses Konzept von multikultureller Gesellschaft basiert also auf der Unterscheidung von allgemeiner, primärer kultureller Identität eines Landes und sekundärer, subkultureller Identität. Ich halte es für das auf lange Sicht einzig konsensfähige – und darüber hinaus auf ebenso lange Sicht auch einzig wünschenswerte Konzept für Europa. Übrigens wurde es (ohne diese begriffliche Unterscheidung) auch in den USA praktiziert, indem kulturelle Minderheiten eine zusätzliche Subkultur entfalten konnten. Es wäre eine verhängnisvolle Fehlentwicklung und Programmierung von Konflikt, an der mexikanischen Grenze zum Beispiel exklusiv spanisch sprechende Enklaven entstehen zu lassen. Der große Unterschied zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den »Vereinigten Staaten von Europa« wird aber darin bestehen, dass Europa im Unterschied zu den USA auf lange Sicht niemals einer kulturellen und sprachlichen Vereinheitlichung zustimmen wird.
Was Habermas an historischen Beispielen für gelungene Ausländerintegration anführt, sind nicht im Entferntesten Beispiele für Multikultur, vor allem nicht im Sinne von Habermas selbst, wonach es überhaupt nur noch Subkulturen, keine Hauptkultur außer der politischen gibt. Von Präzision des Diskurses, der Argumentation, kann bei diesem »Diskurs«-Theoretiker keine Rede sein!2 Hinzukommt mein Widerspruch, dass es heute gerade um Relativierung der Sphäre des Politischen zugunsten der Kultur geht. Die bloß politische Ebene muss die Fackel der kommunikativ-kulturellen übergeben, sofern sie selbst über die militärische und bloß wirtschaftliche Sphäre Herr geworden ist. Diese Aussagen werden durch die Unterscheidung der Subsysteme im nächsten Kapitel leichter verständlich werden. Es sei gleich hinzugefügt, dass die Rassendiskriminierung (der Farbigen) sowie das Problem sonstiger sozial bedingter Gruppenkulturen (z.B. Homosexuelle) vollkommen andere soziale, nicht spezifisch sprachlich-kulturelle Probleme sind und mit Multikulturalität wenig zu tun haben. Gesellschaftliche »Subkulturen« begründen so wenig eine Multikultur im heute aktuellen Sinne wie etwa die unterschiedliche Neigung zu U- oder E-Musik oder zur unterschiedlichen Künsten und Sportarten. Rassenprobleme (ethnische) sind ebenfalls nicht mit Kulturproblemen zu verwechseln. Diese Verwechslung unterläuft aber ständig, wo immer die Alternative »bloßer Verfassungspatriotismus oder ethnische (völkische, rassische) Begründung von nationaler Identität« begegnet.
Dass eine so einfache, wenngleich fundamentale und in ihrer praktischen wie theoretischen Notwendigkeit einleuchtende Unterscheidung wie die von ethnischer und kultureller Begründung der nationalen Zugehörigkeit in den Intellektuellen-Diskursen hierzulande, aber auch in den politischen Reden bisher kaum begegnet, halte ich für kein gutes Zeichen unserer »politischen Kultur«, d.h. kulturellen Verständigung über Politisches bzw. kulturell-kommunikativen Umgangsformen innerhalb der politischen Sphäre. Nebenbei, gerade die Weiterentwicklung politischer Kultur ist ohne handlungstheoretisch begründete Systemtheorie der Gesellschaft (wie Habermas sie trotz der Menge seiner Publikationen schuldig bleibt) nicht möglich.
Was nun drittens Habermas' Verständnis von Kultur angeht, zeigt er durch seine Gleichsetzung mit »ethisch« (nicht nur mit ethnisch), dass ihm ein originäres, eigenständiges Verständnis von kultureller Identität abgeht. →Kultur ist der Inbegriff dessen, was an vor-sprachlichen, sprachlichen und metasprachlichen (d.h. künstlerischen) Objektivationen aus einer Sprachgemeinschaft hervorgeht und den spezifisch kommunikativen Umgang, nicht primär und allein die politisch-rechtlichen Verkehrsformen, tiefgreifend prägt. An die Sprache geknüpft und doch über die Sprache weit hinausgehend in eine diskursiv gar nicht »festmachbare« Gefühlsdimension oder Wertkommunikation, stehen geschichtliche und gemeinschaftliche Werte auf dem Spiel, für die Habermas in seinem Rationalismus (der paradoxerweise zugleich ein Defizit an philosophischer Rationalität anzeigt) blind zu sein scheint. Damit erklärt er sich selbst für inkompetent, über deutsche oder sonstige nationale Identität zu urteilen. Wie schon anfangs gesagt, ist seine ganze normative »Argumentation« nicht argumentativ, sondern vielmehr zirkulär: Die eigentlich zu diskutierenden, aber nicht diskursiv zu entscheidenden, sondern als gesellschaftliche Wertentscheidungen bewusst zu machenden Inhalte (hier bezüglich national-kultureller Identität) werden vorausgesetzt bzw. vorweg geleugnet.