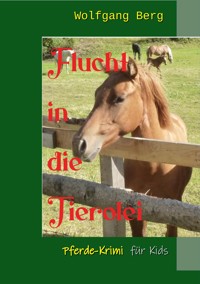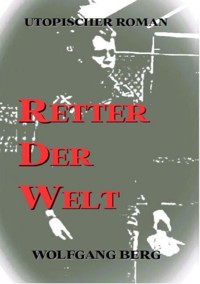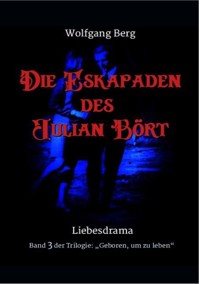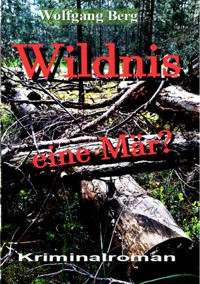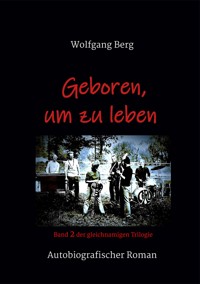
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Geboren, um zu leben
- Sprache: Deutsch
„Geboren, um zu leben“ – Worte die eine tiefe Bedeutung in sich tragen. Sie erinnern daran, dass das Leben ein kostbares Geschenk ist, das wir bewusst genießen und in vollen Zügen auskosten sollten. Jeder Tag bietet neue Chancen: unsere Träume zu verfolgen, Beziehungen zu vertiefen und die kleinen, wunderschönen Momente des Alltags zu schätzen. Auch wenn das Leben manchmal herausfordernd sein mag – wir sind nicht hier, um lediglich zu existieren – wir sind hier, um wirklich und bewusst zu leben. Diese Botschaft passt nicht nur perfekt zu diesem Buch, sondern ganz besonders auch zu Band 3 („Frontmann“) der Trilogie. Obwohl es sich bei beiden Romanen um eine spannende Mischung aus Realität und Fiktion handelt, basieren sie auf den wahren Erlebnissen von Max Bört, der zentralen Figur der Erzählungen. Durch kreative und packende Details werden die Geschichten so lebendig, fesselnd und authentisch geschildert, dass die Wahrheit dabei nicht aus den Augen verloren wird. Band 3 besticht zusätzlich durch nahezu originale Briefwechsel und Szenen, die das Leseerlebnis noch intensiver und glaubwürdiger machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Wolfgang Berg
Geboren, um zu leben
Trilogie Band 2
Wolfgang Berg
Geboren, um zu leben
Trilogie Band 2
© 2024 Wolfgang Berg
veränderte Neuauflagen
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
ISBN: 978-3-384-14850-6
Inhalt
Cover
Halbe Titelseite
Titelblatt
Urheberrechte
Krieg
Nachkriegsjahre
Heiligabend 1947
Die neue Wohnung
Einschulung
Burg
Die Pionierrepublik „Wilhelm Pieck“
Wieder zu Hause
Jugendjahre
Armeezeit
Reife Jugend
Jugend ade
Zeitenwende
Universum Guben
Neubeginn in Guben
Moskau – Reise
Fall der Mauer
Autor
Weitere Bücher
Geboren, um zu leben
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Krieg
Weitere Bücher
Geboren, um zu leben
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Krieg
Wilhelmine wartete sehnsüchtig auf eine Nachricht von ihrem Mann. Es war Krieg, 1943, und er war an der Ostfront stationiert. Lange hatte er sich nicht gemeldet. In seinem letzten Brief erwähnte er die Rasputiza, eine Zeit im Herbst, in der der Regen die Landschaft unpassierbar machte und der Krieg unangenehm war. Mehr hatte er nicht mitgeteilt. Besorgt fragte sich Wilhelmine: „Ist ihm in diesem fremden Land etwas zugestoßen? Und was suchen wir Deutschen überhaupt dort?“ Jeden Tag stand sie dem Briefträger gegenüber und hoffte auf ein kleines Lebenszeichen ihres Mannes.
Sie wollte auf keinen Fall einen Brief von seinen Vorgesetzten erhalten. In diesen Briefen, die vielen Müttern und Frauen das Herz brachen, hieß es meist: „Er ist für Führer, Volk und Vaterland gefallen“. Eines Tages erhielt Wilhelmine die schreckliche Nachricht, dass ihr Mann in einer Schlacht sein rechtes Bein verloren hatte und die Ärzte um sein Leben kämpften. Als sie später einen Brief von ihm selbst aus dem Lazarett in Goslar erhielt, war sie überglücklich und wollte ihn sofort besuchen. Doch sie musste noch vier lange Monate warten, bis er so weit genesen war, dass sie ihn besuchen durfte. Am 23. Februar 1944 reiste sie nach Goslar, dem Tag, als ihr erster Sohn vier Jahre alt wurde. An diesem Tag beginnt auch die Geschichte von Julian Bört.
*
An einem trüben Novembertag des Jahres 1944 erblickte Julian das Licht der Welt. Er war kein Wunschkind, denn es herrschte Krieg und seine Eltern hatten kaum das Nötigste, um die bereits fünfköpfige Familie zu ernähren. Die drei Geschwister im Alter von zwei, vier und fünf Jahren litten zudem an Unterernährung. Und jetzt auch noch diese Geburt? Offiziell gab es keine Lebensmittel zu kaufen, an Kleidung und andere Dinge war erst recht nicht zu denken. Tatsächlich war Julians Existenz nur dem Zufall zu verdanken und begann bereits neun Monate vor diesem Novembertag.
*
Während der letzten Kriegstage kam es in Burg zu heftigen Kämpfen zwischen russischen und deutschen Truppen. Eine Familie mit vier kleinen Kindern, darunter Julian im Kinderwagen, befand sich mittendrin auf der Flucht. Sie hatten sich in einer Scheune auf den Wiesen zwischen Werben und Burg in Sicherheit gewähnt, doch mussten diese vermeintliche Sicherheit verlassen. Deutsche Soldaten hatten dort Stellung bezogen und lieferten sich bald ein Feuergefecht mit den Russen.
Wilhelmine und ihr Mann, dem vor nicht allzu langer Zeit das rechte Bein amputiert worden war, kämpften sich unter Artilleriebeschuss durch die Wiesen. Über Gräben und Fließe, die keine Brücken mehr hatten - sie waren gesprengt worden -, führte ihr Weg zunächst zurück in ihr Wohnhaus. In diesem Spreewaldhaus lagen sie hinter dicken Bohlen der Außenwand, die Schutz vor Einschüssen in die Wohnräume bieten sollten. Am nächsten Tag führte ihr Weg, nicht weniger gefährlich, zu einer Bekannten nach Burg Kauper.
Die Eltern werden später nicht über die schrecklichen Erlebnisse sprechen - können - es kommt ihnen nicht über die Lippen. Und die Kinder? Die haben es Gott sei Dank vergessen. Aber ein Satz von Wilhelmine, den sie in ihren Memoiren zitiert, spricht Bände: „Ich möchte es mir ersparen, über einzelne schreckliche Erlebnisse zu berichten.“
Nachkriegsjahre
Ich habe das Dritte Reich nicht bewusst erlebt und auch den Beginn der neuen Zeit mit dem von den Russen diktierten Kommunismus nicht. Meine ersten Erinnerungen habe ich an Trebendorf. Dorthin zog es meine Eltern nach dem Krieg, um in der Landwirtschaft Fuß zu fassen.
In späteren Jahren erkannte ich, wie hart sie gearbeitet haben, um erfolgreich zu sein. Ich realisierte, dass ihre körperliche Konstitution gegen diesen selbst auferlegten Zwang sprach, dass aber die Hungersnot sie dazu zwang und - ihre Kinder. Ihnen sollte das erlebte Leid einmal erspart bleiben, es sollte ihnen besser gehen als den Generationen vor ihnen.
*
„Mama“, hatte ich Jahre später Wilhelmine gefragt: „Wie war das damals in der ersten Zeit in Trebendorf, als ich krank war und ständig in dem Bett liegen musste? Ich kann mich nur noch an ein großes Mädchen erinnern, das sich sehr um mich bemüht hatte.“
Wilhelmine erzählte: Es war ein dunkler, feuchter Raum, in dem dein eisernes Gitterbett direkt neben der Eingangstür stand. Der ursprünglich weiße, poröse Lack des Bettgestells saugte die hohe Luftfeuchtigkeit wie ein Schwamm auf. Er verlieh dem Bettchen, an das du ständig wie gefesselt lagst, ein gelblich-braunes Aussehen. Ohne fremde Hilfe konntest du dieses Bett nicht verlassen. Weit über dir drang spärliches Licht durch das einzige Fenster des Zimmers.
Die Wand rings herum war schadhaft, abgefallene Putzflächen gaben die Sicht auf feuchte, rote Mauersteine frei. An der noch intakten Wand haftete dunkelgrüne, aufgeplatzte Ölfarbe. Darauf suchten sich Schwitzwasserrinnsale ihren Weg. Sie entstanden, wenn ich früh Feuer machte, durch die plötzliche Hitze der eisernen Kanone. Ich hatte diesen Ofen, bevor ich die Wohnung verließ, mit Rohbraunkohle befeuert. Dort, wo der Putz fehlte, versiegten die Wasserspuren in dem roten Zigelstein. An anderen Stellen hatten sie von der Decke bis zum Boden wieder freie Bahn.
Irmgard, das Schulmädchen, erzählte, dass du gern durch die Gitterstäbe des Bettchens gegriffen hattest. Dann strichst du über die feuchte Wand und lecktest das Wasser von deinen Händen.
Ich hatte wenig Zeit für dich, übergab die Aufgabe deiner Umsorgung deinen Brüdern. Aber die spielten lieber mit den anderen Kindern irgendwo draußen, als sich um dich Kleinen zu kümmern.
Aber Irmgard hat sich wirklich liebevoll um dich gekümmert. Es ist erstaunlich, dass du dich an sie noch erinnern kannst. Nach der Schule spielte sie mit dir und brachte dir sogar das Laufen bei, das du in den Wirren der Nachkriegszeit verlernt hattest. Zu Weihnachten sah die Welt bei dir schon ganz anders aus. Davon hatte ich dir ja schon erzählt.
„Ja, Mama.“
Heiligabend 1947
Im Foyer des Schlosses standen die Trebendorfer dicht gedrängt und lauschten den Worten des Pfarrers. Ich harrte neben meiner Oma aus, ersehnte den Weihnachtsmann nach der Messe. Doch meine Oma sang und betete begeistert mit dem Herrn Pfarrer um die Wette, und es schien kein Ende in Sicht. Stolz trug sie dabei ihren Rosenkranz, diese Gebetskette mit einem Kreuz und 59 Perlen, über ihrem Mantel.
Als kleines Kind verstand ich nichts von all dem und konnte auch den Sinn der Lieder und Gebete nicht erfassen. Später erkannte ich jedoch, dass es sich bei diesem jahrhundertealten Vokabular um fromme Wünsche handelt, die das Wohlergehen der Kinder sowie den Frieden auf Erden zum Ziel haben. Mir wurde aber auch klar, dass diese Wünsche seit Menschengedenken nicht erfüllt wurden. Mit seinen Gebeten wollte der Pfarrer seinen Zuhörern erneut Frieden schenken, nicht ahnend, dass er zumindest für mich und alle Deutschen recht behalten sollte. Mit Ausnahme meines 18-monatigen Militärdienstes, in dem wir den Krieg gegen den „Klassenfeind“ probten, wurden die kleinen und großen Konflikte in Deutschland weitgehend friedlich ausgetragen.
Auch hier im Schloss herrschte eine friedliche und feierliche Stimmung. Bei den Liedern „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“ bewegten sich sogar meine Lippen. Die festliche Stimmung und der herzergreifende Gesang ergriffen mich so sehr, dass ich meine eigene Melodie anstimmte. Offensichtlich hatte ich aber nicht den richtigen Ton getroffen, denn meine Oma zischte: „Julian, pst - sei leise!“
Ich nahm mir die Mahnung zu Herzen, hielt mich artig am langen Mantel meiner Oma fest und musterte die vielen Besucher. Dann erkundeten meine Blicke das Areal des Raumes und verweilten kurzzeitig an einem riesigen Elefantenkopf. Ich wusste damals nicht, dass dieser Kopf, dessen Rüssel und die Stoßzähne drohend in den Raum hinein ragten, eine Jagdtrophäe des ehemaligen Besitzers dieses Schlosses, Gneomar von Natzmer, war.
Der verbrachte dieses Weihnachtsfest nicht mehr in seinem Domizil. Er war in diesem Teil Deutschlands nicht erwünscht und längst in den Westen Deutschlands geflohen. Davon wusste ich natürlich damals auch noch nichts und es wäre mir da sicher auch egal.
Jedoch ließ mir der furchteinflößende Elefantenkopf nicht unberührt. Sofort wandte sich mein Blick von ihm ab. Ich drängte mich an meine Großmutter und übertönte mit meiner schrillen Stimme die Predigt des Pfarrers. Die Oma hatte keine andere Wahl, als mich unter ihren Arm zu klemmen und gemeinsam mit meinen Brüdern nach Hause zu gehen.
Dort wartete der Weihnachtsmann. Es war der Förster mit seinen immer knallroten Wangen, seiner roten Knollennase, den langen weißen Haaren und einem passenden Bart dazu und alles Natur. Der übernahm gern diese Aufgabe, brauchte weder Schminke noch ein Kostüm. Sich in dieser schweren Nachkriegszeit wieder einmal richtig satt essen zu können, war dann sein Weihnachtsgeschenk.
Für mich war alles wieder in bester Ordnung. Bis zum Schlafengehen spielte ich mit meinem Geschenk, einem Pferdestall mit Pferden. Mein Vater hatte dieses Kunstwerk geschnitzt, von dem ich später erfuhr, dass solch künstlerische Begabung ihm nicht zu eigen war. „Not macht erfinderisch“, fügte er noch hinzu. Trotzdem war für mich dieses Spielzeug das Schönste meiner Kindheit. Und mindestens ebenso schön war das Sitzen unter dem Weihnachtsbaum. Vater spielte Geige und alle anderen sangen die Weihnachtslieder mit, selbst der Weihnachtsmann, Förster Wodtke.
Die neue Wohnung
Nachdem ich monatelang in zwei kalten und feuchten Räumen untergebracht war, kam mir die neue Wohnung wie ein Luxusappartement vor. Interessant war die Futterküche im Erdgeschoss. Hier wurde das Wasser mit einer handbetriebenen Schwengelpumpe aus dem Brunnen geholt. Die Kochmaschine, der mit Holz und Kohle befeuerte Herd, sorgte neben seiner eigentlichen Funktion auch für wohlige Wärme im Winter. Der Raum war außerdem mit Dämpfer, Rübenschneider, Zentrifuge und anderen bäuerlichen Geräten ausgestattet.
In dieser Futterküche hing ständig ein undefinierbarer Geruch. Möglicherweise war es darauf zurückzuführen, dass hier Futter für die Schweine zubereitet wurde. Unter der Woche kochte Wilhelmine hier auch das Essen für die Familie. Obwohl das Essen sich nicht großartig vom Futter für die Schweine unterschied, schmeckte es dennoch köstlich. Solange es genug Kartoffeln, Rüben und Kohl gab, um den immer vorhandenen Hunger zu stillen, war alles in bester Ordnung.
Mein Vater hatte ein Geheimnis, das er vor mir und meinen Geschwistern verbarg. Während der Nacht hatten wir Kinder keinen Zugang zur Futterküche, denn Vater brannte oft zu dieser Zeit heimlich seinen eigenen Kartoffelschnaps. Auf diese Art und Weise konnte er ein zusätzliches Einkommen für unsere große Familie erwirtschaften.
Wenn in dieser Futterküche die Instrumentalgruppe ihre Probe hatte, rückte er schon mal so eine Flasche heraus. Da kam beim Spiel mit Mandolinen, Gitarre, Akkordeon und Geige echte Stimmung auf. Ich saß dann irgendwo ganz still in einer Ecke und lauschte dem fröhlichen Spiel und Gesang. Diese Musik begeisterte mich. Ich kannte bald alle Lieder und am liebsten hätte ich stets mitgesungen.
Besonders interessant waren die Besuche von Onkel Harry. Während der regelmäßigen Stromausfälle nutzte er das Kerzenlicht für Schattenspiele, die an den nackten, weißen Kalkwänden der Futterküche gut zu sehen waren. Dabei führte er komplette Märchen mit bloßen Händen und Knüllpapier auf. Eine bessere Unterhaltung gab es für uns Kinder nicht. An einen Fernseher war noch lange nicht zu denken, und ein Radio gab es in unserer Familie auch nicht. Onkel Harry war ein begabter Märchenerzähler und ein talentierter Kunstmaler, Musiker und Sänger. Seine vielfältigen Talente machten ihn zu einem äußerst geschätzten Gast.
Ich fand im neuen Haus insbesondere den Weg zum Plumpsklo interessant. Dieser führte von der Wohnung im ersten Stock durch das gesamte Haus. Die erste Station auf dem Weg dorthin war diese Futterküche. Hier hatte ich immer Appetit auf eine Kartoffel oder ich biss in eine Futterrübe hinein.
Der Weg zum Plumpsklo führte weiter durch den Stall mit den Pferden, Rindern und Schweinen. Besonders beeindruckt haben mich die großen Bullen und Pferde. Die kleinen Ferkel bei der riesigen Sau am Ende des Stalles vor dem Plumpsklo waren natürlich mein Highlight. Ich habe das muntere Treiben manchmal so lange beobachtet, bis sich ein losgerissener Bulle mir näherte. In diesem Moment hatte sich mein Bedürfnis bereits erledigt.
Einschulung
Mit sechs Jahren wurde ich eingeschult. Doch die Schule passte mir nicht. Ein Lehrer unterrichtete gleichzeitig dreißig Schüler der ersten vier Klassen. Das Schulmaterial war sehr überschaubar: Bis zur zweiten Klasse bestand es hauptsächlich aus einer Fibel, einer Schiefertafel und Schieferstiften. Die Schiefertafel konnte ich schnell mit einem Schwamm und einem Lappen gereinigt, und schaffte so Platz für die nächste Aufgabe. Eine Rechenmaschine mit beweglichen Kugeln und eine große Schiefertafel gehörten zur Grundausstattung des Klassenzimmers, um mathematische Rechenoperationen durchzuführen.
Dieser Unterricht war für mich langweilig. Der Religionsunterricht war jedoch alles andere als das. Er begann regelmäßig mit einer „Treibjagd“, bei der mein Freund Leopold auf Anweisung des Religionslehrers eingefangen werden musste. Wenn er eingefangen war, schrie er: „Religion ist Quatsch! Mein Vati hat gesagt, dass es keinen lieben Gott gibt!“
Diese „Treibjagd“ gab der Lehrer bald auf, nicht, weil Leo ihn vom Atheismus überzeugte. Es waren andere Gründe. Irgendwann sorgten Knallerbsen unter den Beinen des Lehrerstuhls für Unterrichtsstörung, ein andermal stank es bestialisch im Klassenraum. Nach dem Religionsunterricht kroch Leopold unter den Lehrertisch und löste den angeklebten Harzer Käse von der Tischplatte, um ihn anschließend aufzuessen. Ein Elternbesuch endete mit dem Ergebnis der Befreiung Leopolds vom Religionsunterricht.
Außerschulisch konnte ich bei einem Theaterauftritt zum Erntefest einen riesengroßen Erfolg verbuchen. Die Schulkinder der Klassen 1 bis 4 führten das Theaterstück: „Die sieben Schwaben“ vor. Ich war Veitli, der Kleinste und somit der siebente Schwabe. Als mein Einsatz nahte, wurden meine Augen immer größer. Ich zitterte am ganzen Körper, hatte Lampenfieber und überlegte angespannt: „Was sollte ich nur sagen?“ Da fragte mein Bruder, der 6. Schwabe bereits programmgemäß:
„Was machst du für ein ängstliches Gesicht?“
Da fiel mir die Antwort plötzlich wieder ein und ich sagte:
„Da raschelt was im Busch, ganz dicht!“
„Ein echter Profi“, bemerkte ein Zuschauer und bekam sich mit seinem Beifall fast nicht mehr ein.
*
Nach diesem Erfolg war die Trebendorfer Zeit für mich beendet. Eine Erbschaft hatte meine Eltern dazu bewegt, wieder nach Burg umzusiedeln, dorthin, wo ich bereits die ersten Monate meines Lebens verbracht hatte. Burg kannte ich natürlich nicht. Ich kannte nur Trebendorf mit seinem Schloss und dem angrenzenden Gut, in dessen Siedlung wir wohnten.
Trebendorf war ein Ort mit einer primitiven überörtlichen Wege- und Straßenverbindung, umgeben von ärmlichen Gehöften. Ein Ort, der trotz seiner Einfachheit, eine gewisse Idylle ausstrahlte. Abgesehen vom Quieken der Schweine, dem Blöken der Kühe vor der Fütterung und dem fröhlichen Treiben der Kinder auf der Straße war hier tote Hose. Nur der Schlossteich, auf dem die Kinder im Sommer in einer Blechbadewanne Boot fuhren und im Winter auf dem Eis Schlittschuh liefen, gab es noch. Aber das war auch wirklich alles.
Burg
Es war an einem Sonnabend im Oktober 1952, als der große Umzug nach Burg startete. Mein Cousin aus Briesen kümmerte sich mit seinen 14 Jahren um diese Aktion. Mit einem Pferdegespann stand er am frühen Vormittag in Trebendorf vor unserem Haus, sorgte für das Verpacken der Möbel und der anderen Dinge und wollte sich so schnell wie nur möglich auf den Weg begeben. Ich interessierte mich während der Zeit des Packens für das Radio, welches die neuen Wohnungsinhaber, Onkel und Tante, in der Küche schon in Betrieb hatten.
Ich war sieben Jahre alt und hatte das erste Mal in meinem Leben Radio gehört. Am liebsten wäre ich vor dem Gerät sitzen geblieben, aber unser Kutscher hatte auf dem Pferdewagen schon das gesamte Hab und Gut verstaut und wollte losfahren. So viel gab es davon ja nicht, es blieb für die gesamte Familie noch Platz auf dem Pferdewagen.
Für mich war dieser Umzug natürlich eine spannende Sache, fast eine Weltreise. Lange Weile kam nicht auf. Mal sangen wir Kinder Lieder, die wir während der Familienfeiern mitbekamen, dann spielten wir wieder unter der Abdeckplane in dem verstauten Mobiliar Verstecke.
Auch sonst gab es unterwegs noch so manches zu erleben. Besonders interessant war die Fahrt durch Cottbus. Schon vor Erreichen dieser größeren Stadt mahnte Wilhelmine unseren Vater zur Vorsicht. Sie hatte ihn beauftragt, die Fahrt durch Cottbus zu übernehmen. Es würden auch Autos auf der Straße unterwegs sein, und die wären gefährlich. Vor allem am Kaiser-Wilhelm-Platz sei starker Verkehr. Thälmannplatz, korrigierte Vater schmunzelnd. Auf die Autos war ich sehr gespannt, denn ich hatte bis dahin selten eines gesehen. Und tatsächlich, am Thälmannplatz entwickelte sich dann doch noch dieses „starke“ Verkehrsaufkommen und sogar eine richtig brenzlige Situation. Ein von rechts kommender DKW reckte seinen Winker links heraus und bog vor unserem Pferdegespann links ab. Es kam beinahe zum Zusammenstoß. Wilhelmine schrie:
„Siehste, ich hab doch gesagt, du sollst aufpassen!“ Und der DKW-Fahrer hielt auch noch an und poltert los:
„Du Dorftrottel, hier gilt rechts vor links!“ Vater ließ sich so etwas nicht von diesem geschniegelten Fatzke sagen und antwortete: „Ich werde dir gleich eine mit rechts linken, dann weißt du rücksichtsloser Affe, was Recht ist!“
Und als der schmächtige Kraftfahrer Vaters riesengroße Muskeln erblickte, stieg er schnell in sein Auto und brauste mit Begleitung unseres lauten Kinderlachens davon. Wilhelmine hatte sich wieder beruhigt.