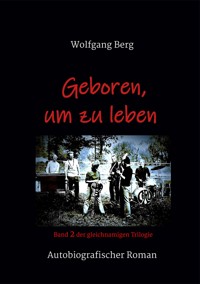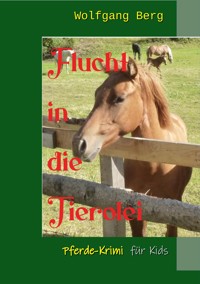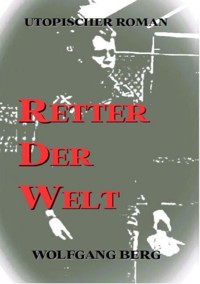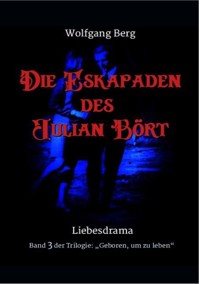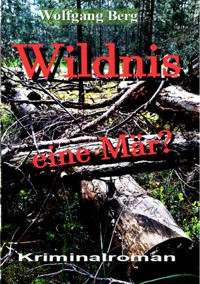
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Roman demonstriert, mit welchen Mitteln in Deutschland Wildnis geschaffen werden soll. Obwohl die Forstpolitik in der Zuständigkeit der EU-Mitgliedstaaten liegt, also nicht vom Europäischen Parlament diktiert wird, (Artikel 4 AEUV), verfolgt Deutschland in Eigenregie ein Wildniskonzept, welches jeden Autor schlechthin zu einem Kriminalroman animiert. • In wenigen Jahren Urwald (Wildnis) schaffen zu wollen, erinnert an die Schöpfungsgeschichte, wonach Gott die Welt in sieben Tagen erschuf. Natürliche Prozesse richten sich aber nicht nach ausgehandelten menschlichen Entscheidungen. So erscheint dieser Grünen-Deal beinahe göttlich, denn es gibt keinen von Menschen erschaffenen Urwald. Was ist Urwald überhaupt? Der Duden beschreibt Urwald als ursprünglichen, von Menschen nicht kultivierten Wald mit reicher Fauna. Wälder also, in die der Mensch nicht eingegriffen hat. • "In die Kulturlandschaft Deutschlands passt der Begriff Urwald also nicht hinein" (Waldhilfe.de Urwald in Deutschland, Internet, 29.6.2023). • Im Teil 1 dieses Romans wird der in Deutschland angestrebte Wildnisgedanke mit Aspekten, Zitaten und Erläuterungen skizziert. • Teil 2 ist eine an der aktuellen Umweltpolitik orientierte fiktionale Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
WOLFGANG BERG
Wildnis – eine Mär?
Kriminalroman
Inhalt
Cover
Halbe Titelseite
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Doku zum Roman
Mord
DIE WICHTIGSTEN PERSONEN
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Quellenverzeichnis
Wildnis - eine Mär?
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwort
Quellenverzeichnis
Wildnis - eine Mär?
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
WOLFGANG BERG
Wildnis – eine Mär?
Kriminalroman
© 2023 Wolfgang Berg
Website: www.spreewald-heide-pension.de
Umschlaggestaltung und Illustration: Wolfgang Berg
Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
ISBN: 978-3-384-00364-5
Vorwort
Dieser Roman demonstriert, mit welchen Mitteln in Deutschland Wildnis (Urwald) geschaffen werden soll. Obwohl die Forstpolitik in der Zuständigkeit der EU-Mitgliedstaaten liegt, also nicht vom Europäischen Parlament diktiert wird, (Artikel 4 AEUV), verfolgt Deutschland in Eigenregie ein Wildniskonzept, welches jeden Autor schlechthin zu einem Kriminalroman animiert.
In wenigen Jahren Urwald (Wildnis) schaffen zu wollen, erinnert an die Schöpfungsgeschichte, wonach Gott die Welt in sieben Tagen erschuf. Es ist jedoch nicht so, dass natürliche Prozesse auf Arrangements von menschlichen oder gar göttlichen Entscheidungen beruhen. So erscheint dieser Grünen-Deal beinahe göttlich, denn es gibt keinen von Menschen erschaffenen Urwald.
Was ist Urwald überhaupt?
Der Duden beschreibt Urwald als ursprünglichen, von Menschen nicht kultivierten Wald mit reicher Fauna. Wälder also, in die der Mensch nicht eingegriffen hat.
„In die Kulturlandschaft Deutschlands passt der Begriff Urwald also nicht hinein.“ [1]
Die in der Dokumentation skizzierten Aspekte, Zitate und Erläuterungen untermauern den Romaninhalt mit Fakten, die der Öffentlichkeit sonst verschwiegen werden.
Der Roman ist eine an der aktuellen Umweltpolitik orientierte fiktionale Geschichte.
Autor
Wolfgang Berg, von Beruf Kaufmann, wuchs in Burg/Spreewald auf. Die Ehe führte ihn nach Drachhausen, einem Dorf nahe der Lieberoser Heide. Hier lebt er in Familie auf einem Bauernhof. Neben seiner Liebe zur Musik, insbesondere dem Saxofonspiel, widmet er sich jetzt als Rentner dem Schreiben von Büchern. Der Familiensaga „Wilhelmine“, deren Handlungsort Burg im Spreewald ist, folgt nun ein der Idee von Wildnis in der Lieberoser Heide entlehnter Regionalkrimi.
Doku zum Roman
Die Initiative „Wildnis in Deutschland“ schreibt unter der Überschrift: „Gute Gründe für mehr Wildnis in Deutschland“ neben anderem:
„Wildnis hilft dem Klima.
Gesunde Wälder, Moore und Auen wirken ausgleichend auf die extremen Wetterfolgen des Klimawandels und senken dauerhaft die Kohlendioxidkonzentration der Atmosphäre. Sie geben Lebewesen Raum und Zeit, sich an neue Klimaverhältnisse anzupassen.“ [2]
Dem ist nichts hinzuzufügen, nur sollte hier das Wort „Wildnis“ durch „gesunde Wälder, Moore und Auen“ ersetzt werden. Denn sie helfen dem Klima, nicht Wildnis.
In diesem Buch geht es um das kleine aufgebauschte Thema „Wildnis“. Im Grunde sollte die Schaffung von Wildnis in Deutschland kein Thema sein, weil Wildnis schaffen zu wollen ein Trugschluss ist. Das sagt die Definition von Wildnis aus. Es ist nachgewiesen, dass intakte Wälder der Umwelt mehr helfen, als sogenannte Wildnisflächen. Die Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. bestätigt diese These in ihrer Erklärung:
„Welches CO2-Speicherpotenzial haben die Wälder der Erde?
Die Wälder der Erde speichern enorme Mengen an Kohlenstoff und sind eine wichtige Senke von Treibhausgasen imKlimasystem. Insbesondere intakte Wälder und deren Ökosysteme können sehr effektiv atmosphärisches Kohlendioxid (CO2) in ihrer Stoffmasse einlagern. Daher ist die Aufforstung und der Schutz von Waldgebieten ein bedeutendes Mittel, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.“ [3]
Trotzdem betonte die damalige Ministerin für Umwelt, Dr. Barbara Hendricks in ihrer Botschaft auf der Wildniskonferenz der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg (NLB) 2015:
„Deutschland braucht Wildnis.“ [4]
Wer hat sie zu dieser Forderung getrieben?
Kannte sie die wissenschaftlich belegten Fakten nicht?
Ein anderes Zitat dieser Wildniskonferenz zu diesem Thema lautet:
„Um die natürliche Entwicklung in den z.T. monotonen Kiefernbeständen zu beschleunigen, wurden in der Entwicklungszone in den letzten Jahren abschnittsweise Initialmaßnahmen mit Auflichtung und Förderung von Naturverjüngung durchgeführt. Diese flächigen Maßnahmen sollen im Frühjahr 2016 beendet sein. Bereits heute finden auf 2.100 ha Fläche keine Eingriffe in die Natur mehr statt.“ [5]
Diese flächigen Maßnahmen waren im Frühjahr 2016 noch lange nicht beendet. Aktuell hat die Stiftung NLB im Internet unter „Naturschutz im Wildnisgebiet Lieberose“ publiziert:
„Eingriffe außerhalb der Pflegezone finden nur noch punktuell in Ausnahmefällen z.B. zum Schutz von Mooren statt. Bereits heute finden auf 65 Prozent der Fläche keine Eingriffe in die Natur mehr statt.“ [6]
Das bedeutet, dass außerhalb der Pflegezone punktuell noch auf 35 Prozent ihrer Flächen (3928 ha) Eingriffe in die Natur geplant sind. Demnach sollen die von höchster wissenschaftlicher Kompetenz gut geheißenen Wälder mittels „Initialmaßnahmen“ behandelt werden. Höchste politische Instanz unterstützt diese absolut paradoxe Phrase von der „Beschleunigung einer natürlichen Entwicklung von Kiefernbeständen“. Welch einen Unsinn unterstützen selbst promovierte Politiker? Welch einen Schaden fügen sie damit der Volkswirtschaft zu?
Die Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) Naturerbe schreibt, dass Deutschland für seine vielfältigen Landschaften, seinem Nationalen Naturerbe, eine besondere Verantwortung trägt.
Wortlaut: „Um dieses Erbe zu bewahren, übergibt die Bundesregierung bis zu 156.000 Hektar national bedeutsamer Flächen an die Länder. Diese Naturerbeflächen, bei denen es sich überwiegend um ehemalige Militärübungsplätze handelt, werden der DBU Naturerbe GmbH dazu in den nächsten Jahren nach und nach übergeben.“ [7]
Bezogen auf diese Flächen schreibt die Professur für Waldumbau der TU Dresden in ihrer „Konzeption und Anlage eines Großexperiments zur Renaturierung von Kiefernreinbeständen“:
„Mit zielorientierten Maßnahmen kann relativ rasch die Naturnähe der Wälder hergestellt werden, aber die Etablierung naturnaher Prozesse in der Walddynamik wird durch diese anthropogenen Eingriffe verzögert. Demgegenüber erlaubt ein Prozessschutzkonzept zwar eine vergleichsweise rasche Initiierung naturnaher Prozesse, der Waldzustand jedoch verbleibt angesichts der Ausgangssituation relativ lange in einem naturfernen Zustand“. [8]
Mit zielorientierten Maßnahmen sind demzufolge Waldbrände, Windbruchsimulationen u.a.m. gemeint, wie an anderer Stelle in der Konzeption des Großexperiments zu lesen ist. Diese anthropogenen (durch den Menschen verursachten) Eingriffe verzögern die Etablierung (Ausbreitung) naturnaher Prozesse in der Walddynamik. Das ist logisch, denn wenn Wälder niedergebrannt werden oder der Wachstum auf andere Weise unterbunden wird, hat das mit naturnahen Prozessen wenig zu tun. Richtig ist deshalb auch die Aussage dieser Experimentalisten, dass der Waldzustand lange in einem naturfernen Zustand verbleibt. Das heißt also, dass er lange dem Kampf gegen den Klimawandel, worum es eigentlich gehen sollte, nicht zur Verfügung steht. Wildnisentstehung braucht sehr viel Zeit.
„Ein Urwald ist ein unberührtes Waldgebiet, das in vielen tausend Jahren ohne den Einfluss von Menschen gewachsen ist. [9]
Laut Greenpeace werden jährlich 7,3 Milliarden Tonnen Kohlendioxid, sowie Methan und Ruß, die ebenfalls erheblich zur Förderung der Klimakrise beitragen, auch durch derartige Waldbrände freigesetzt. Das ist mehr, als der globale Verkehr ausstößt. Wenn dann nach sehr langer Zeit Urwald oder Wildnis entstehen sollten, könnte sich das Problem Klimawandel erledigt haben. Die Klimaaktivisten der letzten Generation täten gut daran, sich des Themas anzunehmen, anstatt unsinnige Forderungen zu stellen. Dann hätten sie und ihre Kindeskinder eine echte Chance, noch sehr lange den Erdball zu bewohnen. Einen geforderten Gesellschaftsrat mit gelosten Mitgliedern zur Erarbeitung von Maßnahmen bräuchten sie dann nicht mehr.
Deutschland trägt für seine vielfältigen Landschaften, seinem Nationalen Naturerbe, eine besondere Verantwortung, damit hat die DBU recht. Wird Deutschland aber seiner Verantwortung auch gerecht, wenn es diesen über lange Zeit naturfernen Zustand zulässt, der mit Nationalem Naturerbe nichts zu tun hat? Vertritt die Bundesregierung hier wirklich noch die Interessen des Volkes?
2000 wurde die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg von staatlichen und privaten Stiftern in Potsdam gegründet. Nach ihren Worten sollte eine einzigartige Naturlandschaft entstehen, die dauerhaft den Naturschutz sichern soll. Natürliche Dynamik in großen zusammenhängenden Wildnisgebiet zuzulassen, ist ihr Ziel. Dass es ein sehr fernes, aus real wissenschaftlicher Sicht fast nicht erreichbares Ziel ist, war den Befürwortern dieses großen Planes mit Sicherheit nicht bekannt. Es gibt auch kein Beispiel einer von Menschen erschaffenen funktionierenden Wildnis in Europa. Dieses Milliarden schwere Projekt der Wildnis scheint ein Husarenstreich, der den Berliner Husarenstreich des Siebenjährigen Krieges weit überbietet. Wer die genannte Entwicklungszone in der Lieberoser Heide kennt, weiß, dass dieses Gebiet insbesondere von Großfeuern heimgesucht wurde (Skizze). Die Öffentlichkeit erfährt vom Ministerpräsidenten Brandenburgs, Herrn Dr. Dietmar Woidke nichts von Initialmaßnahmen, nichts von anthropogenen Eingriffen in die Natur.
Herr Dr.Woidke weiß sicher, was es mit diesen ominösen Eingriffen auf sich hat. Er wird die „Konzeption eines DBU-Projektes zur Renaturierung von Kiefernreinbeständen“, bei der es um Waldumbau zu Wildnis, auch mittels Feuer geht, kennen. Er wird wissen, warum sich z.B. 2018 fast neunzig Prozent der Waldbrände auf munitionsbelasteten Flächen, die größtenteils der Stiftung NLB gehören, ereigneten. Sein Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft hatte diese Zahlen veröffentlicht. Er wird auch wissen, dass die fast flächendeckenden Waldbrände in der sogenannten Entwicklungszone der Stiftung NLB kein Zufall sind.
Die Bevölkerung erfährt von ihm nur, dass womöglich Brandstiftungen hinter den Waldbränden stecken könnten. Sie erfährt nicht:
• Was bedeuten die Initialmaßnahmen?
• Was ist mit der Beschleunigung der natürlichen Entwicklung in den „z.T. monotonen Kiefernbeständen“ gemeint?
Im SPIEGEL-PANORAMA wird dazu berichtet:
„Brandstiftung? ‚Es gibt in der Tat Indizien‘
Jetzt rückt die Ursachenforschung in den Fokus. Innenminister Karl-Heinz Schröter hatte bereits am Freitag den Verdacht geäußert, dass das Feuer absichtlich gelegt worden sein könnte. Denn die Brände, die am Donnerstag erst etwa fünf Hektar umfassten und sich dann rasend schnell auf 400 Hektar ausdehnten, waren an drei Stellen gleichzeitig ausgebrochen. ‚Der Verdacht liegt nahe, dass es Brandstiftung war‘, sagte der SPD-Politiker der ‚Berliner Morgenpost‘. Am Samstag sprach der Innenminister dann von ‚weiteren Hinweisen‘, berichtete der rbb.
Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte dem rbb am Samstagabend: ‚Es gibt in der Tat Indizien, dass der Brand womöglich absichtlich gelegt worden ist‘.“ [10]
Sein genanntes Adverb „womöglich“ passt nicht mit dem Wort Indiz zusammen, welches ein Umstand ist, der mit Wahrscheinlichkeit auf einen bestimmten Sachverhalt, vor allem auf die Täterschaft einer bestimmten Person schließen lässt.
Aus der von SPIEGEL-PANORAMA erhofften Ursachenforschung der Minister ist nichts geworden. Offenbar gibt es kein Interesse daran. Unvorstellbar, dass Herrn Dr. Woidke die abschnittsweisen Initialmaßnahmen mit Auflichtung und Förderung von Naturverjüngung in Entwicklungszonen entgangen sind. Vielleicht hat er sie als ad absurdum negiert.
Michael Müller, Professor für Waldschutz und Waldbau an der TU Dresden schrieb in einem Bericht vom 30.07.2022:
„Deutschland ist Weltspitze in der Überwachung: Waldbrände werden in der Regel innerhalb von zehn Minuten entdeckt. Die ersten Einsatzkräfte sind zumeist bis 15 Minuten nach Alarmierung vor Ort. In den seltensten Fällen weiten sich Brände so aus, wie wir es gerade erleben.“ [11]
Eigenartig, der Wald ist unter ständiger Kontrolle und es gibt sogar Indizien für eine Täterschaft, die einer bestimmten Person zuzuordnen ist. Warum werden die Täter nicht genannt und bestraft?
Unter Waldwissen.net wird das Automatisierte Waldbrand-Frühwarnsysteme vorgestellt, das auch in Brandenburg im Einsatz ist. Ein Zitat daraus:
Montiert auf ehemaligen Feuerwachtürmen, Mobilfunkmasten oder hohen Gebäuden erfassen diese Systeme in einem Radius von typisch bis zu 15 km Rauchentwicklungen ab einer Flächenausdehnung von 10 x 10 m. Dabei dreht sich der optische Sensor einmal um seine eigene Achse und stellt kontinuierlich ein 360-Grad-Panorama her. Alle 10 bis 15 Grad wird eine Bildfolge aufgenommen, die dann von der Bildverarbeitungssoftware auf das Vorhandensein von Rauchmerkmalen analysiert werden. Auf Grund der hohen Dynamik der Sensorik von bis zu 79 db kann das System kleinste Rauchwolken in der Atmosphäre anzeigen und den Ursprungsort mit bis zu 100 m Genauigkeit in 10 km Entfernung in einer elektronischen Karte markieren. So können Waldbrände schon im Anfangsstadium (Schwelbrände) erkannt werden. [12]
Es sollte also technisch kein Problem sein, den Brandstiftern das Handwerk zu legen. Dennoch wiederholen sich die Aussagen von Politikern Jahr für Jahr zu diesem Thema und werden mit der Zeit unglaubwürdig. Dieses Problem der Waldbrände schlägt sich neben anderer Problematik auf die Stimmung der Bevölkerung und letztlich auch auf die Wahlergebnisse aus. Fünf Jahre nach dem legendären Satz des Herrn Woidke, „dass der Brand womöglich absichtlich gelegt worden ist“, gleichen sich die Erklärungen der Politiker, wenn es in den märkischen Wäldern brennt, immer noch.
Die MAZ berichtet am 03.06.2023 online:
Das Feuer in Jüterbog weitete sich am Samstag wieder deutlich aus, während auch in Kolzenburg mehrere kleine Brandherde dazukamen. Die Feuerwehr vermutet im Fall Kolzenburg Brandstiftung. [13]
Die Berliner Zeitung schreibt am 07.06.2023:
Agrarminister Axel Vogel (Grüne) sagte zur Frage nach den Ursachen für Waldbrände: „Wir haben Untersuchungen, die belegen, dass ein Großteil der nachgewiesenen Ursachen Brandstiftung ist und menschliches Fehlverhalten.“ Selbstentzündung durch Munition spiele eine geringere Bedeutung. „Wir haben im vergangenen Jahr neun Fälle festgestellt, die vermutlich durch Selbstentzündung durch Munition entstanden sind“ Im vergangenen Jahr hatte es in Brandenburg insgesamt 500 Waldbrände gegeben. [14]
Dass es sich bei den Waldbränden auf den Flächen der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg seit Jahren um Brandstiftung handelt, liegt auf der Hand.
Dr. Hans-Joachim Mader sagte als Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg bereits 2010 auf der Wildniskonferenz dazu:
„Unsere Mission ist schnell erklärt: Wir kaufen, vornehmlich auf ehemaligen Truppenübungsplätzen Flächen auf, um diese dauerhaft einer ungestörten und von Menschen unbeeinflussten Naturentwicklung zu überlassen. So entsteht Wildnis.“ [15]
Fast im gleichen Atemzug fügte er hinzu, dass er auch Feuer als ein Teil von Wildnisentwicklung versteht.
Unverständlich scheint nur, warum die Brandstifter nicht gestellt und genannt werden. Es spricht einiges für die Annahme, dass es nicht gewollt ist. Mit Wildkameras aufgenommene Wölfe scheinen interessantere Fotoobjekte zu sein, wie aus zahlreichen Artikeln und Reportagen zu entnehmen ist.
Am 06.08.2017 sagte beispielsweise eine Wolfsexpertin im rbb Fernsehen in der Sendung „Die Rückkehr der Wölfe - Geliebt, geduldet, gehasst“:
„Glücksmomente gibt es für die Rudelbeobachterin, wenn die Wildkamera gute Fotos schießt. Der Wolf spaltet die Gemüter, auch im Gebiet der Lieberoser Heide.“ [16]
Es gibt eine Vielzahl solcher Glücksmomente, nur leider nicht, wenn es um Waldbrandstifter in der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg geht.
Wildkameras sind auf dem Gebiet der Stiftung NLB in großer Anzahl angebracht, auch in der Nähe der über die Wege gelegten starken Baumstämme. Diese Barrieren sollen offensichtlich auch Feuerwehrfahrzeugen das Passieren unmöglich machen. Unwillkommene Personen werden von den Kameras bildlich festgehalten, Brandstifter gehören sicher nicht dazu.
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt hat in der „Konzeption eines DBU-Projektes zur Renaturierung von Kiefernreinbeständen“ die Initialmaßnahmen in Tabelle 2 beim Namen genannt. Bei der geht es um Waldumbau zu Wildnis.
„Tab. 2. Übersicht möglicher primärer und sekundärer Renaturierungsmaßnahmen in Waldökosystemen:
Primäre Renaturierungsmaßnahmen:
• Komplette Beräumung des Oberstandes
• Entnahme definierter Baumarten (Entmischung)
• Verwendung eines spezifischen Durchforstungs- und/oder Ernteregimes (Hiebsarten) zur Imitation des natürlichen Kronenschlusses und der Lückengrößenverteilungen (Störungen)
• Schaffung stehenden Totholzes (Ringeln, Kronensprengungen)
• Windwurfsimulation (Umwerfen, Abbrechen oder Anschieben von Bäumen)
• Kontrolliertes Abbrennen der Bestände über intensive Feuer (Kronenfeuer),
• Künstliches Anheben oder Absenken des Grundwasserspiegels.
Sekundäre Renaturierungsmaßnahmen:
• künstliche Einbringung von Verjüngung über Saat, Pflanzung oder Verpflanzung von Wildlingen
• Mischungsregulierungen innerhalb der Baumartenverjüngung
• Anreicherung der Begleitvegetation mit sog. Schutzpflanzen zur Verbesserung der Etablierungsbedingungen für die ‚Zielarten‘
• Bodenbearbeitung (Pflügen, Plaggen, Kultivieren) und Kalkung
• Mähen oder Beweiden zur Reduktion verjüngungshemmender Begleitvegetation
• Mulchen zur Anreicherung des Oberbodens mit organischem Material
• Applikation liegenden Totholzes
• Bodenfeuer zur Förderung der Verjüngungsetablierung und Entfernung verdämmender Begleitvegetation.“ (17)
Für derartige Projekte werden Millionen ausgegeben. Einige dieser Initialmaßnahmen, insbesondere die primären Renaturierungsmaßnahmen, sind in der Lieberoser Heide zu beobachten. Hochwertige Altbäume werden gefällt und in wahllosen Längen zur Erzeugung von Totholz liegengelassen (Bild 1), hochwertiges Windwurfholz wird zu Totholz (Bild 2), Kiefernwälder brennen. (Bild 3) und werden nach dem Abbrand als Entwicklungszone benannt. Hier soll sich Wildnis entwickeln (Bild 4).
Weder primäre, noch sekundäre Renaturierungsmaßnahmen sind mit einer natürlichen Entwicklung von Wildnis, die laut Bundesamt für Naturschutz ohne Einfluss des Menschen dauerhaft zu gewährleisten ist, vereinbar.
Holz, einer der wichtigsten Rohstoffe dieser Erde, wird auf Geheiß der Bundesregierung durch solche Initialmaßnahmen in großen Mengen vernichtet. Und nicht nur das, auch Naturkleinode, wie z. B. die Gegend um den kleinen Zehmesee, den Teerofensee oder den Burghofsee in der Lieberoser Heide wurden durch Waldbrände ihrer geschichtsträchtigen Besonderheit beraubt. Moore werden zerstört.
Im Bericht zur Lage und Entwicklung der Forstwirtschaft in Brandenburg 2016 – 2018 wird die Waldbrandsituation folgendermaßen erklärt:
„Die Ausnahmesituation 2018 bestand vor allem in der Größe der Waldbrände. Vier Brände waren größer als 100 Hektar und sieben Brände größer als 10 Hektar. Allein diese 11 großen Brände verursachten mit 1.459 Hektar 88 Prozent der Waldbrandfläche. Die übrigen 480 Brände betrafen zusammen ‚nur‘ 205 Hektar. [18]
Wenn man die Großbrände auf munitionsbelasteten Flächen unberücksichtigt lässt, beträgt die durchschnittliche Fläche je Waldbrand 0,5 Hektar.“ (Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg, 2019, Seite 13 u. 14).
Das heißt, dass sich 88 Prozent der Waldbrände des Jahres 2018 in von Munition belasteten Schutzgebieten ereigneten.
Diese Flächen gehören in Brandenburg meist der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Es ist bezeichnend, dass die Stiftung nur etwa 1,23 Prozent des Brandenburger Waldes besitzt, aber fast neunzig Prozent der Waldbrände sich darin vollziehen.
Die Vorgehensweise der Renaturierung von Kiefernwäldern wird der Bevölkerung verschwiegen. Wälder brennen, die Behörden „rätseln“ über die Ursachen. Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren kommen zum Einsatz. Ihre Aufgabe ist in Wirklichkeit nicht, die brennenden Wälder der Stiftung zu löschen, sondern das fragwürdige Feuer von den umliegenden Wäldern fernzuhalten. Dr. Hans-Joachim Mader sagte als Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung NLB 2010 auf der Wildniskonferenz:
„Da wir auch Feuer als ein Teil von Wildnisentwicklung verstehen, der benachbarten Bevölkerung aber kein erhöhtes Risiko zumuten wollen, setzen wir in Abstimmung mit den Kreisbrandmeistern ein Brandschutzkonzept um.“ [19]
Die Kreisbrandmeister sollten also das Brandschutzkonzept der Stiftung kennen, das der Entstehung von Wildnis dienen soll.
TUD-Waldexperte Michael Müller, Professor für Waldschutz und Waldbau an der TU Dresden schreibt in seinem Bericht zur Waldbrandlage in Sachsen und Brandenburg sowie Forderungen zum Umgang mit der Gefahr von Waldbränden (30.07.2022):
„Klar ist, Waldbrände haben in der natürlichen Entwicklung von Waldökosystemen in Deutschland keine Bedeutung. Sie werden, so wie auch im Fall der aktuellen Brände in Brandenburg und in der Böhmischen und Sächsischen Schweiz, fast immer von Menschen verursacht, zumeist durch Brandstiftung, mitunter infolge menschlicher Technologien. Damit ist auch klar, dass es gilt, die Prävention zu verbessern bzw. die Brände schnellstmöglich zu löschen.
Das Wissen und die Fähigkeiten dazu haben wir.“
Weiter schreibt er:
„Außerdem brennt es aktuell in Schutzgebieten, das heißt in Wäldern, in denen sich unsere Gesellschaft dafür entschieden hat, nicht einzugreifen und auf wirksame waldstrukturelle Waldbrandvorbeugung zu verzichten. Diese Position sollte überdacht werden. Streifen von 35 bis 50 Metern Breite, in denen man die Brandlast reduziert und Infrastrukturen schafft, beispielsweise tiefe Beastung und Brennmaterial auf dem Boden entfernt, sind ausreichend, um die vertikale Ausdehnung von Bränden zu verhindern, gut bekämpfbare Bodenfeuer zu erzwingen und Wundstreifen sowie Zugangswege für die Einsatzkräfte zu schaffen.
Wenn man das innerhalb dieser Gebiete nicht möchte, sollte man so konsequent sein, diese Gefahren, Risiken und Brandfolgen auch in Zukunft hinzunehmen und nur die Ränder zu Kulturräumen so gut sichern, dass die Brände nicht die Grenzen der dann auch vollständig zu sperrenden und ggf. freizusiedelnden Gebiete nicht überwinden können. Ich bin ausdrücklich nicht dieser Ansicht und auch der Stand des Wissens widerspricht diesem Vorgehen. Wenn die Gesellschaft aber die Erfordernisse für erfolgreiche Brandvorbeugung und Brandbekämpfung in diesen Gebieten nicht erfüllen möchte, weil andere Ziele höherrangig sind, sollte man auch nicht länger Geld für die Brandbekämpfung in diesen Gebieten ausgeben und die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren dort nicht unnötig binden oder sogar in Gefahr bringen.“ [20]
Dieses Zitat von Herrn Professor Michael Müller und ein Zitat von Max Weber bringen das Thema Wildnis und wie damit umgegangen wird, auf den Punkt. Max Weber schrieb einmal:
Die Qualität politischer Entscheidungen bemisst sich nicht an ihren guten Absichten, sondern an ihren guten Folgen. Eine solche Unterscheidung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik gilt auch für die Umwelt- und Klimapolitik.
Die abgebrannten Kiefernwälder werden niemals zu echten Urwäldern werden. So, wie die Gletscher der Eiszeit die Lieberoser Endmoräne gestalteten, wird sie auch in Zukunft bleiben. Dafür sollten wir alles tun. Einen Urwald schaffen, wo niemals einer war, ist Utopie. Die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg versucht, mit der Veröffentlichung wunderschöner Naturbilder ihre Idee vom zukünftigen Urwald zu begründen. Diese gezeigten Landschaften sind nicht auf den vorwiegend vorhandenen märkischen Sand übertragbar, auf dem seit tausenden Jahren mehrheitlich Wälder mit Kiefern und Traubeneichen beheimatet waren. Aktuell tendieren Wissenschaftler im Hinblick auf den zu erwartenden Klimawandel in Deutschland zu Mischwäldern mit Baumarten aus dem Mittelmeerraum, wie der Esskastanie. Dafür bedarf es keiner Brandrodung und keiner sonstigen unnützen Vernichtung von Wäldern, wie mutwillige Totholzerzeugung. Urwälder sollten besser in den dafür geeigneten Ländern dieser Erde erhalten bleiben. Dort wären unsere Fördergelder für derartige Projekte besser angelegt.
Es ist ein Ammenmärchen, dass Wildnis mit der angewandten Strategie, die nichts mit Wildnis und Urwald zu tun hat, dem Klimawandel Paroli bieten kann. Und doch erhält diese Klimapolitik Zuspruch von Wählern. Die haben keine Ahnung, was hinter den Versprechen ihrer Politidole steckt. Und die ahnen nicht, dass diese Politiker vielleicht auch keine tiefgreifende Kenntnis darüber haben. Möglicherweise fehlt ihnen die erforderliche Ausbildung auf dem Gebiet ihrer Arbeitsaufgabe. Die Verstrickung mit sogenannten NGOs (Nichtregierungsorganisationen) lässt das vermuten. Die Politik der Grünen macht zumindest den Eindruck, als würden sie von einer NGO, namens AGORA Energiewende regiert.
Zur Förderung von NGOs ist in der dts Nachrichtenagentur am 4. Juni 2022 zu lesen:
„Bundesverfassungsrichter mahnt den Staat zur Neutralität. Karlsruhe - Bundesverfassungsrichter Peter Müller hat mit Blick auf das geplante Demokratiefördergesetz der Bundesregierung daran erinnert, dass sich der Staat neutral verhalten müsse, wenn er Nichtregierungsorganisationen dauerhaft finanziell fördert. Es sei zwar das gute Recht des Staates, für Gemeinwohlziele an Vereine und Verbände Gelder zu verteilen. Der Staat dürfe seine Neutralitätsposition aber nicht verlassen, sagte Müller der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die staatliche Förderung von Organisationen müsse grundsätzlich neutral "gegenüber politischen und gesellschaftlichen Bestrebungen" erfolgen". [21]
Die deutsche Umsetzung der EU-Waldstrategie 2030 lässt an der Neutralitätsposition zweifeln. NGOs, die diese grüne EU-Strategie der deutschen Regierung zuarbeiten, werden dauerhaft finanziell gefördert. Die Waldeigentümer, um die es bei der Erarbeitung dieser neuen EU-Waldstrategie geht, werden außen vor gelassen. Andere Vorstellungen von Waldbau, Waldschutz und Waldstrategien haben keine Chance auf Berücksichtigung. Die EU-Kommission hat sich einzig mit dem grün gerichteten „Fit for 55 – Paket“ befasst, ohne Ökologie, Ökonomie und Soziales gleichermaßen einzubeziehen. Die Ziele der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 wurden unverändert übernommen. Sie beinhalten Nutzungsbeschränkungen auf 30% der Landfläche, wobei auf 10% der Fläche ein absolutes Nutzungsverbot gelten soll (Skizze).
Die deutsche Umsetzung der EU-Waldstrategie 2030 lässt an der Neutralitätsposition zweifeln. NGOs, die diese grüne EU-Strategie der deutschen Regierung zuarbeiten, werden dauerhaft finanziell gefördert. Die Waldeigentümer, um die es bei der Erarbeitung dieser neuen EU-Waldstrategie geht, werden außen vor gelassen. Andere Vorstellungen von Waldbau, Waldschutz und Waldstrategien haben keine Chance auf Berücksichtigung. Die EU-Kommission hat sich einzig mit dem grün gerichteten „Fit for 55 – Paket“ befasst, ohne Ökologie, Ökonomie und Soziales gleichermaßen einzubeziehen. Die Ziele der EU-Biodiversitätsstrategie 2030 wurden unverändert übernommen. Sie beinhalten Nutzungsbeschränkungen auf 30% der Landfläche, wobei auf 10% der Fläche ein absolutes Nutzungsverbot gelten soll (Skizze).
Wildnis soll entstehen. Die deutsche Regierung diktiert den Waldbesitzern diese EU-Strategie auf. Einst gepflanzte Bäume werden mit haarsträubenden Methoden dafür entfernt. Man vernichtet gestandene Kiefernwälder durch Feuer, Erzeugung von Totholz, Dulden des Borkenkäfers und vielem mehr. Wurden die Menschen bei der Verplanung der schönsten Gebiete Deutschlands vergessen? Wildnis, ja – aber dort, wo sie die Natur selbst geschaffen hat. Wildnis braucht keine Kartografen, die der Natur vorschreiben, wie sie es gern hätten. Die vorgesehenen Nutzungsbeschränkungen würden eine massive Einschränkung der Bewirtschaftung des Waldes bedeuten. Damit würde dem Land weniger Holz zur Verfügung stehen. Soll dann das fehlende Kohlendioxid-bindende Bauholz aus Ländern mit niedrigen ökologischen Standards importiert und teuer bezahlt werden?
Die Schaffung von Wildnis ist kein Thema, weil nicht erforderlich. Andere den Umweltschutz betreffende Themen wären eher ein Buch wert, so der Flugverkehr. Jeden Tag bringen weltweit über 200.000 Flugzeuge ihre Passagiere und Fracht von einem Flughafen zum anderen, und es werden immer mehr. Angemerkt sei: Die größten Klimasünder unter den Fortbewegungsmitteln sind laut „ecowoman“ Flugzeuge.
Beim Reisen mit dem Flugzeug, produzieren wir 380 g CO2 pro km. Damit erzeugt eine Flugzeugreise 153 Prozent mehr CO2-Emissionen als eine PKW-Reise und 950 beziehungsweise 1900 Prozent mehr CO2 als eine Reise mit der Bahn oder dem Bus. [22]
Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft hat in seiner Analyse der Klimaschutzinstrumente im Luftverkehr deutlich kleinere Zahlen verwendet. In der grün beeinflussten Regierung ist der Flugverkehr als Umweltsünder kein großes Thema. Auch nicht diese Beispiele:
• Ist es sinnvoll, in der Nordsee gefangene Krabben zum Puhlen nach Afrika zu fliegen? Es gibt sicher viele geeignete Menschen in Deutschland, denen diese Arbeit zuzumuten wäre.
• Mitbürger stellen sich Solarlichter in den Garten. Sie denken, dann sei es auch kein Problem, in den Urlaub auf die Malediven zu fliegen.
Der Wald ist halt der Sündenbock. Dabei ist Deutschland immer noch, wie vor tausend Jahren, zu einem Drittel bewaldet. Der Wald kann demzufolge nicht am Klimawandel schuld haben, leistet immer noch seine CO2-Dienste. Der Wildnisgedanke hat also andere Hintergründe. Ist er vielleicht nur eine imaginäre Idee - und alle machen mit? Und keiner will der Buhmann sein?
Klimapolitik erweckt oft den Eindruck eines Abenteuers, zumindest, wenn fragwürdige Klimaenthusiasten Gehör bei Politikern finden. Wenn sie gar selbst an der Politik herumbasteln, von der sie keine Ahnung haben, erst recht. Da fällt mir nur der Bibelspruch ein: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“
Heraus kommt dann so eine Strategie, mit der kein Bauer, Waldbesitzer oder Naturfreund glücklich ist.
Braucht Deutschland wirklich Wildnis, oder sind Nationalparke oder Naturschutzgebiete, wie einst der Spreewald, ausreichend? Vor allem dem Spreewald, aber auch vielen anderen Regionen Deutschlands eine von Menschen erdachte Wildnis aufzustülpen, wäre ein sinnloses, frevelhaftes Unterfangen.
Die in der Doku erfasste Thematik inspirierte mich zum Schreiben dieses Buches. Personen, Institutionen, Orte und Handlungen sind fiktiv dargestellt. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen wären rein zufällig. Parallelen zum aktuellen Thema Wildnis sind vorhanden. Die allgemeine Dramaturgie des Buches ist jedoch von meiner Fantasie geprägt.
Wolfgang Berg
Mord
am Schlosshofsee
Kriminalroman
DIE WICHTIGSTEN PERSONEN
Stefan Berrendt
1975 als Sohn von Gerd und Gerda Berrendt geboren, wohnt in Hexhütten. 2000 heiratet er Susanne Kuhsewicht. Im selben Jahr wird Sohn Louis geboren. Als studierter Forstwirt möchte er den Klimawandel positiv beeinflussen und dabei die Lehren seiner Professoren von der Uni anwenden. Doch eine neue Generation von Klimaaktivisten übernimmt das Ruder welches in unwissenschaftliche Gefilde steuert. Seinen Kampf dagegen muss er mit dem Leben bezahlen.
Klaus Kuhsewicht
Bruder von Susanne und Frank, Studien-Kommilitone von Stefan, ist Revierförsters der Stiftung „Wüste Wildnis“ in der Schönblumer Heide. Mit seinem Zuspruch zu neuen Klimarichtlinien hat er gegenüber dem besser geeigneten Stefan bessere Karten bei der Besetzung dieses Postens.
Frank Kuhsewicht
Bruder von Klaus und Susanne, ist Konsortialführer und Vorstandsmitglied der Stiftung „Wüste Wildnis“. Seine Geschäfte laufen nicht immer regelkonform.
Susanne Berrend (Susa), geb. Kuhsewicht
ist mit Stefan verheiratet. Die Ehe wird nach acht Jahren geschieden. Abgesehen von der Liebe zueinander, gibt es keine Gemeinsamkeiten zwischen den beiden. Diese Liebe bewahren sich beide bis zu Stefans Tot. Susanne ist Mitarbeiterin in der Stiftung „Wüste Wildnis“.
Claudia Hägeminster
Die Lebenspartnerin und Kollegin von Susanne, ist in den Entwicklungszonen der Stiftung für Initialmaßnahmen zuständig. Sie ist in ihrer Funktion für eine Vielzahl von Brandstiftungen verantwortlich. Claudia ist neben Susa auch Geliebte von Stefan. Nach dem Tod von Stefan gerät sie selbst in Lebensgefahr.
Gela Berrend
Zweite Frau von Stefan. Als sie mit ihm gemeinsam ein neues Leben beginnen möchte, ist es bereits zu spät.
Dr. Klaus-Dieter Winzling
Nutzte nach der deutschen Einheit die Gunst der Stunde und gründet im Osten gemeinsam mit Frank Kuhsewicht die Stiftung „Wüste Wildnis“. Dort ist er Vorstand, gerät durch zweifelhafte Machenschaften ins Visier der Kriminalpolizei.
Louis Berrendt
Der Sohn von Stefan und Susanne Berrendt ist mit Julia verheiratet. Sie haben einen Sohn, Gerhard-Stefan. Als Kriminalpolizist ist Louis aktiv an der Aufklärung des Mordes an seinem Vater beteiligt.
Gerste
Kosenamen von Gerhard-Stefan.
Jan Brodan
Kriminalhauptkommissar, Chef von Louis.
Beate Gründer, Lina Selbke
Kriminalpolizistinnen, Kolleginnen von Louis.
Renate Rädner
Staatsanwältin
Volker Otte
Richter
Dr. Holzbach
Anwalt
Anne Kuchenbäcker
Sie ist Geschäftsführerin einer Holding-Gesellschaft mit Tochtergesellschaften, wie dem Konsortium des Frank Kuhsewicht.
Konrad Ernst
Amtsbrandmeister
Rita Buttling
Feuerwehrkameradin
1
Stefan Berrendt war sich im Sommer 1995 während der Abschlussfeier seines Studiums nicht bewusst, auf welches Abenteuer er sich mit Susanne einlassen würde. Er spürte zwar beim Vermischen ihrer langen, blonden Haare mit seinen schwarzen, dass genau er dem Beuteschema dieser Kleinen entsprach. Von Mädchen umschwärmt zu werden, warf ihn nie gleich aus der Bahn, das kannte Stefan. War es seine athletische Figur mit dem Gardemaß von fast zwei Metern? War es sein dunkler Teint, der dem zierlichen, blassen Mädchen, das höchstens einen Meter sechzig maß, imponierte? Es war ihm in diesem Moment egal, denn eines registrierte er genau, ihren durchdringenden, stechenden Blick, ausgesandt von einem himmelblauen Augenpaar.
Dieser Funke, der ihn traf, ließ ihn außer Kontrolle geraten. Susanne war aus anderem Holz geschnitzt. So etwas hatte Stefan zuvor nicht gekannt. Sie meinte es gleich ernst. Seit dieser Abschlussfeier hatte er keine Chance mehr, ihr zu entkommen.
Sieben Monate war das her, jetzt blieben Stefan wenige Minuten, dann würde er ihr Ehemann sein. Er ließ die gemeinsame Zeit Revue passieren. „Ich kenne Susanne nur flüchtig, vermag zu wissen, dass eine Feier und wenige miteinander verbrachte Urlaubstage nicht zum Rüstzeug für eine Ehe ausreichen. Inzwischen ist sie im siebenten Monat schwanger. Verstanden habe ich Vater und Mutters Meinung, die Hochzeit sei lange überfällig. Dass Mutter Susanne gleich nach Hause holte, war nicht mein Ansinnen. Ich sagte ihr zwar, dass ich Susanne heiraten werde. Erst, wenn ich sie mit Herz und Seele kennengelernt habe, hatte ich aber hinzugefügt. Da organisierte sie gleich das ganze Brimborium um die Hochzeit.
Im Stillen hatte ich in Erwägung gezogen, dass eine Schwangerschaft kein Grund zum Heiraten sei. Ich hatte keine Chance, mich zu wehren. Jetzt gibt es einen Grund zum Feiern, zumindest nach Ansicht von Vater und Mutter. Ich werde pathetisch an meiner unausgegorenen Hochzeitsfeier teilnehmen.
Klar ist Susanne reizvoll, anzüglich, und wir nutzten die begrenzte Zeit des Zusammenseins zur körperlichen Hingabe in vollen Zügen. Kaum mehr, als ihr unersättlicher Liebesdrang ist mir von ihr bekannt. Ich kenne nicht einmal ihren Beruf, weiß nur, dass sie in einer Stiftung ihr Geld verdient“.
Jetzt stand Stefan vor dem Standesamt inmitten von Leuten, die sich zuvor meist niemals gesehen hatten. Einige schimpften über den längst überfälligen Standesbeamten. Thomas Bender, sein alter Schulfreund, unterhielt derweil die Gesellschaft mit Insiderwissen über die Klimaproblematik. Susannes Bruder Klaus, Forstwirt und ehemaliger Studienkommilitone von Stefan, diskutierte bald lauthals mit. Er hatte erkannt, dass dieser Thomas Bender im Bonner Umweltministerium beschäftigt ist.
Der Standesbeamte war mittlerweile eingetroffen, bestieg die ehrwürdige Treppe zum Standesamt und zog den Rest der Gesellschaft nach sich. Klaus Kuhsewicht hatte ihn anscheinend nicht bemerkt. Er missachtete, im Gespräch vertieft, den eigentlichen Anlass der Zusammenkunft und zwang den Gesprächspartnern seinen Standpunkt zum Klima auf.
Eine grelle Frauenstimme sprengte diese Unterhaltung. „Stefan!“, schallte es im Festungsrund.
„Das ist Susanne!“, erkannte ihr Bruder Klaus. Sofort brach er die Unterhaltung ab. Stefan betrat als letzter das Gemäuer eines im 16. Jahrhundert erbauten Festungsturms. Im mittelalterlich, verträumten Charme ragte er vor ihm empor. „Hier soll ich in Kürze mein ‚Ja‘ sagen?“, fragte er sich unentschlossen.
Die standesamtliche Trauung dauerte dann nicht lange. Aus dem, was Stefan dem Beamten zuvor erzählt hatte, vermochte dieser keine große Rede zusammen zu zaubern. Die sich auf Braut und Bräutigam beziehenden Angaben waren schnell zelebriert. Im wichtigsten Part der Trauzeremonie bat der Standesbeamte das Brautpaar, sich zu erheben. Er fragte zunächst Stefan, ob er Susanne heiraten möchte. Stefan stand von seinem Stuhl auf und sagte:
„So direkt hat mich das bisher niemand gefragt“, und schaute dabei Susanne an. Er hatte mit seiner Größe Mühe, ihr ins Gesicht zu sehen.
„Susanne, du bist ja so klein“, stellte er lachend fest.
„Eins sechzig“, sagte sie und strahlte ihn an, „das hatte ich dir doch erzählt.“
„Ja, aber das war mir doch bei unserem Kennenlernen egal.“
Der Standesbeamte fragte ungeduldig dazwischen:
„Na wollen sie heiraten, oder nicht?“
Da sann Stefan das erste Mal bewusst nach, auf was er sich mit Susanne eingelassen hatte. „Schönheit vergeht“, philosophierte er und hätte sich über diesen unvollendeten Spruch gern mit seinem Freund Thomas amüsiert. Doch ihm blieb nur die stille Frage: „Hat sie außerdem bleibende Eigenschaften anderer Art? Ja und wie kommt der Kuhsewicht überhaupt zu so einer Schwester? Von der Größe her sind sie gleich und blaue Augen hat der auch. Das ist aber schon alles. Dieses pockennarbige Gesicht mit schlanker Hakennase und den abstehenden Ohren sind eine Beleidigung fürs Auge. Mit seinem struppigen Bart versucht er sicher, dies zu verstecken. Aber den Klaus Kuhsewicht muss ich ja nicht heiraten. Susanne ist es. Und die ist eine Frau, wie aus dem Bilderbuch.“
„Herr Berrendt!“, mahnte der Standesbeamte: „Ja oder nein?“
„Ja, aber Herr Standesbeamter, ich komme nicht umhin, mir meine Frau zuvor noch einmal anzusehen.“
„Und sie, Frau Kuhsewicht, wollen sie Herrn Berrendt heiraten?“ Susanne nickte heftig und sagte: „Ja.“
„Damit seid ihr seit diesem Augenblick Mann und Frau und dürft die Ringe austauschen.“
Er las schon das Dokument zur Eheschließung vor, bat dieses zu unterschreiben, da unterbrach Stefan:
„Aber ich muss doch noch ‚Ja‘ sagen“.
„Alles erledigt, Herr Berrendt“, widersprach der Beamte und Susanne gab ihm recht.
„Stefan, du sagtest tatsächlich ja.“
Stefan hatte keine Lust, Streit zu führen. Er nickte mit dem Kopf und unterschrieb das Dokument.
„Na, da haben wir es ja“, sagte der Standesbeamte, zwinkerte Susanne zu und schloss seine Dokumentenmappe. Dann verabschiedete er das Brautpaar. Mit eingezogenem Kopf verließ er wie ein reuiger Sünder den Festungssaal.
„Das ist doch der Gipfel“, schimpfte Stefans Mutter. „Dreizehn Minuten waren das, da lade ich ihn lieber nicht zur Feier ein.“
„Lass gut sein, Gerda“, schaltete sich Vater Gerhard ein. „Dafür wird die Ehe von langer Dauer sein. Wir sollten uns lieber in Richtung Gaststätte begeben, um dort zu essen und zu trinken.“
„Gerhard, deine Rede war jetzt besser, als die des Standesbeamten“, sagte einer.
„Mein Vater“, klärte Susanne Stefan hinter vorgehaltener Hand auf. „Er leidet unter Durst.“ Der Schwiegervater verließ augenblicklich seinen Platz und holte im Ausgangsbereich den Beamten fast noch ein. Binnen Minuten war das Standesamt verwaist und die Gaststätte voll besetzt. Stefan zeigte sich überrascht von der schnellen Verbrüderung der Gäste. Die Zungen waren bald gelöst. An der Festtafel bildeten sich Gruppen, die angeregt miteinander diskutierten. Der Geräuschpegel nahm stetig zu. Bald verstand einer des anderen Wort kaum. Mit weiterem Anstieg des Alkoholkonsums wurden die Diskussionen hitzig und keineswegs im Einklang. Der Klimawandel und welche Rolle der Wald dabei spielen würde, waren das große Thema. Klaus Kuhsewicht schwang das Zepter und sagte am Ende:
„Es liegt in unserer Verantwortung, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten. Wir werden allmählich die alten Kiefernbestände der Stiftung ‚Wüste Wildnis’ entfernen und den Wald sich selbst überlassen. Wildnis nennt man das, was daraus entsteht.“
„Entstehen soll“, korrigierte Stefan. „Und wie willst du die Kiefernbestände entfernen? Die Stiftung ist doch angehalten, nicht in die Natur einzugreifen. Naturschutzgebiete müssen der Bevölkerung frei zugänglich sein, anders als die von dir favorisierte Wildnis. Ich habe es so gelernt, hattest du bei dieser Vorlesung gerade gefehlt?“
„Und du, Stefan, hast versäumt, die Richtlinien der Europäischen Union zu studieren. In denen wird Wildnis gefordert. Wildnis entsteht halt nur dort, wo der Mensch im Wald Feuer und den Borkenkäfer gewähren lässt.“ Stefan schüttelte den Kopf.
„Die Sprüche passen zu deinem Examen-Abschluss“, sagte er. „Sie waren dir beim Besteigen der Karriereleiter offenbar hilfreich. Trotz alledem wurdest du Revierförster, ich dagegen nicht. Zu deinem Trugbild der Entstehung von Wildnis gibt es bisher keine wissenschaftliche Definition. Es sind nur fragwürdige Visionen von grün gesinnten NGOs, diesen ominösen Denkfabriken. In ihrer Rolle als Nichtregierungsorganisationen erwecken sie den Eindruck, als regierten sie uns. Sie werden vom Staat dauerhaft finanziell gefördert und erledigen die Zuarbeit der Minister, die von ihrem Fach oft wenig verstehen. Diese Regierung wird den Klimawandel nicht aufhalten. Im Gegenteil, sie fördert ihn, denn weitgehend realitätsfern ist die grüne Umweltpolitik unter anderem in Bezug auf den Umgang mit dem Wald.“
„He, Stefan, du hast ja echt Ahnung“, lobte Susanne ihren frisch gebackenen Ehemann. „So kenne ich dich gar nicht. Aber ich vertraue trotzdem Klaus.“
„Das unterscheidet uns beide; du glaubst, was Klaus erzählt hat und ich weiß, wovon ich spreche. War dein ‚Ja‘ zu früh ausgesprochen? Wirst du die Hochzeit heute schon bereuen? – was nun, Frau Berrendt?“
„Ich liebe dich, das ist die Hauptsache.“
„Hör auf mit deiner Liebeserklärung, Susanne, das Thema ist doch durch“, sagte ein groß gewachsener Mann. Er winkte mit beiden Händen ab. Die waren großflächig, wie Bratpfannen. Sie verrieten, dass er bei seiner Arbeit tüchtig zupackte.
„Stefan, du hast recht. Ich möchte es aus meiner Sicht erklären: Mein Beruf ist Zimmermann, für meine tägliche Arbeit benötige ich Bauholz. Kiefernholz aus unseren Wäldern ist dafür am besten geeignet. Wenn ich aber heute durch unsere Wälder gehe, blutet mir das Herz. Bestes Nutzholz fault dort vor sich hin. Stattdessen wird Rohholz importiert. 2018 waren es über sieben Millionen Kubikmeter, habe ich gehört. Der miserable Waldzustand mit Totholz ist eine Zumutung für jeden Naturfreund und insbesondere für uns aus der Baubranche. Wir brauchen einen gesunden, aufgeräumten Wald für den Klimaschutz und als Rohholzlieferant.“
„Wer hat denn Schuld am Klimawandel?“, wollte es Susanne nun genau wissen.
„Ich will es mal so sagen“, übernahm Stefan die Antwort. „Der allein Schuldige am Klimawandel ist der Mensch mit seinen Fähigkeiten, seiner Neugier und seinem Erfindergeist. Mit der Trennung der gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Schimpanse vor sechs Millionen Jahren wurden die Ahnen der heutigen Menschen in die Savanne gezwungen. Den aufrechten Gang gäbe es ohne dieses Ereignis nicht, die Entwicklung wäre völlig anders verlaufen. Womöglich würden wir uns immer noch wie unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, von Ast zu Ast hangeln. Von Kapitalismus und Klimawandel würde keiner sprechen – können. Und weil das so ist, fühlen sich bestimmte Menschen, von X-Y bis Karl Schieß-mich-tot, berufen, gegen die Schuldigen zu protestieren. Sie kleben sich auf Autobahnen fest, ketten sich auf Baumkronen an, schweißen sich an Eisenbahnschienen, greifen in Folge dessen in den Verkehr ein, behindern die Wirtschaft, gefährden andere Menschen. Und sie erzielen Wirkung in oberster Instanz. Wenn man diese Typen in den Baumkronen sieht, ist man geneigt, anzunehmen, es seien unsere Vorfahren von vor sechs Millionen Jahren.“
„Das ist so“, reagierte Thomas Bender spontan und grinste. Alle anderen Gäste amüsierten sich ähnlich über Stefans Beitrag, nur Susanne nicht. Sie bekam Farbe im sonst blassen Gesicht, ließ ihren Unmut deutlich erkennen. Ihrem Ärger Luft verschaffend, schrie sie mit erregter Stimme in das Gelächter:
„Stefan, bin ich in deinen Augen etwa eine Äffin?“
„Susanne, nein, um Gottes willen, wie kommst du denn darauf? Ich habe nicht gesagt, dass du eine Äffin bist!“
„Ich war aber bei den von dir angesprochenen Demonstrationen auch schon dabei.“
„Susanne, das ist doch nicht so schlimm, Jugendliche flippen schon mal aus. Es geht mir nur darum, dass man die Fähigkeiten und den Erfindergeist des Menschen nicht anzweifeln sollte. Der heutige Wohlstand wäre ohne den elektrischen Strom, Verbrennungsmotoren und anderem mehr nicht möglich. Selbstverständlich war diese Industrialisierung nicht immer klimafreundlich, aber das war der Zeit geschuldet. Heute können wir nicht alles dem Klima nicht Zuträgliche abrupt abschaffen. Die Menschen werden in der Lage sein, Äquivalente zu finden. Es braucht seine Zeit.“
Susanne stand auf, rannte aus dem Saal und rief dabei:
„Mir scheint, dass ich in deinen Augen eine ausgeflippte Äffin bin“ und war verschwunden.
Klaus Kuhsewicht lachte aus vollem Hals.
„Das ist meine Schwester, Stefan, so kenne ich sie, mach dir da nichts draus.“
„Entschuldige bitte mal, Klaus. Ich heiratete sie heute, und ich hatte mir den Tag ein wenig anders vorgestellt. Du hast sie mir während der Abschlussfeier wie Sauerbier angeboten. Damals hättest du von ihren außergewöhnlichen Reizen erzählen können. Du kannst aber nichts für deine Schwester. Ich bekomme das wieder hin.“
„Na dann viel Spaß“, sagte der neue Schwager, mit dem Stefan nie viel am Hut hatte. Seine reizende Schwester beförderte ihn mit diesem Tag sogar zum Verwandten. Darauf würde Stefan gern verzichten.
2
Sieben Jahre waren seit der Hochzeit vergangen. Das Grundstück der Berrendts schien sich im Dornröschenschlaf zu befinden.