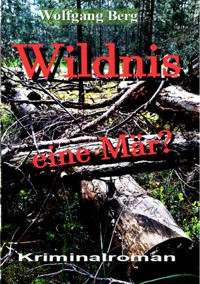9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Geboren, um zu leben
- Sprache: Deutsch
Wilhelmine ist Enkeltochter eines einst sehr betuchten Mannes des Spreewaldortes Burg und Tochter des Berliner Kaufmanns Gustav Achtel aus Berlin. Dennoch gestalten sich ihre Lebensumstände infolge plötzlichen Leids der Großeltern und Trennung der Eltern äußerst ärmlich. Den Lebensunterhalt bestreitet Wilhelmine nach ihrem Schulabschluss als Dienst- und Küchenmädchen, so auch auf dem Rittergut Briesen im Schloss des Barons von Wackerbarth. Dort lernt sie die Mamsell Käthe Scholz kennen, die ihr den Weg zur großen Liebe mit Paul ebnet. Mit ihm gemeinsam steht ihr ein entbehrungsreicher, steiniger Weg durch Krieg und Elend bevor. Ohne Reichtum, dennoch glücklich, verbringt Wilhelmine ihren Lebensabend in Burg. Wilhelmine – eine Zeitreise von der Kaiserzeit des späteren 19. bis hin ins 21. Jahrhundert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Wolfgang Berg
Wilhelmine
Was ich euch noch sagen wollte
Wolfgang Berg
Wilhelmine
Was ich euch noch sagen wollte
© 2023 Wolfgang Berg
Website: www.spreewald-heide-pension.de
Umschlaggestaltung und Illustration: Wolfgang Berg
veränderte Neuauflage
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
ISBN: 978-3-384-00983-8
Inhaltsverzeichnis
Cover
Halbe Titelseite
Titelblatt
Urheberrechte
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Epilog
Wilhelmine
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Prolog
Epilog
Wilhelmine
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
Prolog
- 2008 -
„So, Kinder, jetzt habe ich wieder viel zu viel erzählt“, sagte Wilhelmine. Sie stand auf und gab ihren soeben noch lauschenden Zuhörern, die selbst gar nicht zu Wort kamen, zu verstehen, dass sie jetzt gehen könnten. Sie selbst würde sich ihren Tee brühen, Abendbrot essen und schlafen gehen.
„Das ist ja ein glatter Rausschmiss!“, reagierte ihr neunjähriger Urenkel spontan, der solange wie gefesselt an den Lippen seiner betagten Uromi hing. Ihre alten Geschichten aus längst vergangenen Zeiten hatte er wie Märchen aufgesogen. Das registrierte Wilhelmine natürlich mit Wohlwollen und amüsierte sich dann köstlich über die Kessheit des Kleinen. Doch dann wurde sie mit einem Male nachdenklich.
„Kinder“, sagte sie nach kurzem Schweigen, „ich habe etwas für euch, nichts Besonderes.“
Wilhelmine stand auf, ging zum Wohnzimmerschrank und öffnete das rechte obere Fach, das durch eine Tür mit gewölbter Glasscheibe verschlossen war. Wenn sie etwas Besonderes aus diesem antiken Möbelstück benötigte, griff sie stets auf dieses Schrankfach zurück.
„Schmeißt es einfach in den Ofen, wenn ihr nichts damit anfangen könnt“, meinte sie, während sie Papierkram durchwühlte und einen Stoß handgeschriebener DIN-A4-Blätter herausholte. Es schien, als hätte sie diese vergilbten Seiten aus alten Heften gerettet und sie mit ihrer eigenen Handschrift aufgewertet. Jetzt waren sie mit Sütterlin- und lateinischen Lettern beschrieben.
„Eigentlich wollte ich alles selbst verbrennen und nicht darüber reden“, sagt Wilhelmine. „Es sind ja Sachen dabei, die niemand wissen muss. Aber ich gebe euch trotzdem das, was ich aufgeschrieben habe, nur für euch. Da steht so viel drin, was meine Mutter mir von sich und ihren Eltern erzählt hat. Es wäre schade, wenn das alles in Vergessenheit geriete“.
Aber schon beim Abschied äußerte Wilhelmine Bedenken:
„Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig gemacht habe.“
„Keine Sorge, Mutter, sagte ihr Sohn. Ich vermute, dass es sich um deine Memoiren handelt. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache, das aufzuschreiben. Du musst dir darüber keine Gedanken machen. Dennoch sollten wir jetzt losfahren“
Er verspürte plötzlich große Eile und wollte den Abschied nicht weiter hinauszögern. Nachdem er nach Hause zurückgekehrt war, tauchte er sofort in die mysteriösen Seiten ein und um Mitternacht wusste er: Es ist ein wahrer Schatz.
Kaum war die Nacht vorbei, als am frühen Sonntagmorgen um sieben Uhr das Telefon klingelte. Es gab nur eine Person, die zu dieser Zeit anrufen konnte. Mit einer Vorahnung, was als nächstes kommen würde, ging er zum Telefon. Als er „Wilhelmine“ auf dem Display las, sagte er leise „Natürlich“ und überlegte:
„Soll ich jetzt rangehen oder mich erst am Montag melden? Bis dahin könnte ich alles irgendwo kopieren lassen.“ Er hat das Telefon abgenommen und seine Mutter wie gewöhnlich ohne Pause sprechen gehört. In ihrem Tonfall war ihre innere Aufregung zu spüren, als sie fragte:
„Hast du die Seiten schon gelesen? Ich habe das Geschriebene nicht richtig durchdacht. Du musst mir alles, was ich dir gestern mitgegeben habe, unbedingt zurückbringen; sofort!“
Mutter ließ sich nun nicht mehr umstimmen. Er hatte absolut keine Chance. Wenn sie ihr Werk so dringend verlangte, musste er nach Burg fahren und es ihr bringen.
Was war der Grund für ihre Entscheidung? Sie hatte lediglich über sich selbst, ihre Familienmitglieder und Bekannte geschrieben. War es die Nennung der Namen, welche sie nun nicht mehr preisgeben wollte oder waren es die bislang unerwähnten Details in ihren Geschichten, die sie verbergen wollte?
Seitdem hat Wilhelmine nie wieder über ihr Leben gesprochen. Die außergewöhnlichen Erinnerungen, die der Autor vorübergehend als Skript in seinen Händen hielt, und die zahlreichen Geschichten, die sie teilte, inspirierten ihn, diesen historischen Roman zu verfassen.
Herzlichen Dank, Wilhelmine!
*
Um den vermeintlichen Wunsch Wilhelmines nach größerer Anonymität zu respektieren, hat der Autor einige Namen geändert.
1
Nein, ich war noch nicht richtig wach. Ich träumte in meinem warmen Federbett noch einen schönen Traum aus. Der gleichmäßige Rhythmus des Plätscherns, der seinen Ursprung im Eimer neben meinem Bett hatte, fügte sich nahtlos in diesen Traum ein. Die Klänge waren wie eine vielschichtige Melodie, die ich aus jedem aufgeschlagenen Tropfen heraushörte.
Ich schaute nach oben und entdeckte einen großen braunen Fleck auf der weiß gekalkten Lehmdecke, dessen Umrandung eine abstrakte Form mit kunstvoll gestaltetem Muster bildete. Im Zentrum dieses Flecks bildete sich in rascher Folge ein Wassertropfen, der dann im Eimer sein Ziel fand.
Ein lautes Geräusch unterbrach meine Träumerei. Es war die Haustür, die Mama sicher mit großem Kraftaufwand in ihren Rahmen fallen ließ – mit Erfolg. Sie hatte soeben ihre Tochter geweckt.
„Mama, Mama!“, rief ich aufgeregt, „der Eimer läuft über!“ Dann wurden meine schönen Träumereien endgültig von Mamas Schimpfkanonaden abgelöst.
„Der alte Suffkopf treibt sich nur in den Kneipen herum, statt das Dach zu reparieren!“
„Welcher alte Suffkopf?“, wollte ich wissen.
„Na, Papa, wer denn sonst? Frag nicht so viel und steh lieber auf! Waschen, Zähne putzen, los, los, wir haben keine Zeit! Nimm das Wasser gleich aus dem Eimer, dann wird er auch nicht mehr überlaufen. Es ist auch nicht so braun wie das Wasser aus der Pumpe.
„Ja, Mama, ich stehe ja schon auf.“
Ich richtete mich in meinem Bett auf und verharrte einen Moment im Schneidersitz. Die offenstehende Zimmertür gewährte mir einen Blick bis hinauf zum löchrigen Strohdach des Flures. Hier hindurch drangen nun schon erste Sonnenstrahlen, die den eben noch starken Regenguss ablösten. Geblendet sprang ich aus meinem Bett heraus und verfehlte dabei knapp die bereitstehenden Holzpantoffel. Ich stakste auch lieber barfuß durch den weißen Sand des feuchten Fußbodens. Dabei musterte ich meine Fußspuren, die sich von den parallelen Linien, die mit einer Harke gezeichnet wurden, interessant abhoben.
Die Träume der Nacht waren nun endgültig gewichen und ich konnte wieder klare Gedanken fassen: Es ist Ostersonntag und Mama will mit mir zu meinen Patentanten gehen. Dies wird voraussichtlich bis zum Abend dauern.
Schnell füllte ich die Waschschüssel mit klarem Regenwasser aus dem Eimer, schüttete mir zwei Hände voll Wasser ins Gesicht und glaubte, fertig gewaschen zu sein. Mama ermahnte mich jedoch:
„Keine Katzenwäsche, mein Kleines; Du musst dich bei den Patentanten in deinen neuen Sachen sauber präsentieren!“
„Neue Sachen?“, wunderte ich mich. Ich nahm den Waschlappen und strich mit der harten, groben Kernseife darüber. Endlich hatte ich so viel Seifenschaum produziert, dass Mama sich mit meinem Waschen zufrieden gab. Dann lüftete sie das Geheimnis des Zähneputzens.
„Minka!“, rief sie, „Überraschung! Eine Zahnbürste! Jeden Tag werden ab heute die Zähnchen geputzt, damit sie immer schön weiß bleiben und dir nicht verloren gehen. Das darfst du auch nicht vergessen, sonst siehst du bald so aus, wie die alte ‚Sultkanka‘.“ Was ich nun als Geschenk in den Händen hielt, war ein Knochen, in den in regelmäßigen Abständen kurz gestutzte Schweineborsten versenkt waren. Mama erklärte mir die Funktion dieses „modernen“ Zahnpflegegerätes und dann rubbelten wir mit diesem in meinem Mund herum.
„Und das soll ich nun täglich machen?“, fragte ich etwas verunsichert.
Mutters Geschenke kamen nicht immer so gut bei mir an. Meist waren es praktische Dinge, die ich sowieso irgendwann brauchte.
„Mama, ich ziehe mich jetzt an.“, rief ich.
„Minka, warte noch einen Moment mit dem Anziehen!“, antwortete Mama, ging zum Schrank und kam von dort mit einer wendischen Tracht auf den Armen zurück. Dieses umfangreiche Kleidersortiment breitete sie auf meinem Bett aus. Es fand kaum Platz darauf.
„Selber genäht!“, sagte sie stolz und wies dabei auf Trägerrock, Schürze, Samtweste, Schultertuch und Haube. Mein Gesicht muss dieses Freude ausdrückende Strahlen meiner Mutter nicht gerade erwidert haben, denn sie fragte verwundert:
„Freust du dich denn überhaupt nicht?“
In meinem Kopf spielte sich das Anziehen dieser Sachen ab, wovon ich wusste, dass es sehr umständlich war und viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Außerdem fand ich damals Mamas wendische Sachen nicht so schick, wie die der deutsch gekleideten Frauen in Burg-Dorf.
„Mama, ich will diese Tracht nicht haben!“, sagte ich trotzig. Mutter fiel fast aus allen Wolken.
„Aber Kind, du solltest dich über die Tracht freuen und dankbar sein. Andere Kinder im Dorf haben so eine schöne Tracht gar nicht.“
Das wusste ich ja, aber ich hätte lieber ein normales schönes Kleid, eines, wie es die meisten Mädchen im Dorf trugen, eines, das ich schnell anziehen und wieder ausziehen könnte.
Minuten später stand ich in Unterwäsche vor meiner Mutter und ließ die Prozedur des Anziehens über mich ergehen. Jetzt half kein Weinen und Zetern. Ich musste den ständigen Ermahnungen zum Stillstehen oder zu anderen erforderlichen Handlungen folgen, bis ich nach einer Stunde angezogen und somit reisefertig war.
Wilhelmine mit Mutter Luise
2
Wie ein kleines Hündchen lief ich neben meiner Mama her, in der Hand eine Semmel, an der ich kaute. Wir hatten sie als Proviant mitgenommen; nicht zum Sattwerden, denn schließlich sollte bei den Paten noch ein guter Appetit vorhanden sein. Ich hatte mich meinem Schicksal ergeben.
Beim Laufen betrachtete ich Mutters wendischen Rock mit den bunten, gestickten Blumen drauf. Dann zog ich meine Schürze beiseite und bewunderte die Blumen auf meinem Rock. Auf einmal fand ich diese Kleidung gar nicht so schlecht. Mich plagte ein schlechtes Gewissen. Mama hatte sich bestimmt große Mühe beim Nähen meiner Tracht gegeben, da hatte sie meine Undankbarkeit nicht verdient. Unsere Blicke begegneten sich einen Moment. Jetzt hatte ich meine Mama wieder ganz lieb und als könnte sie Gedanken lesen, nahm sie mich in die Arme und drückte mich.
Hand in Hand führten wir unseren Weg ohne ein Wort fort. Ich ertappte mich schon lange dabei, Gefallen an unserer Reise zu finden, hatte meine Störrigkeit längst abgelegt und war offensichtlich mit meiner Mutter auf einer Wellenlänge. Schließlich wollte ich ja Geschenke bekommen. Meine Tracht fand ich nun sogar lustig. Ich sah fast wie Mama aus, nur eben viel kleiner.
Meine Mutter war eine zierliche Frau mit einem gutmütigen und fröhlichen Gesichtsausdruck. Obwohl sie in ihrem Leben nicht gerade vom Glück begünstigt war, hatte sie oft ein Lächeln auf den Lippen. Schon damals waren feine Nuancen in ihrem Gesicht zu erkennen, die ich nicht zu deuten vermochte. Ihr langes, schwarzes Haar trug sie akkurat gescheitelt und am Hinterkopf zu einem Knoten gebunden. Sie trug stets ein schwarzes Samtband über dem Kopf, möglicherweise zur Zierde, vielleicht auch für den Halt der Frisur. An besonderen Anlässen, wie an diesem Ostertag, trug Mama jedoch eine große, weit ausladende Haube, die ihre Frisur verdeckte. Lediglich der Mittelscheitel guckte an der Oberstirn noch heraus. Ich kannte meine Mutter ausschließlich in ihrer Tracht. Andere Kleidungsstücke hatte sie nicht. Ich konnte sie mir auch gar nicht anders vorstellen als in ihrer Tracht.
Schritt für Schritt näherten wir uns unserem ersten Ziel. Die Vögel zwitscherten und in der Ferne hörte man das fröhliche Lachen von Kindern. Vielleicht hatten sie schon ihre Osternester gefunden und freuten sich deshalb. Ich fühlte mich wie in einer verzauberten anderen Welt. Die Sonnenstrahlen drangen durch die Kronen der knorrigen Kopfweiden, die unseren Weg rechts und links flankierten. Mal waren sie grell und dann wieder verdeckt von den Zweigen.
Blumen, die eben noch vom Regen der Nacht fast erdrückt wurden, reckten nun befreit ihre Köpfe gen Himmel. Sie wiegten sich im Wind und nahmen dabei die Morgensonne gierig entgegen, um sich vom Nass der Nacht zu entledigen. Störche schnappten auf den feuchten Wiesen nach Fröschen.
Oft überquerten wir Fließe und Gräben, die sich wie Krakenarme durch die Landschaft zogen. Bänke waren es, über die wir dann gingen. So nennen die Spreewälder ihre nach oben gewölbten Brücken, die manchmal nur aus einzelnen Bohlen bestehen. Einem Kahnfährmann begegneten wir, der seinen Kahn voller Gäste unter solch einer Bank problemlos durch die Spree stakte. Seinem Gegenverkehr wich er gekonnt aus. Diese Gesellschaften genossen offensichtlich genau wie wir die Spreewaldlandschaft, dieses Geschenk der Natur.
Burg-Kauper nannte sich das Dorf, in dem wir uns jetzt befanden. Hier sah es anders als in Burg-Dorf aus. Kleine Wiesen- und Feldflächen waren in diesem Landstrich von Gräben oder Fließen umgeben, an deren Ufern meist Erlen wuchsen. Heuschober - um eine Stange gestapeltes Heu - gaben der Landschaft eine ganz besondere Note. Manchmal ragten diese Heugebilde noch aus den Resten des Winterhochwassers heraus.
Foto-Werkstätte Erhard Steffen Burg Spreewald
Als unser Weg unter hohen, Schatten spendenden Erlen an einem Fließ vorbeiführte, stoppte Mama ihren Schritt. Sie zog ihr Taschentuch hervor, denn sie hatte Tränen in den Augen. Die plötzliche Traurigkeit meiner Mutter machte mich fassungslos. Ich konnte mir nicht erklären, warum sie so plötzlich weinen musste.
Wir standen vor einem großen Haus. Es stach von den hier vereinzelt stehenden kleinen Spreewaldhäusern, die unserem Zuhause ähnelten, erheblich ab. Es hatte kein Strohdach, wie alle anderen Häuser weit und breit, sondern ein rotes Ziegeldach. Große Fenster mit bunten Butzenscheiben zierten die vorgebaute Veranda. Durch die geschmackvoll verzierte Eingangstür aus Eichenholz würde ich gerne gehen.
Ratlos stand ich neben meiner Mutter und fragte ganz traurig:
„Mama, warum weinst du denn?“
Mutter streichelte mein Haar und sagte:
„Das war mal mein Elternhaus, hier bin ich geboren worden.“
Das konnte ich nicht verstehen und fragte sofort:
„Und warum wohnen wir nicht mehr hier?“
„Als ich noch ganz klein war, hat mir meine Mama einmal erzählt, dass wir alle von hier wegziehen müssen.“
„Warum?“
„Nun, das ist eine lange Geschichte. Mein Papa und meine Mama waren sehr reich und haben dann plötzlich alles verloren. Deshalb mussten wir von hier weg und deshalb sind wir auch jetzt so arm. Später, wenn du größer bist, werde ich dir alles erklären. Jetzt bist du noch zu klein dafür.“
„Mama, ich möchte auch einmal reich sein“, sagte ich zu meiner Mutter. Da wurde plötzlich unser Gespräch von zwei wütenden Hunden unterbrochen, die mit gefletschten Zähnen über uns herfielen. Glücklicherweise hatte meine Mutter alles im Griff und konnte schnell in die große Tasche ihres wendischen Rockes greifen, in der sie extra für solche Zwischenfälle rohe Knochen aus der Fleischerei ihres Bruders deponiert hatte. Die Hunde stürzten sich jetzt auf die Knochen und wir konnten unversehrt unseren Weg fortsetzen. Vor lauter Aufregung hatte ich jedoch ganz vergessen, dass ich eigentlich vorhatte, reich zu werden.
Mein Magen fing an zu knurren.
„Mama, sind wir bald bei Tante Günther?“, fragte ich.
„Wir sind gleich da“, sagte Mama. „Sieh nur dort hinten das große Haus, dort wohnt Tante Günther.“ Ich sah ein auf einem Feldsteinsockel errichtetes Haus, auch mit roten Ziegeln eingedeckt.
„Aber so schön wie dein Elternhaus ist es lange nicht.“, sagte ich.
„Jetzt sei endlich still!“, mahnte Mama. „Siehst du denn nicht, dass Tante Günther uns an ihrer Haustür schon erwartet?“
Meine Schritte wurden immer schneller, bald rannte ich und dann begrüßte ich Tante Günther mit „Dobry źeń“.
„Na Minka, kommst du nach rote Eier?“, fragte sie in wendischer Sprache. Ich konnte sie verstehen, aber antworten wollte ich nicht. Wendisch konnte ich sowieso nicht so gut sprechen, deshalb beließ ich es meist beim Grüßen in dieser Sprache. Außerdem zweifelte ich an der Ernsthaftigkeit der Frage mit den „roten Eiern“. Ich sah die Tante ungläubig an. Bunte Ostereier und andere Geschenke hatte ich mir eigentlich als Geschenk vorgestellt und wusste nicht, dass dieser Osterbrauch des Patenbesuchs „wir gehen nach rote Eier“ genannt wurde.
Inzwischen war meine Mama angekommen. Auch wenn ich mich auf Tante Günther gefreut hatte, so war ich jetzt froh, dass ich nicht mehr ihre vielen wendischen Fragen beantworten musste. Über meine Antworten lachte sie und ich dachte, sie lacht mich aus, weil ich nicht so gut wendisch sprechen konnte. Jetzt hatte sie sich mit Mama viel zu erzählen, und ich konnte die Geschenke gar nicht erwarten. Tante Günther muss das bemerkt haben, denn sie unterbrach Mama in ihrem Gespräch und sagte mir zugewandt: „Ja raz pó cerwjene jaja pójdu, Minka njamóžo je wěcej docakaś. (Ich werde mal die roten Eier holen, Minka kann es doch nicht mehr erwarten.)
Ich war glücklich, denn neben drei verschiedenfarbigen Eiern bekam ich dann auch noch eine Ostersemmel in Form eines flachen Spreewaldkahnes mit zwei Pfefferkuchen obendrauf - einer mit Abziehbild, der andere ohne.
Das krönende Geschenk war aber eine Tasse mit meinem Namen in goldener Schrift versehen. „Maš teke dobry tykańc? (Hast du auch guten Kuchen?)“, fragte ich, nachdem ich meine Geschenke empfangen hatte. Ich hatte diese Frage zuvor gründlich durchdacht, Tante Günther sollte meine schlechte Aussprache nicht mitbekommen.
„Se wě, až mam teke dobry tykańc!“ (Natürlich habe ich auch guten Kuchen!), sagte die freundliche Frau lachend. Sie hatte sicher das Knurren meines Magens gehört.
„Getta“, sprach die Tante meine Mutter an, „ich hole mal schnell den Kuchen aus dem Keller, die Minka verhungert uns sonst noch.“ Sie ging eine mit Klinkern gemauerte Treppe hinab und kam mit einem Teller voller Kuchen bald zurück.
Ich bestaunte inzwischen die gut ausgestattete Küche. Die weiß gestrichenen Fenster und Türen, die Fliesen auf dem Fußboden und die Kacheln an den Wänden beeindruckten mich sehr. Wir hatten zu Hause keine separate Küche, denn bei uns gab es ja nur einen Wohnraum.
„Tante Günther“, sagte ich, nachdem ich satt war: „Dein Kuchen schmeckt viel besser als unser zu Hause.“
„Ach“, sagte sie, „woanders schmeckt es immer besser.“
„Minka, frag nicht so viel!“, schaltete sich Mutter nun ein und sagte:
„Wir werden mal lieber gehen, sonst fragt sie noch Löcher in deinen Bauch. Außerdem haben wir noch einen langen Weg vor uns.“
Kaum hatten wir Günthers hinter uns gelassen, da bedrängte ich Mutter mit neuen Fragen:
„Mama, warum haben Günthers nicht so einen geharkten Fußboden wie wir und warum schmecken die Ostersemmeln und der Kuchen bei Günthers besser als bei uns?“
„Woanders schmeckt es immer besser!“, bekam ich auch von Mama zur Antwort.
„Und warum haben die keinen Sand in der Stube?“
„Das erzähle ich dir später.“
„Mama, warum schmeckt es woanders immer besser?“, bohrte ich nun energisch nach.
„Frag nicht so viel und hebe lieber die Beine beim Laufen!“
Ich hatte wieder keine richtige Antwort erhalten. Das machte mich misslaunig und ich hob nun betont auffällig meine Beine. Auf einmal hatte ich begriffen, wie arm wir wirklich waren und dass Mama mir nicht sagen wollte, dass es anderen Leuten besser ging. Ich spürte, dass sie damit höchst unglücklich war und fragte dann doch noch auf eine sanfte, fast fürsorgliche Art:
„Mama, sind wir arm? Meine Mutter sagte nun nichts mehr. Sie zog ihr Taschentuch hervor und versuchte ihre Tränen zu verstecken.
„Minna“, sagte sie nach einer Zeit des Schweigens, „wir sind sehr arm, aber glaube mir, mit Gottes Hilfe werden wir unsere Armut bald hinter uns lassen.“
„Mama, weine nicht, es wird bestimmt alles gut!“, sagte ich und dann ging ich in Gedanken versunken neben meiner Mutter her.
Längst hatten wir die nächsten Paten hinter uns gelassen. Die schwere Tracht wurde mir langsam zur Last. Die Haube drückte auf dem Kopf und der Trägerrock hing schwer auf meinen Schultern. Ich fühlte mich schlapp und wurde unzufrieden. Außerdem wollten mir die Beine dann auch noch ihren Dienst versagen. Ich warf mich ins Gras neben dem Weg und nörgelte:
„Mama, ich kann nicht mehr laufen!“
„Minna!“, rief Mutter böse, „sofort stehst du auf! Mit dem neuen Rock darfst du nicht im frischen Gras liegen! Der bekommt grüne Flecke und die bekomme ich nicht mehr raus.“
Das hatte ich verstanden, stand sofort auf und trottete mit müden und mit schmerzenden Gliedern weiter neben meiner Mutter her.
Es war später Nachmittag, da hatten wir Burg-Dorf wieder erreicht.
„Wir sind bald bei Gratzens“, sagte Mama. „Von denen bekommst du bestimmt ein schönes Geschenk, denn sie sind ja unsere Verwandten und die haben auch etwas mehr. Weißt du was, Minka, du singst am besten Tante Graz ein Lied vor, vielleicht gibt es dann noch etwas obendrauf.“
Mutter hatte sich die Idee des Singens sicher nicht ohne Hintergedanken ausgedacht. Sie wollte mich aber auch bei Laune halten und begann selbst das Berliner Lied, „Komm Karlineken, komm“, zu singen. Sie sang allerdings, „Komm Karlinka, komm“. Ich sang es so mit, denn ich kannte es ja nicht anders. Als das Lied beendet war, sagte sie:
„Bei Tante Graz wirst du das alleine singen.“
Sie wusste genau, dass ich das gerne tat. Dann erzählte sie einiges von Berlin, von meinem Vater. Ich hörte interessiert zu und bemerkte, dass sie ihn nicht vergessen konnte. Sie geriet beim Erzählen regelrecht ins Schwärmen. Mutter konnte gut erzählen, ihren Geschichten lauschte ich immer gern.
Wir hatten die letzte Patin erreicht, Tante Graz.
„Minka, ich dachte schon, du kommst heute gar nicht mehr dein Geschenk abholen, sagte sie in ihrem oberschlesischen Dialekt.“ Dann ging sie in ihren Fleischerladen nebenan und holte einen Teller mit Wurst. Mir gab sie mit der Bemerkung, „du bist mir ganz schön spitz geworden!“, eine dicke Scheibe Wurst zum gleich essen, bevor sie ein paar Stullen für uns belegte.
Das Ostergeschenk hatte mich dann enttäuscht. Es waren nur zwei rote Eier, die Mama in die Kiepe legen konnte und eine Ostersemmel. Vielleicht gibt es noch etwas obendrauf, wenn ich jetzt das Lied singe, dachte ich, und fing an zu singen: „Komm Kalinka, komm …“.
Tatsächlich holte Tante Graz zwei Reichspfennige aus ihrem Portemonnaie und reichte mir diese Münze. Ich machte einen Knicks, bedankte mich, da sagte Mama:
„Minka, du kennst doch noch eine Strophe“, während sie das Geld in ihre Rocktasche gleiten ließ.
Ich sagte „ja“ und sang das Gleiche noch einmal von vorne. Tante Graz lachte, „das ist aber jetzt die letzte Strophe“, bemerkte sie und holte noch zwei Reichspfennige hervor. „Die sind für Minka.“
„Ist Gretchen nicht da?“, fragte ich, denn von ihr bekam ich meist etwas Schönes zum Anziehen.
„Ach ja, Minka“, sagte Tante Graz, „das hätte ich beinahe vergessen. Sie ist zwar in Berlin, hat aber ein Kleidchen für dich hier gelassen. Ich bedankte mich, dann verabschiedeten wir uns.
Von Grazens hatten wir es nicht mehr weit nach Hause. Lautes Gejohle kam uns von dort bald entgegen. Mama schimpfte, als wir näher kamen und erkannten, dass zwei betrunkene Männer den Hermann in ihrer Mitte hatten und ihn halb schleifend und halb tragend nach Hause brachten.
„Der ist doch schon wieder besoffen“, schimpfte sie.
Habt ihr ihn wieder besoffen gemacht und das Geld aus der Tasche gezogen?“
Die Zwei nahmen Reißaus und Papa schlief dort, wo er abgelegt wurde, im Stroh des Ziegenstalls ein.
Ich beschäftigte mich mit meinen Geschenken. Eine Ostersemmel hatte ich noch aufgegessen, dann half mir Mama aus meiner schweren Tracht. Todmüde fiel ich in mein Bett , war schnell eingeschlafen.
Diesen Osterspaziergang hatte ich mein Leben lang nicht vergessen. Er gab mir zu denken und prägte mich. Es war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, in der es viele arme und sehr arme Familien gab. Zu den Letzteren gehörte unsere Familie. Ich hatte diese Armut an jenem Ostertag zum ersten Mal richtig gespürt und auch registriert.
3
Ostern war vorbei und die Einschulung stand bevor. Ich hatte meine Schulmappe gepackt und freute mich auf den Schulbeginn. Meine Mutter hingegen schien ein Problem zu haben. Sie druckste herum, wollte mir etwas sagen, aber kam nicht gleich mit der Sprache raus. Dann fing sie an:
„Minka, zu deinem Namen will ich dir, bevor du zur Schule gehst, noch etwas erzählen.“
„Mama“, sagte ich, „ich weiß doch, dass ich Wilhelmine Renberg bin, oder heiße ich doch Gertrud?“
„Nein, nein, du bist schon unsere kleine Minka, aber dem Lehrer musst du sagen, dass du Wilhelmine Graz heißt. Das ist dein richtiger Name, den wir dir bei deiner Taufe gaben. Unser Papa ist nicht dein richtiger Papa, deshalb heißt du Graz, wie ich früher auch hieß. Dein richtiger Papa ist ein feiner Mann. Er wohnt in Berlin.“
„Ich heiße nicht Wilhelmine Renberg?“
„Nein.“
Zum ersten Mal in meinem Leben erfuhr ich so ganz nebenbei, dass mein Name gar nicht mein richtiger war, und fand erst einmal keine Antwort. Mama hatte mich solange belogen. Ich fing an zu weinen, dann fragte ich:
„War mein Berliner Papa auch ganz reich wie dein Papa früher?“
„Ja – der ist immer noch reich!“
„Mama, dann können wir doch zu meinen richtigen Papa nach Berlin ziehen, dann sind wir auch reich.“
„Nein, Minka, das geht nicht. Wir haben doch unseren Papa und deine Brüderchen zu Hause. Der Berliner Papa möchte keine Kinder. Das verstehst du noch nicht.“
Ich konnte das alles auch wirklich nicht verstehen und sprach kaum noch ein Wort. Mir gingen meine zwei Papas, der arme Papa, mit dem Mama immer nur schimpfte und mein reicher Berliner Papa nicht mehr aus dem Kopf. Warum sind wir so arm und der Berliner Papa so reich, fragte ich mich immer wieder und fing wieder an zu weinen.
„Mama, ich möchte bei meinem Papa in Berlin wohnen.“
„Willst du nicht bei deiner Mama und deinen Brüderchen sein?“
„Ihr sollt alle mitkommen.“
„Und Papa?“
„Der alte Suffkopf kann zu Hause bleiben.“
„Aber Kind, das sagt man doch nicht!“
„Der ist doch immer besoffen, das hast du ja heute früh auch gesagt!“
Mutter schwieg. Ich weinte vor mich hin und konnte mich so schnell nicht beruhigen.
„Mama“, fing ich wieder an, „wenn ich jetzt Graz heiße, möchte ich auch Trudchen heißen.“
„Minna, das geht doch nicht“, reagierte Mutter nun ungehalten.
„Wenn es nach Tante Pauline ginge, würdest du wirklich Trudchen heißen, weil Gertrud ein Berliner Modename ist. Die anderen Paten meinten aber, dass Minka viel schöner wäre, weil das besser zu dir passen würde.“ Sie sagten: „Was sollst du denn mit so einem städtischen Namen als spätere Bäuerin mit einem wendischen Rock auf dem Arsch?“ Ich fand das lustig und lachte laut.
Meine verschiedenen Namen sprangen aber weiter durch meinen Kopf: „Eigentlich heiße ich Wilhelmine. Trotzdem ruft Mama manchmal Minna, na ja, Mama und die anderen Tanten sagen ja immer Miena. Und nun heiße ich auch noch Graz wie Tante und Okel Graz von der Fleischerei?“
*
Am ersten Mai 1925, einem Freitag, wurde ich als „Minna Graz“ eingeschult. Gemeinsam mit all den anderen Schulanfängern betrat ich das Klassenzimmer und hatte auch bald meinen Platz gefunden. Meine Augen waren auf einen großen bunten Tütenhaufen gerichtet. Was es damit auf sich hatte, erklärte der Lehrer in seiner ersten Amtshandlung.
„Bevor die Schule so richtig beginnt“, sagte er, „bekommt jedes Kind eine Zuckertüte.“
Ein lautes begeistertes „Jaaa!“, aus vierzig kleinen Kinderkehlen hervorgerufen, erfüllte den Klassenraum. Dann rief der Lehrer alle Kinder beim Namen auf und gab ihnen je eine dieser kleinen bunten Tüten. Mich schien er vergessen zu haben, denn ich wurde nicht aufgerufen.
Während die anderen Kinder schon ihre bunt glänzenden Tüten bewunderten, schoss ich in meiner Bankreihe hoch und verdrehte mir beinahe den Hals in dem Glauben, dass noch irgendwo in einer Ecke eine Zuckertüte stehen würde. Der Lehrer hatte keine vergessen. Auch mich hatte er nicht vergessen. Er stellte sich direkt vor meinen Platz und dann sprach er mich von oben herab mit meinem neuen Namen an. Zum ersten Mal in meinem Leben wurde ich mit diesem Namen angesprochen. Aber Mama sagte doch, dass ich Wilhelmine Graz heiße, er aber sagte:
„Na Minna Grazia, hat man dich vergessen?“
„Ich heiße Wilhelmine Graz!“, presste ich aus meinem Mund.
„Ja, ja, ich weiß das“, sprach er vor sich hin.
„Normalerweise müsstest du die größte Tüte bekommen.“
Dann legte er eine kleine spitze, graue Tüte auf meinen Platz und sprach weiter: „Deine Mutter hat nicht das Geld für eine Zuckertüte und schon gar nicht für den Inhalt.“
Ich sank mit herunterhängendem Kopf auf meine Bank zurück und hielt die Hände vor mein Gesicht. Obwohl ich nicht weinen wollte, kullerten die Tränen nur so aus den Augen heraus und weichten das vor mir liegende graue Tütenmaterial auf, aus dem sich bald einzelne Bonbon herauslösten.
Auf Bonbon hatte ich aber keinen Appetit mehr. Ich war wütend. Durch meine gespreizten Finger sah ich zu dem Lehrer auf und mir wurde in dem Moment bewusst, dass er mir die Tüte geschenkt hatte, weil Mama für mich keine Zuckertüte drüber hatte. Jetzt kamen mir wieder Mutters Worte von Ostern in den Sinn:
„Wir sind sehr arm.“
Ich biss die Zähne zusammen und nahm meine Hände vom mit Tränen verschmierten Gesicht. Auch wenn ich nicht in der Lage war, klare Gedanken zu fassen, so hatte ich eines begriffen: Ich war ein Außenseiter. Ich wollte keiner sein, aber ich war machtlos, dagegen etwas zu tun. In dieser Situation half mir keiner.
Ich hatte mich eigentlich auf die Schule gefreut, aber die erste Stunde hatte mir diese Freude genommen. Trotzdem besann ich mich am Ende der ersten Schulstunde der Worte, die mir im Vorschulalter immer wieder nahegelegt wurden:
„Du musst in der Schule fleißig lernen, damit es dir in deinem Leben einmal gut gehen wird oder, damit du einmal viel Geld verdienen wirst.“ Nun war mir bewusst geworden, wie wichtig das Lernen in der Schule für mich sein wird. Ich wollte ab sofort alles für meinen Traum tun, um einmal reich wie mein Berliner Papa und wie mein Opa es damals war, zu werden. Mit der Wut der Ungerechtigkeit im Bauch wurde aus mir gleich am Anfang meiner Schulzeit eine kleine Streberin.