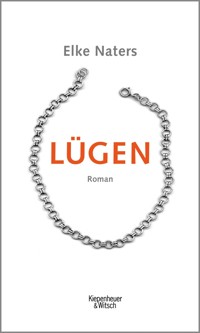12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Himmel weit, die Hoffnung groß und das Leben eine Herausforderung: Das ist Südafrika, eine bunt gemischte Nation mit elf offiziellen Sprachen. Die beiden Autoren zeigen uns alle Facetten: von Kapstadt über Durban, die Garden Route und verborgene Weintäler bis in die Kalahari-Wüste; von der Wild Coast über das subtropische Natal bis nach Pretoria und Johannesburg. Sie überwinden abenteuerliche Pässe, brettern über sandige Schotterpisten und gehen mit Brillenpinguinen baden. Sie suchen im Addo-Park nach Löwen, tauschen sich mit jungen afrikanischen Schriftstellern aus und erklären, was man unbedingt in einem Sammeltaxi zu beachten hat. Und sie verraten, warum Barfußlaufen hier so wichtig ist und was Fußball mit schwarzem Stolz zu tun hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deISBN 978-3-492-96631-3© Piper Verlag GmbH, München 2010, 2011 und 2018Covergestaltung: Birgit KohlhaasCover: Günter Gräfenhain/Bildagentur HuberKarte: cartomedia, KarlsruheDatenkonvertierung: Fotosatz Amann, MemmingenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Motto
Karte
Ankommen
Die blutige Schulter der Sonne: Weite
Braai und Barfußlaufen: Verhaltensregeln
Bakkies und Baboons: Auf der Straße
Lekker Kos: Heimat geht durch den Magen
Blink Toekoms: Vom Trinken und Genießen
The Big Five und andere Giganten
Eish bru! Slang und Sprachgebrauch
Ein Ei, ein Wicket und viele Vuvuzelas: Sport
Ein Land auf der Suche nach sich selbst: Identität
Die Vier Hoeke: Insassen und Außenseiter
Mutterstadt: Hafen der Heimatlosen
Komiker und Townshipgrills: Aweee!
Der Matrosenhund: Alles, was man zum Glück braucht
Die Keksfabrik: Kreatives Kapstadt
Große Vögel: Die Westküste
Höhlen und Jäger: Die Cederberge
Die Mission: Berge und Nacktbaden
Das Leben ist ein Fluss: Ein Dorf
Das Ende der Welt: Kap Agulhas
Transkei, Ciskei und Bophuthatswana: Die Homelands und Sun City
Hart, aber herzlich: Johannesburg
Ubuntu: Der lange Weg zur Freiheit
African Renaissance: Ein neues Land
Die Kunst ist frei: Grahamstown
Neue Männer braucht das Land: Angus Buchan und die Männerkonferenz
Vorurteile und Aberglaube: Kollision der Kulturen
Gastfreundschaft und derbe Flüche: Die Buren
Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Verbrechen und Wahrheit
Literaturempfehlungen
Unsere kleine, persönliche Leseliste – über die im Text erwähnten Bücher hinaus
Empfehlenswerte Buchläden in Kapstadt
Nkosi Sikelel’ iAfrika!
Ankommen
Der Himmel weit, die Hoffnung groß und das Leben eine Herausforderung. Das ist Südafrika. Ein Land, das weniger durch seine Grenzen bestimmt wird als durch seinen Traum, besser gesagt, seine Träume. Sie widersprechen und sie ergänzen sich, sie regen auf, und sie machen die kreative Kraft aus, den Lebenshunger, der uns Europäer oft überrascht.
In Südafrika zu landen bietet erst einmal keine großen Überraschungen. Nirgendwo Giraffen am Flughafen, kein Handgemenge und Gebrüll am Taxistand und auch keine Mamas, die mit schrillen Stimmen ein Willkommen ululelen. Weit aufregender ist es, wenn man aus Mosambik durch alte Minenfelder ins subtropische Natal fährt oder zu Fuß den Krüger-Nationalpark von Simbabwe aus zwischen Löwen und Elefanten durchquert. Was wir niemandem empfehlen.
Das Einzige, was einem am Flughafen von Johannesburg oder Kapstadt auffällt, sind die vielen Gesichter eines modernen Landes, so unterschiedlich wie die Lebensgeschichten und Hoffnungen, die sich dahinter verbergen.
Das blonde Mädchen mit den Sommersprossen, das im Zeitungsladen Magazine durchblättert, arbeitet als Lehrerin in einer Townshipschule und träumt von einer Zukunft für die Aids-Waisen in ihrer Klasse. Der dicke Taxifahrer mit dem Cappuccino-Becher und dem T-Shirt mit dem Aufdruck »Bafana Bafana« (»Unsere Jungs«; Spitzname der südafrikanischen Nationalmannschaft) ersehnt sich den Fußballweltmeistertitel und eine moderne Zulu-Stammesgesellschaft mit vielen Ehefrauen. Die ältere Dame in ihrem Souvenirshop hat die Vision von einer sozialistischen Solidarität der Arbeiterinnen und Desmond Tutu als nächstem Präsidenten des Landes. Und der deutschstämmige Pensionsbesitzer, der auf seine Gäste wartet, spart auf ein game reserve, einen privaten Wildpark in der Kalahari, in dem die Buschmänner wieder jagen können wie vor 10.000 Jahren. Ähnlich wie der müde Flugkapitän, der eben den Terminal verlässt und sich nach einer Woche London auf die Gottesnähe auf seiner Schaffarm in der Halbwüste Karoo freut. Der kapmalaiische DJ hingegen, der auf seinem Plattenkoffer schläft, ist weniger glücklich. Das muslimische Mädchen, von dem er träumt, darf er wahrscheinlich niemals heiraten, weil er nicht an Allah glaubt.
Das Nebeneinander so vieler Welten kann verwirrend sein. Einer unserer ersten Nachbarn, ein Elektriker, hörte am Wochenende laut Pink Floyd, trank billigen Brandy mit Cola und erklärte uns, wie wichtig es sei, die fokin aliens aus der Landschaft zu verbannen. Wir dachten erst, er meinte Ausländer wie uns, aber er sprach von nicht einheimischen Pflanzen – und schnippte seine Kippen in unseren Garten.
Das ältere Ehepaar gegenüber empfahl eine christliche Schule für unsere Kinder, in der sie noch den Hintern versohlt bekommen, und die Frau des Wäschereibesitzers nebenan brachte zur Begrüßung selbst gebackene Ingwerkekse, lehnte aber erschrocken ab, als Sven sie auf einen Tee einlud. Es dauerte eine Weile, bis klar wurde, dass ein verheirateter Mann allein zu Hause keine Frau einladen darf. Porceline, die massige Xhosa, die zum Putzen kam, störte das nicht, weil eigentlich jeder Mann eine wuchtige afrikanische Mama respektiert. Sie achtete eher darauf, dass wir ihr jedes Mal Eier und Speck servierten und die Cola mit Eiswürfel einschenkten. Denn: wenn schon unterbezahlt, dann mit Stil.
Die Inder vom Schlüsseldienst zwei Häuser weiter lernten wir nie kennen. Die flogen bei jeder Gelegenheit zu Verwandten nach Durban. Die kleine kecke Engländerin um die 70 dagegen lud sich gern selber ein und quatschte uns die Ohren voll mit Geschichten von ihrem Leben in den ehemaligen Kolonien, ihren Weltreisen, ihren Jahren im Köln der Nachkriegszeit und wie sie täglich Hunde im Township füttere.
All diese Menschen sind eine Metapher für das Land am südlichen Ende Afrikas, in dem beinahe jeder ein Einwanderer ist, mit einem neuen oder einem alten Traum.
Was Südafrika als Schmelztiegel vieler Kulturen von Amerika unterscheidet, ist das Nebeneinander. Amerika hat seine Einwanderer über Jahrhunderte, wenn auch mit Mühe, unter dem Glücksversprechen und dem Ideal des Vorortwohlstands vereint. Ähnliches passiert zwar auch in Südafrika, weil der Weg aus der Armut scheinbar nur über den Bankkredit, die Lohnarbeit und die Doppelgarage führt. Alle wollen Strom, ein großes Auto und einen Rasensprinkler, weil es den Unterprivilegierten als westliche Lösung vorgelebt wird. Aber die Identitäten sind zu stark, um sich unter solch banalem Ideal vereinen zu lassen. Der Anlageberater aus Pretoria fährt über die Weihnachtsferien in sein Heimatdorf, um an einer rituellen Beschneidung seiner Neffen teilzunehmen; der junge Jazzmusiker aus dem Township Manenberg versucht das Jetset-Leben des verschwundenen District Six in Kapstadt wiederzubeleben; und wir lieben das Dorfleben, wo Hunde und Katzen streunen, Kinder auf den Staubstraßen radeln oder mit alten Autoreifen spielen und man im Kramladen auf der Rückseite einer Cornflakes-Packung anschreiben lassen kann.
Das Schöne ist, dass einem weder als Reisendem noch als Einwanderer zu viel Anpassung abverlangt wird. Woran auch, in einem Land mit so unterschiedlichen Kulturen und elf offiziellen Sprachen? Im Gegenteil.
Willkommen in einem Land, in dem jeder neugierig ist auf Besucher. Wo ein Lebenshunger herrscht, der einem, aus Europa kommend, völlig absurd erscheint. Hier schreit alles nach mehr Regen, mehr Fußball, mehr Gerechtigkeit, mehr Musik, mehr Lohn, mehr deutschem Bier und noch mehr Zusammensein mit Familie, Freunden, Fremden. Das ist der Reichtum eines sonst manchmal armen Landes. Man gehört zur Familie.
Die blutige Schulter der Sonne: Weite
Südafrika ist freundlich und leicht zu erkunden, und der Abenteuergeist der frühen afrikanischen und europäischen Siedler ist überall zu finden.
Anders als in Europa gibt es keine Märchenschlösser, gotischen Kathedralen, Stierjagden oder malerische Grachten zu bestaunen. Das wahre Gesicht Südafrikas offenbart sich in seinen Menschen und Landschaften.
Zwei Dinge erfährt der Reisende: einen Sprung zurück in der Zeit. Und eine nie gekannte Weite.
Der Sprung in die Vergangenheit führt in eine noch unverdorbene Natur und eine Wildheit, die Europa schon lange nicht mehr kennt. In Europa haben wir zwar den Vorteil von WiFi-Hotspots an jedem Kiosk und geteerten Fahrradwegen durch den einsamsten Wald, aber die Abenteuerplätze unserer Kindheit und die Rauheit anderer europäischer Länder, in die wir jedes Jahr gereist sind, finden wir oft nicht mehr wieder.
Als wir uns für Südafrika entschieden, wollten wir, dass unsere Kinder die Ungezähmtheit und Unschuld der Natur kennenlernen, die wir seit unserer Kindheit vermissen. Wir wollten, dass sie Natur nicht als etwas definieren, das hinter einem Zaun lebt, sondern als das, was sie Jahrtausende für den Menschen war: eine fast feindliche Lebenswelt, in der wir klein und verloren sind.
All das vergeht, wir sehen es auch hier. Der 120 Kilometer lange Küstenabschnitt zwischen Kapstadt und Hermanus könnte wie in Spanien in wenigen Jahren eine einzige lang gezogene Siedlung sein, so wie Küstenorte um Durban immer näher zusammenrücken und einige der löchrigen Autobahnen für die Fußball-WM sattschwarzen Pisten gewichen sind.
Alles wird vernünftiger. Sogar die »Rauchen verboten«-Schilder in Supermärkten verschwinden, weil selbst die hartnäckigsten Buren die Zeichen der Zeit lesen können.
All das ist unaufhaltsam, aber Südafrika ist zum Glück groß und afrikanisch genug, dass die Überzivilisierung noch lange auf sich warten lassen wird.
Die wahre Größe des Landes erfährt man auf seinen Straßen. Eine – oft karge – Weite, die einen süchtig macht wie Gottes Gegenwart, der hier ein wenig großzügiger war bei der Erschaffung der Welt. Zwischen wildem Meer, glühenden Felswänden und auf endloser roter Erde fühlt man sich als Mensch winzig. Plötzlich fällt einem auf, dass man auf dieser Regionalstraße seit einer Stunde keiner Menschenseele begegnet ist. Weder in einem Auto noch zu Fuß.
Für uns Europäer ist es immer wieder unfassbar, wie unberührt Gegenden in Südafrika sind. Und das Schöne an dieser Unberührtheit der Schöpfung ist, dass man sie sieht. Was nützen einem 200 Quadratkilometer menschenleerer Urwald, wenn man nur einen Meter weit hineinsehen kann? In Südafrika sieht man die Weite, man kann sie spüren, und sie fühlt sich eindeutig mächtig an. Und die gleichen Menschen, die die Erschließung Europas vorantreiben und über jeden Bach eine Brücke bauen, erholen sich von dieser Mühe in Südafrikas Weite, die zwar erschlossen, aber nicht gezähmt ist.
Was die ersten Europäer an der afrikanischen Südspitze mehr auf dem Herzen hatten als Landeserkundung, war ihr Glaube. Bartolomeu Diaz errichtete 1488 das erste Kreuz in Mossel Bay, nachdem er den südlichsten Punkt Afrikas, Kap Agulhas, umfahren hatte. Das »Kap der Nadeln« wurde so genannt, weil um die Zeit seiner Entdeckung geografischer und magnetischer Nordpol identisch waren.
Nicht einmal der Anblick des mythischen Meeresbergs, den die Portugiesen noch vor dem Kap Agulhas passiert hatten, hatte sie reizen können, dieses Land zu erkunden. Die Portugiesen kannten Hitze und Regenarmut schon von zu Hause und blieben daher lieber auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien. Meeresberg nannten ihn die einheimischen Nomadenvölker, die San und die Khoikhoi (oder kurz Khoi), was oft zu Khoisan zusammengezogen wird. Auf seinem flachen Sandsteinplateau formen sich die Wolken, die der Meereswind Richtung Inland bläst, wie zu einem Tischtuch, das manchmal in fließenden Bewegungen die Abhänge hinabwogt. Weshalb die Siedler ihn später Tafelberg nannten. Die Holländer wussten, was einladend klingt. Schließlich sollten die Gärten am Tafelberg von 1652 an die Seefahrer Richtung Osten mit frischem Gemüse, Fleisch und Wein versorgen. In jenem Jahr landete van Riebeeck mit drei Schiffen, um für die Niederländische Ostindien-Kompanie eine Versorgungsstation auf dem Weg nach Indien einzurichten. Und zur Verwunderung der nomadisierenden Buschleute und ihres Viehs baute er als Erstes eine Festung aus Erdwällen.
Das vorgelagerte Kap nannten die Portugiesen tormentoso, stürmisch, wobei es im Sturm vielmehr tückisch ist. Die Holländer nutzten die geschützten Buchten desselben Kaps während der Winterstürme als Häfen. Sie waren hartnäckiger am Cabo de boa esperanza, am Kap der Guten Hoffnung, wie es der portugiesische König später benannte. Weil es den Seeweg zu Indiens Gewürzen eröffnete, nicht weil er sich in diesen unbekannten Landstrich verliebt hätte.
Dieses Kap ist noch heute das Tor zu Südafrika. Wer nicht mit Allradantrieb über die afrikanischen Grenzen rumpelt, auf dem Fahrrad aus Mosambik kommt, durch die Kalahari Botswanas ins Land trampt oder im Ballungsgebiet von Johannesburg und Pretoria landet, beginnt seine Erkundung des Landes wie die ersten Siedler am Kap.
Es ist immer spannend zu sehen, wodurch Besucher der Kapregion bezaubert werden, die im Gegensatz zum meist flachen, heißen Inland die sanften Hügel der Weingegenden kennt, den schroffen Sandstein und Granit der Felsenküste und verschiedenste Klimazonen. Freunde, die im Dorf Botriver 80 Kilometer östlich von Kapstadt Wein anbauen, können Regen und kühlen Wind haben, während wir nur 20 Kilometer weiter im Süden am sonnigen Strand liegen. Und in der Universitätsstadt Stellenbosch können Sommertage so schwül und heiß sein wie in Thailand, während man am nahen Franschhoek-Pass durch kalten Nebel fährt.
Jeder findet hier etwas, in das er sich verliebt. Ein sehr kritischer deutscher Freund zum Beispiel, der Südafrika sonst eher hässlich und unkultiviert fand, war begeistert von Caledon, einer kleinen Provinzhauptstadt mit rauem Charme. Er war weniger von den sich bis zum Horizont wölbenden Weizenfeldern angetan als von den Getreidesilos und den klotzig ehrlichen Landhäusern, die nur gelegentlich den Schnörkelgiebel der kapholländischen Häuser aufweisen.
Um das Land und seine seltsame Geschichte zu verstehen, muss man sich die Anziehungskraft vorstellen können, die dieses trotzige Stück Natur auf die ersten Holländer, Briten und Deutschen ausübte, wie das Grasland des Nordens auf die Bantu-Völker, von denen die meisten schwarzen Stämme Südafrikas abstammen.
Deutsche, Holländer, Briten und viele andere reisen noch heute ununterbrochen und in großer Zahl an. Und sie reisen alle durchs Land mit einem seltsamen Heimatgefühl, das sie sich nicht erklären können.
Es scheint die Sehnsucht nach einer ursprünglichen Heimat zu sein. Namibia ist zwar heute, politisch gesehen, ein anderes Land, aber landschaftlich nur die Fortsetzung der immer karger und trockener werdenden Wüstenschönheit der Westküste, die nur einmal im Jahr aufblüht, wenn im Spätaugust endlose Blumenfelder das harte Land bedecken.
Das Entlegene Namibias hat eine ähnliche Anziehung wie das Kap für die frühen Seefahrer. Uwe Timm erzählt in »Morenga« von der Sehnsucht des Oberveterinärs Gottschalk in Deutsch-Südwest. Pferde, Rinder, ein kleines Haus in der Einöde mit Bibliothek und Klavier, und die Familie musiziert wie in Goethes »Wahlverwandtschaften«. Fügt man noch ein prasselndes Feuer und ein Stück Wild auf dem Grill dazu, ist das bis heute der romantische Urtraum deutscher Aussiedler.
Im Weg waren den ersten Siedlern nur die Ureinwohner. Die kilometerlange Bittermandelhecke, die damals das Kleineuropa am Kap von den einheimischen Viehhirten trennte, kann man zum Teil heute noch im Botanischen Garten von Kirstenbosch am Tafelberg sehen. Sogar einen Graben hatten sich die Ratsherren, die Zwölf, in Amsterdam ausgedacht, damit Kapstadt eine Insel werde wie die geliebte Kolonie Batavia im heutigen Indonesien.
Einsamkeit findet man schon im nahen Nationalpark am Kap, an der südwestlichsten Spitze des Landes südlich von Kapstadt. Der Weg dorthin entlang der Bergrücken lässt einen spüren, wie schnell man die Stadt hinter sich lassen kann und das Ego an Größe verliert angesichts der Majestät an diesem Ende der Welt.
Wer wie wir oft die Küste Richtung Osten fährt, über Somerset West, Gordons Bay, Kleinmond und Fisherhaven, sieht zunächst den Bauboom der letzten Jahre bis nach Hermanus, Stanford und Gansbaai, wo täglich um die Hundert Touristen nach Weißen Haien tauchen. Kurz danach aber ist Schluss. Die Asphaltstraße Richtung Kap Agulhas geht über in Schotter und Allradwege und einen riesigen Nationalpark. Und das in einer relativ dicht besiedelten Region Südafrikas. Praktisch nur über die N2, die Nationalstraße im Inland, kommt man weiter die Küste hoch über die Garden Route, die weniger Gärten als weite Strände, Wälder und Hügel um fast immer sonnige Küstenorte zu bieten hat.
Der direkte Weg zu den ersten Burenrepubliken Transvaal und Free State dagegen geht auf der N1 Richtung Nordosten mitten durchs Land. Pässe führen vom Kap durch die niedrigen, fast baumlosen Bergketten, Wein wächst in den bewässerten Furchen und am Flussufer entlang der Straße, dann eröffnet sich die Karoo-Wüste, in deren Berghöhlen der Welt älteste Kulturschätze lagern: die Felsmalereien der Buschleute.
Die Trekburen am Ende des 18. Jahrhunderts waren von der großzügigen Landschaft, vom offenen Herzen Südafrikas ebenso angezogen wie die Stämme des Nordens, die sich übers heutige Simbabwe vom fünften Jahrhundert nach Christus an auf die Suche nach Weideland machten und dabei immer mehr nach Süden vorstießen.
Obwohl Südafrika mit seinen verschiedensten Hominidenfunden als evolutionäre Wiege der Menschheit gilt, besiedelte in einer Zeit, als in Europa das Römische Reich verging und andere Weltreiche längst den halben Erdkreis gewonnen und wieder verloren hatten, kaum ein Volk dieses Land. Einiges von dieser Leere spürt man noch, wenn man von Johannesburg wenige Hundert Kilometer nach Westen fährt, wo die Kalahari beginnt. Hier überleben die Bauern gerade mal so von der Schaf- und Ziegenzucht, und das Land erstreckt sich trocken und flach bis zum Horizont. So klar und unbehindert scheint die Sonne, dass sie schon eine Stunde vor Aufgang den blassblauen Himmel im Osten rot aufglühen lässt.
Hierhin verschlug es im Jahr 2008 ein Team des staatlichen Senders SABC, das mit ein paar Fernsehprominenten im Schlepptau eine Sendestation einweihen sollte. Die Premierministerin der Provinz North West kam, Journalisten und ein Komitee mit dem Clan-Chef und Stammeskönig Bareki, dem der Anschluss dieses Tals der Ahnungslosen zu verdanken war.
Noch nie wurde hier, nördlich der Diamantenstadt Kimberly, eine Fernsehsendung empfangen. Die Buren verboten Fernsehen bis 1976 als Teufelswerk, doch seit dem Ende der Apartheid ist Südafrika in der medialen Gegenwart angekommen. Nur ist noch nie etwas von der neuen Freiheit hierher übertragen worden zu dem Volk Batswana, den verstreuten Coloureds, wie die Farbigen in Südafrika genannt werden, und Afrikaanern in einem Landstrich, in dem kaum Autos, aber überall Eselskarren verkehren. Wenig überraschend, dass keiner der Einheimischen die mitgereisten Serienstars und Fernsehhelden erkannte. Aber als der Transmitter eingeschaltet wurde und die Fernseher gleichzeitig losbrüllten, brachen ein paar ältere Leute in Tränen aus. Jahrelang hatten sie Angst gehabt, dass sie sterben würden, bevor sie die magic box sehen dürften. Und einige freuten sich darauf, endlich Präsident Thabo Mbeki, Mandelas Nachfolger, live sehen zu können. Nur dass der schon seit ein paar Monaten nicht mehr regierte.
Das Land ist ungezähmt und wird es auch bleiben. Vom Kap bis nach Natal. Unbezwingbar wie die Wüste. Man muss sich ihr anpassen. Man muss seinen Motor abstellen, die Augen für einen Moment schließen und dem Wind lauschen, der über die rote, trockene Landschaft der Karoo weht, die sich endlos vor einem ausbreitet, unbarmherzig und doch voller Leben.
Man muss sich in die ersten Trekburen hineinversetzen, die vom Kap aufbrachen, um nie wiederzukehren. Wie viele Tagesetappen werden wir mit dem Ochsenwagen brauchen bis zur nächsten Wasserstelle? Wo grasen hier Springböcke zum Jagen? Was kommt nach der nächsten Bergkette? Und wenn man dann am Abend hungrig auf den Sonnenuntergang sieht, versteht man vielleicht die Buschleute, die im Abendrot die blutige Schulter der erlegten Sonne sahen. Südafrika hat eine Landschaft, die nur die Liebe eines Hartnäckigen akzeptiert. Sogar echte Südafrikaner fühlen sich darin manchmal verloren.
Als wir einmal in die Große Karoo jenseits der Hex-River-Berge kamen und auf der 250 Kilometer langen Schotterstraße nach Calvinia waren, fuhren wir durch eine lehmig rote, leere Staublandschaft voller struppiger Büsche und verlorener Farmhäuser in der Ferne. Die Straße führt so tief durch eine andere Welt, dass die jungen Kapstädter, denen wir bei einer Reifenpanne halfen, völlig verängstigt schienen. Es war über 40 Grad heiß, und ihr nagelneuer Allradantriebwagen hatte aufgegeben. Es gab keinen Handyempfang, und selten kam ein anderer Wagen vorbei.
Dankbarere Menschen haben wir selten getroffen, obwohl wir nur eine gute Stunde von Kapstadt entfernt waren. Wir lachten über die Angsthasen, doch als wir uns dann in der Nacht auf einer Hodia-Farm bei den Buschmannhöhlen in Kagga Kamma unter den südlichen Sommerhimmel stellten, spürten wir auch Furcht. Ehrfürchtig sahen wir auf den größten und belebtesten Himmel unseres Lebens, in dem die Milchstraße nicht ein blasser Schatten ist, sondern ein ausufernder, lebendiger Flusslauf mit Nebenarmen voller Galaxien.
Braai und Barfußlaufen: Verhaltensregeln
Da die Südafrikaner ein herzliches und gastfreundliches Volk sind, wird man sich schnell Freunde machen, und diese werden einen dann zum Essen einladen. Eine Gelegenheit, Land und Leute kennenzulernen, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.
Essenseinladungen sind oft spontane, zwanglose Zusammenkünfte, bei denen jeder etwas mitbringt und man sich meist um den braai, den Grill, versammelt. Handelt es sich ausdrücklich um einen bring and braai, bedeutet das, dass jeder sowohl sein Essen als auch seine Getränke selbst mitbringt. Das Fleisch wird allerdings nicht selbst gegrillt, sondern beim braaimaster abgeliefert. Üblicherweise ist das der Herr des Hauses; gibt es einen solchen nicht, wird ein anderer Mann diese Aufgabe übernehmen, denn Frauen haben am Grill nichts verloren. Der Braaimaster macht das Feuer und grillt das Fleisch und die Würstchen. Grillen ist in Südafrika eine äußerst ernste Angelegenheit, und es heißt: »Never interfere with a man’s fire.« Dem Grillmeister ins Handwerk zu pfuschen ist tabu. Das fertige Fleisch wird in einem Behälter gesammelt und anschließend auf den Tisch gestellt. Jeder isst, was er mitgebracht hat.
Wird man zu einem gewöhnlichen Dinner eingeladen, fragt man die Gastgeber, was man mitbringen kann, zum Beispiel Getränke oder einen Nachtisch.
Bei einem spitbraai wird ein ganzes Tier (meist Lamm oder Schaf) an einem Drehspieß (dem spit) über offenem Feuer gegrillt. Das ist ein großes gesellschaftliches Ereignis, bei dem die hungrigen Gäste sich um den Grill scharen und mit den Fingern knusprige Stückchen vom Braten stibitzen, während der Braaimaster noch das Fleisch in Portionen zerlegt.
Bei einer Einladung zu einem potje hingegen ist Vorsicht geboten. Potjekos ist eine Art Eintopf aus Ziegen-, Schafs-, Wild- oder Ochsenfleisch, der in einem speziellen gusseisernen Topf (potje, sprich poikie) über offenem Feuer stundenlang vor sich hin gart. Das kann sich nach unserer Erfahrung bis Mitternacht hinziehen, weswegen wir entweder eine Einladung dazu meiden oder vorher gut essen.
Potjekos haben die Trekburen auf ihren langen Reisen mit dem Ochsenkarren erfunden. Wenn sie ein Lager aufschlugen, wurde ein riesiger Kessel voll Eintopf gekocht. Was nach dem Essen übrig blieb, wurde in dem Kessel unter den Wagen gehängt und beim nächsten Halt aufgewärmt. Das ging über Tage hinweg, da das Fett, das obenauf schwamm, das Essen konservierte.
In keinem Fall ist zu erwarten, dass zur verabredeten Zeit das Essen auf dem Tisch steht. Ob Potje oder Braai: Oft wird das Feuer erst entzündet, wenn alle da sind, und dann sitzt man um eine Schale Chips herum, bis das Holz niedergebrannt ist.
Generell gilt: Südafrikaner haben eine andere Zeitauffassung als wir. Schon Desmond Tutu hat sich gegen die Legitimation der african time gewehrt, auf Deutsch: dass man einfach zu spät kommt. Viel zu spät. Sinnbildlich wird das, wenn einem jemand just now (jetzt gleich) die geliehene Säge zurückgeben will. Er wird sie noch die nächsten zwei Jahre benutzen. Mehr Hoffnung kann man haben bei einem now now (jetzt jetzt), das fast einem »bald« gleichkommt und noch vor dem dritten Bier eintreffen könnte.
Es ist höflich und üblich, jeden Menschen bei der Begrüßung zu fragen, wie es ihm geht. Man kann nicht höflich genug sein, und im Gegensatz zu Deutschland wird einen die Kassiererin im Supermarkt nicht fassungslos ansehen, wenn man sie mit »How are you today?« begrüßt, sondern mit einem strahlenden Lächeln antworten: »Fine and yourself?« Ich las einmal, dass für Deutsche im Ausland allgemein die Regel gilt: Seien Sie so freundlich, dass Sie denken, man würde Sie für verrückt halten, dann haben Sie die unterste Stufe der Höflichkeit erreicht. Das gilt im Besonderen für Südafrika. Während die Höflichkeit in Amerika nur eine Floskel ist, ist sie bei den Südafrikanern herzlich und ernst gemeint.
Eher ungewohnt für den Europäer ist die Begrüßung der Afrikaaner von Menschen, die sie besonders ins Herz geschlossen haben, mit einem Kuss auf den Mund. Das ist nicht jedermanns Sache, und es ist deshalb nicht unhöflich, wenn man den Kopf leicht zur Seite dreht und den Kuss auf die Wange umlenkt. Es bleibt dem Europäer auch überlassen, ob er die ansonsten übliche Umarmung – meist ohne Wangenküsschen – erwidern möchte oder nicht. Auf Afrikaans heißt diese Begrüßungsform drucki, was auch für einen Deutschen sehr verständlich beschreibt, worum es geht. Als ich unsere Tochter am ersten Schultag von der Schule abholte, stand die Lehrerin am Ausgang des Klassenzimmers und verabschiedete jedes Kind einzeln mit einer festen Umarmung.
Nun gibt es aber auch hier äußerst reservierte Menschen, und solange sie nicht entschlossen auf einen zukommen, schüttelt man ihnen wie in Deutschland die Hand. Sofern es sich um einen »Engländer« oder Afrikaaner handelt, denn gibt man einem Xhosa oder Zulu die Hand, wird er sie nicht schütteln, sondern erst drücken, dann den Daumen umgreifen und schließlich wieder die Hand – das alles in schneller Abfolge. Für Eingeweihte gibt es eine langwierige und ausgefeilte Abfolge von Umfassen und Umgreifen, die mit einem gegenseitigen Daumenschnippen beendet werden kann. Am besten lässt man seine Hand vom Gegenüber führen oder sich das Ritual von einem Einheimischen zeigen.
Man sagt, für Schwarzafrikaner ist es ein Zeichen von Respekt, den direkten Augenkontakt zu vermeiden. Das gilt durchaus nicht für jeden, und die meisten sehen einem fröhlich in die Augen. Dies nur als Hinweis, nicht jeden für verschlagen zu halten, der einen nicht direkt ansieht.
Afrikaanische Kinder werden dazu erzogen, älteren Menschen gegenüber großen Respekt zu zeigen, sie mit tannie (Tante) oder oom (Onkel) anzusprechen – selbst Fremde – und auf jede Frage brav und bescheiden mit »Yes, tannie« oder »No, tannie« zu antworten.
Als ich daher vorsichtshalber unsere Freundin Mandie fragte, ob ich die Mutter unserer gemeinsamen Freundin Coia mit tannie ansprechen müsse, sah sie mich entsetzt an und sagte: »Nein!«
»Warum nicht?«
»Weil du alt bist.«
Ich nehme an, dass sie mit ihren 21 Jahren keinen Unterschied zwischen mir und der 70-jährigen Mutter von Coia sehen konnte, aber ich habe durchaus 50-Jährige nur wenig ältere Frauen mit Tannie ansprechen hören. Mich sprechen dafür öfter junge schwarze Frauen liebevoll mit »Mama« an, was mich freut.
Man muss sich auch nicht wundern, wenn Menschen einem bereits nach zehn Minuten Gespräch ihr Leben erzählen, von den Schwierigkeiten mit ihren Kindern oder in der Ehe berichten. Und wenn jemand seine Hilfe anbietet, dann meint er es auch so. Nachbarschaftliche Unterstützung ist selbstverständlich in diesem Land, in dem es kein mit Deutschland vergleichbares Sozialnetz gibt und viele Menschen nicht krankenversichert sind. Eine Witwe und Mutter von drei Kindern, deren jüngster Sohn Zacharias an einem Gehirntumor erkrankte und operiert werden musste, wurde von ihrer Kirche, von Freunden und der Nachbarschaft unterstützt. Jemand kümmerte sich um die zwei anderen Kinder, während die Frau mit Zacharias im Krankenhaus war; es wurde für die Familie gekocht und eingekauft, und da die Frau ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen konnte, legte man zusammen, um ihr Einkommen zu sichern. Der kleine Zach wurde gesund, es gab eine große Geschichte über ihn in der lokalen Zeitung und einen langen Dankesbrief der Mutter an all die wunderbaren Menschen, die ihr in dieser schwierigen Zeit geholfen haben.
Problematisch ist dieser Zusammenhalt in der Geschäftswelt. Der Energieminister, der seine 24-jährige Nichte in den Vorstand eines Stromkonzerns wählen lässt, gehorcht nur dem Clan-Gesetz, wonach man füreinander sorgt. Und so wird eine Haltung, die großartig für eine Witwe mit drei Kindern ist, zum Bremsklotz in der modernen südafrikanischen Wirtschaft, die auf westlichen Prinzipien der Konkurrenz und Individualität beruht.
Wer weiß, vielleicht erwächst daraus eines Tages noch ein neues Wirtschaftsmodell: ein funktionierender Familienkapitalismus, denn in Afrika ist man immer ein Team.
Die Südafrikaner haben auf dem Land und in ihrer Freizeit einen sehr lockeren Kleidungsstil. Wenn nicht ausdrücklich formelle Kleidung angeordnet ist, kann es vorkommen, dass Männer barfuß oder in Schlappen und kurzen Hosen erscheinen, zusammen mit gestreiftem Polohemd oder einem »Burenhemd« (mit heller abgesetzten Brusttaschen). Buren kann man von englischstämmigen Südafrikanern daran unterscheiden, dass ihre Hosen kürzer sind und sie – wenn sie nicht barfuß laufen – Schuhe und dicke Socken dazu tragen. Die afrikanischen Männer dagegen sind meist sehr smart gekleidet und nie in kurzen Hosen zu sehen.
Barfußlaufen ist des Südafrikaners Leidenschaft. Die Kinder dürfen bis zur siebten Klasse ohne Schuhe zur Schule kommen. Was viele sommers wie winters tun. Barfuß, aber in Schuluniform. Auch erwachsene Männer laufen gern ohne Schuhe herum, selbst in der Stadt. Vom Strand kommend in den bakkie (Pick-up) springen, barfuß mit Shorts und Polohemd, die Sonnenbrille im Haar, das Handy am Ohr, das Surfbrett auf dem Dach, die Kinder braun gebrannt mit nassem Haar in Badeanzügen hinten auf der Ladefläche, noch ein paar Hunde dazu – das ist das ultimative Lebensgefühl. Oder einfach lekker, ein Wort, das für Wohlgefühl in allen Lebenslagen angewandt wird. Lekker Tag, lekker Wetter, lekker Surf, lekker Essen.
Ein südafrikanischer Freund, der mit seiner Familie ein Jahr in einer kleinen Stadt in Mittelengland verbrachte, erzählte, wie seine Töchter eines Tages von einer besorgten Polizeistreife nach Hause gebracht wurden, weil sie barfuß auf der Hauptstraße gelaufen waren. Im Hochsommer. Später kamen sogar zwei Sozialarbeiter vorbei, um sicherzugehen, dass in der Familie alles mit rechten Dingen zugeht.
Südafrikaner sind Freizeitmeister. Neulich verabredeten wir uns mit unserem Freund Andries zum Wasserskifahren. Wir hatten ordentlich gefrühstückt, um die nächsten paar Stunden ohne Essen zu überstehen, packten dementsprechend nur Badesachen und ein paar Handtücher ein. Andries und seine Frau Coia hatten ein wenig mehr dabei. Nicht nur das Boot auf dem Anhänger, sondern noch zwei Kajaks auf dem Dach und den Bakkie bis obenhin vollgepackt mit Schwimmwesten, drei Faltstühlen, diversen Decken, Taschen voll Ersatzkleider für die Kinder, einer Matratze, Spielsachen, einem Korb mit Proviant: Äpfel, zwei Tüten voll biltong – getrocknetem Fleisch –, Kräcker, zwei Thermoskannen Kaffee, vier Kaffeetassen, Erdnüsse, Rosinen, und zwei Paar Wasserski nicht zu vergessen. Nach einer halben Stunde kam Wind auf, und der mit großer Vorfreude geplante Wasserskitag musste abgebrochen werden, was die Laune allerdings nicht im Geringsten beeinträchtigte.
Im Sommer am Strand ist immer ein Sonnenschirm dabei, ein Windschutz, Strandstühle, Chips für hungrige Kinder und eine Kühltasche mit Getränken und Fleisch. Im Auto wartet das Feuerholz, denn man wird an jeder Raststelle, jedem Picknickplatz, überhaupt an jedem nur erdenklichen Ort, wo Leute zusammenkommen, Braai-Stellen finden. Selbst mitten im Wald. Keiner kann quengeln, weil es zu heiß, zu windig, zu langweilig, weil er durstig oder hungrig ist. An alles ist gedacht, und jeder tut, was ihm gerade Freude macht. Isst, trinkt, spielt, schwimmt, liest, schläft, surft, taucht. Und immer beschäftigt sich jemand mit den Kindern, denn das ist der größte Spaß daran. Freizeit geht mit einem großen Maß Organisation einher, die den einzigen Zweck hat, zum größten Maß an Komfort, Spaß und Entspannung zu gereichen. Nie sieht man eine Familie angespannt oder im Freizeitstress. Vielleicht ist das das Resultat von jahrelangem Barfußlaufen: eine größere Gelassenheit und Verbundenheit mit der Erde, auf der man steht.
Zum guten Ton gehört es auch, den anderen machen zu lassen und nicht zurechtzuweisen. Das gilt auch für Ehemänner und Kinder. Keine Frau würde ihrem Mann ins Feuer pfuschen, selbst wenn es viel zu lange dauert oder er es überhaupt nicht in Gang bringt, und die Kinder lässt man ihren Spaß haben. Bei einem Pfadfindertreffen war das kleine Wäldchen am Klubhaus voller Acht- bis Zwölfjähriger, die Holz hackten und überall kleine Feuer machten, um Marshmallows zu grillen. Nachdem ich einen Knirps eine Weile beobachtet hatte, wie er mit der Axt auf ein Stück Holz zwischen seinen Beinen hieb, fragte ich eine der Mütter: »Bin das nur ich, oder macht das auch sonst noch jemanden nervös?« Sie sagten: »Wir haben gerade darüber gesprochen: Am besten gar nicht hinsehen.« Das taten wir dann, und alles ging gut. Keine abgehackten Hände oder Füße, kein Waldbrand, nur ein Junge wurde von einem kleinen Skorpion gebissen und musste ins Krankenhaus gefahren werden, kam aber kurz darauf fröhlich zurück. Skorpione unter sechs Zentimeter Länge sind harmlos im Westkap, haben wir aus diesem Vorfall gelernt. Wenn ihre Zangen kleiner als ihr Stachel sind. Oder war es andersherum?
Nicht wegschauen sollte man allerdings, wenn die Kinder am oder sogar im Meer sind. Die Atlantikküste hat es in sich und ist voller Strömungen, und es passiert nicht selten, dass es den ein oder anderen Schwimmer hinauszieht. Ein Rat, den jeder Vater seinen Kindern mitgibt: »Dreh dem Meer nie den Rücken zu!«
Neulich sah eine Freundin eine Sendung über München und fragte mich ungläubig, ob die Menschen dort wirklich splitternackt im Park herumlägen und warum in aller Welt sie das machten. Völlig unverständlich für die weißen Südafrikaner. Nackt badet man daheim im eigenen Pool, wenn es keiner sieht, das nennt sich dann skinny dip. An öffentlichen Stränden sollte man in jedem Fall auch das Bikinioberteil anbehalten, wenn man kein Aufsehen erregen will.
Wobei den Schwarzafrikaner der Anblick eines bloßen Busens völlig kaltlässt, denn der ist für ihn nicht mehr als die Nahrungsquelle für Säuglinge. Der Frauenhintern ist vielmehr, worauf es ankommt.
Rassismus ist ohne Frage verpönt unter aufgeklärten Menschen. Es gibt eine stillschweigende Übereinkunft, Rassenunterschiede nicht zum Thema zu machen. Steve Otter, ein englischstämmiger Journalist, der zwei Jahre in Khayelitsha, Kapstadts größtem Township, gelebt und ein Buch darüber geschrieben hat, bringt es auf den Punkt: »Political correctness in Südafrika heißt, die Rasse oder Hautfarbe des Gegenübers am Pooltisch nicht zu bemerken.«
Es gehört ebenfalls zum politisch korrekten Ton, Menschen nicht anhand ihrer Hautfarbe zu beschreiben, sofern es nicht unbedingt nötig ist. Oder gar von blacks (Schwarzen) zu reden. Weder im Allgemeinen noch im Besonderen. Inzwischen sagt man african. Völlig übertrieben aber ist es, wie einmal von einem Reiseleiter gehört, das Wort schwarz völlig zu vermeiden. Ohne Probleme kann man sich seinen Kaffee black bestellen.
Die Haltung der Afrikaner zum moolah, zu Kies, Knete, also Geld, ist ganz anders als die der Weißen. Wer Geld hat, der zahlt; wenn er sich weigert oder meckert, riskiert er, sein Gesicht zu verlieren, deshalb zieht er lieber zähneknirschend seinen Geldbeutel. Diese Einstellung kann schnell zum Problem werden. Sarah, eine junge Xhosa-Frau, kann nicht über Weihnachten zu ihrer Familie in die Transkei fahren, weil alle von ihr Geschenke erwarten. Dabei verdient sie nicht mehr als 300 Rand (knapp 30 Euro) die Woche, wovon sie ohnehin ein Drittel ihrer Familie schickt. Doch allein die Tatsache, dass sie woanders lebt und Arbeit hat, macht sie in den Augen ihrer Angehörigen und Freunde reich. Geld ist in der afrikanischen Kultur nicht für einen allein da, sondern für alle, die zum erweiterten Haushalt gehören. Hat man es in der Tasche, gibt man es lieber schnell aus, für Kleider, Schuhe oder Dinge, auf die man in den Jahren der Apartheid verzichten musste, und verlässt sich auf die Freunde, die genug Geld mit sich herumtragen, um die Barrechnung zu bezahlen.
Bakkies und Baboons: Auf der Straße
So liebenswert und hilfsbereit die Südafrikaner im täglichen Leben sind, so erbarmungslos sind sie auf den Straßen. Da wird dicht aufgefahren, gedrängelt, selten stoppt ein Auto für ein anderes, und wer als Fußgänger gewohnt ist, dass Fahrzeuge bremsen, sobald man seinen Fuß auf die Straße setzt, riskiert hier sein Leben. Eher wird für eine Schildkröte gebremst. In diesem Fall wird der Wagen am Seitenstreifen abgestellt und das Tierchen sicher auf die andere Seite getragen. Fußgänger werden lediglich angehupt. Auch Fahrradfahren ist riskant. Nicht nur, weil die wenigen Radfahrer gern auf der falschen Seite fahren und nachts ohne Licht unterwegs sind.
An Radler scheint man sich in diesem Land noch nicht so richtig gewöhnt zu haben, obwohl oft ganze Tour-de-France-Pulks von bunten Radprofis unterwegs sind. In Südafrika gilt das Gesetz der Straße: Je größer das Fahrzeug, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, übersehen zu werden. Groß ist gut, größer besser. Das absolute Lieblingsauto ist der Bakkie, am beliebtesten der Toyota Hilux, ein Pick-up mit großer Ladefläche, auf der man Kinder, Hunde, Arbeiter, Anhalter, Sand, Möbel, Ziegelsteine, Schrott, Holz, Schafe, Dung etc. transportieren kann, offen oder geschlossen, Zwei- oder Viersitzer. Das klassische Farmauto, das aber ebenso in der Stadt gefahren wird. In Johannesburg kann sich der Städter sogar Dreck auf sein Allradauto spritzen lassen, das sonst nie schwieriges Gelände sieht. Den Spritzdreck gibt es natürlich in verschiedenen Farbtönen. Je nachdem, ob die Nachbarn denken sollen, dass man in der Kalahari war (gelb), in Mosambik (ocker) oder einfach nur bei einer Off Road Show (dunkelbraune Dreckbatzen).
Vor den Schulen sitzen Mütter in Ungetümen und warten auf ihre Kinder, während der Dieselmotor vor sich hin dröhnt. Kleine Frauen in hochhackigen Schuhen mit rot lackierten Zehennägeln und frisch geföhnten Haaren fahren Autos, die in die Kategorie Kleinlaster passen. Ein Bild dafür, was eine südafrikanische Mutter hauptberuflich ist: eine hart arbeitende Busfahrerin, die ihre Kinder und deren Freunde von einem Ort zum anderen chauffiert; kein Weg ist ihr zu weit, keine Fahrt zu viel. Groß müssen die Autos sein, schon allein wegen der Sicherheit der Kinder, und hoch, und viele PS müssen sie haben, am besten noch einen Schnorchel (hilfreich bei Überschwemmungen und Flussdurchquerungen) und Vierradantrieb.
Letzterer ist unumgänglich für die 4×4-Tracks, Hinterlandstraßen und Wege, die man mit einem normalen Auto nicht befahren kann und über die man deshalb an Strände und Orte kommt, die nicht jeder erreicht. Seit ein paar Jahren ist es verboten, im Sand am Strand entlangzufahren; viele bedauern das, und manche fahren dort immer noch.
Ende der Leseprobe