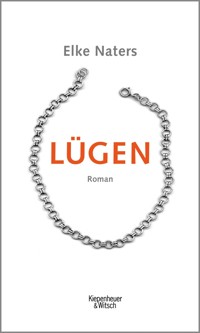Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adeo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Vor acht Jahren wohnten wir in Berlin Mitte und waren an einem Punkt unseres Lebens, an dem sich Überdruss und Unzufriedenheit breitmachten, die schwer zu fassen waren. Berliner Winterdepression? Midlifecrisis? Bücher schreiben, Kinder kriegen, trinken gehen, ein paar rauschhafte Nächte, gute Filme, anregende Gespräche. So zog das Leben vorbei, die meiste Zeit recht angenehm, ohne besonderen Schmerz, aber auch ohne besondere Tiefe. War das wirklich alles? Wir hatten den Mauerfall erlebt in Berlin, waren Pop, mittendrin in der neuen deutschen Literatur. Wir hatten in Bangkok gelebt, aber waren wieder nach Hause zurückgekehrt auf der Suche nach einer Heimat im Leben und im Herzen - einem Weiter, Besser, Größer. Aber der kulturelle Reichtum der Kunst, Musik und Literatur boten keine Antworten mehr. Wir waren durstig und hungrig, aber wir wurden nicht satt. Wir haderten mit dem Deutschsein, dem Gesetzten und Überskeptischen, dem Saturierten. Wir sehnten uns nach sozialen Utopien, die wirklich umgesetzt wurden, und weniger nach Konsum und sozialem Aufstieg. Uns verlangte nach Gemeinschaft und nicht Vereinzelung, nach Exzentrik und weniger Ordentlichkeit. In Südafrika fanden wir schließlich die Antwort auf Fragen, die uns immer wieder das Glück geraubt hatten." Elke Naters und Sven Lager
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Morgendämmerung
Sunbeam
Mormor in Bangkok
Herr Haarmann sagt
Dahinter Buschland, Wildnis und Ödnis
Von traurigen Hunden, lauten Vögeln und hungrigen Pavianen
Das Hochzeitskleid
Wir sind Zwerge
Glaube und Zweifel
Haben und Sein
Deutschafrikaner
Sturmtaufe
Maryna
Atem
Molo Matakata
Stadt, Land, Fluss
Männer
Sex und das Land
Das Leben der anderen
Vater und Sohn
Vuvuzela
Königinnen
Alles neu
Breakfast Club
Leben und Tod
Supernatürlich
Die blaue Perücke
Lonely
Free Hugs
Liebe in Zeiten
Heimat
Personal Jesus
The Sharehouse
Das Abendmahl
Moskow Mule
Glossar
Für Hein, Diane, Maryna, Donald, Johan und Pretty
Morgendämmerung
Es muss im Leben mehr als alles geben, sagt die Hündin Jenny in Maurice Sendaks Kinderbuch Higgelty Piggelty Pop. Und so ging es uns auch.
Vor acht Jahren wohnten wir wieder in Berlin Mitte und waren an einem Punkt unseres Lebens, an dem sich Überdruss und Unzufriedenheit breitmachten, die schwer zu fassen waren. Berliner Winterdepression? Künstlermelancholie? Midlife-Crisis? Wir hatten zweieinhalb aufregende und manchmal einsame Jahre in Thailand verbracht und waren wieder in die alte Heimat zurückgekehrt. Aber auch die fühlte sich fremd an. Bücherschreiben, Kinderkriegen, Trinkengehen, ein paar rauschhafte Nächte, gute Filme, anregende Gespräche. So zog das Leben vorbei, die meiste Zeit recht angenehm, ohne besonderen Schmerz, aber auch ohne besondere Tiefe. War das wirklich alles?
Wir hatten den Mauerfall erlebt in Berlin, waren Pop, mittendrin in der neuen deutschen Literatur. Wir hatten in Bangkok gelebt vor dem Bürgerkrieg, aber waren wieder nach Hause zurückgekehrt auf der Suche nach einer Heimat im Leben und im Herzen – einem Weiter, Besser, Größer. Aber der kulturelle Reichtum der Kunst, Musik und Literatur bot keine Antworten mehr.
Berlin war großartig und doch fad. Wir waren durstig und hungrig, aber wir wurden nicht satt. Wir haderten mit dem Deutschsein, dem Gesetzten und Überskeptischen, dem Saturierten. Wir sehnten uns nach sozialen Utopien, die wirklich umgesetzt wurden, und weniger nach Konsum und sozialem Aufstieg. Uns verlangte nach Gemeinschaft und nicht Vereinzelung, nach Exzentrik und weniger Ordentlichkeit.
Da es nicht weiter in die Tiefe ging, suchten wir die Lösung in der Breite. Wir wollten mehr Sonne, herzlichere Menschen, kulturelle Vielfalt und ein anregendes Leben. Wir dachten ans Mittelmeer, Vancouver, Kalifornien. Zu unserer großen Überraschung landeten wir in Südafrika.
In einer warmen Januarnacht saßen wir auf einer Bank im Garten unter der großen Bougainvillea, der Mond ging auf, groß und voll, und stand für einen Moment auf dem Bergrücken, als wollte er hinunterrollen und im Meer versinken. Ein Frieden, zum Anfassen groß, kam über uns und wir wussten, hier wollten wir leben und nirgendwo anders.
Wir gingen Langusten angeln, barfuß einkaufen, im wilden Atlantik surfen, bestiegen den Tafelberg und lernten überall Menschen kennen, die die natürliche Großzügigkeit ihres Landes widerspiegelten. Auch ihre Lebensgeschichten waren ein paar Nummern größer als unsere. Es war aufregend und wir waren glücklich. Wir waren nicht reich, nicht krankenversichert, unsere Kinder verstanden kein Englisch und wir alle kein Xhosa oder Afrikaans. Es war ein Abenteuer und wir fühlten uns frei. Und auf seltsame Weise auch zu Hause.
Wir fanden Freunde in fremden Kulturen und Sprachen und wir fanden eine Antwort auf Fragen, die uns immer wieder das Glück geraubt hatten. Die Stimmung im Land war elektrisierend, als wäre die Luft geladen. Hier wurde radikal geschenkt und geholfen und gleichzeitig aus Eifersucht oder Neid gemordet. Hier prallten Welten aufeinander und das belebte unsere Gespräche und Gedanken. Hier wurde man überall mit einem Lachen begrüßt, vor allem wenn man selbst lächelte.
Hier wurden wahre und gleichzeitig abenteuerliche Geschichten erzählt und jeder Mensch war ein Pionier in dieser jungen Nation. Land und Leute waren im Umbruch. Arm und Reich drifteten auseinander, der Sozialismus des ANC war genauso korrupt wie der Kolonialismus der Apartheid. Das Ubuntu der Xhosa wurde wiederentdeckt, die friedliche Gemeinschaft, die mehr zählt als der persönliche Gewinn. Die jungen Buren erfanden sich neu mit jiddischer Musik und Bands wie Die Antwoord. Stand-up-Comedy durchbrach endlich alle Vorurteile und Rassenschranken, und ein sehr praktischer Glaube war dabei, ein Land zu vereinen. Ein Glaube, der Nelson Mandela und Desmond Tutu die Stärke gegeben hatte, ein in sich verfeindetes Land zu befrieden.
Dieser Glaube war radikaler und aufregender als Punk, Pop und Piratenpartei. Wir sahen Todkranke auferstehen, Drogensüchtige in Zungen beten und Vergewaltigungsopfer ihren Tätern vergeben.
Wir sahen ein Licht, das heller und durchdringender war als alles, was wir bisher gesehen hatten. Und es war nicht nur die afrikanische Helligkeit. Es war das Licht, das aus den Menschen schien, denen wir begegneten. Ein Feuer, von dem man uns sagte, dass wir es eines Tages zurück in unsere alte Heimat tragen werden.
Sunbeam
Wir lernten uns im Dezember 1993 in Berlin kennen, in einem runtergekommenen Industriebau in Moabit auf Svens erster und einziger Ausstellung, die er hauptsächlich deshalb machte, um die Frau seines Lebens kennenzulernen. Der Plan ging auf. Ich verliebte mich in ihn, als er in ein Käsebrötchen biss. Wir verbrachten den Abend zusammen, und obwohl er in den frühen Morgenstunden mit seiner schlecht gelaunten Exfreundin nach Hause fuhr, war unsere gemeinsame Zukunft entschieden. Drei Wochen später zog er bei mir ein und nach drei weiteren Monaten war ich schwanger.
Wir bekamen einen Sohn, Anton, und lebten glücklich von Sozialhilfe in meiner Dreizimmerwohnung in Charlottenburg. Von dem Geld für die Babyerstausstattung kauften wir uns einen Computer, auf dem ich meinen ersten Roman schrieb.
Unsere Tochter Luzie wurde Anfang Februar 1997 geboren – nach einem endlos langen, harten Winter, wie jeder Winter in Berlin endlos lang und hart ist. Wir wohnten inzwischen in einer riesigen Altbauwohnung in Schöneberg. Vorderhaus, dritter Stock. Von November bis April kam die Sonne nicht mehr über das gegenüberliegende Gebäude. Ab März hing ich aus dem Fenster und sah sehnsüchtig hinauf in den bereits sonnigen vierten Stock und schätzte, wie viele Tage die Sonne noch brauchte, bis sie endlich zu uns herunterkam. Wir hatten Parkettboden, Stuck, eine große Schiebetür, viel Platz, hohe Wände. In jedem Zimmer gab es einen großen Kachelofen, die Briketts lagerten auf dem Balkon. Die Küche heizten wir mit dem Gasherd. Der Nachbar empfahl uns einen „Energieberater“, der den Stromzähler so geschickt manipulierte, dass man Elektroheizer bei durchschnittlichem Stromverbrauch Tag und Nacht laufen lassen konnte. Bad und Klo waren unbeheizbar. Normal. Anton hatte in einem Winter drei Streptokokken-Mandelentzündungen hintereinander, dazu Krupphusten und spastische Bronchitis. Wir benebelten ihn täglich mit dem Inhalator, das Geräusch habe ich heute noch in den Ohren.
Die anthroposophische Kinderärztin empfahl eine Klimaveränderung. Freunde mit kleinen Kindern schwärmten von Thailand: Hütte am Strand für fast kein Geld, Sandkasten vor der Tür, warmes, flaches Kindermeer, Sonne, gutes Essen, Erholung – ein Traum. Sie mussten uns nicht lange überreden. Wir wollten raus aus dem Winterknast, so schnell wie möglich. Wir liehen uns Geld und als Luzie sechs Wochen alt war, flogen wir mit unseren Freunden los. Es war Svens erste Überseereise.
Nach gefühlten 60 Stunden und 5-mal umsteigen kamen wir nachts in Koh Samui an. Wir liefen in der feuchtwarmen Tropenluft über die Rollbahn. Das Flughafengebäude war nur ein kleiner Bambusunterstand, wo wir unser Gepäck abholten. In einem Tuktuk fuhren wir stundenlang im Dunkeln über holprige Straßen. Staub wehte uns ins Gesicht, jeder hielt ein schlafendes Kind im Arm. Schließlich erreichten wir die Bungalowanlage, in der unsere Freunde vor drei Jahren in sagenhaft billigen Hütten direkt am Strand gewohnt hatten.
Die Anlage war nicht mehr wiederzuerkennen. Die kleinen Hütten am Strand gab es nicht mehr, dafür große, luxuriöse Häuser auf Stelzen, die wir uns nicht leisten konnten, dahinter eine Gartenanlage mit kleineren, dicht an dicht gebauten Steinhäusern. Dort mieteten wir uns ein. Das Restaurant unter dem Bambusdach, wo wir uns zum Abendessen treffen wollten, war von deutschen Rockern belegt, die Bier tranken und ihre Musik auch gleich mitgebracht hatten. Ich ging in unsere kleine enge Steinhütte in fünfter Reihe, setzte mich aufs Bett und hatte einen kleinen Nervenzusammenbruch.
Die Luft war auch noch spätabends heiß und schwer. Sie roch süß und leicht verbrannt. An der Decke drehte sich ein Ventilator. Die Kinder schliefen, eine Neonlampe erleuchtete den Raum. In der Ferne war der Hardrock nur noch als Wummern wahrzunehmen. Dann verstummte er plötzlich. Sven brachte mir ein Bier und etwas zu essen. Das Bier trank ich mit einem Schluck leer. Das grüne Curry mit Reis war köstlich. Jetzt waren nur noch die Zikaden zu hören und das Summen der Mücken. Gelegentlich schrie ein Gekko. Wir löschten das Neonlicht, saßen im Dunkeln, lauschten der Nacht und beschlossen, am nächsten Tag umzuziehen, am besten ganz weit weg.
Am nächsten Morgen sah die Welt ein wenig freundlicher aus. Unser Steinbungalow stand inmitten eines üppigen grünen Gartens. Es gab einen langen weißen Sandstrand mit einem stillen, warmen azurblauen Meer. Am Ende des Strandes standen noch zwei kleine halb verfallene Bambushütten, immerhin direkt am Wasser. Wir zogen in eine der beiden Hütten. In der Nacht wachte ich auf und sah eine Ratte, kaum größer als unser Baby, über das halb verfallene Dachgebälk laufen. Kurz darauf bekam Anton einen Krupphustenanfall und wir verbrachten die restliche Nacht am Strand. Luzie schlief auf meinem Schoß, Anton hustete in Svens Arm. Das Meer lag vor uns, still und dunkel. Die Wellen plätscherten sanft ans Ufer. Über uns ein gewaltiger Sternenhimmel.
Als der Morgen dämmerte und Anton aufhörte zu husten, gingen wir zurück in unsere Rattenhütte und legten uns aufs Bett. Wir schlossen abwechselnd für ein paar Minuten die Augen. Einer von uns musste wach bleiben, um das Baby vor der Ratte zu beschützen. Unsere Freunde waren in ihrer Steinhütte geblieben und wurden am Morgen von der deutschen Nachbarin beschimpft, weil ihre Kinder Krach machten. Überhaupt gab es hier außer ein paar thailändischen Angestellten nur Deutsche. Wenn man das Meer, den Strand und die Wärme abzog, hätten wir genauso gut in Castrop-Rauxel sein können.
Wir zogen wieder in eine Steinbude, diesmal in der dritten Reihe. Sven und Achim mieteten ein Moped und fuhren abwechselnd die ganze Insel ab auf der Suche nach einem schöneren Ort.
Ich blieb zurück, saß mit dem Baby im Schatten unter Palmen oder im Restaurant, ging am Strand spazieren und lernte eine Yogalehrerin kennen, die aus Kiel kam. Sie kannte sich aus auf der Insel und nahm uns mit auf einen Spaziergang am späten Nachmittag, nachdem die anderen von ihrer erfolglosen Quartiersuche zurück waren.
Gleich hinter der Anlage lag ein Wald. Wir wanderten im Schatten der Bäume. Vogelgezwitscher, Palmen, kleine Holzhütten auf Stelzen, zwischen denen die Fischer ihre Netze gespannt hatten. Kinder spielten auf der Veranda und winkten uns zu. Keine Straßen, keine Autos, keine lärmenden Touristen. Nur Tierstimmen und eine atemberaubend wilde Landschaft. Ein Zauberwald.
Wir kamen an eine kleine Bucht, eingeschlossen von wildbewachsenen Felsen. Ein schneeweißer Strand, mit kleinen Bambushütten, still, verlassen, friedlich. Es war wie ein Traum. Als hätte uns die Yogalehrerin durch einen Zaubereingang ins Paradies geführt. Es gab zwei Hütten, die lagen ein wenig abseits im Schatten von Palmen im Sand, direkt am Meer. Perfekt für uns. Zu schön, um wahr zu sein. Wir fragten nach und bekamen zu unserer Überraschung sofort die Schlüssel in die Hand gedrückt. Wir zogen noch am selben Tag ein und verbrachten dort wunderbare Ferien. Hier begann unsere Liebe zu Thailand mit der Erkenntnis, dass das Glück manchmal gleich um die Ecke liegt und das Paradies nur zehn Minuten Fußweg von der Hölle entfernt.
Mormor in Bangkok
Das Haus, von dem wir geträumt hatten, lag gleich am Ende der Straße. Ein zweistöckiger Bau aus den 60ern, in dem früher einmal jemand aus der amerikanischen Botschaft gelebt hatte. Es hatte einen kleinen Garten mit Hibiskusbüschen und Strelizien und ein stiller Kanal umrundete die acht Häuser der kleinen Enklave, an deren Eingang ein Wachmann in seinem Sessel schlief.
Die Winterurlaube am Strand in Thailand waren jedes Jahr um einen Monat länger geworden. Wir lebten in einer kleinen Hütte, schrieben Romane, spielten mit unseren Kindern, oft kamen Freunde und Familie für ein paar Wochen vorbei, wir mussten nicht kochen und nicht frieren, aber irgendwann wurden uns die Palmen und die weißen Sandstrände zu viel. Uns zog es zurück in die Stadt. Nicht nach Berlin. Nach Bangkok. Schriftstellerfreunde waren dahin gezogen, wir hüteten ihr Haus für ein paar Wochen und suchten in dieser Zeit nach einem für uns. Die Motorradtaxifahrer an der Straßenecke halfen uns dabei. Sie kannten die Gegend wie kein anderer. In ihren grünen Westen rasten sie durch den Stau zwischen den Wolkenkratzern, und wir saßen hintendrauf, ohne Helm, weil die angeblich voller Läuse waren.
Einer der Motorradtaxifahrer brachte uns auch zu unserem Haus in einem stillen Wohnviertel. Es stand seit Jahren leer und hatte auf uns gewartet. Der Besitzer, ein reicher Chinese, der gerne handelte, bestand darauf, dass wir es für mindestens ein Jahr mieteten. So war die Entscheidung gefallen und unser Traum, für ein paar Jahre im Ausland zu leben, wurde wahr. Nicht gemütlich am Strand, wo sich das Leben wie Dauerferien anfühlte, sondern in Bangkok, der aufregendsten Stadt Asiens.
Mit nur zwei Koffern waren wir angekommen, es war warm und wir brauchten nicht viel. Im Haus waren Betten, Stühle und ein Tisch, große Bäume und ein riesiger Bambus spendeten Schatten und gleich nebenan lagen die Straßen Soi Thonglor und Ekkamai mit kleinen Bars und Musikstudios, wo junge kreative Thais sich trafen.
Jeden Tag liefen wir unsere stille Straße hinab zur Sukhumvit, auf der immer Stau herrschte und über der gerade der Skytrain eröffnet worden war, mit dem man statt in drei Stunden in nur 20 Minuten in die Innenstadt kam. An den Straßenecken standen unzählige Essensstände, an denen wir uns Mangos mit süßem Reis, Hühnchenspieße oder Suppen kauften und manchmal gleich an kleinen Plastiktischen aßen. Es war heiß und schwül und wir bewegten uns stets langsam. Die Bordsteine waren eng, aber die Thais bemühten sich immer, höflich und ohne einen zu berühren, an einem vorbeizugehen. Wenn es zu eng schien, streckten sie eine flache Hand aus, als würden sie vorsichtig den Zwischenraum wie mit einem Schwert teilen können, um so aneinander vorbeigleiten zu können.
In unserer kleinen Anlage lebten fast nur Ausländer, die, mit vielen Vergünstigungen ausgestattet, von ihren Firmen nach Thailand versetzt worden waren, sogenannte Expats. Die amerikanische Familie zwei Häuser weiter hatte einen Gärtner, zwei Maids und einen Chauffeur. Die Frau bekam jedes Jahr ein Kind. Gegenüber wohnten Engländer mit ihren drei Söhnen, die jeden Morgen mit dem kleinen Schulbus der englischen Privatschule abgeholt und nachmittags wieder abgeliefert wurden und die wir sonst so gut wie nie zu Gesicht bekamen. Ihr Hund dagegen, ein trauriger Labrador, zog bei uns ein und ging nur noch zum Fressen nach Hause.
Der Amerikaner neben uns war Anwalt und hatte eine Thaifreundin, die den ganzen Tag im klimatisierten Wohnzimmer vor dem Fernseher saß, außer am Wochenende, wenn seine Motorradgang kam. Mit der trank er dann Whiskey, spielte Billard und schlug den Mädchen auf den Hintern. Unsere Kinder nannten sie die Süßigkeitennachbarn, weil sie immer Bonbons bekamen, wenn sie gemeinsam mit den Nichten und Neffen der Thaifreundin Horrorfilme guckten, während wir dachten, sie schauten sich Zeichentrickserien an. Thais nehmen ihre kleinen Kinder auch mit ins Kino, egal wie blutrünstig der Film ist. Sie sehen es als reine Unterhaltung.
Wenig erinnerte uns an Deutschland. Nur wenn das Rudel Pekinesen des Japaners hinter uns mit ihren Glöckchen aufgeregt zum Tor lief, dachte ich manchmal an Weihnachten und Schnee.
Auf der Straße trafen wir ausschließlich sanfte Thais, die mit geradem Rücken vor sich hin wandelten oder mit sanfter Stimme plauderten. Die ganze Haltung der Thais war erstaunlich. Nie schrie einer oder knallte wütend eine Tür zu, nie schubste einer oder drängelte sich vor. Die Motorradtaxifahrer in ihren Neonwesten riefen sich manchmal etwas zu oder glotzten Mädchen nach, aber es gab keine groben Bemerkungen oder obszöne Pfiffe. Die Frauen an den Curryständen ratschten manchmal laut und lachten auf, aber waren vollendete Höflichkeit, wenn man ein Plastiktütchen rotes Fischcurry bestellte.
Die Ruhe und Sanftheit der Thais beeindruckten mich. Ein Friede ging von ihnen aus, der das Gegenteil zu der Ruppigkeit der Berliner ist und sogar in unserem Haus zu spüren war. Unser Leben in Bangkok war die reinste Erholung. Fast bewegungslos trieben die Frangipaniblüten auf dem Kanal hinterm Haus, Eichhörnchen sprangen fröhlich hoch oben von Ast zu Ast und die Großstadt brummte beruhigend in der Hitze wie ein ferner Wasserfall.
Wir lernten Thai bei einem jungen Mann, der uns manchmal mit brother oder sister ansprach, weil er dachte, wir wären Christen, worüber wir nur lachten. Christen in Thailand? Wir? Das klang absurd. Wo hier doch alles mit friedensstiftendem Buddhismus gesättigt war. Und nachdem wir ein paar Dutzend Worte und Redewendungen gelernt hatten, wurde uns noch klarer, wie zutiefst kindlich und reich die Kultur und die Menschen in Thailand sind.
An der Ecke Ekkamai lag ein Massagesalon, in dem wir uns oft von blinden Masseuren aus dem Isaan, dem armen Norden, massieren ließen. Männer wie Frauen hatten ungewöhnlich starke Hände, mit denen sie anfingen, die Füße zu kneten, und sich unendlich langsam hocharbeiteten, wenn sie überhaupt über die Beine hinauskamen. Es waren die besten Massagen meines Lebens, und nachdem ich ein paar Worte Thai gelernt hatte, begann ich ihr pausenloses Geplapper zu verstehen. Zu meiner Überraschung unterhielten sich die Masseure nicht über Politik, Aktien, Sex oder Fernsehserien, sondern darüber, was für ein frisches und gutes grünes Curry sie eben zum Frühstück an der Thonglor bei der Dame mit dem roten Kopftuch gegessen hatten (so wurde sie von allen genannt). Oder darüber, was für einen knusprigen, kleinen Wels sie sich gleich nach der Massage vom Grill kaufen würden, oder dass sie nach der Arbeit ganz sicher mal den neuen Nudelstand neben dem Kino ausprobieren würden. Sonst sprachen Taxifahrer, Polizisten, Studenten und Zufallsbekannte auch gerne übers Wetter oder die Familie.
Mitten im Juni, wenn es jeden Tag zur exakt gleichen Zeit eine Stunde lang regnete, hört sich eine Konversation dann so an: „Heute regnet’s sicher wieder!“ – „Ja! Ganz schön viel Wasser.“ – „Soll aber kühler werden.“ – „Wie schön!“ – „Und den Kindern geht’s gut bei der Großmutter auf dem Land?“ – „Ja, alle wohlauf und in der Schule.“ – „Ahh, da auf dem Dorf gibt’s den besten Klebereis mit Bohnen!“ – „Ja, mögen Sie die Hühnchenspieße an der Soi 38?“ – „Und die Nudelsuppen!“ – „Ich glaube auch, dass es heute wieder regnet.“ – „Ich auch.“ – „Ganz sicher sogar.“
Verwunderung kam immer dann auf, wenn wir erwähnten, dass wir nicht in Bangkok lebten, weil eine Firma uns bezahlte, sondern weil wir gerne hier waren, ganz aus freien Stücken. Und dass wir Schriftsteller sind, Bücher schreiben. Über Thailand? Ganz sicher. Was für ein nach Jasmin duftendes, vom Lachen junger Menschen erfülltes Land, das schön ist wie eine unerwartete Waldlichtung! Aber so blumig konnten wir es dann doch nicht beschreiben. Überhaupt dauerte es eine Weile, bis Thais begriffen, dass wir nicht Englisch mit Dialekt, sondern Thai sprachen. Dann gab es ein großes Aha und dann wieder Lachen, weil wir wahrscheinlich so klangen wie für uns Sachsen, deren Vorfahren im 17. Jahrhundert nach Peru oder Transsylvanien ausgereist sind und die immer noch gutes altes Lutherdeutsch sprechen.
Thais lachen, wenn sie sich freuen, aber noch mehr, wenn etwas peinlich ist. Die Freude, uns Thai sprechen zu hören, war also doppelt. Nur unser Sohn war erbost, dass die Leute immer lachten, wenn er hinfiel oder sich irgendwo anstieß. Ich konnte ihm noch so oft erklären, dass sie das tun, damit er sein Gesicht wahren kann und es weniger peinlich ist. Tatsächlich sah man Thais nie hinfallen oder kleckern. Sie waren die reine, friedliche Selbstbeherrschung. Nur die reichen Thais, wenn sie chinesischstämmig waren oder Emporkömmlinge, schienen ein Recht auf Herumkommandieren und Anschnauzen zu haben. Aber das sahen wir selten.
Ich liebte das Kindliche und Herzliche der Thais. Sie teilten alles und es war unmöglich, Thaifreunde zum Essen einzuladen, weil sie immer mehr mitbrachten, als alle zusammen essen konnten. Es musste mit den kleinen Schreinen zu tun haben, die entlang der Straße oder in kleinen Tempeln standen. Frauen mit Einkaufstüten knieten vor Buddha-Statuen und beteten mit Räucherstäbchen in den Händen. Wir taten es ihnen nach, rieben Goldblätter auf die Buddhas und knieten andächtig vor ihnen nieder. Die Tempelpriester, Bonzen nannte man sie, sprachen Segen über die Besucher und besprenkelten sie mit Wasser. Manchmal klingelten ihre Handys mittendrin, sie trugen goldene Uhren und viele von ihnen sahen aus wie der Dalai Lama.
Das alles erinnerte mich auch an die katholischen Gottesdienste in meinem Internat, nur dass die Besucher hier lächelten. Kurz zollte man Respekt, bedankte sich, und weiter ging das Leben. Buddha war praktisch überall, so wie früher bei uns zu Hause die Telefonzellen, und er war genauso leicht zu bedienen. Es gab sogar einen kleinen Köcher mit beschrifteten Holzstäbchen, die man schütteln konnte, bis ein herausfallendes Stäbchen einem die erwünschte spirituelle oder praktische Antwort gab.
Der Buddhismus ist keine Religion, sondern eine Philosophie, erklärte mir der Mann der Grundschullehrerin auf einem Ausflug mit unserem Sohn. Anton war in die erste Klasse gekommen und ging in eine kleine christliche Schule, die bezahlbar war. Sonst gab es nur Staatsschulen, auf denen kein Englisch unterrichtet wurde, und Schulen für Superreiche. Die Schule war nicht mehr als ein Wohnzimmer mit 12 Kindern, die gerne dort waren. Die Lehrerin und ihr Mann waren amerikanische Missionare, auch sanft und freundlich, aber streng. Er trug immer eine dunkle Sonnenbrille und war früher Drogenschmuggler gewesen. In der Schule erstaunten uns seine Söhne jedes Mal mit akrobatischen Kunststücken und ihre Vornamen begannen alle mit J. Wie Jesus.
Ich fand den Buddhismus interessanter. Er ließ mir meine Freiheit, auch wenn mir nicht ganz klar war, wie. Es war nicht so wichtig, bis meine Großmutter starb. Weit weg, auf einem anderen Kontinent.
Ich hatte meinen Vater mit 15 verloren, aber er war kaum da gewesen für mich. Umso näher war mir meine schwedische Großmutter gewesen, bei der ich, seit ich laufen konnte, jeden Sommer verbracht hatte, oft allein mit ihr und meinem Großvater, der gerne schwieg, Zigarillo rauchte und Zeitung las. Mormor, wie wir sie nannten, Schwedisch für Muttersmutter, war meine beste Freundin gewesen. In ihrer Jugend war sie Turmspringerin gewesen und sie hatte ein aufregendes Leben gehabt, wild und abenteuerlich und schön. Ihr Tod nahm mich sehr mit. Die Entfernung. Die Frage, wohin sie ging, warum wir sterben, warum wir Krankheiten erliegen müssen. Warum mein Großvater mit Mitte 60 senil wurde und verwirrt starb.
Zwei Tage nach ihrem Tod saß ich im Erdgeschoss am orangenen iMac und tippte, als ich spürte, wie sie durchs Haus ging. Ein ungewöhnlicher Wind wehte die Stufen vom Schlafzimmer hinab, eine Tür klapperte, etwas Schönes lag in der Luft und ich roch ihr altertümlich blumig-süßes Parfum.
Die Tibeter sagen, erinnerte ich mich, dass die Seelen der Toten drei Tage umherwandern. Für mich war es keine Frage, dass meine Großmutter durchs Haus spaziert war, ein Haus, das sie nie gesehen hatte. Ein letzter Ausflug nach Asien, ihre Enkel und Urenkel sehen, den Garten bewundern, mir von der anderen Seite winken, ein wenig altertümliches Eau de Cologne in die Luft sprühen.
Ich beschloss, ihren Tod zu würdigen. Oder besser: ihr Leben. Und zwar in dem Tempel, den ich vorne an der U-Bahn-Station hinter den Bürobedarf- und Stoffläden entdeckt hatte.
Gebet und Andacht wären frei, sagte man mir, ich sollte lediglich etwas für jeden betenden Mönch mitbringen. Der Preis, fand ich heraus, war für alle der gleiche: ein Mönch, ein Eimer.
In jedem Laden, selbst im Supermarkt, standen die orangefarbenen Eimer auf kleinen Podesten. Sie schienen ein täglicher Gebrauchsartikel zu sein, nur hatte ich bis dahin nicht ganz verstanden, wofür. In den Eimern lagen Sardinenbüchsen, Kondensmilch, Reis, Waschmittel, Seife, Zahnbürsten und was auch immer ein Asket brauchte. Keine Comics, Schokoriegel, keine Probierflaschen Whiskey oder Automagazine, nur das Wichtigste für die jungen Männer in den orangenen Roben, denen jeder am Bordstein Platz machte und die Frauen unter keinen Umständen berühren durften. Dabei waren sie ganz normale junge Männer, oft zu arm für eine Ausbildung, oder sie leisteten ihr spirituelles Jahr ab, wie der König und jeder respektable Thai-Mann es taten. Der junge König in seiner Robe und mit Ray-Ban-Sonnenbrille hing bei uns zu Hause an der Wand neben einem Bild mit King Elvis Presley und König Bhuimbol bei einem Konzert. Jeder Haushalt besaß ein Bild des Königs. Konservative bevorzugten ihn in übergroßer Militäruniform, andere fröhlich und mit einer Spiegelreflexkamera in der Hand.
Am verabredeten Tag nahmen wir unsere drei Eimer, die in gelbe Folie verpackt waren, und gingen zum Tempel, um für meine Großmutter zu beten. Oder besser: beten zu lassen. Wir beteten ja nicht, das sollten die Profis übernehmen. Oder was auch immer ich mir dabei dachte. Es war mir drei Eimer wert. Und ich war neugierig.
Würden die Mönche eine halbe Stunde lang religiös verzückt singen und dann mit ihren Gebetsmühlen knattern und Worte sprechen, die schon vor Anbeginn der Zeit gesprochen wurden? Oder würden sie Ohmmmm singen und uns so alle in einen Trancezustand versetzen, in dem wir mit Mormor in Kontakt treten und von ihr Abschied nehmen konnten? Ich hoffte sogar, dass die Gebete dieser heiligen Männer ihr über den Styx sicheres Geleit geben würden, wie auch immer das aussieht. Ich war froh, dass alles, was von uns verlangt wurde, sich auf drei orangefarbene Eimer beschränkte, und ich dafür Einblick in eine spirituelle Welt haben konnte, an die ich nicht so richtig glaubte.
Die Kinder waren noch klein und deswegen wollten sie auf dem Weg zum Tempel lieber zu McDonald’s oder ins Kino. Im Kino war es so kalt, dass wir oft erst mal nach Hause mussten, um einen Pulli zu holen. Und McDonald’s war tabu bis auf maximal zweimal die Woche. Die Kinder verstanden aber auch, dass wir Großmutter ehren wollten, und warteten brav mit uns in einem Vorraum des Tempels, der wie fast alles in Bangkok aus Beton gebaut und mit Neonlichtern ausgestattet war.
Frauen und Männer gingen mit Eimern durch eine Tür und kamen ohne wieder heraus. Als wir dran waren, bat uns ein älterer Mönch mit einer großen Brille, die bernsteinfarbene Gläser hatte, in ein Zimmer, in dem wir die Eimer zu Dutzenden anderen stellten und uns dann auf Kissen knien durften. Der alte Mönch erklärte drei kahl geschorenen jungen Männern, worum es ging, und sie fingen an, mit gefalteten Händen vor dem Gesicht auf Thai zu murmeln. Ich suchte noch die richtige Stellung zum andächtig sein, da wünschte uns der alte Mönch schon einen schönen Tag und wir waren entlassen.
Von der Sonne geblendet torkelten wir aus dem Tempel und gingen ohne Umschweife zu McDonald’s.
Herr Haarmann sagt
Nach zweieinhalb Jahren Bangkok zogen wir wieder nach Berlin. Wir hatten einen Plan. Nicht in den alten Westen wollten wir, sondern in die neue Mitte, die wir bisher verachtet hatten, weil sich dort alle Zugezogenen breitmachten, denen Berlin vor dem Mauerfall zu hart und zu schmutzig gewesen war. Wir wollten unsere Vorurteile überwinden und Berlin mit offenen Herzen und unvoreingenommenen Köpfen noch eine Chance geben und zogen in einen schicken Plattenbau gleich neben dem Gendarmenmarkt.
Freunde hatten uns ihre alte Wohnung vermittelt und waren zwei Stockwerke tiefer gezogen. Am Wochenende gab es sogar einen Club in unserem Haus, wo sich alle trafen. Besser hätten wir es uns nicht wünschen können, wir waren wieder mittendrin.
Wir kamen im Frühjahr zurück nach Berlin. Die Sonne schien, die Blumen blühten, die Bäume wurden grün. Wir zogen in unsere neue Wohnung im 6. Stock an der Friedrichstraße. Der einzige Einrichtungsgegenstand war ein kleines Camouflagezelt, das die Kinder im Wohnzimmer aufstellten. Darin schliefen wir die erste Nacht. Nomaden mit festem Wohnsitz. Das fühlte sich passend und richtig an, und wir bedauerten, dass wir nicht weiter so einfach leben konnten. In einem kleinen Zelt, in einer großen leeren Wohnung, mitten in der Stadt.
Alles schien perfekt. Freunde ringsum, die Kinder gingen in die Schule und danach in den Hort, wir hatten den ganzen Tag frei, um zu schreiben. Alles fühlte sich neu und aufregend an. Wir lebten in einem Berlin, das wir so bisher nicht kannten. Die neue Mitte, die 2002 zwar nicht mehr ganz neu war, für uns aber schon, die wir bisher in Kreuzberg, Charlottenburg und Schöneberg gewohnt hatten. Es war kein Zurückkommen, sondern ein Neuanfang. Wir hatten genug buddhistische Gelassenheit mitgebracht, um uns von den grantigen Berlinern nicht die Laune verderben zu lassen, wir waren gut gelaunt und freundlich und so kamen uns auch die Leute entgegen, wie die Kindergartenleiterin des Horts in der Französischen Straße, der eigentlich schon überfüllt war, die aber trotzdem für unsere Kinder Platz machte. Die Grundschule am Brandenburger Tor war bunt und kosmopolitisch mit Kindern der Botschaftsangestellten aus aller Welt. Doreen kam aus dem Kongo, Justyna aus Polen, Jury aus Russland, Wael irgendwo aus dem Mittleren Osten, genau was wir uns für unsere Kinder wünschten, die bisher fast mehr Zeit in Thailand als in Berlin zugebracht hatten. Luzie lernte im Russischen Haus auf der Friedrichstraße töpfern und Anton Schachspielen bei einem russischen Schachmeister. Die alte Heimat hatte uns in neuem Kleid mit offenen Armen aufgenommen und ans Herz gedrückt.
Nur mit dem Schreiben ging es nicht voran, und als wir uns eingelebt hatten, die Wohnung sich langsam füllte und die Aufregung sich legte, kam der Wurm rein. Das neue Leben wollte sich nicht so richtig einstellen. Vielleicht, weil wir immer noch die Alten waren.
Ich hatte keine Lust mehr, Freunde zu treffen, lag Abend für Abend auf meiner nachtblauen Chaiselongue mit der Fernbedienung im ausgestreckten Arm, weil die Batterie schwach wurde und ich zu schlapp war, sie auszutauschen, zappte bis Mitternacht durch die Programme, bis mir die Augen zufielen und ich mich schließlich von der Chaiselongue drei Meter weiter ins Bett schleppte. Zu der Fernsehsucht und unerklärlichen Antriebslosigkeit kam eine ebenso unerklärliche Angst um das Leben meiner Kinder. Wenn das Telefon klingelte, blieb mir jedes Mal fast das Herz stehen, weil ich dachte, jemand rief an, um uns mitzuteilen, dass einem Kind etwas zugestoßen war. Genauso, wenn ich eine Polizeisirene hörte, während meine Kinder in der Schule waren. Manchmal riss mich die Angst nachts aus dem Schlaf und ich lag mit rasendem Herzen wach im Bett und konnte nicht mehr einschlafen. Ich bekam Panikattacken in der U-Bahn, das ließ sich vermeiden, indem ich nicht mehr U-Bahn fuhr, aber die Angst um meine Kinder fraß mich in dieser Zeit fast auf.
Mein kauziger Homöopath, der früher einmal Nervenarzt gewesen war, sagte nach einem Beratungsgespräch für 150 Euro mitleidlos: „Was Sie haben, sind Wachstumsschmerzen.“
Das half mir auch nicht weiter, das einzige Tröstliche daran war, dass es, wenn er mit seiner Diagnose richtig lag, irgendwann wieder vorbei sein würde, sobald ich mich ausgewachsen hatte.
Ich beschloss, einen Arzt zu suchen. Einen Psychologen oder Therapeuten oder was auch immer; ich hatte keine Ahnung, wer dafür zuständig war. Ich fragte meine Freunde, aber die kannten nur Analytiker und an die glaubte ich nicht. Ich wusste von vielen, die jahrelang zur Analyse gingen und immer noch dieselbe Macke hatten. Ich wollte schnelle, effektive Hilfe.
Da ich nicht U-Bahn fahren konnte und lange Wege in unbekannte Stadtteile mich in Panik versetzten, suchte ich nach einem Psychotherapeuten in der Nähe. Ich fand einen hinter dem Bahnhof Friedrichstraße in einem runtergekommenen Plattenbau. Die Klingelschilder waren kaum zu lesen. Hinter einer verschmierten und verkratzen Glastür konnte ich einen langen Gang erkennen, der ins Nichts führte. Schließlich entdeckte ich den Namen des Psychologen. Kein Praxisschild, nicht einmal ein Dr. oder Psych. oder irgendein Hinweis, dass es sich hier um einen Arzt mit Zulassung handelte. Nur ein Zettel mit dem immerhin gedruckten und nicht handgeschriebenen Namen, der über das metallene Namensplättchen geklebt war.
Ich spürte eine erneute Panikattacke aufsteigen und rief Sven an. Nachdem ich ihm die Situation beschriebene hatte, sagte er: „Da gehst du auf keinen Fall hin.“
„Aber ich habe doch einen Termin.“
„Na und, ruf ihn an und sag ab.“
„Kann ich das wirklich tun?“
„Natürlich kannst du.“
Ich rief die Praxis an. Eine Männerstimme meldete sich, und ich sagte, ich stünde hier vor seinem Eingang, wäre mir aber nicht sicher, ob es die richtige Adresse sei, weil ich keinen Hinweis auf seine Praxis finden könne. Er sagte, das sei schon richtig, ich solle nur raufkommen. Ich sagte, es täte mir leid, aber das sei mir unmöglich. Er könne nicht im Ernst von mir erwarten, diesen verwahrlosten Hausflur zu betreten. Ich müsste ihm leider absagen. Das Gespräch ging noch eine Weile hin und her. Dann sagte er, er könne mir entgegenkommen, wenn ich solche Probleme mit seinem Hausflur hätte.
Ich sagte: „Sie verstehen nicht, ich werde nicht kommen.“
Er sagte: „Gut, wie Sie wollen, aber gegen Ihre Angst müssen Sie dringend etwas unternehmen.“