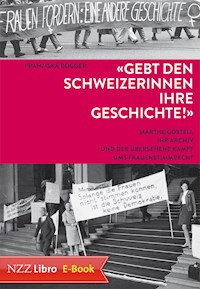
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ausgehend von vielfältigen Archivakten deckt Franziska Rogger auf, dass die wissenschaftliche Geschichtsschreibung an den Schweizer Universitäten den Frauenstimmrechtskampf falsch dar stellt, da sie insbesondere die dem Kampf vorangehenden Hauptakten nie eingearbeitet hat. Mit diesem mangelhaften Verfahren wurde den Schweizer Frauen ihre eigenständige Geschichte recht eigentlich unterschlagen. Die Autorin stellt die weibliche Welt in einem Längsschnitt seit dem 18. Jahrhundert dar. Gleichzeitig zeichnet sie die Entwicklung von Marthe Gosteli von der eng mit der Familie verbundenen Frau zur individuellen Persönlichkeit und engagierten Kämpferin für das Frauenstimmrecht nach. Neu ist dabei, dass die Ereignisse aus weiblichen und männlichen Augen gesehen und kommentiert werden. Ohne ideologische Sichtweise wirft sie in der Darstellung der politischen Kämpfe, die sowohl von sozialdemokratischen wie bürgerlichen Frauen einmütig durchgefochten wurden, Seitenblicke auf weitere internationale und nationale Denkweisen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRANZISKA ROGGER
«GEBT DENSCHWEIZERINNENIHRE GESCHICHTE!»
MARTHE GOSTELI,IHR ARCHIVUND DER ÜBERSEHENE KAMPFUMS FRAUENSTIMMRECHT
VERLAG NEUE ZÜRCHER ZEITUNG
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2015 Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2015 (ISBN 978-3-03810-006-5).
Titelgestaltung: Katarina Lang, Zürich
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978-3-03810-084-3
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Neuen Zürcher Zeitung
PROLOG
Für eine eigenständige Geschichte der Schweizerinnen, für ein stolzes Selbstbewusstsein und für eine gleichberechtigte Zukunft
PROLOG
Die Schweizerinnen haben eine eigene, in sich selbst beruhende unverwechselbare Geschichte, nur wurde sie noch nie erzählt. Die universitäre Wissenschaft hat die den Männern gegengleiche Geschichte der Schweizer Frauen unterschlagen. Sie hat für das immer wieder isoliert erwähnte Kernstück der Frauengeschichte, den Stimmrechtskampf, die Hauptquellen nicht beachtet. Der Sieg in diesem politischen Frauenkampf war auf der Basis einer veränderten Schweiz das Ergebnis einer über Generationen hinweg erprobten Taktik der Schweizer Frauen, die 1971 endlich aufging. Dabei war die politische Gleichberechtigung als Ausgangspunkt für eine nachhaltige und vollwertige Gleichberechtigung gedacht. Dieser Kampf wird in Teil 1 erstmals auch anhand der Akten der federführenden, von links wie rechts unterstützten und präsidierten Arbeitsgemeinschaft der schweizerischen Frauenverbände für die politischen Rechte der Frau erzählt, bei der in den nationalen Abstimmungen von 1959 und 1971 sämtliche Fäden zusammenliefen.
Teil 2 beschreibt ein individuelles, weibliches Leben, zurechtgestutzt von den damaligen als frauengerecht empfundenen Einschränkungen, überlagert von äusseren Bedingtheiten und angereichert von weiblichen Vorbildern. Es ist die Lebensgeschichte der Pionierin Marthe Gosteli, die sich im Frauenstimmrechtskampf persönlich und leitend engagierte. Zudem gründete sie auf ihrem eigenen Gutshof in Worblaufen bei Bern das Archiv zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung. Darin finden sich nicht nur zentrale Dokumente zum Stimmrechtskampf, sondern auch wichtige, bis ins 19. Jahrhundert zurückgehende Papiere zur Vergangenheit der Schweizer Frauen überhaupt. Als Archivarin und Historikerin des Herzens half Gosteli mit, den Schweizerinnen zu ihrer Gleichberechtigung in der Geschichte zu verhelfen, die ihrer Ansicht nach unabdingbar für eine gleichberechtigte, emanzipierte Zukunft ist: «Ohne Gleichberechtigung in der Geschichte keine Gleichberechtigung in der Zukunft.»1
Auch die Frauen in der Schweiz entwickelten sich vom eng eingebundenen Mitglied des Familienverbands zur individuellen Persönlichkeit. Beides gilt es in Teil 3 konkret vor Augen zu führen. Anhand der weit ins 18. Jahrhundert zurückgreifenden Familienpapiere der Familie Gosteli, heute im Staatsarchiv Bern beherbergt, kann die Entwicklung Schritt für Schritt anhand eines Beispiels vorgezeigt werden. Nur mit dem langen Atem durch die Geschichte der Ahnen und Vorfahrinnen sind die Prägungen der Schweizerinnen und gegengleich auch jene der Schweizer zu erkennen. Diese Prägungen, die sowohl Männer wie Frauen imprägnierten, lassen weibliche Diskriminierungen und männliches Machtgehabe begreifen, auf dass beides zu beiderseitigem Vorteil überwunden werden kann.
Abb. 1: Marthe Gosteli, lachend in ihrem Archiv zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung, das sie im Haus ihrer Vorfahren auf dem Altikofen in Worblaufen 1982 eingerichtet hat. Vor ihr auf dem Tisch liegen Fotos verdienter Stimmrechtskämpferinnen, in ihrem Rücken stapeln sich Archivschachteln mit Dokumenten aus der schweizerischen Frauenwelt.
Ohne eine Geschichte der Schweizerinnen gibt es auch kein stolzes, weibliches Selbstbewusstsein. Ohne eine Geschichte der Schweizerinnen sind auch ihre Stärken und Siege nicht zu erkennen. Die Helvetierinnen versinken entweder in einem Dunst von Unwissenheit oder in einem Sumpf von Niederlagen. Dabei gibt es nebst vielem Unerfreulichem und vielen Diskriminierungen auch erfreulich Bemerkenswertes: stolze Siege, eigenständige Erfolge und schweizerische Stärken.
Erstens hatten nirgendwo anders auf der Welt die Frauen ihre Wahlrechte gegen einen männlichen Souverän zu erkämpfen. Die Schweizerinnen haben es als einzige geschafft, gegen die Phalanx der Männer anzutreten und zu gewinnen. Die Bedeutung der Schweizer Frauenbewegung war, dass sie trotz grosser Differenzen und selbst mit Frauen, die innerhalb der bestehenden Gesellschaft keine Chance zur echten Gleichberechtigung sehen konnten, in der Frauenstimmrechtsfrage legal und unblutig siegte. Dabei müssen die Schweizer Frauen nicht auf einen leidvollen Weltkrieg zurückblicken, der ihnen aus den Trümmern heraus zu ihrem Recht verhalf. Kriegsbedingte Erschütterungen mögen den Frauen europäischer Länder ihr Wahlrecht früher gebracht haben. Allerdings wurde auch im Ausland möglichst schnell die «verkehrte» Welt revidiert, auf dem Arbeitsmarkt die «natürliche» Privilegierung des männlichen Geschlechts wiederhergestellt.2 Die Schweizerinnen mussten sehr lange auf den Moment warten, wo sie auf gänzlich verändertem Terrain mit organisierter Verweigerung die politische Bevorzugung der Männer aushebeln konnten. Die eigentliche Grösse und Würde der Schweizer Frauen steckt in der Hartnäckigkeit, in der Wiederholung, in der Unbeugsamkeit. Sie siegten erst nach jahrzehntelangem Ausharren mit einer raffinierten Taktik des Widerstands. Ein beispielloser Erfolg!
Zweitens haben die Schweizerinnen seit 1971 Abstimmungs-, Initiativ- und Referendumsrechte, die kein anderes Land seinen Frauen (und Männern) bietet.3
Drittens waren die Schweizerinnen fähig, auch ohne Stimmrecht neben der offiziellen, politischen Schweiz eine funktionierende, gut organisierte Nebenwelt zu schaffen, einen Staat im Vereinsmassstab, um sich, vom offiziellen Politleben ausgeschlossen, doch irgendwie ins Milizsystem des Herrenstaates einzuklinken und für die Männer glaubwürdig und unumgänglich zu werden. Das so gewonnene politische Gespür und das Wissen der Frauen kamen der Schweiz in entscheidenden Kriegszeiten zugute und liessen sie überleben. Mag es in der wirtschaftlichen Männerwelt ausgesehen haben, «als habe es die Frauen nicht gegeben»,4 in der weiblichen Gegenkonstruktion gab es sie seit Jahrzehnten. Die Männer nahmen diese weibliche Welt selten ernst, viele Frauen übersahen sie, und sie schufen ein «Misserfolgsnarrativ» – vielleicht aus Gründen der Selbstdiskriminierung.
Viertens wurde den Frauen nirgendwo auf der Welt so früh der Zugang zu den Universitäten geöffnet. Die allerersten Studentinnen, Doktorinnen und Professorinnen finden sich ab 1867 in der Schweiz. Hier war die Schweiz Pionierin. Und gerade in der organisierten Frauenbewegung gab es viele Akademikerinnen, die ihre erworbenen Kenntnisse für die Emanzipation im beruflichen und politischen Leben einsetzten. Mag die politische Gleichberechtigung viel zu spät gekommen sein, eine akademische Chancengleichheit bestand umso früher. So war die Schweiz, was die Gewerbemöglichkeiten betraf, verhältnismässig avantgardistisch.
Fünftens griffen Frauen in ihrer Geschichte auf das Wissen ihrer Vorfahrinnen zurück. Sie zogen in ihren Vereinigungen neue Mitglieder nach, die sie mit ihren Erfahrungen und Erinnerungen anlernten. Die Lehrerinnen der Mädchenschulen etwa, die gut und zum Teil an Universitäten ausgebildet waren, begeisterten junge Frauen für ihre Rechte. Sie lernten über Generationen hinweg voneinander. Die Schweizerinnen haben sich in ihren vielen Kämpfen personell, taktisch und vereinsstrategisch aufeinander bezogen, sie haben also eine eigenständige, in sich selbst fortlaufende weibliche Geschichte entwickelt.
Sechstens waren Schweizerinnen fähig, Eigeninitiativen umzusetzen. Wo haben Frauen ein ganzes Spital samt Pflegerinnenschule aufgebaut und betrieben, wie es 1900 die Schweizer Akademikerinnen und Pflegerinnen taten? Nonprofitunternehmungen verdanken weiblichen Kräften ihr Bestehen. Schweizer Frauen haben Mädchenschulen aufgebaut, Heime und Restaurants in eigener Regie geführt. Sowohl die Damen um 1900 wie auch die Frauen um 1980 managten Informationsstellen, schufen männerfreie Räume und gaben Zeitungen heraus.
Siebtens übernahmen die Schweizerinnen bei der Gestaltung schweizerischer Zukunft die Vorreiterinnenrolle. Die Schweizerinnen nahmen den Weg zu einer gerechteren, gegengleichen Gleichberechtigung nach 1971 unter die Füsse, weit früher als die Männer. Sie mussten sich nämlich lange vor den Schweizer Männern damit auseinandersetzen, wie eine individualisierte Gesellschaft weit weg vom Familienverbund, der als wirtschaftliche, soziale, gesellschaftliche Interessengemeinschaft funktioniert, aussehen müsste. Die Schweizer Männer konnten sich noch lange als Oberhaupt eines allerdings stark geschrumpften Familienbundes fühlen. Erst zögerlich wurden sie gewahr, dass sie sich in eine neue Rolle schicken mussten. Der Schweizer Mann hält heute fest, dass er zwar als traditionelles Oberhaupt der Familie ausgedient, «aber seinen neuen Platz noch nicht gefunden» habe.5 Dass den Schweizer Frauen ihre Rechte weit über ein nachvollziehbares Datum hinaus verweigert wurden, war eine Diskriminierung. Dass die Schweizer Männer ihre neuen Rollen über ein nachvollziehbares Datum hinaus vertagen, ist in der Konsequenz stimmig. Und eine späte Rache?
TEIL 1
Die unterschlagene, eigenständige Geschichte der Schweizerinnen: ihre Hartnäckigkeit, ihre Taktik des Widerstands und ihr Sieg
Teil 1 zeigt den politischen Kampf der Schweizer Frauen erstmals anhand der wichtigsten bis anhin unterschlagenen Hauptquellen. Das Grundlagenmaterial für diese Historie liegt im Archiv zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung, das von Marthe Gosteli, einer der frauenpolitischen Pionierinnen, gegründet wurde. Erzählt wird, wie sich die Schweizerinnen mit der Forderung nach politischer Gleichberechtigung vorerst auf das weibliche Frauenstimm- und -wahlrecht konzentrierten und wie sie auf der Basis einer veränderten Schweiz und einer über Generationen hinweg erprobten Taktik 1971 siegten. Nicht zuletzt dank des langen Kampfs für politische Rechte besitzen die Schweizerinnen eine eigene, in sich selbst beruhende unverwechselbare Geschichte – die aber bis heute nie erzählt wurde. Bezüge zu Marthe Gostelis Leben, das in Teil 2 behandelt wird, sowie ihre Bemerkungen als eine zeitgenössische Mitkämpferin sind bereits in diesen Teil 1 eingestreut.
DER LANGE WEG BIS ZUR STIMMRECHTSNIEDERLAGE VON 1959
Der Paukenschlag der SAFFA von 1928 und das Vorbeikriechen der Stimmrechts-Schnecke
Immer wieder hatten sensationelle Auftritte und erregende Statements einzelner Schweizerinnen auch in früheren Jahrhunderten aufhorchen lassen. Noch nie aber hatten die Frauen ihre Verdienste und Wünsche so sichtbar und einmütig, so öffentlich und national dargestellt wie an der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit SAFFA 1928 in Bern. Die Schweiz war begeistert.
Den Schwerpunkt setzten die berufstätigen Frauen. Die Promotorinnen der SAFFA waren Frauenberufsverbände. Die Schweizerinnen waren nicht mehr nur in bäuerlichen Grossfamilien aufgehoben. Viele arbeiteten ausser Haus als Handwerkerinnen, Gewerblerinnen oder Dienstleisterinnen. Ende der 1920er-Jahre gab es unzählige stellenlose Lehrerinnen und Sekretärinnen.
In dieser nationalen Schau zeigten die Schweizerinnen, wozu sie imstande waren. Um alle für die SAFFA arbeitenden Frauenkomitees aufzuzählen, brauchte es im Ausstellungskatalog 13 eng bedruckte Seiten. Damals war jede fünfte Einwohnerin Mitglied in einem der 1626 Frauenvereine. Die heutige Sicht mag trügen; nicht nur besonders bewusste Frauen wirkten in Vereinen mit, es war normal, vornehmlich in gemeinnützigen Frauenvereinen mitzutun. Die Frauenstadt der SAFFA war von der Architektin Lux Guyer in lockerem Pavillonstil auf knapp 100000 Quadratmeter auf dem Viererfeld erbaut worden. Vierzehn Gruppen vom Hausfrauenverein Bern bis zu den Schweizerinnen im Ausland präsentierten rund 5600 Schaunummern. Das SAFFA-Orchester bestand aus lauter Musikerinnen. Eine eigene SAFFA-Zeitung und ein Theaterstück wurden kreiert, ein SAFFA-Gedicht und ein SAFFA-Walzer geschrieben.
Abb. 2: Die SAFFA 1928 «by night». Wer aus dem Berner Bahnhof trat, konnte dem leuchtenden Schriftzug beim heutigen Hotel Schweizerhof zur Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit folgen.
Abb. 3: Am SAFFA-Umzug wurde als Symbol für die Langsamkeit, mit der die berechtigte Forderung nach dem Frauenstimmrecht behandelt wurde, eine Schnecke durch die Strassen gezogen. Sie kam auch an einer beeindruckten Marthe Gosteli vorbei. Die Umzugsteilnehmerinnen, adrett mit Hut, trugen Fahne und Schärpen mit dem Stimmrechtslogo. Ein Bub marschierte mit: «Das ist Felix, der Sohn von Agnes Debrit-Vogel. Sie wollte dafür sorgen, dass wenigstens ‹ein Mannli› im Umzug sei», weiss Marthe Gosteli.
Der Festzug am Eröffnungstag, es war der 25. August 1928, dauerte zwei Stunden, 2000 Frauen machten mit und zogen 40 Wagen. Die spektakulärste Nummer war die Stimmrechts-Schnecke, die als Symbol für die Langsamkeit, mit der man die Forderung nach dem Frauenstimmrecht bis anhin behandelt hatte, durch die Strassen gezogen wurde. Unter den Tausenden von Zuschauern und Zuschauerinnen war auch ein elfjähriges Mädchen vom Land: die kleine Marthe Gosteli. Sie erinnert sich: «Ich war noch ein Goof, meine Mutter nahm meine Schwester und mich mit an den Umzug. Meine Tante Marie Salzmann war im Zusammenspiel mit den Frauen ihres Dorfvereins in die Sache involviert.»
Selbst Vater Ernst Gosteli, Landwirt und Gutsherr auf Altikofen, hatte mit der SAFFA zu tun, und zwar als Grossrat. Da sich der Hauptträger der Ausstellung, der Bernische Frauenbund (heute Frauenzentrale) unter Rosa Neuenschwander vorgängig um eine öffentliche Defizitgarantie bemüht hatte, kam die Ausstellung am 14. September 1927 im Grossen Rat zu Sprache. Der Regierungsrat empfahl den Staatsbeitrag wärmstens angesichts der guten Organisation, der sehr sparsamen und vorsichtigen Budgetierung, der Frauensolidarität und des vornehmen Zwecks der Ausstellung. Für die SAFFA sei einem weniger bang als für manch andere Ausstellung, wenn man sich vorstelle, «was für eine Begeisterung heute schon durch die ganze Frauenwelt» gehe. Das Garantiekapital von 75000 Franken wurde von den Männern störungslos und einhellig genehmigt. Allerdings soll sich auf verschiedenen Ratsgesichtern ein ungläubiges Lächeln gezeigt haben, weil am Erfolg der SAFFA gezweifelt wurde. Zu Unrecht! Zur grossen Überraschung aller wurden die kühnsten und optimistischsten Erwartungen übertroffen. Die Ausstellung, eine logistische Meisterleistung mit 700 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, wurde mit 630000 Gästen zehnmal eifriger besucht als erwartet. Die Ausstellerinnen erwirtschafteten einen Reingewinn von über 300000 Franken, der den Grundstock einer noch heute bestehenden Bürgschaftsgenossenschaft für junge Unternehmerinnen bildet.6
Abb. 4: In den 1920er-Jahren wurden die Männer nicht ohne Not an den Kochherd gerufen. Die gemeinnützigen Frauen boten während der Krise aber Kochkurse für arbeitslose Männer an.
Abb. 5: In den 1920er-Jahren wurde noch nicht die gleichberechtigte Arbeitsteilung propagiert. Das Hammerschwingen wurde den Hausfrauen in der Schweizer Illustrierten Zeitung als «Gymnastik» nahegelegt.
Albert Einsteins Stimmrechtsweiber, die erfolgreichste Schweizer Petition von 1929 und Amerikas Frauensolidarität
Die SAFFA 1928 hatte den Schweizer Frauen viel Achtung, Ehre und sogar gutes Geld, aber keine politischen Rechte eingebracht. Schweizerinnen und Schweizer begegneten Änderungen mit Zurückhaltung und bevorzugten ein vorsichtiges und langsames Hinterherhinken. Trotzdem hatten die Schweizer Frauen einen Schritt weg von ihrem Familienverbund, hin zur individuellen Persönlichkeit getan und sich verstärkt in ausserfamiliären, solidarischen Gruppen organisiert, deren Zusammenhalt von gemeinsamen weiblichen Interessen geprägt war.
Die Schweizerinnen gewannen Selbstbewusstsein. Den Schwung der Ausstellung ausnützend, lancierten der Schweizerische Stimmrechtsverein und die Frauenagitationskommission der SP Schweiz 1929 eine nationale Petition, die in Ergänzung der schweizerischen Bundesverfassung das volle Stimm- und Wahlrecht verlangte.7 Hier gelang die Zusammenarbeit mit der Linken, die an der SAFFA noch abseits gestanden hatte, und gemeinsam konnte man ein trauriges Jubiläum feiern: Es waren zehn Jahre vergangen, seitdem eine frühere Nationalratsmotion zugunsten des Frauenstimmrechts in der Schublade verschwunden war.
Die Unterschriftensammlung für die Petition war eine Meisterleistung politischen Managements. Generalstabsmässig geplant sammelten Frauen und Männer in einem ohnehin schon harten und mit Grippewellen durchzogenen Winter Unterschrift um Unterschrift, sie schreckten auch vor beschwerlichen Fussmärschen in die hintersten Winkel der Schweiz nicht zurück.
Unter den Sammlern war auch Albert Einsteins jüngerer Sohn Eduard. Ihm war das Frauenstimmrecht eigentlich egal. Er glaubte an die Sinnlosigkeit des Staats, Demokratien waren für ihn barer Unsinn. Doch gefiel es ihm über alle Massen, im März 1929 mit den Petitionsbogen von Wohnung zu Wohnung zu gehen, ins richtige Leben der einfachen Leute und in die Gefilde der Reichen hineinzuschauen. Er erzählte seinem Vater in einem Brief von heiteren Zwischenfällen beim Unterschriftensammeln fürs Frauenstimmrecht. Bezeichnend ist Teddys Erlebnis mit einer Frau, die ihm unter der Türe erklärte, zum Unterschreiben sei jetzt niemand zu Hause! Sie unterschrieb schliesslich doch mit ihren Besucherinnen und selbst ein Alter erhob sich behäbig vom Pianostuhl und «pflanzte» seine Unterschrift. Wie er Eduard auf dessen unterhaltsamen Bericht hin brieflich mitteilte, war der grosse Albert Einstein allerdings der uncharmanten Ansicht, dass unter den «Weibern» eigentlich nur solche mit männlichem Einschlag für das Frauenstimmrecht kämpften.8
In der Bittschrift wurde die «hohe Bundesversammlung» gebeten, mit einer Verfassungsergänzung den Schweizer Frauen das volle Stimm- und Wahlrecht zuzuerkennen. Nach einer Parforceleistung wurde sie von 170397 Frauen und 78840 Männern unterzeichnet. Die viertel Million Unterschriften bedeutet, dass 1929 rund 10 Prozent der gesamten erwachsenen Bevölkerung von 2410000 hinter der Eingabe standen. Es war ein stolzes Resultat, und diese nationale Frauenstimmrechtspetition gilt denn als eine der erfolgreichsten – wenn nicht als die erfolgreichste überhaupt – in der Geschichte des schweizerischen Petitionsrechts.9
Abb. 6: Gruppenbild mit strahlendem Mann. Die grösste Petition aller Zeiten wurde am 6. Juni 1929 bei strömendem Regen in einem Marsch durch Bern getragen. Siebzig Vertreterinnen der Kantonalkommissionen brachten die Pakete mit den 247506 Unterschriften in einem von sieben Mitgliedern des Aktionskomitees eröffneten Zug zum Bundeshaus, wo sie vom Ständeratspräsidenten Oskar Wettstein, RD ZH, und vom Nationalratschef Heinrich Walther, CVP LU, empfangen wurden.
Die Unterschriftenbögen wurden am 6. Juni 1929 bei strömendem Regen in einem langen Demonstrationszug, gruppiert nach Kantonen, durch Bern getragen. Ein solcher Marsch galt als extreme Aktionsform, die Schweizer Frauen hatten sie bei der International Woman Suffrage Alliance IWSA abgeschaut. Siebzig Vertreterinnen der Kantonalkommissionen trugen – erstaunt über die eigene Kühnheit – die Pakete in einem von sieben Mitgliedern des Aktionskomitees eröffneten Zug zum Bundeshaus.10
Die beteiligte Frauenrechtlerin und Pädagogin Helene Stucki – Marthe Gostelis spätere Lehrerin – kommentierte die Übergabe der Petition im Bundeshaus mit Bitterkeit: «Was soll man über den ‹Empfang› im Vestibül des Bundeshauses sagen? Wenn das überhaupt etwas hochtönende Wort gebraucht werden darf dafür, dass Journalisten und Photografen bereitstanden, dass die Herren National- und Ständeräte sich aus ihren Sitzungssälen heraus bemüht hatten, um dem vorläufigen Einzug des weiblichen Elements ins männerrechtliche Parlamentsgebäude zuzusehen; die einen belustigt, die anderen mit spöttischem oder verächtlichem Lächeln, die dritten mit wohlwollend-feierlicher Miene […]. Wer gerade einen blöden Witz aufschnappte, war innerlich entrüstet – als ob ein bisschen Hohn und Spott nicht alle in Kauf nehmen müssten, die da zu rütteln wagen ‹am Schlaf der Welt›.»11
Am meisten bewegte die konsternierte Helene Stucki, dass sich nichts bewegte, als die Petitionärinnen auf der Tribüne des Nationalratssaals sassen: «Wir sassen und warteten, immer hoffend, es werde sich unten im Saale etwas ereignen, was unser Herz höher schlagen lasse. Aber es geschah nichts.» Den Wortwechsel mit den zurückhaltend liebenswürdigen Herren Nationalrats- und Ständeratspräsidenten fand Stucki höchst langweilig: «Sind uns doch die väterlichen Mahnungen zur Geduld, die Aufforderung zur selbstlosen sozialen Arbeit, die Versicherung, dass man unsere Wünsche ernsthaft prüfen werde, so gar nichts Neues mehr.» Stuckis Hoffnung blieb auch unerfüllt, als ihre Bittschrift und die Motionen im Herbst 1929 in den Räten behandelt wurden. Die Bundesversammlung stellte sich positiv zum Begehren, überwies es aber sang- und klanglos dem Bundesrat: «Die Frauen, die damals die Tribünen besetzten, erlitten eine neue Enttäuschung, sofern sie überhaupt auf diesem Gebiet noch ‹enttäuschungsfähig› waren. Man nahm unsere fast 250000 Unterschriften genau so wichtig oder unwichtig wie irgendein Bittgesuch eines Einzelnen oder einiger weniger.»12
Abb. 7: Eine partnerschaftliche Ehe wird in den 1920er-Jahren als verkehrte Welt dargestellt: «Er, im Küchenschurz, schält tränenden Auges Zwiebeln, während sie zigarettenrauchend das neueste Buch über die ‹Moderne Ehe› liest.» Diese Zeichnung einer Ehe, versicherte die Schweizer Illustrierte Zeitung, sei ein Scherz, ein «Schreckgespenst» eines verknöcherten Junggesellen.
Die Frauen der bestens organisierten Frauenvereine suchten in den 1920er-Jahren unverdrossen, die Männerfront zu knacken: mit Soupers, Tombolas und Scharaden, mit Flugblättern, Umzügen und Dutzenden von Vorträgen, mit Witz, Humor und Lustspiel.13 Immer wieder mussten sie einen neuen Anlauf nehmen, neue Mobilisierungsstrategien und Protestaktionen diskutieren. Niederlage reihte sich an Niederlage – dazwischen hiess es warten und hoffen, dass es dereinst Gründe, Ursachen und einen Anlass geben möchte, der den Frauen eine erfolgreiche Intervention ermöglichen würde, sodass irgendeinmal die Schweizer Männer es als vorteilhafter erachten könnten, den Frauen ihre Rechte zu geben. Unterstützung erhielten sie von einigen Männern, die entweder selbstbewusst genug waren, sich eine unpopuläre Meinung zu leisten oder – selbst im Widerspruch zu der herrschenden Meinung – gerne gegen den Strom schwammen. Unterstützung erhielten sie in den 1920er-Jahren übrigens auch von solidarischen Amerikanerinnen! Die Leslie Woman Suffrage Commission stellte ihnen von 1924 bis 1929 jährlich 2500 Franken zur freien Verfügung. Die armen Frauen im Entwicklungsland Schweiz sollten es zur Propagierung ihrer Stimmrechtsanliegen verwenden.14
Konspiratives Frauentreffen, redende Stumme und die bundesrätliche mittlere Schublade rechts
Im Frühling 1933 mussten sich die Schweizer Frauenbewegten mit dem erblühenden Frontenfrühling auseinanderzusetzen. Die Goldenen Zwanzigerjahre hatten in der Weltwirtschaftskrise geendet, die Schockwellen des Börsenkrachs vom 25. Oktober 1929 – dem Schwarzen Freitag – hatten sich weltweit ausgebreitet. Arbeitslosigkeit, Deflation und soziales Elend liessen gewaltbereite Demagogen hochkommen. In Italien regierten Benito Mussolinis Faschisten und in Deutschland hatten die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 mit Reichskanzler Adolf Hitler die Macht übernommen. Auch in der Schweiz keimten nationalistische Erneuerungsbewegungen auf. Obwohl die Schweizer Frauen weder in den Staat, noch in die Armee noch in die Hochfinanz eingebettet waren und schon gar nicht zum Politestablishment, zur militärischen oder wirtschaftlichen Führungselite gehörten, hatten sie früh Gefahr gewittert. Möglich, dass ihnen die Verbindungen ihrer Brüder, Ehemänner und Väter nützliche Informationen verschafft hatten. Am 18. Juni 1933, nachmittags um 14.15 Uhr, traf sich eine zufällig zusammengewürfelte Schar verantwortungsbewusster Frauen in der Zürcher Frauenzentrale bei der Fürsorgerin Maria Fierz am Schanzengraben 29. Am konspirativen Treffen hinter verschlossenen Türen nahmen auch aus Bern drei engagierte Frauenrechtlerinnen teil: die Historikerin Dr. Ida Somazzi, eine Freundin von Gostelis Tante Marie Salzmann, dann die Mathematikerin Dr. Annie Leuch sowie Gostelis damalige Lehrerin, die wirblige Psychologin Dr. Louise Grütter. Die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit IFFF war durch die Friedensaktivistin Clara Ragaz vertreten. Sie wurden «in dieser für unser Land ernsten Stunde» zusammengerufen, um sich angesichts der neuen Bewegungen auszusprechen und eine gemeinsame Strategie auszuhecken. Es sollte vermieden werden, dass Frauen, enttäuscht über ihren politischen Ausschluss aus dem Männerstaat und darbend in der Wirtschaftskrise, den Verlockungen der Erneuerer verfielen. Man wollte nicht aus Trotz und Ärger über den Männerstaat kopflos und unverantwortlich verführerischen Slogans nachrennen. Mochte auch das Neue vordergründig ganz erfreulich tönen, sodass man es gar mitzutragen geneigt sei, so sähe man hintergründig doch «Gefahrmomente», diagnostizierten die Konspirativen.
Abb. 8: Die 1930er-Jahre waren politisch bedrohlich und wirtschaftlich angespannt. Beklommen blickt diese wohl alleinstehende Frau am 15. März 1933 bei der persönlichen Abgabe der Steuererklärung im «Erlacherhof» auf die Formulare. Welches Loch werden ihr die Steuern ins Haushaltsbudget reissen?
Die Bedeutung dieser Zusammenkunft und ihre Richtungsgebung kann nicht gross genug eingeschätzt werden. Wie darzustellen sein wird, versuchten Jahrzehnte später die Schweizer Frauen bei der Zivilschutzeinbindung und der Menschenrechtskonvention die schweizerische Männerwelt auszuhebeln, indem sie ihr die «erpresserische» Losung entgegenhielten: Entweder ihr gebt uns das Frauenstimm- und -wahlrecht oder wir machen nicht mehr mit. Diese Verweigerungshaltung brachten sie weder im Ersten Weltkrieg noch in den bedrohlichen 1930er-Jahren auf: Es nützte nichts, in faschistischen oder nationalsozialistischen Diktaturen den Männern gleichgestellt zu sein, wenn dies eine Gleichstellung in der vollständigen Entrechtung bedeutet hätte. Louise Grütter drückte dies unmissverständlich aus: «Wenn wir auch hier [in der Schweiz] trotz des Fehlens des Frauenstimmrechts uns haben entfalten können, so war dies nur der Demokratie und dem Liberalismus zu verdanken.» Das verschworene Grüppchen gab sich Rechenschaft darüber, dass «die Rechte der Schwächeren, also auch die Rechte der Frauen», nur in einer demokratischen Staatsform und einem Wohlfahrtsstaat gedeihen könnten. Sicherheit und Selbstständigkeit seien nicht möglich «bei Hitler, nicht bei Mussolini und auch nicht bei Sonderegger». Sie misstrauten Führern wie Emil Sonderegger und Georges Oltramare und deren «Hasspredigt gegen Juden und Freimaurer und gegen die Sozialdemokratie». Nach dreieinhalb Stunden gingen die Frauen mit dem Vorsatz auseinander, Leitsätze zum Thema Frau und Demokratie zu formulieren.15
Schon auf den Nationalfeiertag 1933 hin machten sich die Verschworenen öffentlich bemerkbar. Frauenvereinigungen vom Katholischen Frauenbund bis zur Zentralen Frauen-Agitationskommission der Sozialdemokratischen Partei erliessen zum 1. August 1933 einen Appell an die Schweizer Frauen, um sie zum «Kampfe für die Demokratie» und zur nationalen Einheit aller Sprachen, Konfessionen und Rassen aufzufordern. «Die Stummen reden», wunderten sich die (männlichen) Zeitgenossen. Es war bis dahin undenkbar gewesen, dass eine so breit abgestützte, grenzüberschreitende Frauengemeinschaft das Wort laut und öffentlich an sich gerissen und ungefragt in politischer Sache interveniert hätte. Auch auf lokaler Ebene wurde gegen die Gefährdung der Demokratie agiert. Der Bernische Frauenbund etwa organisierte am 25. Februar 1934 eine Tagung mit Vorträgen des Historikers Prof. Werner Näf und der Schriftstellerin Maria Waser.16
Abb. 9: Auch der Bernische Frauenbund machte sich Sorgen um die Demokratie. Am Sonntag, 25. Februar 1934, referierten dazu im Grossratssaal Bern der Historiker Werner Näf und die Schriftstellerin Maria Waser. Am Pult steht die Präsidentin Rosa Neuenschwander.
Die organisierten Schweizer Frauen versuchten darzustellen, dass Hand in Hand mit den Erfordernissen der Demokratie, der Unabhängigkeit und der Landesverteidigung die Frauenrechte einhergehen müssten.17 Doch die Stimmrechtsfrage rückte im Strudel bedrohlicher Tagesfragen und dringenderer Probleme in den Hintergrund. Und als der zuständige Thurgauer FdP-Bundesrat Heinrich Häberlin am 12. März 1934 zurücktrat, soll er das unerledigte Geschäft betreffend politischer Frauenrechte seinem Nachfolger mit dem Hinweis übergeben haben: «Das Material für das Frauenstimmrecht liegt im übrigen […] in der mittleren Schublade rechts Deines Schreibtisches.»18 Die Schubladisierung ist aus Frauensicht empörend, aus Männersicht war sie eine notwendige Massnahme, um bei der herrschenden Stimmung unter dem Stimmrechtsvolk keine Niederlage einfahren zu müssen.
Gab es in der Schweiz ähnlich langwierig verzögerte Geschäfte wie das Frauenstimm- und -wahlrecht? Es gab. Zum Beispiel wurde das erste schweizerische Strafgesetzbuch, das die Abschaffung der Todesstrafe brachte, 20 Jahre nach Erscheinen der bundesrätlichen Botschaft und 40 Jahre nach Annahme des Verfassungsartikels vom männlichen Volk 1938 angenommen.19 Geduld ist das Merkmal der schweizerischen Demokratie.20
Mit Frau und Demokratie gegen Nationalsozialismus und Frontenfrühling
Im Oktober 1934 wurde die Arbeitsgemeinschaft Frau und Demokratie formal gegründet. Erste Präsidentin war die auch im Völkerbund engagierte Ida Somazzi. Trotz Spannungen zwischen linken Friedensaktivistinnen und gemeinnützigen Frauen, die sich mit der Wehranleihe beschäftigten, gelang es, eine breite Frauenallianz zu mobilisieren. Auch die sozialdemokratischen Frauen zogen am gleichen Strick. Schon 1931 hatte das Heft Frauenrecht vor dem Faschismus und dem Pestherd Deutschland gewarnt. Mit Anna Siemsen übernahm 1934 eine aus Nazideutschland geflüchtete Frau die Redaktion von Die Frau in Leben und Arbeit, die sich keine Illusionen machte.
Nachdem die rechtsradikale «nationale Tatgemeinschaft» ihr Volksbegehren zu einer Totalrevision der Bundesverfassung in ihrem Sinne lanciert hatte und dieses am 8. September 1935 zur Volksabstimmung gelangen sollte, war die Allianz Frau und Demokratie eine treibende Kraft im Kampf dagegen. Die «Hausmütter» des Schweizer Volkes warnten im Vorfeld der Abstimmung mit Vorträgen und Kursen vor dem drohenden Verlust einer Demokratie, die sie, obwohl ausgeschlossen, unterstützten. Höhepunkt ihrer Kampagne war der dezentral organisierte und breit abgestützte «Tag der Schweizerfrauen» am 1. September 1935, der erfolgreich in Lausanne, Basel, Zürich und Bern durchgeführt wurde.21 Die Rednerinnen waren sorgfältig ausgewählt, um die ganze Breite der Frauengemeinschaft zu demonstrieren: Unter anderen sprach in Lausanne Anne de Montet, Präsidentin des Bundes Schweizerischer Frauenvereine, in Basel die Mitbegründerin von Frau und Demokratie, Emmi Bloch, in Zürich die Bäuerinnenführerin Anna Munz-Altwegg und im Berner Münster Hanna Bichsel als Vertreterin der sozialdemokratischen Frauenbewegung. Die Männer waren schliesslich bei dieser Abstimmung gleicher Meinung wie diese Frauen und schmetterten an der Urne das ständestaatliche Begehren für eine Totalrevision der Schweizer Bundesverfassung mit über 72 Prozent ab.22 Auch in Zukunft sollte die Gruppe Frau und Demokratie noch für Aufmerksamkeit sorgen, etwa als der Anschluss Österreichs an Deutschland am 12. März 1938 den Schweizerinnen «bis ins Tiefinnerste einen Ruck» gab und sie erneut mit einer «Kundgebung der Schweizerfrauen» für Demokratie und Unabhängigkeit an die Öffentlichkeit traten.23
Wohl als Folge ihres beherzten öffentlichen Auftretens wurden Frauen nun wert befunden, im Männerstaat 1.-August-Reden zu halten. Rosa Neuenschwander machte sich 1935 im Schweizer Radio Gedanken zum Nationalfeiertag und hielt als erste Frau 1941 vor dem Münsterportal die Bundesfeieransprache. Neuenschwander, lange Jahre Präsidentin des Bernischen Frauenbundes, setzte in ihrer Rede Religion und Nächstenliebe anstelle von Materialismus und Egoismus. Rosa Neuenschwander war für die Frauen eine Lichtgestalt, da sie für das Berufsleben junger Frauen einiges bewirkt hatte. Und bei den Männern punktete sie mit ihrer «fraulichen» Tätigkeit im sozialen Bereich. Als sie bzw. der Bernische Frauenbund 1939 das Pestalozziheim Bolligen errichtete, das noch heute als «agilas» Jugendliche mit besonderem Förderbedarf in die Berufswelt integriert, vermittelte Marthe Gostelis Vater Land, das ihm gehörte.24 Sie war eine patente Frau, die selbst an wärmsten Tagen «ihren Mann» stellte: «Frl. Neuenschwander […] hielt trotz der Hitze durch, während Offiziere in Ohnmacht sanken,» wurde ihre Standhaftigkeit protokolliert.25
Gefangen zwischen Hitler und Mussolini: die Landesausstellung 1939
In Zürich öffnete vom 6. Mai bis 29. Oktober 1939 die Landesausstellung ihre Tore. «Landidörfli», Schifflibach und Schwebegondeln begeisterten die Bevölkerung. Über 10,5 Millionen Frauen, Männer und Kinder besuchten die «Landi», was bedeutet, dass jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Schweiz durchschnittlich zweieinhalbmal an der Ausstellung war. Auch Familie Gosteli genoss die Schau.
Abb. 10: Mutter Hanni, Vater Ernst, Johanna und Marthe wurden mit Hüten und sonntäglich gekleidet für ein Erinnerungsfoto an der «Landi» 1939 abgelichtet. Marthes Schwester Johanna arbeitete damals im «Landi»-Pavillon «Soll und Haben» und lebte für ein paar Monate in Zürich.
Die Schweizer Landesausstellung stand vornehmlich unter dem Eindruck äusserer Bedrohung, insbesondere als nach dem Überfall der Deutschen auf Polen am 1. September 1939 die erste schweizerische Generalmobilmachung ausgerufen wurde. Die Schweiz war nicht frei, weder in ihren politischen noch wirtschaftlichen noch wohltätigen Handlungen. Oder wie Marie Boehlen es formulierte: «Wir standen mitten im Weltkrieg, der uns auf allen Seiten umbrandete, gleichsam die Gefangenen Hitlers und Mussolinis.»26
Im Nachhinein wurde der «Landi», wie sie liebevoll genannt wurde, etwas gar viel Schönfärberei, ein etwas zu kurzer Blick auf die weniger Privilegierten vorgeworfen.27 Die Schweizer Frauen warben in ihrem «Landi»-Pavillon, einem filigranen, auf Stelzen stehenden Achteckbau aus Holz, für ihre Anliegen. Die Schweizerinnen zeigten nicht nur ihre Nützlichkeit für Volkswirtschaft und Landesverteidigung, sondern stellten auch die politische Ungleichbehandlung, ihre Diskriminierung dar. Und dies, wie sich Marthe Gosteli schmunzelnd erinnert, auf lustige Weise: «Da waren zwei Häuschen aufgestellt – das Steueramt und das Stimmlokal. Kleine Frauenfiguren kreisten auf einer Rundbahn herum. Jedes Mal, wenn eine Frau beim Stimmlokal ankam, schlug die Tür mit energischem Ruck zu. Beim Steueramt aber öffneten sich die Tore weit, die Frauen durften hineinspazieren und drinnen ihr Scherflein abladen.» Auch ein riesiger Kasten war aufgestellt, von einem Bundesweibel bewacht, in dem alle im Laufe des Jahrhunderts eingereichten Frauenpetitionen in tiefem Schlaf ruhten. Die Anspielungen fruchteten nicht, das politische Leben stagnierte während des Kriegs.
Den Dank – nicht aber das Mitregieren im Vaterland verdient
Im Zweiten Weltkrieg leisteten die Schweizerinnen Grosses: Sie übernahmen die Männerarbeiten und haushalteten unter schwierigen Bedingungen, sie arbeiteten in der Flüchtlingshilfe und in den 650 Soldatenstuben, im Frauenhilfsdienst FHD und im Eidgenössischen Kriegsernährungsamt. Wenn Marthe Gosteli davon erzählt, so schildert sie erst den hochfliegenden Stolz der Schweizerinnen, mitmachen zu dürfen und geschätzt zu werden, um dann die bodenlose Enttäuschung anzudeuten, wie man die Frauen danach abschob.
Abb. 11: Sie sind kaum auseinanderzuhalten: die Soldatenmänner und die Hilfsdienstfrauen, die mit Helm Mitte April 1945 am Muristalden zusammenstehen.
Für die Schweizer Frauen war es damals alles andere als selbstverständlich, dass der Bundesrat sie zu Beginn des Zweiten Weltkriegs zum freiwilligen militärischen Hilfsdienst FHD aufforderte, dem übrigens Gostelis Verwandte, Elisabeth Du Bois-Trauffer, als erste Chefin vorstand. Sie waren stolz, dass General Henri Guisan-Doelker zusammen mit Gertrud Hämmerli-Schindler, Präsidentin des zivilen Frauenhilfsdienstes, die FHD-Reihen abschritt. Die Schweizerinnen konnten sich aber, im Gegensatz zu den heroischen finnischen Soldatinnen – den «Lottas» – oder zu den britischen WRNS – den kriegsrelevanten Entschlüsslerinnen feindlicher Codes –, nicht bewähren. Zum einen kam es glücklicherweise in der Schweiz nicht zum oft befürchteten Einmarsch Hitler-Deutschlands. Zum anderen wurden die Schweizerinnen von der eidgenössischen Männerarmee auf Distanz gehalten. Mochten sich Schweizerinnen in früheren Jahrhunderten ohne institutionelle Sicherungen in bewaffnete Kämpfe eingemischt haben und in kriegerischen Auseinandersetzungen getötet worden sein, so sah dies im 20. Jahrhundert anders aus. Die Frauen des FHD erhielten erst keine Uniformen, sondern gingen mit einer Armbinde und «mit der Schürze in die Landesverteidigung», kurz: Der Frauendienst wurde nur halbherzig in die Armee eingegliedert. 1941 kam es gar zu einem Eklat, wie Marthe Gosteli weiss: «Die verdienten Frauen, die den FHD mit aufgebaut hatten, wurden 1941 von den Militärmännern kurzerhand entmachtet.»28 Die Männer verwahrten sich dagegen, dass Frauen in ihre Armee eindrangen und auch eine Mehrheit der Frauen war wohl froh, «nicht in die Uniform kämpfender Soldaten gesteckt» zu werden.29
Abb. 12: Gertrud Hämmerli-Schindler, Mitglied der Eidgenössischen FHD-Kommission und Präsidentin des Schweizerischen Zivilen Frauenhilfsdienstes, marschiert erhobenen Hauptes und an der Seite von General Henri Guisan-Doelker durch die FHD-Reihen.
Ähnlich verlief der Einsatz der Frauen in der Kriegswirtschaft. Dem für sie wichtigsten Gremium, dem Kriegsernährungsamt, waren die grossen Frauenverbände konsultativ angegliedert. So berieten der Bund Schweizerischer Frauenvereine BSF, der Schweizerische Verband Volksdienst SV und der Schweizerische Frauenstimmrechtsverband SFV, gemeinnützige, katholische und sozialdemokratische Frauen, Landfrauen und Hausfrauen, Konsumentinnen und Lehrerinnen angesichts der Rationierungen und knappen Versorgungslage Politiker und Hausfrauen in Ernährungs- und Beschaffungsfragen. Else Züblin-Spiller, Mitbegründerin des FHD 1938, war Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Kriegsernährung.
Die «Generalin» Züblin-Spiller war denn auch für diesen Posten wie keine andere Person befähigt. Sie hatte sich Ende des Ersten Weltkriegs 200 Schweizer Industriellen auf ihrer Reise nach Amerika angeschlossen und in der Detroiter Autofabrik des Henry Ford die vom Hörensagen bekannten Fliessbänder bestaunt. Während sich die geschockten Unternehmer genötigt sahen, auch ihre Schweizer Fabriken umzurüsten, um konkurrenzfähig zu bleiben, hatte Spiller ihr Augenmerk auf die Bewirtschaftung der Arbeiterschaft bzw. der «human resources» gerichtet.30 Sie hatte gesehen, wie die Amerikaner ihre Arbeiterinnen in Kantinen verköstigten und den Nachwuchs in Horten betreuten. Was sie selbst im Krieg bei der Führung der Soldatenstuben gelernt hatte, setzte sie tatkräftig zugunsten der Industrieangestellten und Fabrikarbeiterinnen um. Sie richtete bereits 1918 alkoholfreie Kantinen ein, entwickelte Reglemente zu deren Führung und kämpfte für eine Kostenbeteiligung durch die Arbeitgeber. Daraus wuchs 1920 der Schweizer Verband Volksdienst.
Abb. 13: In den USA lernte Frl. Spiller nicht nur Fliessbänder und Fabrikhorte kennen, sondern auch ihren Ehemann Prof. Dr. med. Ernst Züblin. In die Schweiz zurückgekehrt, gab er Else Spiller «den Schutz seiner Liebe und seines Namens». Das Paar verlobte sich im Oktober 1920 (Bild) und heiratete im folgenden Dezember in Kilchberg. Die Ehe blieb kinderlos, Züblin-Spiller zog nach dem frühen Tod ihrer Schwägerin die vier Kinder ihres Bruders gross.
Als Else Züblin-Spiller aber nach dem Krieg zusammen mit Jeanne Eder-Schwyzer im Namen des Dritten Frauenkongresses und des Konsultativen Frauenkomitees dem Bundesrat das höfliche Gesuch stellte, man möchte das Frauenkomitee auch weiterhin bestehen lassen, «um in mancherlei Problemen zur Verfügung der verschiedenen Bundesämter stehen zu können», winkte der Bundesrat ab. Der Brief vom 30. August 1947, von Bundesrat Walther Stampfli, FdP Solothurn, an Züblin gerichtet, troff erst vor Schmeicheleien. «Wir wissen doch, welch wertvolle Kräfte schon immer sich gerade unter unseren Schweizerbürgerinnen befanden, und was unser Land überhaupt der Frau zu verdanken hat.» Der Wirtschaftsminister sprach von geschätzten einsichtigen und weitsichtigen Frauen, auf deren Rat und Stimme man seit jeher gehört habe. Dann erlaubte er sich die Bemerkung, dass ein konsultatives Frauenkomitee, selbst wenn es «die besten und führenden Köpfe der schweizerischen Frauen» in sich vereinige, «unmöglich in allen Spezialfragen, mit denen sich die Bundesverwaltung zu befassen hat, gleich beschlagen sein könne». Man wolle von Fall zu Fall Zusammenkünfte einberufen. Bundesrat Stampfli verwies auf die ständigen Kommissionen, in denen Frauen mitwirken dürften, falls die Themen «Fraueninteressen berührten».31 Das hiess nichts anderes, als dass die Frauen aus dem Konsultativauftrag katapultiert wurden wie sie auch aus der Armee geworfen wurden.
Die Schweizer Milizsoldaten, endlich vom Aktivdienst an der Grenze befreit, wollten zurück in ihre alten beruflichen und hierarchischen Stellungen. Sie kamen glücklicherweise (fast) alle körperlich heil zurück. Auch wenn die Unabhängigkeit des Landes nicht einfach dem heroischen Einsatz der Soldaten an der Grenze geschuldet ist, wie ihnen dies selbst von Historikern noch eingeredet wurde, war das Bild des Soldaten doch nicht, wie anderswo, durch Niederlagen und Verbrechen erschüttert.32
Im Ausland erschütterten Aderlasse und Armut grundlegend die Arbeits- und Politwelt. Hier waren die Frauen genötigt, ins selbstständige Erwerbsleben ausserhalb des Haushalts einzutreten, was als Voraussetzung gilt, dass das Frauenstimmrecht Fuss fassen kann.33 Da in der Eidgenossenschaft keine Lücken und Defizite entstanden waren, wurde eine gesellschaftliche Neugestaltung nicht zwingend notwendig. Die Schweizerinnen mussten sich nicht in den allgemeinen Arbeitsprozess einbinden. Zum einen gab es keine Arbeitsplatzlücken dringend auszufüllen, zum anderen reichten die Löhne der arbeitenden Männer mehrheitlich für eine ganze Familie. Oder theoretisch gesagt: Die jedem Geschlecht zugeschriebenen Fähigkeiten und Tätigkeitsbereiche blieben in der Schweiz bis weit ins 20. Jahrhundert bestimmend.34 Die schweizerische Frauenmehrheit liess sich aufatmend und dankbar in die Vorkriegszeit zurückfallen. In diesem rückwärtsblickenden politischen Klima musste manche Stimmrechtlerin seufzend konstatieren: «D’Froue sälber si der bösischt Hemmschue für üsi Bewegig.»35
Der Dritte Schweizerische Kongress für Fraueninteressen stand 1946 unter dem Eindruck: «Wir sind noch einmal davongekommen.» Müde von Kriegsangst und -arbeiten klammerten sich alle ans Altbewährte. Neues begehrte man nicht, es hatte Unheil gebracht. Innovationen gab es kaum angesichts des kriegsversehrten ausländischen Umfelds und der – im heutigen Vergleich – Armseligkeit der wirtschaftlichen und kulturellen Ressourcen. Die Erstarrung des Kalten Kriegs legte sich über die westliche Welt.
Zwar hatten sich die Frauen, wie General und Bundesrat schrieben, den Dank des Vaterlandes verdient, doch in politische Rechte liess er sich nicht ummünzen. Besser erging es den linken Männern. Sie konnten ihre Wahlerfolge im Dezember 1943 umsetzen, als die Bundesversammlung das Konkordanzregime öffnete und mit Ernst Nobs erstmals einen Sozialdemokraten in die Landesregierung wählte.36 Die legendäre Zauberformel sollte dann 1959 eingeführt werden.
Verachtete Stimmrechtlerinnen und Ledige, das rührige Berner «Aktionskomitee für die Mitarbeit der Frau in der Gemeinde» und die Berner Petition von 1945
Im Zweiten Weltkrieg hatten sich die organisierten Schweizer Frauen dem Dienst am Vaterland nicht verweigert, um sich nicht ins eigene Fleisch zu schneiden und keine Diktaturen zu unterstützen. Noch vor Kriegsende aber rüsteten sich die Bernerinnen wie viele andere Schweizerinnen erneut zum Kampf, um nebst vaterländischen Pflichten und Lasten doch noch zu einigen politischen Rechten zu kommen. Treibende Kraft war die Bergbauerntochter und Fürsprecherin Marie Boehlen gewesen, die sehr gerne und mit vollem Einsatz politisch arbeitete und später gestand: «Wenn ich damals – als ich beruflich auf unbefriedigten Stellen sass – nicht hätte politisch in Kommissionen arbeiten können, wäre ich ganz depressiv geworden.» Boehlen sollte 1945 in die SP eintreten. Damals arbeiteten linke und bürgerliche Frauen zusammen und demonstrierten etwa im März 1943 gemeinsam für das «Recht auf Arbeit».37
Marie Boehlen und ihre Mitstreiterinnen setzten 1941 auf friedliche Zusammenarbeit, vermieden absichtlich alles Provozierende und wichen selbst dem Wort «Stimmrecht» peinlichst genau aus. Aus heutiger Sicht ist es schwer vorstellbar, mit welch negativem Beigeschmack dieses Wort behaftet war. Der Name Frauenstimmrechtsverein war ein rotes Tuch, eine Emanze verhasst, ihre Anliegen ernteten beissenden Spott. Marthe Gosteli gesteht: «Es tat mir weh, wenn man mich sogar im lieben Bekanntenkreis als Frauenstimmrechtlerin belächelte, als Suffragette beschimpfte.» Andere Zeitgenossinnen wussten weitere unglaubliche Müsterchen zu erzählen. «Früher war ich vielen Leuten ein Ärgernis, weil ich für das Frauenstimmrecht kämpfte, und die wollten nichts mit mir zu tun haben», hielt Marie Boehlen fest. Ein Mann habe ihr beispielsweise einmal ins Gesicht gesagt: «Was, Sie sind für das Frauenstimmrecht! Und ich habe gedacht, Sie sind eine normale Frau!» Auch Margrit Liniger-Imfeld, die Luzerner Frauenrechtlerin, erzählte von anonymen Drohungen: Stimmrechtlerinnen wurden als «schlechte Mütter und als Frauen ohne Charme» abgestempelt. Frieda Amstutz-Kunz erinnerte, dass «es noch Mut und Überzeugungstreue kostete, ‹dafür› zu sein». Es soll vorgekommen sein, dass man Zeitungen Inserate entzog, wenn sie Artikel zugunsten des Frauenstimmrechts publizierten.
Noch schwieriger wurde es, wenn die Frauen ihrer «natürlichen» Aufgabe nicht nachkamen oder nachkommen konnten. «Die Frauenstimmrechtlerinnen waren keine richtigen Frauen, besonders, wenn sie ledig waren», meinte Marie Boehlen, die wie Marthe Gosteli, Mascha Oettli und etliche andere Frauenbewegte unverheiratet blieb: «Man zweifelte an meinem ‹Frausein›. So fand ich mich doppelt im Abseits.» Gertrud Heinzelmann klagte: «Ich bin eine alleinstehende Frau, die man an die Wand drückt. Ich gehöre zu dieser Quantité négligeable, die man übergeht.» «Die Diskriminierung des allein stehenden Menschen – vor allem der Frauen – ist immer noch spürbar», weiss Gosteli und zitiert Gotthelfs launige Worte: «Es ist ganz recht, wenn man sie [die ledigen Frauen] mit Gänsen vergleicht, sie werden nämlich gerupft wie diese, nur mit dem Unterschied, dass es das ganze Jahr geschieht, während eine Gans nur ein- bis zweimal gerupft wird.» Bei der Berufsarbeit gab es einen zweifachen Doublebind: Ledige Frauen wurden nicht ernst genommen, da sie keinen Mann gekriegt hatten, waren sie aber stolze Mütter, hatten sie angeblich zu Hause genug zu tun, um nicht noch auswärts arbeiten oder gar Karriere machen zu können. Die ledigen Frauen hatten an ungleich tieferen Löhnen gegenüber ihren männlichen Kollegen zu leiden und wurden neben höheren Steuern auch in der Sozialversicherung stärker belastet.
Bei der schmalen Börse war es schwierig, passende Wohngelegenheiten zu finden, vornehmlich auch im Alter.38 Deshalb entstanden viele Jahre, bevor die Frauen ihre männerfreien Orte im öffentlichen Raum in politischen Aktionen reklamierten, das Schweizerische Lehrerinnenheim im Berner Egghölzli oder Institutionen wie die «Pergola» und das Restaurant Daheim, wo die Frauen unter sich waren und auch gerne ihre Sitzungen abhielten.39
Die Abneigung gegenüber dem Wort Stimmrecht bewog also die Bernerinnen, 1941 auf Anregung von Gerda Stocker-Meyer ihre Frauenrechte unter anderer Flagge einzufordern. Sie schufen ein Komitee für die Mitarbeit der Frau in der Gemeinde, das zum einen Werbung und Schulung betreiben sollte, zum anderen mit einer Eingabe beim Grossrat intervenierte. «Das Aktionskomitee», erklärt Marthe Gosteli, «hat diesen Namen gewählt, um den Eindruck zu vermeiden, dass Frauen bloss auf Rechte pochten. Wer aber sollte schon dagegen sein, wenn Frauen im Dorf mitarbeiteten, etwas Soziales leisteten? Man wollte auf die Mitarbeit der Frauen hinweisen, die gerade in den Kriegsjahren enorm gross war, und die partnerschaftliche Arbeit in allen, also auch in politischen Belangen betonen. Zudem suchte das Komitee im regionalen Zusammenschluss den Stadt-Land-Kontakt.» In ländlichen Gegenden mussten selbst Frauen sachte an die Idee der Gleichberechtigung herangeführt werden: «Wir konnten den Bäuerinnen nicht sagen, dass wir vom Frauenstimmrechtsverein kamen. Also sagte man: Es geht um die Mitarbeit der Frauen in den Gemeinden.»40
Es fanden sich in Bern auch zwei Grossräte, die im Sinne des Komitees eine Motion zugunsten des Frauenstimmrechts einbrachten. Diese wurde aber von der kantonalen Legislative im Februar 1943 abgeschmettert. Adrienne Gonzenbach, die bei der Grossratsdebatte auf der Tribüne sass, staunte darüber, was alles gegen das Frauenstimmrecht ausgesagt wurde. Die Front der Bauern erhob sich wie eine Mauer für ein Nein. «Die Bauern», klagt Marthe Gosteli, «waren ein Problem.» Da konnte noch lange alt Regierungsrat Hugo Dürrenmatt, BGB Bern-Land, an der Spitze des Ehrenkomitees stehen und signalisieren, dass nicht nur linke Städter für das Frauenstimmrecht sein durften.41 Und auch eine welsche Bäuerin wie Augusta Gillabert-Randin, die in der Stimmrechtsfrage eine eigene Meinung vertrat und der Marthe Gosteli ein Buch widmete, stand hier auf einsamem Posten.42
Abb. 14: Nur Zuschauerinnen im «Frauengetto»! Louise Grütter (hintere Reihe, links der Säule) und Adrienne Gonzenbach-Schümperli (mittlere Reihe, links der Säule, sich vorbeugend) während der Nationalratsdiskussion im Dezember 1946. In dieser Wintersession gab es zwei Vorlagen, welche die Frauen direkt betrafen. Im Geschäft «Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit» ging es am 16. Dezember 1946 um den besonderen Schutz der Frauen in der Arbeitswelt, am darauffolgenden Tag beim Bundesgesetz zur Alters- und Hinterlassenenversicherung unter anderem um die Renten der Ehefrauen.
Nach der Niederlage im Berner Grossen Rat versuchten die Aktivistinnen etwas Grösseres zu unternehmen und lancierten in Erinnerung an die erfolgreiche schweizerische Petition von 1929 eine mobilisierende Berner Petition für ein fakultatives Gemeindestimmrecht. Diese Bittschrift sollte denjenigen den Mund stopfen, die immer wieder behaupteten, die Frauen selbst wünschten gar keine zusätzlichen Rechte.
Bevor mit dem eigentlichen Sammeln begonnen werden konnte, musste nicht nur Geld, sondern auch Heizmaterial gewonnen werden. «Da es Krieg und Winter war, und die Kohlen rationiert, bettelten wir Heizmaterial zusammen, das von unsern Mitgliedern denn auch gespendet wurde.» Adrienne Gonzenbach erinnerte sich, wie sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn «auf einem Leiterwagen das Heizmaterial einsammelte und hinunter ins Marzili, durch die Matte und den Altenberg zog». Das Hauptquartier war nämlich in der Wohnung von Marie Boehlen im Altenberg eingerichtet und hier amtete die «tüchtige und gewissenhafte, liebenswürdige Hausfrau Marietta Keller» als Sekretärin. Petitionsbogen wurden nach allen Richtungen verschickt, weit in die Landschaft hinaus wurden die Fühler gesteckt, um Unterschriftensammlerinnen zu gewinnen und diese arbeiteten «wie emsige Bienen».43
Flankierend zur Sammlung wurden im ganzen Kanton Kundgebungen und Vorträge organisiert, denn es war das erklärte Ziel, mit der Kampagne Öffentlichkeit herzustellen, aus dem Zirkel der bereits Überzeugten herauszutreten. Erfahrene Frauen und bekannte Männer propagierten die Petition.
Wie aufregend und anspannend die Kampagne für die öffentlichkeitsungewohnten Frauen sein konnte, erzählte Marie Boehlen. Sie leitete zitternd vor Angst und Spannung vom Sitz des Grossratspräsidenten aus eine der Kundgebungen und litt auch bei ihren vielen Vorträgen, die sie öfters in entfernte Gemeinden hinausführten. Zum einen war es ein beklemmendes Gefühl, wenn nach ihren feurigen Worten eisige Stille im Saal herrschte, zum anderen war es sehr anstrengend, nach Mitternacht nach Hause zu kommen und morgens in aller Frühe wieder zur Arbeit zu erscheinen.
Die Petition scharte schliesslich 40 bernische Frauenvereine und beinahe alle Parteien hinter sich. Und wieder gab es, diesmal auf kantonaler Ebene, ein Rekordergebnis. Das Aktionskomitee für die Mitarbeit der Frau in der Gemeinde konnte 1945 eine von 38000 Frauen und 12000 Männern unterzeichnete Petition einreichen, sie stellte, wie Marthe Gosteli bewundernd beifügt, «die grösste je auf bernischem Kantonsgebiet zustande gekommene Willensäusserung dar». Das Resultat bedeutete, dass 15 Prozent der erwachsenen Frauen und 5 Prozent der Männer die Petition unterschrieben hatten.44
Zweihundert Bernerinnen trugen die Petition am 16. Mai 1945 in einem Marsch – damals Umzug genannt – durch Bern und hinterlegten sie im Rathaus. Doch auch dieser Vorstoss der Berner Stimmrechtlerinnen versandete im politischen Niemandsland. In Zürich sah es ähnlich düster aus. Als die Zürcherinnen 1947 ihr kantonales Frauenstimmrecht propagierten, war ihr Plakatslogan zwar ebenfalls «Zämme schaffe – zämme stimme», ihr Aktionskomitee aus der Grossstadt hingegen warb unverhüllt – aber ebenso erfolglos – «für das Frauenstimmrecht im Kanton Zürich».45
Abb. 15: Zweihundert Frauen aus Berner Gemeinden ziehen am 16. Mai 1945 in einem Umzug durch Bern zum Rathaus, um dort ihre Petition zu hinterlegen. Die Bittschrift mit den 49967 Unterschriften verlangte die Ermächtigung der Gemeinden, das Frauenstimm- und -wahlrecht einführen zu dürfen. Es war die grösste je auf bernischem Kantonsgebiet zustandegekommene Willensäusserung.
Auch auf Bundesebene bewegte sich nichts. Eine Motion von Gewerkschaftsseite hatte zwar 1944 im Nationalrat zu prüfen verlangt, ob nicht verfassungsrechtlich das Frauenstimm- und -wahlrecht zu gewährleisten sei. Immerhin ständen frauenrelevante Geschäfte an: die AHV und der Familienschutz mit einer Mutterschaftsversicherung.46 Darauf bauend, forderte der Frauen-Dachverband, der Bund Schweizer Frauenvereine, am 6. Februar 1945 im Namen von 38 Frauenverbänden, in der Frauenstimmrechtsfrage vorwärtszumachen. Der Nationalrat überwies das Begehren am 12. Dezember 1945 grossmehrheitlich. Allerdings zweifelten die Befürworter, die Linke und die LdU, an der Entschiedenheit und Lauterkeit ihrer Kollegen. Gottlieb Duttweiler meinte, ihm falle auf, dass stets, wenn vom Frauenstimmrecht die Rede sei, ein die Frauen verletzendes Schmunzeln über die männlichen Gesichter husche: «Es ist irgendwie etwas Schlimmes hinter dieser Heiterkeit», erklärte der Migros- und LdU-Gründer. Er sprach an, was in gedruckten Quellen nie festgemacht werden kann: eine nonverbale abfällige und höhnende Geringschätzung, ein verstecktes Mobbing, ein Gebärdenpsychoterror, vielleicht verletzender als laute Schmähungen. Der Vorstoss blieb denn auch irgendwo stecken.
Die Verfassungsfeier von 1948, ein Volk ohne Schwestern und der schwarze Fleck auf der Europakarte
Am 2. Mai 1948 wurden in der Schweiz 100 Jahre Bundesverfassung gefeiert. Das «Volk von Brüdern» war stolz auf die Schweiz, die gelungene Einheit nach überstandenem Sonderbundskrieg, die demokratische Verfassung von 1848 und das glimpfliche Überleben der «neutralen und bewaffneten Schweiz» in den beiden Weltkriegen. Während die Männer ein ziemlich ungebrochenes Bild von ihrer Schweiz hatten, sahen die in Vereinen organisierten Frauen den politischen Riss als «Volk von Brüdern ohne Schwestern». Sie fragten, was das für eine Demokratie sei, die über die Hälfte der Menschen ausschliesse, und sie forderten: «Frauen, wehrt euch gegen unsere Halbdemokratie! Verlangt volle Bürgerrechte!»47
Im «Geiste der Vaterlandsliebe und im Wissen um die gleiche Verantwortung von Mann und Frau» organisierten die Schweizer Frauen 1948 in Bern eine nationale Kundgebung. In der vollbesetzten Aula der Berner Hochschule hielt Ida Somazzi die programmatische Rede zu 100 Jahre Schweizer Demokratie ohne demokratische Frauenrechte. Der Forderungskatalog, den die Rednerinnen an diesem 2. Mai 1948 ansprachen und der in einer Resolution zusammengefasst wurde, sprach so ziemlich alles an, was die uralte, alte und neue Frauenbewegung vorbrachte bzw. vorbringen sollte. Hier ging es um rechtliche, politische, soziale und wirtschaftliche Gleichstellungen; es ging um die Chancengleichheit im Beruf hinsichtlich Berufsausbildung, Aufstiegsmöglichkeiten und Entlöhnung; es ging um den Familienschutz inklusive Mutterschaftsversicherung und den Bau von gesunden, billigen Wohnungen, es ging um die Hausfrau als Verwalterin des Grossteils des Volkseinkommens wie auch als Konsumentin.48 Dem Bundesrat wurde eine Europakarte mit einem schwarzen Fleck in der Mitte überreicht. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle europäischen Länder ausser der Schweiz und Liechtenstein das Frauenwahlrecht eingeführt.
Dies war die Situation, als Marthe Gosteli 1949 in den Frauenstimmrechtsverein Bern eintrat. Der Verein war bereits 1908 gegründet und ein Jahr später mit den anderen lokalen Stimmrechtsvereinen zum Schweizerischen Verband für Frauenstimmrecht SVF zusammengefasst worden. Vereinsaufnahme und erste Sitzungen boten Marthe Gosteli nichts Aussergewöhnliches, nichts, das sich in der Erinnerung festgesetzt hätte.
Blank liegende Nerven in der Stimmrechtsfrage: Urnengang oder Neuinterpretation der Verfassung, Marie Boehlen oder Iris von Roten?
Zur Zeit von Marthes Vereinseintritt wurde in der Frauenszene leidenschaftlich die Frage diskutiert, ob es nicht um einiges einfacher wäre, Artikel 4 der Bundesverfassung neu zu interpretieren, der da lautete: «Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich.» Das Bundesgericht sollte doch einfach festhalten, dass im Begriff alle Schweizer die Schweizerinnen mitgemeint seien.
Auf eine Erweiterung des Begriffs Schweizer hatte 1887 bereits die Juristin Emilie Kempin-Spyri gedrängt, um als «Anwalt» praktizieren zu dürfen. Ihre Auffassung «ebenso neu als kühn» wurde vom Bundesgericht abgeschmettert wie dann auch 1923 und 1928 staatsrechtliche Beschwerden von Léonard Jenni, der die Namen einiger Bernerinnen und Genferinnen ins Stimmrechtsregister eintragen wollte.49 Auch am Artikel 74 liess sich nicht rütteln, der da hiess: «Stimmberechtigt ist jeder Schweizer, der das zwanzigste Altersjahr zurückgelegt hat und im Übrigen nach der Gesetzgebung des Kantons, in dem er seinen Wohnsitz hat, nicht vom Aktivbürgerrecht ausgeschlossen ist.»
Nichtsdestotrotz versuchten die Schweizer Frauen immer wieder, sich mit verschiedensten Erklärungen ins Stimmregister zu schmuggeln, eine Gesetzeserweiterung hinzukriegen und die für die Frauen ungünstigen Artikel nicht historisch, sondern aktuell vernünftig auslegen zu lassen. Die Forderung nach einer eleganten Neuinterpretation kam meist dann auf den Tisch, wenn die Stimmrechtlerinnen wieder einmal besonders frustriert waren.50
Anfang der 1950er-Jahre war es erneut so weit. Weder die Eingabe des Schweizerischen Verbands für Frauenstimmrecht SVF noch die Vorstösse von Nationalrat Peter von Roten, CVP Wallis, sollten Erfolg haben. Am 2. Februar 1951 erklärte der Bundesrat definitiv, dass die historische Auslegung der Verfassungsartikel zwingend sei, die Paragrafen nicht uminterpretiert werden dürften: Trotz Hochachtung vor den «vielen hochgesinnten Schweizerinnen, die nicht mehr auf dieser Erde weilen», und ihren nachgefolgten «Vorkämpferinnen für das Frauenstimmrecht» glaube der Bundesrat nicht, von der von Bundesgericht und Doktrin vertretenen Rechtsauffassung «abweichen zu sollen», wonach das Frauenstimmrecht in eidgenössischen Angelegenheiten nur durch eine Verfassungsrevision eingeführt werden könne. Somit war klar, dass mit einem Urnengang des männlichen Souveräns eine Verfassungsänderung an die Hand genommen werden musste. Doch die Partialrevision kam nicht voran. So wurden neue Postulate und Frauenumfragen, Stimmregistereinträge und Uminterpretationsversuche lanciert.51
Vehemente Verfechterin des Interpretationspfades war von Rotens Ehefrau, die streitbare Feministin Iris von Roten, Urgrossnichte der Meta von Salis und promovierte Anwältin. Sie war 1943 bis 1945 Redaktorin beim Schweizer Frauenblatt gewesen und dann, nach einem Studienaufenthalt in den USA, Werbechefin bei der Wäschefirma Hanro. Als die Interpretationsfrage am ausserordentlichen schweizerischen Kongress des Verbands für Frauenstimmrecht vom März 1952 in Winterthur diskutiert wurde, prallte von Roten-Meyer heftig mit Marie Boehlen zusammen. Die Nerven lagen blank, man wollte endlich einen Sieg in der Stimmrechtsfrage.
Boehlen selbst erzählte später lachend, dass sie mit von Roten einen unangenehmen Zusammenstoss hatte. Boehlen war der Ansicht, dass die Frauen nie eine Änderung der Verfassungsauslegung erreichen konnten: «Mir war klar, dass dieser Weg ein Irrweg war. Wenn 100 Jahre lang – seit 1848 – ausdrücklich der entsprechende Artikel einseitig zugunsten der Männer ausgelegt wurde, war es rechtlich einfach undenkbar, dass das Bundesgericht ihn anders hätte interpretieren können», war sie sich sicher. «Es ging einfach nicht. Ich schlug also dem Kongress Initiativen vor und wandte mich dezidiert gegen den Interpretationsweg. Ich sehe mich noch dastehen und sehe eine überaus wütende Iris von Roten auf mich zukommen. Sie zitterte vor Empörung und durchbohrte mich mit den Augen. Sie schaute mich schauderhaft an. Ehrlich – ich dachte, jetzt würde ich durchgehauen!» Dass von Roten eine unduldsame Lady war, die kaum abweichende Meinungen ertrug, konnte später während ihres berühmten Fernsehauftritts mit Esther Vilar beobachtet werden.52 Der Schweizer Stimmrechtsverband entschloss sich nach leidenschaftlicher Debatte, dem von Roten’schen Interpretationspfad zu folgen. «Iris von Roten war an sich eine nette, hübsche Frau, die gut reden konnte und ein sicheres Auftreten hatte. Sie hat gewirkt! Die anderen Frauen waren ja nicht Juristinnen, und sie fanden natürlich den von Roten’schen Weg viel einfacher. Eine Initiative war ja immer mit mühseliger Arbeit verbunden.»53 Von Boehlens Antrag, eine eidgenössische Volksinitiative für eine Verfassungsrevision in die Wege zu leiten, wurde «Umgang genommen», wie es in der Chronik der Schweizerischen Frauenbewegung auf das Jahr 1952 sibyllinisch formuliert wurde.54
Das Bundesgericht bestätigte am 26. Juni 1957 nach einem Vorstoss der welschen Frauenrechtlerin Antoinette Quinche seine Haltung. Aus Gründen der Rechtssicherheit interpretierte das oberste Gericht den strittigen Paragrafen historisch und bekräftigte seinen Standpunkt.55 Bedeutende Staatsrechtslehrer, obwohl sie dem Frauenstimmrecht zugetan seien, hätten abgewinkt. Insbesondere erklärte der Staatsrechtler Werner Kägi den Weg der Neuinterpretation «weder rechtlich für zulässig, noch politisch für gangbar».
Mochte man sich bei anderer Gelegenheit dagegen verwahren, dass Bundesrat oder Bundesgericht irgendeinen Verfassungsartikel nach eigenem Gusto uminterpretieren und die Verfassungssicherheit ankratzen könnten, so war dieses No-Go bei der «gerechten Sache» der Frauenrechte ärgerlich. Kein Wunder, brandete jahrzehntelang Vorschlag um Vorschlag für eine Uminterpretation Richtung Bundeshoheiten – meist von bösen Worten begleitet. Auch Iris von Roten propagierte den Interpretationsweg weiterhin, etwa 1959 in ihrem Frauenstimmrechts-Brevier, nachdem «der Leerlauf der Volksabstimmungen zur Frage ‹Frauenstimmrecht ja oder nein› ein Vierteljahrhundert geklappert hatte».56 Selbst der Schweizerische Verband für Frauenstimmrecht hielt jahrzehntelang am Interpretationsglauben fest. «Er verlor Jahre mit seinem unvernünftigen und erfolglosen Kampf zur Neuinterpretation der Bundesverfassung», seufzte Marie Boehlen: «Er ist für die Katz gewesen.»57 Im Einvernehmen mit Marie Boehlen glaubte Marthe Gosteli nie an den Interpretationsweg und kam nie vom «legalen, geraden Weg» ab: «Ich hielt stets am demokratischen Vorgang fest, dass in der Schweiz der Souverän, also die Männer, einzig zuständig seien.»
Wurde in der Schweizer Geschichte wirklich nie ein Verfassungsparagraf ohne Volksabstimmung geändert? Doch! Zum Beispiel 1923 im erwähnten Streit um die Anwaltsberechtigung von Emilie Kempin-Spyri. 37 Jahre nach dem ersten Urteil hielt das Bundesgericht fest, der Ausschluss der Frauen vom Anwaltsberuf sei sachlich nicht gerechtfertigt und verfassungswidrig. Diese tief greifende Praxisänderung wurde erklärt mit gewandelten gesellschaftlichen Verhältnissen. In der Zwischenzeit hatte nämlich eine Reihe von Kantonen Anwältinnen zugelassen. Kantonale Patente berechtigten diese zudem, in sämtlichen Kantonen zu praktizieren. Das Bundesgericht bestätigte also ein Fait accompli.58 Auf die Frage des Frauenstimmrechts angewandt heisst dies, dass für Neuinterpretationen des Verfassungsartikels 74 (Gleichstellung bei Wahlen und Abstimmungen) eine Chance bestanden hätte, wenn viele Kantone dieses Recht bereits zugestanden hätten, wenn auf messbar veränderte Verhältnisse und auf Rechtsgleichheit hätte gepocht werden können. Dies war aber (noch!) nicht der Fall. (Vgl.S. 142 und S. 256)
Die erfolgreiche Berner Initiative von 1953 und viele Jastimmen bei der verlorenen Berner Abstimmung von 1956
Der Frauenstimmrechtsverein Bern glaubte im Gegensatz zum schweizerischen Verband nicht an den Interpretationsweg. Auf kantonaler Ebene begaben sich die Nimmermüden auf die Ochsentour von unten nach oben, getreu der bundesrätlichen Empfehlung: «Erst wenn einige Erfahrungen auf dem Boden des kantonalen […] Rechts gesammelt sein werden, wird man mit einiger Aussicht auf Erfolg daran gehen können, das Frauenstimm- und -wahlrecht in der Eidgenossenschaft zu übernehmen.»59 Die Jetzt-erst-recht-Generation kämpfte weiter. Die Idee der Frauenrechte musste in den Köpfen verankert werden. Die Forderung durfte nicht überraschend und exotisch daherkommen, wenn dereinst sich denn die Gesellschaft aufgrund zahlreicher neuer technischer, wirtschaftlicher, finanzieller oder anderer Impulse so verändert haben würde, dass es die Männer wohlfeiler fanden, auf Privileg und Patriarchat zu verzichten. Noch aber lagen die politischen Frauenrechte nicht im Mainstream, das Umfeld war entsprechend garstig und der lange pickelharte Kampf zermürbte. Wie in jeder erfolglosen Mannschaft hatten auch Stimmrechtlerinnen mit Motivationsschwierigkeiten und Schuldzuweisungen zu kämpfen. Es erstaunt nicht, dass die eine oder andere Frau – nicht aber die neu rekrutierte Marthe Gosteli – den Idealismus verlor und an der Hoffnung verzweifelte, je die Einführung des Frauenstimmrechts noch zu erleben.
Die Berner Aktivistinnen, die 1945 die Petition mit einer Rekordunterschriftenzahl gemanagt hatten, stellten sich zur kantonalbernischen Vereinigung für die Mitarbeit der Frau in der Gemeinde auf. Marie Boehlen, die mit ihrem Initiativvorschlag auf nationalem Frauenparkett abgeblitzt war, realisierte ihn nun auf kantonalbernischem Boden. Eine Fraueninitiative von den Frauen und für die Frauen war eine Neuheit in der Schweiz und zudem ein gewagtes Unternehmen, wenn man bedenkt, dass nur Stimmberechtigte, also Männer, unterschreiben durften. Am 9. Februar 1952 wurde das Unterfangen vom strategiebewussten Quartett Marie Boehlen–Frieda Amstutz–Gerda Stocker–Adrienne Gonzenbach lanciert. Trotz unterschiedlichen politischen Meinungen bildeten die vier ein sehr gut harmonierendes Führungsteam, wie sich Marthe Gosteli erinnert, die den ganzen Prozess bis zum erfolgreichen Abschluss hautnah mitverfolgen konnte, wurde sie doch am 12. Februar 1952 in den Vorstand des Frauenstimmrechtsvereins Bern geholt.60
Abb. 16: Berner Stimmrechtlerinnen in den 1950er-Jahren (v.l.n.r.): Die Pressefrau Gerda Stocker-Meyer, die Frauen-Sekretärin Anita Kenel, die Juristinnen Dr. Elisabeth Schmid-Frey und Dr. Marie Boehlen sowie die Lehrerin Adrienne Gonzenbach-Schümperli hatten sich immer wieder dem Kampf für das Frauenstimmrecht zu stellen.
Das Sekretariat war dieses Mal im Restaurant Daheim mit der «unschätzbar geschickten Sekretärin Anita Kenel» eingerichtet. Erneut musste der ganze Apparat für die Unterschriftensammlung in Bewegung gesetzt werden. 319 Frauen sammelten ab Neujahr 1953 auf dem Land, einige Hundert in den Städten und ein spezielles Team im Jura. Grossanlässe wurden organisiert, Referentenführer zu Stimmrecht und Gemeindeaufgaben neu aufgelegt. Schriften mit Titeln wie So wahrt der Männerstaat die Rechte der Frau und Die Fahnen hoch! wurden publiziert. Namentlich auf dem Lande wurden Schulungskurse für Frauen zugunsten ihrer Mitarbeit in den Gemeindeorganen durchgeführt.61 Die Kurse fanden grossen Anklang, es gab Kursnachmittage mit bis zu 90 Teilnehmerinnen. Die organisierten Frauen zogen landauf, landab und argumentierten, belehrten, taktierten. Sie klärten die Frauen auf, wieso weibliche Mitbestimmung gesellschaftlich und sozial wichtig sei, zerpflückten die immergleichen Gegenargumente. Sie weibelten wie eh und je.
Abb. 17: An einer öffentlichen Veranstaltung 1953 in Bern gaben gegnerische Einwände den Stimmrechtlerinnen viel zu schmunzeln und zu lachen. Am grossen Tisch sitzt links vorn mit Kette die Erzieherin Emma Flück-Michel. Als zweite hinter ihr lacht die Kaffeehausbetreiberin Elisabeth Gfeller. Stehend ist die spätere Jugendanwältin Marie Boehlen zu sehen, und vor ihr sitzt Redaktorin Frieda Amstutz. Rechts aussen debattiert Seminarlehrerin Ida Somazzi.
Die Unterstützung durch politisch erfahrene Männer war bei dieser Initiative ausdrücklich erwünscht. Als Aushängeschilder dienten im Ehrenkomitee 103 prominente Persönlichkeiten. Die Frauen konnten auf SP, FdP, LdU zählen, nicht aber auf die BGB. Marthe Gosteli zeigte ein gewisses Verständnis: Schliesslich müsse man sich fragen, «in welchen Situationen sich Behördenmitglieder, aber auch Politiker, befanden, die in der Vergangenheit Entscheide getroffen haben und am Geschichtsprozess beteiligt waren. Viele Behördenvertreter, die ich in den Jahrzehnten meiner Tätigkeit für die Rechte der Frauen kennengelernt hatte, fanden den Umgang der Öffentlichkeit und der Politik mit den Pionierinnen und ihren Anliegen schrecklich, aber sie konnten in ihrer Lebenssituation gar nicht anders handeln, als das zu tun, was sie getan haben – oft eben nicht zugunsten der Frauen. Es ging in vielen Fällen darum, die Stelle behalten und die Familie ernähren zu können. Solche Umstände müssen wir ebenfalls berücksichtigen, wenn wir über die Vergangenheit sprechen.»62 Immerhin gab es in der BGB Einzelpersönlichkeiten wie alt Regierungsrat Hugo Dürrenmatt, der sich «beflügelt durch den idealistischen Schwung seines Wesens und die Kraft seines unabhängigen Geistes» in den Dienst der bernischen Frauenbewegung stellte.63
Die Berner Initiative war sehr erfolgreich. «Dank einer musterhaften Disziplin und Einsatzbereitschaft vieler Frauen», freute sich Adrienne Gonzenbach, «brachten wir [rund] 35000 gültige Unterschriften zusammen; dreimal mehr als gefordert waren!» Die Staatskanzlei habe vermerkt, dass nur selten eine solch saubere Arbeit abgeliefert würde.64
Die Vorlage war eigentlich bescheiden. Sie verlangte nur, dass es der Kanton Bern seinen Gemeinden freistellte, den Frauen fakultativ das Stimm- und Wahlrecht zu geben. Zudem war sie ein alter Zopf. Mit dem Gemeindefakultativum hatte man sich nämlich bereits zu Grossvaters Zeiten 1916 herumgeschlagen. (Vgl. S. 281)
Abb. 18: Die Berner Initiative für das Frauenstimmrecht wurde am 7. Juli 1953 in Form eines stattlichen, in den Berner Farben geschmückten Bündels von 250 Initiativbögen dem bernischen SP-Regierungsratspräsidenten Georges Moeckli überbracht. Das Komitee beim Verlassen des Regierungsgebäudes (v.l.n.r.): alt Regierungsrat Hugo Dürrenmatt (Ehrenpräsident), Gerda Stocker-Meyer, in jurassischer Tracht Mlle Mouttet, Tochter des damaligen bern-jurassischen Regierungsrates, Mlle Rosa Equet aus La Neuveville, Marie Boehlen mit Hut (vorn) und leicht verdeckt hinter ihr Anita Kenel. Ganz hinten die Herren Erwin Schneider (SP-Parteisekretär) und Dr. Gerhard Staender (FDP-Vizepräsident des Arbeitsausschusses).





























