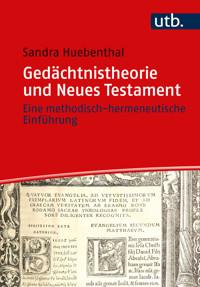
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Mit seinem innovativen Ansatz erschließt das Lehrbuch erstmals die Erkenntnisse interdisziplinärer Forschung zu Gedächtnis und Erinnerung für die Interpretation des Neuen Testaments. Jenseits der Frage wie es gewesen ist, werden die Texte des Neuen Testaments nicht als historische Berichte, Geschichtsschreibung oder Augenzeugenerinnerung gelesen, sondern als Zeugnisse frühchristlicher Identitätsbildung, die sich sozialen Aushandlungsprozessen verdanken. Neben einer grundlegenden Einführung in die Grundbegriffe kulturwissenschaftlicher Gedächtnistheorie bietet das Buch exemplarische Lektüren neutestamentlicher Texte als Identitätstexte, an die Leser:innen mit ihren eigenen Erfahrungen anknüpfen können, und einen Ausblick in das Potential kulturwissenschaftlicher Exegese.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sandra Huebenthal
Gedächtnistheorie und Neues Testament
Eine methodisch-hermeneutische Einführung
Narr Francke Attempto Verlag · Tübingen
Prof. Dr. Sandra Huebenthal ist Inhaberin des Lehrstuhls für Exegese und Biblische Theologie an der Universität Passau.
Umschlagabbildung: Novum Instrumentum omne. Diligenter ab Erasmo Roterodamo recognitum & emendatum, non solum ad graecam veritatem, verum etiam ad multorum utriusque lingae codicum ... fidem. Basilea: Froben, 1516. Bayerische Staatsbibliothek; Creative Commons CC0 1.0
DOI: https://www.doi.org/10.36198/9783838559049
© 2022 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 5904
ISBN 978-3-8252-5904-4 (Print)
ISBN 978-3-8463-5904-4 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Im Zuge des Cultural Turn haben kulturwissenschaftliche Ansätze – und mit ihnen auch Fragen zu Erinnerung und kollektiven Gedächtnissen – in viele Einzelwissenschaften Einzug gehalten. Theologie und die Bibelwissenschaft bilden dabei keine Ausnahme. Schon seit der Antike ist die Erforschung biblischer Texte mit Fragen zu Erinnerung und Gedächtnis verbunden. Meist war der Blick dabei auf die Prozesse der Bildung und Überlieferung von Traditionen gerichtet, und daher ist es nicht verwunderlich, dass kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorie – und ihr anglo-amerikanisches Pendant Social Memory Theory – zuerst von der historischen Jesusforschung aufgegriffen wurde und so das Paradigma des historischen Jesus durch das Paradigma vom erinnerten Jesus ersetzt wurde.
Dies ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Wenn man den Blick von den Prozessen auf die Produkte der Erinnerung lenkt, geht es weniger darum, wie Traditionen entstanden sind und weitergegeben wurden; vielmehr geht es darum, konkrete Artefakte wie die Schriften des Neuen Testaments als Produkte kollektiver Gedächtnisse zu verstehen sind. Dieser Zugang ist für Theologie und Bibelwissenschaft noch relativ neu, und daher fehlte eine Einführung in Hermeneutik und Methodik, die Erkenntnisse kulturwissenschaftlicher Gedächtnistheorie für die Arbeit mit biblischen Texten aufbereitet, und außerdem aufzeigt, welche neuen Möglichkeiten sich für die Lektüre und das Studium der Bibel ergeben.
Die Anwendung von Erkenntnissen der interdisziplinären Forschung zu Gedächtnis und Erinnerung auf biblische Texte steht noch am Anfang, eine erprobte und allgemein akzeptierte Methodik existiert noch nicht. Das vorliegende Lehrbuch will also eine Lücke schließen; seine Chance liegt deshalb in dem Versuch, erstmals einen solchen Zugang zu entwicken, zu beschreiben und durchzuspielen. Dazu gehört neben einer allgemeinen Einführung auch die Darstellung der praktischen Anwendung auf die Lektüre neutestamentlicher Texte. Dabei zeigt sich das Potential eines kulturwissenschaftlich und gedächtnistheoretisch informierten Studiums des Neuen Testaments: Da Produktions- und Rezeptionsseite der Texte mit den gleichen Methoden analysiert werden, wird es für heutige Leserinnen und Leser, die ebenfalls zur Rezeptionsseite gehören, leichter, die neutestamentlichen Texte als identitätsstiftende Texte früher Christen und als Teil ihres eigenen kulturellen Gedächtnisses zu verstehen und mit eigenen Erfahrungen an die in den Texten beschriebenen Erfahrungen anzuknüpfen.
Das vorliegende Lehrbuch erklärt in drei Teilen Begriffe und Konzepte zu Gedächtnis und Erinnerung und zeigt anhand von Beispielen, wie kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorie das Verständnis und die Auslegung neutestamentlicher Texte bereichern und ergänzen kann. Exemplarische Lektüren neutestamentlicher Texte geben Gelegenheit, einzelne Methodenschritte an Textbeispielen zu erproben und die dabei gewonnenen Erkenntnisse auszuwerten. Der Ausblick im dritten Teil untersucht anhand verschiedener Beispiele, wie eine so verstandene kulturwissenschaftliche Exegese ihren Platz im Spektrum der exegetischen Hermeneutiken finden kann, und wie sie andere Zugänge zu den gleichen Texten ergänzt.
Das vorliegende Buch entstand im Zusammenhang mit mehreren Lehrveranstaltungen an der Universität Passau. Die Textbeobachtungen von Studierenden und Kollegen zum Neuen Testament und zu Texten des frühen Christentums sowie die Diskussionen zur kulturwissenschaftlichen Exegese mit Studierenden und Kollegen haben dieses Buch an vielen Stellen entscheidend vorangebracht. Mein Dank gilt insbesondere den Mitgliedern des Passauer Oberseminars, des Seminars „Bibel, Erinnerung, Identität: Neutestamentliche Texte lesen“ und der Vorlesung „Biblische Hermeneutik“ für intensive Diskussionen und für die Bereitschaft, sich auf eine neue Hermeneutik einzulassen. Mein ganz besonderer Dank gilt Dr. Manuel Bonimeier, Renate Braun, Verena Grassl, Dr. Bernhard Klinger, Felix Graf Lambsdorff und Eva Mlatílikova für ihre kritischen Rückmeldungen zum Manuskript des Lehrbuchs. Laura Schmidt danke ich herzlich für die professionelle Gestaltung der Graphiken und die Vorbereitung für den Satz.
Es war eine Freude, das vorliegende Lehrbuch gemeinsam mit Dr. Kristina Dronsch entwickeln zu können und fast 20 Jahre nach unserer gemeinsamen Zeit im Oberseminar wieder zusammenzuarbeiten. Stefan Selbmann danke ich für den professionellen und trotzdem unkomplizierten Lektoratsprozess und dem Verlag Narr Francke Attempto für die stets gute Zusammenarbeit und das Vertrauen in einen neuen Ansatz.
Passau im Mai 2022
Sandra Huebenthal
Hermeneutische Grundlegung und Methodik
I.1 Einführung und Begriffsklärung
Das erste Kapitel erläutert die Bedeutung von Gedächtnis und Erinnerung für biblische Texte und erklärt ausgehend von der inter- und transdisziplinären Forschung wie Gedächtnis/Erinnerung als hermeneutische Kategorie in der Bibelwissenschaft zur Anwendung kommen kann.
Gedächtnis und Erinnerung in der Bibel und im frühen Christentum
Gedächtnis1 und Erinnerung sind nicht nur Alltagsbegriffe, sondern auch theologisch aufgeladene Kategorien mit großer Wirkungsgeschichte. Schon im Alten Testament sind Gedächtnis und Erinnerung wichtige theologische Kategorien, da sich das Volk Israel über Erinnerung und Vergegenwärtigung konstituiert.
Besonders gut sichtbar wird diese Verbindung in der identitätsstiftenden Erinnerung des Exodusgeschehens, z. B. in Ex 13,3–10Ex 13,3–10 :
3Mose sagte zum Volk: Denkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten, dem Sklavenhaus, fortgezogen seid; denn mit starker Hand hat euch der HERR von dort herausgeführt. Nichts Gesäuertes soll man essen. 4Heute im Monat Abib seid ihr weggezogen. 5Wenn dich der HERR in das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Hiwiter und Jebusiter geführt hat – er hat deinen Vätern mit einem Eid zugesichert, dir das Land zu geben, wo Milch und Honig fließen –, erfülle diesen Dienst in diesem Monat! 6Sieben Tage sollst du ungesäuerte Brote essen, am siebten Tag ist ein Fest für den HERRN. 7Ungesäuerte Brote soll man sieben Tage lang essen. Nichts Gesäuertes soll man bei dir sehen und kein Sauerteig soll in deinem ganzen Gebiet zu finden sein. 8An diesem Tag erzähl deinem Sohn: Das geschieht für das, was der HERR an mir getan hat, als ich aus Ägypten auszog. 9Es sei dir ein Zeichen an der Hand und ein Erinnerungsmal zwischen deinen Augen, damit die Weisung des HERRN in deinem Mund sei. Denn mit starker Hand hat dich der HERR aus Ägypten herausgeführt. 10Bewahre diese Satzung, Jahr für Jahr, zur festgesetzten Zeit!
Der für das Judentum zentrale Begriff zachor (Gedenken, Erinnerung, vom hebräischen Verb זכר) begegnet in diesem Textstück gleich zweifach: In 13,3Ex 13,3 wird das Volk dazu aufgerufen, sich zu erinnern und in 13,9Ex 13,9 ist von einem Zeichen zur Erinnerung die Rede, mit dem die Erinnerung verkörpert und damit ebenso vergegenwärtigt wird wie durch das Ritual, sieben Tage lang ungesäuerte Brote zu essen. Die abschließende Ermahnung, diese Ordnung zu bewahren, stellt sicher, dass die Erinnerung in jedem Jahr wiederum zu einem bestimmten Zeitpunkt vergegenwärtigt wird. Die Erinnerung hat damit nicht nur ein klares Ziel – Identitätsstiftung –, sondern auch einen klaren Ort im Jahreszyklus der Erinnerungsgemeinschaft, dem Volk Israel, das sich aus der Erinnerung an das konstituierende Ereignis oder Gründungsereignis der Herausführung aus Ägypten, dem Exodus, heraus versteht.
Im Christentum spielen Gedächtnis und Erinnerung ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Kategorie anamnesis ist ein ähnlich zentraler Begriff wie zachor im Judentum. Das Neue Testament, das in kulturwissenschaftlicher Perspektive die Gründungsurkunde des Christentums darstellt, ist dabei das Scharnier zwischen Gründungsereignis(sen) und vergegenwärtigender Erinnerung bei der Lektüre oder liturgischen Inszenierung der Texte.
In den Schriften des Neuen Testament werden für Gedächtnis, Gedenken und Erinnerung unterschiedliche Begriffe verwendet, die alle auf der Wurzel mnē (μνη-) basieren: anamnēsis (ἀνάμνησις, Lk 22,19Lk 22,19 ; 1 Kor 11,241 Kor 11,24 .251 Kor 11,25 ; Hebr 10,3Hebr 10,3 ), mneia (μνεία, Röm 1,9Röm 1,9 ; 1 Thess 1,21 Thess 1,2 ; 3,61 Thess 3,6 ; Phil 1,3Phil 1,3 ; Phlm 4Phlm 4 ; Eph 1,16Eph 1,16 ; 2 Tim 1,32 Tim 1,3 ), mnēmē (μνήμη, 2 Petr 1,152 Petr 1,15 ), mnēmosynon (μνημόσυνον, (Mt 26,13Mt 26,13 ; Mk 14,9Mk 14,9 ; Apg 10,4Apg 10,4 ) und hypomnēsis (ὑπόμνησις, 2 Tim 1,52 Tim 1,5 ; 2 Petr 1,132 Petr 1,13 ; 3,12 Petr 3,1 ). Die Verwendung des Begriffsfeldes sich erinnern, gedenken beschreibt dabei nicht allein ein innerliches oder geistiges Geschehen, sondern bezeichnet auch Worte oder Handlungen, die „dem Gedächtnis dienen und zur Erinnerung werden“, wie es im Theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament heißt.2 Diese Form von Gedächtnis/Erinnerung kann sowohl individuell als auch kollektiv sein, sprich: von Einzelnen oder Gruppen ausgeübt werden. Sie dient in den meisten Fällen der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens, das zu bewahren und weiterzugeben ist. Diese Prozesse sind damit strukturanalog zum alttestamentlichen zachor. Mit Otto MichelMichel, Otto , der den Artikel im Theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament verfasst hat, lässt sich formulieren, dass die apostolische Verkündigung nicht nur Erinnerung ist, sondern gleichzeitig auch nach Erinnerung verlangt, die bestimmte, mitunter ritualisierte Formen braucht.
Erinnerung ist als hermeneutische Kategorie für den Umgang mit den Evangelien und das Verständnis der Evangelien ist fast so alt wie das Nachdenken über die Evangelien selbst. Bereits in der frühen Kirche wurde der Diskurs über die Evangelien mit Begriffen aus dem Wortfeld mnēmoneuō (μνημονεύω) geführt. Die bekanntesten frühchristlichen Autoren, die mit diesen Begriffen arbeiten, sind JustinJustin der Märtyrer der Märtyrer (ca. 100–165 n. Chr.) und PapiasPapias von Hierapolis von Hierapolis (ca. 70–140 n. Chr.), dessen Werk nur noch in Fragmenten vorliegt und beispielsweise bei EusebEuseb von Caesarea von Caesarea (ca. 260–340 n. Chr.) überliefert ist. Justin und Papias bezeichnen die Evangelien als apomnēmoneumata (ἀπομνημονεύματα) oder hypomnēmata (ὑπομνήματα).
In der Ersten Apologie erklärt JustinJustin der Märtyrer zur Herkunft der Eucharistie:
Denn die Apostel haben in den von ihnen stammenden Denkwürdigkeiten, welche Evangelien heißen, überliefert, es sei ihnen folgende Anweisung gegeben worden: Jesus habe Brot genommen, Dank gesagt und gesprochen: „Das tut zu meinem Gedächtnis, das ist mein Leib“, und ebenso habe er den Becher genommen, Dank gesagt und gesprochen: „Dieses ist mein Blut“, und er habe nur ihnen davon mitgeteilt.3
Uns geht es hier weniger um den Inhalt seiner Ausführungen als um den Begriff, den er für die Evangelien verwendet: apomnēmoneumata (ἀπομνημονεύματα), eine Wendung aus dem Begriffsfeld „Erinnerung“.
PapiasPapias von Hierapolis von Hierapolis verwendet ebenfalls Wendungen aus dem Begriffsfeld „Erinnerung“, wenn er über die Herkunft der Evangelien spricht. Die Evangelien nach Matthäus und Johannes nennt er „Erinnerungen an die Lehre des Herrn“ (tōn toū kyriou diatribōn hypomnēmata, τῶν τοῦ κυρίου διατριβῶν ὑπομνήματα)4 und auch das Markusevangelium gilt ihm als „Erinnerung“, wenngleich aus zweiter Hand. Markus als Hermeneut (hermeneutēs, ἑρμηνευτὴς, gerne mit „Dolmetscher“ übersetzt) hat ihm zufolge die Lehre des Petrus so aufgeschrieben, wie er sich erinnerte.5 Das Markusevangelium wäre demnach die schriftliche Erinnerung an die mündlich vorgetragene Lehre des Petrus, das Matthäus- und Johannesevangelium Erinnerungen an die Lehre des Herrn.
Mit den Erinnerungen aus zweiter Hand erklärt PapiasPapias von Hierapolis die Unstimmigkeiten und die mangelnde Ordnung, die offenbar im Markusevangelium wahrgenommen wurden. Dabei wird noch etwas anderes sichtbar, das für das Verständnis der Evangelien als „Erinnerungen“ und die hermeneutische Kategorie der „Erinnerung“ wichtig ist: Papias geht zwar von der authentischen Zeugenschaft des Markus aus, das Markusevangelium ist für ihn aber kein objektiver Bericht. Er geht vielmehr von einer bedarfs- und damit hörerorientierten Lehrtätigkeit des Petrus aus, die Markus dann nach seinem Erinnerungsvermögen notiert. Es geht demnach im Markusevangelium nicht um eine strukturierte Gesamtdarstellung der Worte und Taten Jesu in ihrer chronologischen Reihenfolge, sondern um die Erinnerung des Petrus, die in einzelnen ungeordneten Episoden vorliegt und aus seiner eigenen Perspektive erzählt wird. Wenn wir einen Schritt zurücktreten, wird klar, dass bei Papias – und darin ist ihm der Kirchenschriftsteller EusebEuseb von Caesarea gefolgt – im Hinblick auf die Evangelien von Geschichtsschreibung keine Rede ist. Es handelt sich vielmehr um eine Form verkündigender Lehre, die in ihrer schriftlichen Form ebenfalls wieder Verkündigung sein soll.6
Aus der Verwendung von Begriffen aus dem Wortfeld Gedächtnis/Erinnerung in der Antike lässt sich damit festhalten, dass „Gedächtnis“ und „Erinnerung“ keine historischen, sondern hermeneutische Kategorien sind. Es geht nicht um das, was geschehen ist, sondern darum, wie Geschehenes verstanden wird.
Gedächtnis und Erinnerung in der Kulturwissenschaft
Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert wird disziplinübergreifend zu Gedächtnis und Erinnerung geforscht. Für unsere Zwecke ist dabei insbesondere die kulturwissenschaftliche Forschung interessant, doch um sie besser zu verstehen und einordnen zu können, ist es sinnvoll, mit einem Blick auf die Etymologie des Begriffsfeldes Gedächtnis/Erinnerung zu beginnen.
Eine sprachliche Herleitung des Erinnerungsbegriffs lässt unterschiedliche Bedeutungsnuancen erkennen, die bereits anzeigen, in welche Richtung Forschung zur Erinnerung gehen kann. „Der Ursprung des Verbs ‚erinnern‘ liegt im ‚inne werden‘ oder ‚innern‘.“1 Das zugrundeliegende semantische Wortfeld erstreckt sich dabei vor allem auf die Bedeutung „ins Bewusstsein bringen“ oder „ins Gedächtnis bringen“, also „an etwas denken oder zurückdenken“. Der Grundgedanke besteht darin, dass bestimmte Inhalte wieder in den Griff des gegenwärtigen Bewusstseins gebracht werden. Diese Bewegung kann reflexiv geschehen im „sich erinnern“, oder auf ein anderes Subjekt bezogen sein.
Die Verwendungsgeschichte des Substantivs „Erinnerung“ zeigt vier unterschiedliche Nuancen. Die beiden älteren Nuancen sind einerseits „Mahnung, Aufforderung, Bitte, Hinweis, etwas nicht zu vergessen“, und andererseits „Gedenken, Andenken, und Nachdenken über Vergangenes, Vergegenwärtigung, Rückblick“. Die Bedeutungsnuance „Summe der vorhandenen Erinnerungen“ ist hier grundgelegt. Hinzu treten etwa ab dem 18. Jahrhundert zwei weitere Bedeutungsnuancen: „Erinnerung“ steht nun auch für das Erinnerungsvermögen als „Fähigkeit, sich zu erinnern“ und für das Gedächtnis selbst als „Besitz der bisher aufgenommenen Eindrücke“. Wir haben es bei der Erinnerung demnach mit vier unterschiedlichen Bedeutungsfacetten zu tun:2
Abb. I.1: Bedeutungsfacetten des Begriffs „Erinnerung“
Hinzu kommt die Ausdifferenzierung des Bedeutungsfelds des Begriffs „Gedächtnis“ in die beiden Bereiche „Erinnerungsvermögen“ im Sinne der „Fähigkeit, Sinneswahrnehmungen oder psychische Vorgänge im Gehirn zu speichern, sodass sie bei geeigneter Gelegenheit ins Bewusstsein treten können“ und dem Gedenken im Sinne des ehrenden Andenkens:
Abb. I.2: Ausdifferenzierung des Bedeutungsfelds „Gedächtnis“
Die Besonderheit des Gedächtnisses besteht vor allem darin, dass hier weniger an einen Prozess als eine Struktur, einen Zustand oder eine Momentaufnahme gedacht wird.3 Die Unterscheidung von Speicher- und Funktionsgedächtnis, die uns im nächsten Kapitel begegnen wird, ist in dieser Unterscheidung bereits angelegt.
Wenn man die Begriffe „Gedächtnis“ und „Erinnerung“ mit ihren Begriffsnuancen genauer anschaut, wird ein weiterer Unterschied sichtbar: Erinnerung wird stärker als Prozess gedacht, Gedächtnis stärker als Struktur. Dabei ist die Konnotation des Begriffs „Erinnerung“ eher aktiv, während das „Gedächtnis“ eher passiv erscheint. Mit Matthias BerekBerek, Matthias ins Wort gebracht:
Mittlerweile herrscht disziplinübergreifend weitgehend Einigkeit darüber, Erinnern als Prozess des Entstehens von Erinnerungen zu begreifen und das Gedächtnis als Fähigkeit dazu oder die veränderliche Struktur dieser Erinnerungen […]. Gedächtnis ist ein bestimmter Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt, es ist die Gesamtheit der in der Gegenwart zuhandenen Wissenselemente über die Vergangenheit. Erinnern ist dagegen der aktive Vorgang, das eigentliche Reproduzieren der vergangenen Wahrnehmungen. Das Verhältnis von Gedächtnis und Erinnerung kommt insofern der bekannten Humboldt’schen Unterscheidung von Werk (Ergon) und Tätigkeit (Energaia) nahe […]. Dem entspricht, dass es im deutschen Alltagsgebrauch für das Nomen ‚Gedächtnis‘ keine dazugehörige Verbform gibt, im Gegensatz zur ‚Erinnerung‘. Vielmehr wird ‚erinnern‘ oft sogar mit ‚ins Gedächtnis rufen‘ gleichgesetzt. Die Erinnerung trägt also im Gegensatz zum Gedächtnis einen deutlich prozessualen Charakter.4
Abb. I.3: Grundlegende Unterschiede der Konzepte „Gedächtnis“ und „Erinnerung“
Schon diese grundlegenden Erkenntnisse lassen vermuten, dass Forschung zu „Erinnerung“ und Forschung zu „Gedächtnis“ in ganz unterschiedliche Richtungen gehen kann. Untersuchungen zu Erinnerungsprozessen und Erinnerungsweitergabe unterscheiden sich womöglich deutlich von Untersuchungen von Gedächtnistexten, die eher als Speicher oder Strukturierung von Wissensbeständen verstanden werden. Wenn dann noch die Begriffe unscharf verwendet werden, etwa weil etwas als „Erinnerung“ bezeichnet wird, das nach der oben eingeführten Taxonomie eher mit „Gedächtnis“ zu bezeichnen wäre, werden unterschiedliche Forschungsgebiete miteinander verknüpft, die außer dem gemeinsamen Überbegriff „Erinnerung“ womöglich nicht viel miteinander teilen. In der Bibelwissenschaft ist diese Unterscheidung tatsächlich zentral, wenn es um die Anwendung von Gedächtnis/Erinnerung als hermeneutischer Kategorie geht. Die Unterscheidung zwischen unterschiedlichen hermeneutischen Zugängen, die alle unter dem Begriff Erinnerung arbeiten und die uns in Kapitel III.2/III.3 begegnen werden, lassen sich auf die unterschiedlichen Facetten von Gedächtnis und Erinnerung zurückführen. Wie sich dann zeigen wird, besteht ein Unterschied zwischen der Frageperspektive, ob es bei Jesuserinnerungen um den Prozess der Weitergabe von Erinnerungen verbunden mit dem Erinnerungsvermögen der frühesten Zeugen und der Gedächtnisleistung einzelner Tradenten geht oder um die Analyse und Interpretation von Erinnerungsbildern, die wie die Evangelien in Textform vorliegen.
Bleiben wir zunächst noch bei der inter- und transdisziplinären Forschung zu Gedächtnis/Erinnerung, die auch die Fragestellungen und Untersuchungsmethoden in der Theologie mitgeprägt hat. Wie unterschiedlich die Zugänge zu Gedächtnis/Erinnerung in den diversen Disziplinen sein können, führt AleidaAssmann, Aleida Assmann in ihrer Einführung in die Kulturwissenschaft auf. Sie formuliert eine Reihe von Unterschieden, die in den einzelnen Disziplinen im Bereich der Definition, aber auch der konkreten Forschung relevant sind. Diese weitere Differenzierung gibt dabei auch einen ersten Überblick darüber, aus welchen Disziplinen bibelwissenschaftliche Forschung zu Gedächtnis/Erinnerung theoretische, hermeneutische und methodische Anleihen macht. Zu den verschiedenen Disziplinen und ihrem jeweiligen Fokus gehören nach Assmann:5
Neurologie: neuronale Grundlagen
Psychologie: kognitive und emotionale Gedächtnis-Prozesse von Individuen
Psychoanalyse/Psychotherapie: Erinnerungsprozesse anlässlich von Lebenskrisen
Soziologie: Erinnerungs- und Erzählgemeinschaften in sozialen Kontexten
Geschichte: Zuverlässigkeit oder Unzuverlässigkeit menschlichen Gedächtnisses im Verhältnis zu schriftlichen Quellen
Geschichte/Politologie: Art und Weise, wie Gesellschaften ihre Vergangenheit in symbolischen Formen nach den Bedürfnissen ihrer Gegenwart und abgestimmt auf ihre Zukunftsorientierungen (re-)konstruieren
Literaturwissenschaft/Kunstwissenschaft: Kulturelles Gedächtnis als kulturelles Erbe in Form von Texten, Bildern, Vorstellungen und Praktiken)
Die Auflistung verdeutlicht, dass das Forschungsfeld „Gedächtnis/Erinnerung“, insofern es die Einzeldisziplinen übersteigt und nur in einer arbeitsteiligen Form erforscht wird, in der Tat transdisziplinär ist. Die einzelnen Disziplinen erforschen unterschiedliche Bereiche, bauen dabei aber auf den Ergebnissen anderer Disziplinen auf. Dazu gehört auch, dass keine der unterschiedlichen Perspektiven das Thema in seiner Gesamtheit oder umfassend abbilden kann. Keine Disziplin – und das betrifft auch die Theologie – hat den Gesamtüberblick. Aus diesem Grund muss auch die Bibelwissenschaft auf die Erkenntnisse der anderen Disziplinen zurückgreifen, um wissenschaftlich diskursfähig zu bleiben.
Gedächtnis und Erinnerung in der Bibelwissenschaft
Diese Erkenntnis ist für die konkrete Arbeit beim Verständnis und der Auslegung der Bibel von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Wenn die Erkenntnisse und Methoden anderer Disziplinen für die wissenschaftliche Erforschung der Bibel im Feld Gedächtnis/Erinnerung erkenntnisleitend sind, ist es nicht möglich, für die Entstehung und Auslegung biblischer Texte Konditionen anzunehmen, die von den individuellen und sozialen Prozessen anderer Kulturen und Kulturkreise abweichen. Anders gesagt: für die Entstehung der biblischen Texte gelten keine Sonderregeln, sondern die Bibel wird verstanden als eine Sammlung kultureller Texte unter anderen. Ihre spezielle Bedeutung für eine bestimmte Gruppe als Sammlung Heiliger Schriften oder kanonischer Texte wird nicht geschmälert, wenn biblische Text mit den Methoden unterschiedlicher Disziplinen untersucht und biblische Texte mit anderen Zeugnissen aus dem gleichen oder einem verwandten Kulturraum verglichen werden.
Die hermeneutische Kategorie Gedächtnis/Erinnerung bezeichnet in der Bibelwissenschaft die Anwendung von Erkenntnissen aus der inter- und transdisziplinären Forschung zu Gedächtnis und Erinnerung bei Individuen und Gruppen und nutzt Forschungsergebnisse aus Disziplinen wie der Neurowissenschaft, der Historischen Psychologie und kulturwissenschaftlichen Gedächtnistheorie für die Erforschung und das Verständnis biblischer Texte.
Gedächtnis/Erinnerung bietet damit einen hermeneutischen Zugang für das Verständnis der Prozesse kollektiver Erinnerung, Identitätskonstitution und Traditionsweitergabe und kann bei der Klärung von Erwartungen an Artefakte kollektiver Gedächtnisse wie biblischer Texte im Hinblick auf ihre historische Verortung und/oder ihre Bedeutung für eine bestimmte Erinnerungsgemeinschaft dienen.
Nachdem bereits in der frühen Kirche Gedächtnis/Erinnerung als hermeneutische Kategorie für das Verständnis der Evangelien genutzt wurde, dürfte es für die Bibelwissenschaft eigentlich kein Problem sein, an die oben skizzierten Erkenntnisse aus der inter- und transdisziplinären Forschung anzuschließen und sie in einer kulturwissenschaftlichen Perspektive auszuwerten. Dass es ganz so einfach doch nicht ist, liegt daran, dass im Laufe der Geschichte andere Aspekte stärker nuanciert wurden. Diese waren einerseits die Pragmatik der Texte als Verkündigung und andererseits ihre Autorität, die auf Augenzeugenschaft und/oder einer Traditionskette beruht, wobei die Autorität der Zeugen und die vermeintliche Objektivität des Zeugnisses immer mehr verschmolzen.
Dieser Zusammenhang wurde im Zuge der historischen Jesusforschung mehr und mehr infrage gestellt und es ist vielleicht kein Zufall, dass interdisziplinäre Forschung zu Gedächtnis/Erinnerung seit den 1990er Jahren zuerst in der historischen Jesusforschung heimisch geworden und vor allem dort anzutreffen ist, wo sie als Memory Approach oder Erinnerungsparadigma zur Untersuchung von Traditionsprozessen und Jesusbildern/Jesuserinnerungen genutzt wird. Hier steht deutlich die Facette „Erinnerung“ als Prozess im Hintergrund. Ein weiteres und jüngeres Anwendungsfeld ist die Lektüre neutestamentlicher (und frühchristlicher) Text als kollektive Gedächtnistexte. Dieser Zugang betont die Facette „Gedächtnis“ und fokussiert stärker auf Struktur. Um diesen zweiten Zugang geht es in diesem Lehrbuch.
Das Lehrbuch hat drei Teile. Im ersten Teil geht es um die hermeneutischen Grundlagen für einen kulturwissenschaftlich-gedächtnistheoretischen Zugang, der es ermöglicht, neutestamentliche Texte als Artefakte kollektiver Gedächtnisse – und damit als Momentaufnahmen frühchristlicher Identitätsbildungsprozesse – zu lesen. In diesem ersten Teil werden Prozesse und Formate individueller und kollektiver Erinnerung ebenso in den Blick genommen wie Prozesse der Weitergabe von Erinnerungen und Traditionen sowie die mit ihnen verbundenen Medien. Der erste Teil endet mit einem systematisierenden Überblick über die neutestamentliche Zeit und einem Vorschlag für die methodische Herangehensweise an neutestamentliche Texte als Gedächtnistexte.
Im zweiten Teil werden sechs exemplarische Lektüren neutestamentlicher Texte dargeboten, die zeigen, wie die Lektüre neutestamentlicher Texte als Gedächtnistexte in der Praxis aussehen kann und welches Potential dieser Zugang als Ergänzung historisch-kritischer Exegese bietet. Die ausgewählten Texte stammen aus unterschiedlichen frühchristlichen Generationen und unterschiedlichen literarischen Genres und werden in chronologischer Reihenfolge vorgestellt. Den Anfang macht der Galaterbrief als Dokument der zweiten urchristlichen Generation. Danach folgen der Kolosserbrief und das Markus- und Lukasevangelium als Texte der dritten Generation und schließlich die Apostelgeschichte und der zweite Petrusbrief als Vertreter der Übergangszeit in die vierte Generation bzw. der vierten Generation.
Der dritte Teil fasst auf der Basis der Erkenntnisse aus den ersten beiden Teilen den aktuellen Stand zum Potential und den Anwendungsmöglichkeiten kulturwissenschaftlicher Exegese für Bibelwissenschaft und Theologie insgesamt zusammen. Den Auftakt bildet ein Vergleich der beiden Thessalonicherbriefe in kulturwissenschaftlicher Lesart als Gedächtnistexte unterschiedlicher Generationen. Im dritten Teil wird ferner erläutert, welche Impulse der kulturwissenschaftliche Zugang der Einleitungswissenschaft für die Verortung neutestamentlicher und frühchristlicher Texte in konkreten Entstehungsszenarien geben kann, wie sich die hermeneutische Kategorie der Erinnerung zur historischen Rückfrage verhält und was kulturwissenschaftliche Exegese konkret zur Auslegung von biblischen und frühchristlichen Texten beitragen kann. Abschließend wird der Blick auf den biblischen Kanon als Identitätstext und kulturelles Gedächtnis aller Christen geweitet.
Literaturhinweise
Assmann, Aleida: Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen (GrAA 27), Berlin 2006.
Berek, Matthias: Kollektives Gedächtnis und die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Erinnerungskulturen (KSS 2), Wiesbaden 2009.
Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen: Eine Einführung. Stuttgart 22017.
Gudehus, Christian; Eichenberg, Ariane; Welzer, Harald (Hg.): Gedächtnis und Erinnerung: Ein interdisziplinäres Handbuch Stuttgart 2010.
I.2 Individuelle Erinnerung
Das zweite Kapitel zeigt, dass Erinnerung und soziale Identität eng miteinander verknüpft sind. Ausgehend von unterschiedlichen Systemen individuellen Erinnerns wird deutlich, dass persönliche Erfahrungen nicht nur anhand sozialer Rahmen wahrgenommen und gewertet werden, sondern auch die Weitergabe von persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen in Abhängigkeit von sozialen Rahmen erfolgt und meist im Medium einer Geschichte weitergegeben wird.
Alltagskommunikation und die Weitergabe von Erfahrungen
Beginnen wir unsere Erkundung der Welt der individuellen Erinnerung und ihrer Weitergabe mit einer alltäglichen Szene, die ein Klassiker im weiten und komplizierten Feld der Beziehungskommunikation ist und in dieser oder ähnlicher Form in einer Soap Opera oder romantischen Komödie stattfinden könnte. Zwei Freundinnen treffen sich und eine der beiden hat gerade jemanden kennengelernt. Der standardisierte Dialog könnte folgendermaßen klingen:
Weißt du, er ist einfach wunderbar.
Klingt prima. Wie ist er denn so?
Er ist einfach großartig
Und das heißt…?
Nichts. Er ist einfach nur großartig.
Großartig! Und wie genau? Erzähl mal…
Weißt du, er ist einfach phantastisch. Genau der Mann, ich mir immer gewünscht habe.
Es ist offensichtlich, dass dieses Gespräch nirgendwohin führt. Die beiden Freundinnen bekommen keine Verbindung, zumindest reden sie in diesem Teil des Gespräches aneinander vorbei. Um einen gemeinsamen Nenner zu finden und im Gespräch tatsächlich einen Kontakt herzustellen, braucht es mehr als enthusiastische Worte derjenigen, die gerade Mr. Fabulous getroffen hat. Es braucht Bilder, Metaphern oder Geschichten, an die ihre Freundin mit der eigenen Erfahrung anknüpfen kann.
Das Gespräch der beiden wird sich dann irgendwann von Beschreibungen wie „wunderbar“, „großartig“ und „fantastisch“ wegbewegen und gewöhnlich mündet diese Bewegung in eine Anekdote, die über den Neuen erzählt wird. Das könnte dann ungefähr so klingen:
Oh Mann, er ist einfach so unglaublich aufmerksam. Ich hatte ihn schon öfter mal wo gesehen, aber er hat es irgendwie hingekriegt, dass wir uns an dem Tag im Supermarkt treffen. Du weißt ja, wie ich mich beim Einkaufen anstellen kann, wenn ich nicht so genau weiß, was ich will. Der Typ schien meinen nicht vorhandenen Einkaufszettel besser zu kennen als ich, denn er hat genau vor meinen Lieblingsnudeln gestanden und mich angelächelt. Echt jetzt. Und bevor ich wusste, ob ich lieber Spaghetti oder Linguine nehmen soll, hatte er die Packung schon in der Hand, strahlte mich an und sagte „Wir wär’s damit? Für die Sauce hätte ich auch eine Idee…“
Zugegeben, spätestens an diesem Punkt sind wir mitten im Klischee angekommen und man hat genügend Fantasie, sich die Szene in all’ ihrer romantischen Peinlichkeit vorzustellen. Das ist kein Wunder, denn wir haben es hier mit einer genretypischen Szene zu tun und im Grunde wartet man bei entsprechenden Filmen nur darauf, dass genau so etwas passiert.
Das ist im wahren Leben nicht viel anders, denn die kulturellen Kontexte einer Gesellschaft, zu der auch Literatur und Film gehören, prägen als Muster die Erwartungen an bestimmte Situationen. Die erste Begegnung mit dem Partner fürs Leben – und fast jeder könnte im ersten Moment dieser besondere Mensch sein – sollte filmreif sein. Zumindest aber so, dass man sie als gute Story erzählen kann.
Was die geschilderte Szene interessant macht, ist die Tatsache, dass eine der Gesprächspartnerinnen nicht einfach nur erzählt, was passiert ist, sondern direkt eine Interpretation der Ereignisse aus ihrer Perspektive liefert: „Er ist einfach so unglaublich aufmerksam“. „Er hat es irgendwie hingekriegt…“ „Der Typ schien meinen nicht vorhandenen Einkaufszettel besser zu kennen…“ – Die Interpretation der Szene im Supermarkt hätte auch ganz anders ausfallen können, doch das wird die Version sein, die weitererzählt wird und an die sich alle erinnern. Sie wird wahrscheinlich auch die Fassung sein, die als Schlüsselmoment der Beziehung bei der Hochzeit der beiden zum Besten gegeben wird.
Wie unterschiedlich die Perspektive auf die geschilderte Szene ausfallen kann, wird in dem Moment klar, in dem das Paar sich trennt. Sowohl die erste Begegnung und der Beginn der Liebesgeschichte als auch die Trennung wird gewöhnlich anhand kleiner Geschichten weitergegeben. Die Begegnung im Supermarkt hat sich nicht verändert, doch sie wird nach einer Trennung völlig anders dargestellt. Zum Beispiel so:
Wie geht es Mr. Fabulous? Ich habe Euch schon eine Ewigkeit nicht gesehen.
Ey, hör mir bloß mit dem auf. Das ist zum Glück aus und vorbei.
Ernsthaft? Ich dachte, dass Ihr wie füreinander geschaffen seid.
Ja, wie Feuer und Wasser.
Ach komm, der aufmerksamste Mensch, den du dir vorstellen kannst?
Der Typ ist nicht aufmerksam, sondern einfach nur dominant. Erinnerst du dich an die Geschichte, als wir uns im Supermarkt zum ersten Mal getroffen haben? Schon damals hat er mich doch einfach nur bevormundet mit dieser blöden Spaghettipackung…
Wenn man von den standardisierten Klischees absieht, lässt sich von Alltagsbegegnungen und alltäglichen Gesprächen dieser Art durchaus etwas lernen. Zum einen, dass der Moment, in dem sich Gesprächspartner ernsthaft begegnen und wirklich ins Miteinandersprechen kommen, oft der Moment ist, in dem Bilder, Erfahrungen oder Erzählmuster auftauchen, mit denen beide Gesprächspartner etwas verbinden. In diesem Fall war es das Klischee der ersten Begegnung im Supermarkt. Diese Szene diente nicht nur dazu, vom ersten Treffen und Kennenlernen zu erzählen, sondern auch dazu, die Erfahrung ins Wort zu bringen, wie es ist, jemanden kennenzulernen, der sehr bald ein besonders wichtiger Mensch geworden ist. Sie zeigte auch, dass das gleiche Ereignis, die gleiche Begegnung, unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden kann und die jeweilige Wahrnehmung und Wertung etwas mit der Perspektive und den Bedürfnissen der betroffenen Person zu tun haben. Beide Spuren werden wir weiterverfolgen.
Als dritte Erkenntnis aus dem Alltagsgespräch kommt hinzu, dass die Weitergabe von Erfahrung immer eine passende sprachliche Einkleidung braucht. Die alltäglichste und am weitesten verbreitete Form der Erfahrungsweitergabe ist die Geschichte. Das hat eine Menge damit zu tun, dass Menschen ihre Erfahrungen in der Form organisieren und erinnern, die episodisches Gedächtnis genannt wird. Im episodischen Gedächtnis werden – im Gegensatz zum semantischen Gedächtnis, das nur rohes Datenmaterial wie Zahlen, Daten oder Formeln speichert – Erfahrungen in Form von Geschichten enkodiert und mit emotionalen Markern versehen. Ein Großteil unserer Erfahrungen ist im episodischen Gedächtnis gelagert und wird im Medium der Geschichte geteilt und weitergegeben.
Alltagserfahrungen
Es braucht Bilder, Metaphern oder Geschichten, an die andere mit ihrer eigenen Erfahrung anknüpfen können.
Oft erfüllen Anekdoten (Geschichten) diesen Zweck.
Kulturelle Kontexte einer Gesellschaft prägen als Muster die Erwartungen an bestimmte Situationen.
Erfahrungsgeschichten sind perspektivisch gebunden.
Ein Großteil der menschlichen Erfahrungen ist im episodischen Gedächtnis gelagert und wird im Medium der Geschichte geteilt und weitergegeben.
Analoge Beobachtungen lassen sich in den Erzählungen der neutestamentlichen Texte machen.
Erfahrung, Erinnerung und narrative Versprachlichung: Geschichten erzählen
Die Speicherung und Weitergabe von Erfahrungen in Form von Geschichten ist keine neuere Errungenschaft moderner Menschen, sondern das, was man auch eine anthropologische Konstante nennt. Sprich: Da die neuronalen Grundlagen sich seit Jahrtausenden nicht verändert haben, ist der Prozess der narrativen Erinnerung und Weitergabe von Erfahrungen etwas, das wir mit unseren Vorfahren teilen und was sich daher auch gut begründet für die Menschen in der Antike annehmen lässt. Entsprechend lässt sich die gleiche Beobachtung auch für die Erzählungen in den Evangelien machen.
Spinnen wir daher den Faden aus dem Alltagsbeispiel weiter. Ein Gespräch zwischen jemandem, der Jesus in Galiläa begegnet ist und jemand, der Jesus noch nicht kennt, ließe sich auf der Grundlage des Musters gut vorstellen und könnte folgendermaßen klingen:
Stell dir vor: Wir haben es endlich geschafft, diesem Jesus zuzuhören. Er ist wirklich beindruckend!
Was sagt er?
Er ist ganz einfach überwältigend. Ihn zu treffen und ihm zuzuhören, hat unser Leben völlig verändert. Er ist einfach authentisch. Der lehrt mit echter Autorität, nicht so wie diese Schriftgelehrten.
Das klingt gut. Aber was sagt er denn genau? Was ist seine Botschaft?
Dieser fiktive Dialog klingt nicht zufällig so ähnlich wie Mk 1,21–22f.Mk 1,21–22f. Das ganze erste Kapitel des Markusevangeliums und ein Großteil des zweiten und dritten Kapitels erzählen nicht explizit, was Jesus lehrt, sondern lediglich, welchen Eindruck er bei den Zuhörern hinterlässt. Das Markusevangelium erzählt davon, dass seine Hörer überwältigt (ekplessō, ἐκπλήσσω, 1,22Mk 1,22 ; 6,2Mk 6,2 ; 7,37Mk 7,37 ; 11,18Mk 11,18 ), erschreckt (thambeō, θαμβέω, 1,27Mk 1,27 ; 9,15Mk 9,15 ) und außer sich (existēmi, ἐξίστημι, 2,12Mk 2,12 ; 3,21Mk 3,21 ; 5,42Mk 5,42 ; 6,52Mk 6,52 ) oder schlicht erstaunt und verwundert (thaumazō, θαυμάζω, 5,20Mk 5,20 ; 12,18Mk 12,18 ) von Jesu Lehre sind. Was er genau lehrt, erfahren die Leser jedoch nicht.
Der Inhalt von Jesu Lehre wird erst vergleichsweise spät im Evangelium thematisiert. Die ersten Kapitel werden von der Wirkung Jesu auf seine Zuhörer dominiert, nicht von dem, was er sagt. Jesus wird als charismatische und enigmatische Person mit Autorität vorgestellt: Nach dem Prolog erfahren die Leser wie Jesus die ersten Jünger, Simon und Andreas (1,16–18Mk 1,16–18 ) und Jakobus und Johannes (1,19–20Mk 1,19–20 ) beruft. Als die kleine Gruppe Kafarnaum erreicht, lehrt Jesus in der dortigen Synagoge am Sabbat (1,21–22Mk 1,21–22 ), treibt einen unreinen Geist aus (1,23–28Mk 1,23–28 ), heilt die Schwiegermutter des Simon (1,29–31Mk 1,29–31 ) und nachdem der Sabbat vorüber ist, alle Kranken und Besessenen der Stadt. Früh am Morgen zieht sich Jesus in die Einsamkeit zum Gebet zurück (1,35Mk 1,35 ), wird aber sehr bald gefunden, da jedermann nach ihm sucht und fragt (1,36–37Mk 1,36–37 ).
Bis zu diesem Punkt in der Geschichte haben die Leser Jesus noch nicht besonders viel sagen hören, abgesehen vom Ruf an Simon und Andreas Hierher, hinter mich und ich werde euch zu Fischern von Menschen machen (1,17Mk 1,17 ) und der Bedrohung des Dämons Sei verstummt und komm heraus aus ihm(1,25Mk 1,25 ). Es mutet vor diesem Hintergrund fast schon unlogisch an, wenn Jesus zu denen, die ihn am folgenden Morgen finden, sagt: Lasst uns anderswohin gehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich ausgegangen (1,38Mk 1,38 ). Die Leser fragen sich womöglich noch immer, worin Jesu Botschaft denn eigentlich besteht.
Die Erzählstimme fasst zusammen: Und er ging durch ganz Galiläa, verkündigte in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus (1,39Mk 1,39 ). Bis hierher haben die Leser schon mehrfach gehört, dass Jesus in den Synagogen verkündigt (1,22Mk 1,22 .27f.Mk 1,27f. 39Mk 1,39 ) und dass er das mit Vollmacht tut, doch sie wissen noch immer nicht, was er eigentlich sagt. Der Eindruck, den Jesus hinterlässt, wird deutlich beschrieben, während der Inhalt seiner Reden unklar bleibt. Antike Leser scheinen dieselbe Beobachtung gemacht zu haben und ebenfalls nicht so recht zufrieden damit gewesen zu sein. Es spricht Bände, dass Matthäus die Bergpredigt (Mt 5,1–7,29Mt 5,1–7,29 ) genau nach Mk 1,21Mk 1,21 in seinen Erzählfaden einfügt, bevor es heißt, dass die Zuhörer von seiner Lehre überwältigt waren, da er mit Vollmacht lehrte, nicht wie die Schriftgelehrten. Lukas fügt an der gleichen Stelle Jesu erste Rede oder, wie es in der Sekundärliteratur manchmal heißt, seine „Antrittspredigt“ in Nazaret (Lk 4,16–30Lk 4,16–30 ) ein.
Der fiktive Dialog über Jesus könnte auch folgendermaßen ausgesehen haben:
Stell dir vor: Wir haben es endlich geschafft, diesem Jesus zuzuhören. Er ist wirklich beeindruckend!
Wie ist er denn so?
Er ist ein charismatischer Mensch mit großer Autorität, nicht wie diese Schriftgelehrten. Er gebietet den Dämonen und sie gehorchen ihm. Stell’ dir vor, was am letzten Sabbat in der Synagoge passiert ist…
In dieser Version wird eine Geschichte erzählt, oder zumindest ein kulturelles Muster eingespielt, mit dem beide Gesprächspartner etwas verbinden. Wenn man sich die Bedeutung von Dämonen und Besessenheit und die Angst davor, die in der Antike weit verbreitet war, vor Augen führt, gibt es kaum eine bessere Möglichkeit, die lebensverändernde Begegnung mit Jesus in eine Geschichte zu verpacken.
So gelesen, sind die Exorzismen und Heilungserzählungen der Evangelien nicht (einfach) Berichte von Exorzismen und Heilungen, sondern Reflektionen über die heilsame und befreiende Begegnung mit Jesus in Form einer Wundererzählung. Berufungsgeschichten folgen einem ähnlichen Muster: Sie erzählen von der lebensverändernden Begegnung mit Jesus im Medium einer Berufungsgeschichte, die – zumindest im Markusevangelium – nicht ohne weitere Zusatzinformationen verständlich ist. Warum sollten erwachsene Fischer jemandem folgen, den sie noch nie zuvor gesehen haben und der ihnen das seltsame Versprechen gibt, sie zu „Fischern von Menschen“ zu machen? Diese Geschichten erschließen sich erst in der Retrospektive: als Versuche, die Erfahrung der heilenden und befreienden Nähe Gottes im Medium sozial akzeptierter narrativer Interpretationsmuster zu versprachlichen.
Anders formuliert: Menschen haben Erfahrungen mit Jesus gemacht. Die Begegnung mit ihm und seiner Botschaft hat ihr Leben verändert, und sie wollen diese Erfahrung weitergeben. Von 1,16Mk 1,16 an lesen sich die ersten Kapitel des Markusevangeliums als Erzählungen von solchen Erfahrungen. Die Episoden, die in den ersten Kapiteln zusammengeführt werden, geben wenig Auskunft darüber, wer Jesus ist und worin seine Botschaft besteht, doch sie verdeutlichen ganz klar, welche Erfahrungen Menschen mit ihm gemacht haben, welchen Eindruck er bei ihnen hinterlassen hat.
In der Literatur ist der Zusammenhang zwischen Erfahrung und narrativer Versprachlichung ebenfalls bekannt und wurde von einer Reihe von Schriftstellern explizit thematisiert. „Ein Mann hat eine Erfahrung gemacht und nun sucht er nach der Geschichte seiner Erfahrung […]. Man kann nicht mit einer Erfahrung leben, die ohne eine Geschichte bleibt.“1 Der Schweizer Autor Max FrischFrisch, Max hat in seinem Roman Mein Name sei Gantenbein kongenial vorweggenommen, was später durch neurowissenschaftliche und kulturwissenschaftliche Forschung bestätigt wurde: Menschliche Erfahrung wird narrativ versprachlicht und verarbeitet. Als Schriftsteller war Max FrischFrisch, Max geradezu besessen von der Beziehung von Erfahrung, Wahrheit und Fiktion. Neben seinem literarischen Werk hat er diese Fragestellung in mehreren Vorlesungen, Gesprächen und Interviews thematisiert.
An einer Stelle sagt FrischFrisch, Max :
Geschichten gibt es nur von außen. Unsere Gier nach Geschichten, woher kommt sie? Man kann die Wahrheit nicht erzählen. Das ist’s. Die Wahrheit ist keine Geschichte, sie hat nicht Anfang und Ende, sie ist einfach da oder nicht, sie ist ein Riß durch die Welt unseres Wahns, eine Erfahrung, aber keine Geschichte.2
Die Vorstellung ist so einfach wie bestechend. In einem anderen Interview führt er aus:
„Was wir in Wahrheit haben, sind Erfahrungen, Erlebnismuster. Nicht nur, indem wir schreiben, auch indem wir leben, erfinden wir Geschichten, die unsere Erlebnismuster ausdrücken, die unsere Erfahrung lesbar machen.“3
Die verkürzte Version dieses Gedankens lautet:
„Die Erfahrung will sich lesbar machen. Sie erfindet sich ihren Anlass. Und daher erfindet sie mit Vorliebe eine Vergangenheit.“4
Ein ähnlicher Ansatz findet sich auch in Georges SimenonsSimenon, Georges literarischer Fiktion Maigrets Memoiren:
Die Wahrheit wirkt niemals wahr. […] Erzählen Sie irgendjemandem irgendeine Geschichte. Wenn Sie sie nicht frisieren, wird man sie unglaubwürdig und unecht finden. Aber wenn Sie sie frisieren, wird sie echter wirken, als sie eigentlich ist.“5
FrischsFrisch, Max Erkenntnisse sind zwischenzeitlich sowohl von der neurowissenschaftlichen als auch von der kulturwissenschaftlichen Forschung bestätigt worden, insbesondere, was den Bereich der Erinnerung und der Weitergabe von Erinnerungen betrifft, den wir uns nun genauer anschauen.
Semantisches und episodisches Gedächtnis
Die für die unterschiedlichen Erinnerungsprozesse von Individuen relevante Unterscheidung zwischen semantischem und episodischem Gedächtnis stammt aus der Neurologie. Auf der Basis der Forschung von Endel Tulving werden die höheren Systeme des Langzeitgedächtnisses in zwei Kategorien unterteilt: episodisches und semantisches Gedächtnis. Semantisches Gedächtnis bezeichnet dabei den Bereich der Daten ohne Kontext wie mathematische Gesetze oder Vokabeln. All jene Fakten also, die jeder erwachsene Mensch sich im Laufe seines Lebens angeeignet hat. Im semantischen Gedächtnis werden diese Fakten ohne den Kontext, in dem sie gelernt wurden, gespeichert. Die Anwendung von Vokabeln auf einen fremdsprachlichen Text funktioniert, ohne dass man sich die dazugehörige Situation oder Lernstrategie bewusstmacht. Diese Art der Information ist wiederum im episodischen Gedächtnis abgelegt. Dieses Gedächtnissystem speichert nicht nur Erfahrungen an sich, sondern auch die mit ihnen verbundenen Zeiten und Orte und in vielen Fällen auch die emotionale Bewertung der entsprechenden Situation.
Das semantische Gedächtnis kann verstanden werden als Speicher des persönlichen Weltwissens einer Person und hat den Charakter einer Enzyklopädie. Gelernte Daten werden sicher und verlässlich gespeichert und können gewöhnlich auch nach längeren Zeiträumen ohne nennenswerte Veränderung wieder aufgerufen werden. Das ist im Bereich des episodischen Gedächtnisses, das einen dynamischen Charakter hat, nicht der Fall. Das Aufrufen von episodischen Erinnerungen ist nicht der gleichen Stabilität unterworfen wie beim semantischen Gedächtnis. Semantisches und episodisches Gedächtnis sind unterschiedliche Systeme: Sie sind in unterschiedlicher Weise organisiert und in unterschiedlichen Bereichen des menschlichen Gehirns lokalisiert.
Abb. I.4: Semantisches und episodisches Gedächtnis
Es ist interessant zu sehen, dass Informationen aus dem episodischen Gedächtnis, wenn sie aufgerufen werden, als vergangenes Wissen wahrgenommen werden, während semantische Informationen als gegenwärtiges Wissen erscheinen.1 Die unterschiedlichen Formen der Erinnerung lassen zudem vermuten, dass die jeweiligen Daten in beiden Systemen abgelegt werden. Das historische Ereignis von 9/11 oder des Falls der Berliner Mauer würde demnach im semantischen Gedächtnis abgelegt, die persönliche Erinnerung daran, was an diesen beiden Tagen geschehen ist, im episodischen Gedächtnis. Der Unterschied wird offensichtlich, wenn das Ereignis aufgerufen wird. Die meisten Menschen wissen sofort, von welchem Datum die Rede ist und können sich gewöhnlich auch erinnern, wo die Nachricht sie erreicht hat und wie sie sich in diesem Moment gefühlt haben. Letzteres ist meist mit Bildern und kurzen Sequenzen verbunden. Diese Sequenzen sind jedoch nicht in einer bestimmten Reihenfolge gespeichert. Es kommt daher häufig vor, dass Erinnerungen, die auf den 11. September 2001 oder den 9. November 1989 datiert werden, eigentlich an einem anderen Tag davor oder danach stattgefunden haben. Einträge im episodischen Gedächtnis werden niemals als „Fakten“ oder „Daten“ gespeichert, wie es im semantischen Gedächtnis der Fall ist. Sie sind gemeinsam mit ihrem Kontext und einem emotionalen Marker als gedeutete Erfahrungen kodiert, nicht als objektive Eindrücke der Situation. Wenn sie im episodischen Gedächtnis eingespeichert werden, sind die Episoden bereits vom persönlichen Erfahrungssystem und den persönlichen Standards semantisiert und diese Interpretation bleibt erhalten, wenn sie wieder aufgerufen werden.
Sowohl der Prozess der Einschreibung als auch der Prozess des Wiederaufrufens verläuft nicht störungsfrei. William Stern hat bereits um 1900 herum festgehalten: „fehlerlose Erinnerung ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme“2. Erweitertes Wissen über die unterschiedlichen Erinnerungssysteme und neurowissenschaftliche Forschung haben diese Vermutung bestätigt und der Vorstellung von Erinnerung in hieratischen Blöcken ein Ende gesetzt. Unter Gedächtniswissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen herrscht mittlerweile breiter Konsens, dass Erinnerung nicht reproduziert, sondern erschafft.3 Der Aufruf von Einträgen aus dem episodischen Gedächtnis ähnelt daher weniger dem Gang ins Archiv, um ein bestimmtes Bild hervorzuholen, als mehr einer Neuanfertigung dieses Bildes. Im Prozess der (Re-)Konstruktion wird dieses Bild ebenso wie schon beim Prozess der Enkodierung semantisiert – und dabei sehr oft auch verändert. Das erklärt Phänomene wie gegenläufige oder falsche Erinnerungen. Störungen der Erinnerungsprozesse sind notwendige Mechanismen bei der Auswahl und Organisation von Erinnerungen. Diese Prozesse finden völlig unbewusst auf der Ebene des Gehirns statt. Die überwiegende Mehrzahl der Menschen erinnert sich nicht absichtlich falsch oder gar nicht, sondern nach den jeweiligen Standards und Grenzen des eigenen Gehirns.
Der französische Soziologe Maurice HalbwachsHalbwachs, Maurice , der im nächsten Kapitel genauer vorgestellt wird, hat die These entfaltet, dass individuelle Erinnerung vom jeweiligen sozio-kulturellen Umfeld geprägt ist. Auch dieser Ansatz nahm spätere Forschung vorweg. Halbwachs vermutete zu Recht, dass die persönliche Erinnerung des Individuums mit dem kollektiven Gedächtnis seiner Peer Group interagiert. Er versteht Erinnerung als soziales Phänomen, das von außen in eine Person hineinwächst und durch die Art und Weise geformt wird, wie das Individuum seine Umwelt, insbesondere nahe Bezugsgruppen wie die Familie oder die eigene Religionsgemeinschaft, erlebt. Individuelle Erinnerung ist daher von der Sprache und den Vorstellungen der jeweiligen Bezugsgruppe, aber auch deren Kommunikationsmustern und Werthaltungen geprägt und geformt. Individuelles Erinnern findet Halbwachs zufolge immer in sozialen Rahmen statt. Diese sozial vermittelten Referenzrahmen dienen als Regulierungsmechanismen für die persönliche Wahrnehmung und Wertung.
In der Konsequenz sind Erinnerung und Identität untrennbar miteinander verbunden. Das gilt sowohl für Individuen als auch für Gruppen und betrifft auch das Teilen und Weitergeben von Erfahrungen. Nicht nur die Erfahrung selbst wird im Einklang mit bestimmten sozialen Rahmen erinnert und semantisiert, sie wird auch entsprechend der geltenden kulturellen Muster und sozialen Rahmen weitergegeben. Wir können das Diktum von Max FrischFrisch, Max daher folgendermaßen erweitern: DieErfahrung will sich lesbar machen. Sie erfindet sich ihren Anlaß. Und daher erfindet sie mit Vorliebe eine Vergangenheit im Einklang mit akzeptierten sozialen Rahmen.
Körperliches Gedächtnis und ausgelagertes Gedächtnis
Neben semantischem und episodischem Gedächtnis unterscheiden Gedächtnisforscher im Anschluss an die Arbeiten von Tulving mittlerweile insgesamt fünf unterschiedliche Langzeitgedächtnissysteme.1 Zum semantischen Gedächtnis (auch Wissenssystem) und zum episodischen oder autobiographisch-episodischen Gedächtnis treten mit dem prozeduralen Gedächtnis, dem perzeptuellen Gedächtnis und dem Priming drei weitere Gedächtnissysteme hinzu. Die unterschiedlichen Systeme entwickeln sich nach den Erkenntnissen der Forschung aufeinander aufbauend ab dem Babyalter. Das episodisch-autobiographische Gedächtnis, das es nach bisherigem Kenntnisstand nur bei Menschen gibt, entsteht also zum Schluss, beginnend etwa mit dem 4. Lebensjahr. Semantisches und episodisches Gedächtnis unterscheiden sich von den anderen drei Systemen des Langzeitgedächtnisses in einem entscheidenden Punkt: Einträge in diesen Gedächtnissystemen können externalisiert oder ausgelagert werden, während es sich bei den anderen drei Formen um Körpergedächtnis handelt.
Abb. I.5: Die unterschiedlichen Gedächtnissysteme im Überblick. Aus: MarkowitschMarkowitsch, Hans J. , Hans: Das Gedächtnis. Entwickung, Funktion, Störungen. München 2009, 73.
Die Möglichkeit der Auslagerung von Gedächtnisinhalten, beispielsweise in Form von Schrift, hat das menschliche Gedächtnis weder ersetzt, noch, wie schon Platon befürchtete, verkümmern lassen, sondern seinen Umfang eher erweitert. „Der externe Speicher der Aufzeichnungen“, heißt es bei AleidaAssmann, Aleida Assmann, „dehnt das Gedächtnis und entlastet es zugleich; wodurch eine unausweichlich wachsende Diskrepanz zwischen dem verkörperten Gedächtnis und dem externen Archiv entsteht“2. Solche externen Archive sind zunächst einmal nicht mehr als Speicher, aus denen sich Daten abrufen lassen. Das Wissen, wo sich im Zweifel etwas nachschlagen lässt, ersetzt das verkörperte Wissen nicht. Platon hat zu Recht darauf hingewiesen, dass Speichermedien das funktionale Wissen nicht ersetzen können. Dass sich auf verkörpertes Wissen auch in Zeiten schier unbegrenzter Datenspeicher nicht verzichten lässt, verdeutlicht ein Alltagsbeispiel: Auch wenn Ärzte alle Wissensbestände grundsätzlich nachschlagen könnten, wird man doch lieber die Ärzte aufsuchen, die nicht erst nachschlagen müssen, welche Knochen oder Organe wo genau angesiedelt sind und welche Symptome üblicherweise welche Ursache haben. Ausgelagertes und verkörpertes Wissen sind dabei die beiden zentralen Stichworte. Das Wissen einer Gesellschaft und Kultur gliedert sich in ein Speichergedächtnis und ein Funktionsgedächtnis, die sich in den Worten von Aleida AssmannAssmann, Aleida „wie Hintergrund und Vordergrund zueinander verhalten“ – oder wie das, was man in Kopf hat, sich zu dem Wissen verhält, das man im Lexikon nachschlagen kann.
Abb. I.6: Speicher- und Funktionsgedächtnis
Ein für unsere Gegenwart typischer Irrtum in Bezug auf das eigene Wissen hat mit der Verwechslung von Speicher- und Funktionsgedächtnis zu tun. Viele Menschen, die glauben, dass sie über ein großes Wissen verfügen, haben dieses Wissen nicht im Körpergedächtnis, sondern wissen lediglich, wo sich die entsprechenden Fakten rasch abrufen lassen, sprich: Welchen externen Speicher sie wie befragen müssen. Die Wissensillusion hat sich mit dem mobilen Internet verstärkt, da sich vermittels eines Smartphones länger vermuten lässt, man wisse mehr als man tatsächlich weiß.
AleidaAssmann, Aleida Assmann führt zur Unterscheidung zwischen Speicher- und Funktionsgedächtnis ferner aus:
Im Speichergedächtnis werden Quellen, Objekte und Daten gesammelt und bewahrt, unabhängig davon, ob sie von der Gegenwart gerade gebraucht werden […]. Das Funktionsgedächtnis ist demgegenüber das aktive Gedächtnis einer Wir-Gruppe. So wie das autobiographische Gedächtnis die Identität eines Individuums stützt, stützt das kulturelle Funktionsgedächtnis die Identität eines Kollektivs. Es enthält eine Auswahl aus der Fülle der überlieferten Bestände, die für die Identität dieser Gruppe relevant ist.3
Die Ausführungen lassen erkennen, dass es nicht nur die Möglichkeit des verkörperten und des ausgelagerten Wissens in Speicher und Funktionsgedächtnis, sondern neben dem individuellen Gedächtnis jedes einzelnen Menschen auch so etwas wie ein kollektives Gedächtnis gibt. Individuelles und kollektives Gedächtnis sind miteinander verbunden und können dennoch voneinander unterschieden werden.
Mit den Formen des kollektiven Gedächtnisses beschäftigt sich das nächste Kapitel. Für den Augenblick genügt es festzuhalten, dass die Unterscheidung zwischen Speicher- und Funktionsgedächtnis für die Arbeit mit der hermeneutischen Kategorie der Erinnerung in der Bibelwissenschaft relevant ist, weil beim Ausgriff auf vorausliegende Tradition (das, was als kulturelles Gedächtnis bezeichnet wird) immer wieder Einträge aus dem Speichergedächtnis in das Funktionsgedächtnis geholt werden. Das betrifft beispielsweise die Verwendung alttestamentlicher Traditionen in neutestamentlichen Texten oder auch Verweise auf Praktiken der frühen Kirche in aktuellen theologischen Diskussionen. Die dabei aufgerufenen – und damit aktualisierten – Daten oder Wissensbestände waren nicht „vergessen“, sondern lediglich kein Teil des Funktionsgedächtnisses (mehr), während sie im Speichergedächtnis weiterhin zugänglich waren. Durch ihre Einführung in den jeweiligen Zusammenhang werden sie aktualisiert und dem Arbeitsgedächtnis einer Gruppe wieder zugänglich gemacht. Ob sie dort bleiben oder wieder „vergessen“ werden – also ins Speichergedächtnis zurückehren – ist für jeden Fall neu auszuhandeln.
Literaturhinweise
Assmann, Aleida: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 1999.
Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung, Stuttgart 32017.
Huebenthal, Sandra: You can’t live with an experience that remains without a story. Memory theory and how Mark’s Gospel narrates experiences with Jesus, in: Nicklas, Tobias; Kelhoffer, James A. (Hg.): The Gospel of Mark in its historical and theological context, Tübingen 2022 (im Erscheinen).
Markowitsch, Hans J.: Das Gedächtnis. Entwicklung, Funktionen, Störungen, München 2009.
Welzer, Harald: Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung, München 22008.
I.3 Formen sozialer Erinnerung
Während die Existenz des individuellen Gedächtnisses weithin unbestritten ist, wurde (und wird) die Existenz kollektiver Gedächtnisse immer wieder infrage gestellt. Das dritte Kapitel stellt den französischen Soziologen Maurice HalbwachsHalbwachs, Maurice , der die Begriffe des sozialen und kollektiven Gedächtnisses in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in den sozialwissenschaftlichen Diskurs eingebracht hat, als Vater der sozialen Gedächtnisforschung vor. Um die hermeneutische Kategorie der Erinnerung in der Bibelwissenschaft anwenden zu können, ist es nötig, den Ansatz von Maurice Halbwachs und seine Weiterentwicklung durch AleidaAssmann, Aleida und Jan AssmannAssmann, Jan zu kennen.
Soziales und kollektives Gedächtnis (Maurice HalbwachsHalbwachs, Maurice )
Das Konzept des kollektiven Gedächtnisses geht auf den französischen Soziologen Maurice HalbwachsHalbwachs, Maurice zurück.1 In seinem Werk Les cadres sociaux de la mémoire hat Halbwachs, wie im letzten Kapitel schon angeklungen ist, die These aufgestellt, dass individuelle Erinnerung von sozio-kulturellen Umfeld der jeweiligen Person geprägt ist. Halbwachs nahm an, dass die Erinnerung des Individuums mit den Erinnerungen der anderen Mitglieder seiner Bezugsgruppe interagiert. Erinnerung wird dadurch zum sozialen Phänomen: Sie wächst gewissermaßen von außen in das Individuum hinein. Für die persönliche Erinnerung spielen wichtige Bezugsgruppen wie die eigene Familie oder Religionsgemeinschaft demnach eine besondere Rolle. Das Gedächtnis des Einzelnen ist durch Sprache und Begrifflichkeit, aber auch durch kommunikative Muster und Wertungen der Bezugsgruppe geprägt, wie wir es beispielsweise auch von Soziolekten kennen. Anders formuliert: die sozialen Rahmen und kulturellen Muster, die einen Menschen umgeben, steuern seine Wahrnehmung und Bewertung. Erinnerung ist im Sinne von Halbwachs daher immer ein soziales Phänomen.
In diesem Prozess interagiert die Erinnerung des Individuums mit den Erinnerungen der anderen Mitglieder seiner Bezugsgruppe. Dabei spielen Emotionen eine zentrale Rolle. Aus der neurowissenschaftlichen Forschung ist bekannt, dass Erinnerungsepisoden immer mit den ihnen zugehörigen emotionalen Markern gespeichert werden. HalbwachsHalbwachs, Maurice nahm bereits an, dass die Gefühle, die ein Individuum seiner Bezugsgruppe gegenüber hegt, seine Erinnerung prägen und seine Positionierung innerhalb dieses sozialen Gefüges bestimmen. Gefühle und Affekte wirken dabei gleichermaßen als Auswahlkriterien und Verstärker: Erinnerungen, die mit stärkeren Emotionen aufgeladen sind, erfahren eine höhere Prägnanz und bekommen einen höheren Wert zugeschrieben, als solche die weniger stark emotional aufgeladen sind. Überraschenderweise ist es dabei unerheblich, ob die emotionale Ladung positiv oder negativ ausfällt. Die Erinnerungen erhalten ihre Relevanz innerhalb des sozialen Rahmens aufgrund der emotionalen Marker. Sie eröffnen damit einen weiteren Horizont, der dem Individuum sein Selbstverständnis und seine Identitätskonstruktion durch Interaktion mit der Gruppe und innerhalb der Gruppe ermöglicht. Ohne jeglichen Bezug zu einem sozialen Rahmen, schließt Halbwachs, ist die Ausbildung individueller Erinnerungen und einer individuellen Identität nicht möglich.
Maurice HalbwachsHalbwachs, Maurice geht ferner davon aus, dass Erinnerung die Vergangenheit nicht als solche und am Stück bewahrt, sondern lediglich einzelne Teile der Vergangenheit und dass diese Teile ebenfalls perspektivisch gebunden sind. Diese perspektivische Wahrnehmung, die sich in Gefühlen und Wertungen äußert, betrifft nicht nur den Prozess der Speicherung von persönlichen Erinnerungen im episodischen Gedächtnis, sondern auch ihren Wiederaufruf. Wenn Erinnerungen erneut abgerufen werden, werden die einzelnen Teile demnach nicht einfach wiedergefunden, sondern entsprechend der Bedürfnisse des Individuums, das sie aufruft, neu konstruiert und emotional markiert.
Der Ägyptologe Jan AssmannAssmann, Jan , der in seiner eigenen Forschung zum kollektiven Erinnern auf den Ansätzen von Maurice HalbwachsHalbwachs, Maurice aufbaut, fasst diesen Gedanken folgendermaßen zusammen: „Die Vergangenheit existiert nur als soziale Konstruktion. Sie wird nur erinnert rekonstruiert, insoweit sie gebraucht wird“2. Das heißt auch, dass die Rekonstruktion der Vergangenheit, unabhängig davon, ob sie von einem Individuum oder einer Gruppe vorgenommen wird, nicht ohne kreative Elemente auskommt. Diese kreativen Elemente hängen entscheidend davon ab, in welchem Rahmen die Erinnerung aktualisiert wird. Anders formuliert: Da Erinnerung auch eine funktionale Seite hat, wird die Vergangenheit jeweils nach den Bedürfnissen der Gegenwart konstruiert. Oder wie Max FrischFrisch, Max treffend formulierte: Jede Gegenwart schafft sich die Vergangenheit, die sie braucht.
Diesen sozialen Rahmen nennt HalbwachsHalbwachs, Maurice kollektives Gedächtnis. Der Einzelne verortet seine Erinnerungen in diesem Rahmen, um sie verstehen, interpretieren und kommunizieren zu können. Der Akt der Erinnerung selbst wird dabei jedoch nicht vom Individuum auf die Gruppe übertragen, sondern die Gruppe bietet lediglich den Verstehens- und Deutungsrahmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in der gleichen Weise wie das einzelne Ereignis seinen Platz und seine Bedeutung nur dadurch gewinnt, dass es im Kontext anderer Ereignisse gesehen wird, sich eine Struktur auch nur dann ausbilden und sichtbar werden kann, wenn mehrere Ereignisse verbunden werden. Diese Interdependenz von Ereignis und Struktur hat zur Folge, dass sich soziale Rahmen verändern können – und mit ihnen entsprechend auch die Erinnerungen. Soziale Rahmen und die in ihnen verorteten Erinnerungen sind damit nicht Ein-für-alle-mal, sondern höchst anfällig für Veränderungen. Wenn die Struktur eines sozialen Rahmens von Ereignissen bestimmt wird, haben neue Ereignisse und neue Erkenntnisse das Potential, diesen Rahmen zu verändern.
Abb. I.7: Kollektives Gedächtnis (Maurice HalbwachsHalbwachs, Maurice )
Auch dieser Zusammenhang lässt sich gut anhand eines Alltagsbeispiels erklären. Früher oder später beschäftigt sich fast jeder mit der eigenen Familiengeschichte und fast unweigerlich stößt man dabei auf Überraschungen. Wenn beim Aufräumen des Dachbodens alte Fotoalben oder Briefe aus der Großelterngeneration auftauchen, werfen sie nicht selten ein neues Licht auf die eigene Familie. Solche Erkenntnisse werden über kurz oder lang die Familiengeschichte und Geschichten über die Familie verändern. So wurde in einer befreundeten Familie unlängst erst die Mutter des Großvaters rehabilitiert: Sie galt immer als besonders kaltherzige Frau, weil sie ihren Erstgeborenen nicht selbst aufgezogen, sondern schon als Baby zu Pflegeeltern gegeben hatte. Lange nach dem Tod des Großvaters hat die Familie beim Aufräumen die Familiendokumente genauer angesehen und festgestellt, dass die Urgroßmutter noch keine siebzehn Jahre alt war als der Großvater geboren wurde und dieses Ereignis in einer Stadt weit entfernt von ihrer eigenen Familie, ihrem Arbeitsplatz als Dienstmagd und ihrem sozialen Umfeld stattfand. Dass kein Vater auf der Geburtsurkunde steht, ist fast überflüssig zu erwähnen. Die Vorstellung von der kaltherzigen Frau ist rasch dem Mitleid mit einem jungen Mädchen gewichen, das sich seine Jugend sicher anders vorgestellt hatte und sich kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs in einer fremden Stadt alleine durchschlagen musste.





























