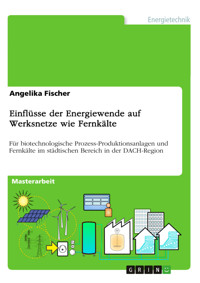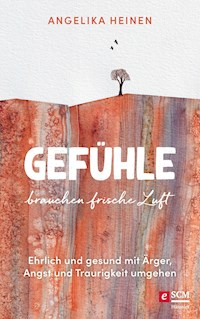
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wir alle wünschen uns ein Leben, das von Freude, Leichtigkeit und harmonischen Beziehungen bestimmt ist. Deswegen versuchen wir viel zu oft, unangenehme Gefühle zu unterdrücken - und verkümmern dabei innerlich. Wie aber können wir gesund mit Ärger, Angst und Traurigkeit umgehen? Und wie passen diese Gefühle mit unserem Glauben und unseren christlichen Werten zusammen? Psychotherapeutin Angelika Fischer zeigt uns die Bedeutung und den positiven Wert unserer Gefühle auf und ermutigt dazu, sie ernstzunehmen und auszudrücken - denn Gott heißt uns mit all unseren Gefühlen willkommen. Er kennt unser Herz und lädt uns ein, vor ihm schonungslos echt zu sein. Entdecke einen neuen, bejahenden Umgang mit deinen Gefühlen - und erlebe innere Freiheit!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ANGELIKA HEINEN
GEFÜHLE
brauchen frische Luft
Ehrlich und gesund mit Ärger, Angst und Traurigkeit umgehen
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
ISBN 978-3-7751-7574-6 (E-Book)
ISBN 978-3-7751-6121-3 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: CPI books GmbH, Leck
© 2022 SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen
Internet: www.scm-haenssler.de; E-Mail: [email protected]
Soweit nicht anders angegeben, sind die Bibelverse folgender Ausgabe entnommen:
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Weiter wurden verwendet:
Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart (LUT)
Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen
Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft
Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. (NGÜ)
Bibeltext der Schlachter Bibelübersetzung.
Copyright © 2000 Genfer Bibelgesellschaft.
Wiedergegeben mit der freundlichen Genehmigung.
Alle Rechte vorbehalten. (SLA)
Lektorat: Esther Schuster
Titelbild: stocksy (Catherine MacBride, Ireland)
Autorenfoto: Michaela Wohlleber
Gesamtgestaltung: Kathrin Spiegelberg, www.spika-design.de
Inhalt
Über die Autorin
Vorwort
Neue Schöpfung, alte Gefühle?
Das Problem der Christinnen und Christen mit »negativen« Gefühlen
Gefühle – unsere verkannten Schätze
Sieben Grundemotionen
Vier Grundbedürfnisse
Gefühle als Botschafter der Bedürfnisse
Wie die Psyche für sich sorgt, wenn wir sie lassen
»Alles gut« – Wie wir uns selbst schaden, wenn wir Gefühle unterdrücken
Gefühle annehmen statt loswerden
»ACT« – der Ansatz der Akzeptanz- und Commitment-Therapie
»Willkommen!« – Gefühle annehmen, verstehen und auf sie eingehen
»Sag es einfach!« – Gefühle ausdrücken in der »Gewaltfreien Kommunikation«
Gefühle eines Christenmenschen
Gott – der fühlende Schöpfer und Vater
Jesus – der fühlende Sohn Gottes
»Mit-Gefühl« – Wie Gott unseren menschlichen Gefühlen begegnet
Die Psalmen – harter Tobak großer Beter
Gefühle brauchen frische Luft
Gebet mal anders
Mehr Sein als Schein – Eine persönliche Erfahrung
Mein größter Wunsch
Dank
Anhang
Wortschatz der Gefühle
Anmerkungen
Über die Autorin
Angelika Heinen (Jg. 1982) lebt im Rheinland und arbeitet dort als Psychotherapeutin in einer Gemeinschaftspraxis. Sie engagiert sich in einer FeG, mag Musik und Schauspielerei und liebt es, im Urlaub mit Kamera und Klettersteig-Set Berge zu erklimmen.
Vorwort
Dass es dieses Buch gibt, ist für mich ein kleines Wunder und immer noch eine große Überraschung. Denn es stand nie auf meiner »Löffel-Liste« (Sie wissen schon: die Liste der Dinge, die man noch tun oder erleben will, bevor man »den Löffel abgibt«), ein Buch zu schreiben. Als die Gelegenheit dazu aber plötzlich »vor meiner Tür stand und laut und deutlich anklopfte«, habe ich mich entschieden, sie hereinzubitten und willkommen zu heißen. Und mir war nach kurzer Zeit klar: Wenn ich schon die Gelegenheit dazu habe, dann schreibe ich auch über mein absolutes Herzens-Thema, das mir persönlich, beruflich, im Freundeskreis und in Gemeinden immer wieder begegnet und so etwas wie ein Feuer in mir anzündet: »Wie kann ich als Christin oder Christ ehrlich, authentisch und gesund mit meinen Gefühlen umgehen?«
Ich kenne gläubige Menschen, die diese Frage überhaupt nicht verstehen, weil es für sie völlig selbstverständlich ist, wütend, traurig oder ängstlich sein zu dürfen – auch als Christin oder Christ. Sie können sich sehr glücklich schätzen! Viel häufiger begegnen mir aber Glaubensgeschwister, die sich damit schwertun, weil sie denken, dass diese Gefühle nicht mit einem tiefen Glauben, einer guten Gottesbeziehung oder einer Nachfolge im Sinne Jesu vereinbar sind. Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Hoffnung, Freude, Glaube, Trost … das sind doch die Kernthemen unseres Glaubens. Ärger, Angst und Traurigkeit haben da nichts zu suchen! Mit dieser Haltung, die oft auch noch durch Bibelverse untermauert wird, geraten Menschen in ernsthafte psychische Nöte, weil sie sich verbieten, das zu empfinden, was sie empfinden. Sie fühlen sich dann schlecht, schuldig oder minderwertig in ihrem Glauben, hinterfragen ihre Gottesbeziehung, schämen sich oder setzen sich unter Druck, mehr beten oder in der Bibel lesen zu müssen. Mir blutet das Herz – nicht nur als Mensch und Christin, sondern auch als Psychotherapeutin –, wenn ich erlebe, wie Menschen unter ihrer Frömmigkeit leiden und auf Dauer hart, bitter, verkrampft oder sogar depressiv werden, weil sie Gefühle »wegsperren« und vor sich selbst und vor Gott nicht zu 100 Prozent ehrlich sind.
In diesem Buch möchte ich eine Brücke bauen zwischen Psychologie und Seelsorge, zwischen Psychotherapie und gelebtem Christsein. Eine Brücke, die hoffentlich einen Weg zu einem gesunden Leben als Christin oder Christ bahnt und dazu ermutigt, auch unangenehme Gefühle anzunehmen, wertzuschätzen und ehrlich auszudrücken. Ich wünsche mir, dass Sie es als Einladung verstehen, manche festgefügte Überzeugung zu hinterfragen oder sogar zu verändern, um einen neuen Blick auf Ihr (Gefühls-)Leben zu gewinnen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn meine persönliche Erfahrung, die überhaupt erst meine Leidenschaft für dieses Thema geweckt hat, auch für Sie eine Ermutigung wäre, regelmäßig »Ihr Herz zu lüften«. Denn Gefühle brauchen frische Luft!
Angelika Heinen
Neue Schöpfung, alte Gefühle?
Es ist Sonntag, kurz vor 10 Uhr morgens, und ich sitze in der Gemeinde. Gleich beginnt der Gottesdienst. Ich habe mich heute überwinden müssen zu kommen, denn eigentlich war mir gar nicht danach. Die Vorstellung, viele Leute zu treffen und vielleicht sogar noch angesprochen zu werden – »Hey, schön, dich zu sehen! Alles gut bei dir?« –, hat mir Bauchschmerzen bereitet. Es ist gerade gar nicht »alles gut« bei mir. Ich bin traurig. Bedrückt. Nachdenklich. Viele Gedanken kreisen in meinem Kopf, die mir Sorgen machen, die ich aber nicht abstellen kann. Ich weiß, dass diese Gedanken mir nicht guttun. Sie helfen nicht, sie machen nichts besser, teilweise sind sie sogar vollkommen übertrieben und irrational. Aber ich kriege sie nicht weg.
Heute Morgen nach dem Aufstehen habe ich mit mir gerungen: Soll ich wirklich zum Gottesdienst gehen? Mir ist so gar nicht nach Singen zumute. Ich fühle mich nicht nach »Halleluja – du begeisterst mich«1, nach »Lobe den Herrn«2 oder »Oh Happy Day«3. Ich möchte auch eigentlich gar nicht groß gesehen werden und erst recht nicht nach dem Gottesdienst noch bei Kaffee und Keksen mit anderen »nett plaudern«. Aber ich habe eine kleine Hoffnung in mir, dass die Predigt mich vielleicht aus meinen Grübelgedanken und meiner Niedergeschlagenheit herausholen könnte. Dass ich irgendetwas mitnehmen kann, was mich ermutigt, aufbaut oder stärkt. Also sitze ich jetzt hier und harre der Dinge, die da kommen werden. Ich habe mir einen Platz hinten und am Rand der Reihe gesucht und beobachte, wie die anderen Gemeindemitglieder gut gelaunt hereinkommen und sich fröhlich begrüßen. Es wird gelacht, sich umarmt, Komplimente werden ausgetauscht – »Gut siehst du aus! Du strahlst ja richtig heute!« –, und ich war noch nie so froh darüber, von niemandem wahrgenommen zu werden. Wenig später hat jeder seinen Platz gefunden, der Gottesdienst beginnt und ich lasse die Begrüßung der Moderatorin an mir vorbeiziehen: »Was für ein herrlicher Sonntagmorgen …«, »ein Privileg, miteinander Gottesdienst feiern zu dürfen …« Schon oft habe ich solchen Worten von Herzen zugestimmt, aber heute empfinde ich den Morgen nicht als herrlich, den Gottesdienst nicht als Privileg, und in Feierlaune bin ich sowieso nicht.
Die Lobpreislieder, die dann von der ganzen Gemeinde geschmettert werden, sind mir fast ein bisschen zu laut, zu begeistert und sprechen mir so gar nicht aus der Seele. Ich stehe mit allen anderen auf, um mir nichts anmerken zu lassen, bringe aber keinen Ton heraus. Hinter vielen Aussagen in den Liedern steht für mich heute ein großes Fragezeichen: »Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing«4, »Ich lieb dich, Herr«5, »Ich kann nicht anders, als zu singen«6 – wirklich? Alle um mich herum gehen vollkommen auf in der Musik. Sie singen laut mit, klatschen, tanzen oder haben wenigstens ein breites Lächeln im Gesicht. Was ist nicht in Ordnung mit mir? Was stimmt nicht mit mir, dass ich es nicht hinkriege, mitzusingen, Gott zu loben und ihm zu danken? Er ist es doch wert und ich glaube doch an ihn! Was steht denn zwischen mir und ihm, dass mein Herz so zugeschnürt ist und ich mich überhaupt nicht über Gott und seine Liebe freuen kann? Eines haben die Lieder auf jeden Fall verändert: Die Sorgen und Grübelgedanken, mit denen ich gekommen war, sind nun völlig in den Hintergrund gerückt. Stattdessen grübele ich jetzt darüber nach, ob ich nicht richtig glaube oder was ich falsch mache, sodass es mir gerade so geht, wie es mir geht. Und dann denke ich, dass diese Fragen an sich schon falsch sind! Wie kann ich nur im Gottesdienst so egozentrisch um mich und um meine Befindlichkeiten kreisen?! Ich sollte meinen Blick doch auf Gott richten und endlich mit diesem Selbstmitleid aufhören – dann würde es mir bestimmt sofort besser gehen!
Kurz bevor ich an meinen eigenen Gedanken irrewerde, ist der Lobpreisblock endlich vorbei, und der Prediger tritt nach vorne. Wir setzen uns, und noch durstiger als zu Beginn warte ich auf ein paar erfrischende Tropfen Ermutigung oder Trost – irgendetwas, was mein inneres Chaos zur Ruhe kommen lässt und meinen Gedanken eine neue, positive Richtung gibt. »Der Vers, um den es heute gehen soll, steht in Philipper 4,4. Dort heißt es: ›Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch!‹«
Wow, das hat gesessen! Wie ein sauberer, kraftvoller Faustschlag direkt in meine Magengrube! Die weiteren Ausführungen des Predigers kommen gar nicht mehr bei mir an. Ich habe jetzt endgültig zugemacht und kämpfe mit den Tränen. Ich kann das nicht! Vielen anderen Aufforderungen könnte ich problemlos folgen: Ich könnte ohne Weiteres Geld für das Straßenkinderprojekt in Brasilien spenden. Ich könnte für den Gemeindebasar nächsten Monat einen Kuchen backen – von mir aus auch gerne zwei. Ich könnte die ältere Dame aus der Gemeinde besuchen, deren Mann gerade gestorben ist. Ja, von mir aus könnte ich sogar ab und zu im Kindergottesdienst aushelfen oder den Küchendienst koordinieren. Aber was ich nicht kann, ist, mich jetzt und hier »im Herrn zu freuen«!
Wahrscheinlich bin ich hier einfach fehl am Platz. Wahrscheinlich habe ich die »Frohe Botschaft« noch gar nicht verstanden. Wahrscheinlich habe ich einen zu kleinen Glauben. Wahrscheinlich lese ich zu wenig in der Bibel. Wahrscheinlich mache ich viel zu wenig »Stille Zeit«. Wahrscheinlich steht noch irgendeine Sünde zwischen mir und Gott … Ich harre irgendwie bis zum Ende des Gottesdienstes aus und stehle mich dann schnell und unauffällig davon. Wahrscheinlich … bleibe ich nächstes Mal einfach besser zu Hause!
Kennen Sie so etwas? Dass eine Predigt, ein Bibelvers oder fröhliche Lobpreismusik genau das Gegenteil von dem bewirkt, was wir uns eigentlich erhoffen – und was augenscheinlich bei allen anderen funktioniert? Ich persönlich habe das nicht nur einmal erlebt. Und wenn ich genau hinschaue, dann hatte es immer mit etwas zu tun, das ich den »frommen Anspruch an unsere Gefühlswelt« nennen möchte. Je nachdem, wie wir geprägt sind, stellen wir an uns und andere bestimmte Ansprüche, wie man als Christ oder Christin handeln, sprechen, denken und fühlen sollte. Überlegen Sie doch einmal, wie Sie folgenden Satz weiterführen würden: »Als Christin bzw. Christ will ich/sollte ich/muss ich nicht/darf ich nicht …« Auf diese Weise entdecken Sie vielleicht Ihre eigenen bewussten oder auch unbewussten Ansprüche an Menschen, die sich als Christin oder Christ bezeichnen.
Es würde ein ganz eigenes Buch füllen, wollte man sich fragend mit den Geboten, Regeln und Normen im Leben eines Christen oder einer Christin auseinandersetzen. Ich möchte aber hier gerne den Fokus auf einen Bereich richten, der nach meinem Empfinden noch etwas komplexer ist. Es ist nicht besonders schwierig für mich, als Christin nicht zu betrügen, hilfsbereit zu sein oder niemanden absichtlich zu verletzen. Das kostet mich zwar manchmal vielleicht Überwindung oder Zurückhaltung, aber ich kann mich dazu entscheiden und danach handeln. Doch was mache ich mit all den Erwartungen und Ansprüchen an meine Gefühle? Wenn ich mich einfach entscheiden könnte, mich »allezeit zu freuen«, würde ich das ja gerne tun – und wer würde das nicht? Aber ich kann nun mal nicht meine Gefühle wie an einem Mischpult regeln, wo ich die Tiefen herunter- und die Höhen hochdrehen kann. Die Frage ist allerdings: Muss ich das überhaupt? Bin ich als Christin verpflichtet, mich immer gut zu fühlen? Ist eine Christin per definitionem immer zufrieden, fröhlich, positiv oder wenigstens dankbar? So zugespitzt gefragt würde es wahrscheinlich niemand bejahen. Aber wie komme ich überhaupt auf so eine Frage?
Auf meinem bisherigen Lebens- und Glaubensweg habe ich die unterschiedlichsten christlichen »Landschaften« gesehen und kennengelernt: die katholische Kirche, evangelische Landeskirchen und viele verschiedene freikirchliche evangelische Gemeinden. Und sosehr sie sich auch in ihrer Theologie, ihren Strukturen und in der Form ihrer Gottesdienste unterschieden – so bin ich doch überall Menschen begegnet, die seit ihrer Entscheidung für Jesus scheinbar nur noch schöne, positive Dinge erlebten. Ich hörte sie niemals klagen, und wenn wir uns unterhielten, hatten sie immer Grund zu Freude und Dankbarkeit. Immer ein Loblied auf den Lippen, immer erfüllt von Gottes Liebe! Sie beriefen sich dabei oft auf Bibelverse wie »Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch!« (Philipper 4,4), »Sagt in allem Dank! Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch« (1. Thessalonicher 5,18), »Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat! Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm!« oder »Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke« (Nehemia 8,10; LUT), um nur einige Beispiele zu nennen. Ich mag solche Verse. Sehr sogar! Und ich habe sie schon häufig selbst zitiert oder in Postkartenform verschenkt. Oft geht mir dabei das Herz auf und ich fühle eine tiefe, echte Freude.
Dann gibt es aber auch diese Momente wie in dem eben beschriebenen Gottesdienst, wo es mir bei solchen Aussagen innerlich alles zuschnürt. Fast reflexartig hole ich dann oft tief Luft und atme kräftig durch. Das passiert genau dann, wenn ich den Eindruck habe, dass die schönen, positiven Worte mit aller Kraft auf eine Situation »draufgepresst« werden, zu der sie eigentlich nicht passen. Es fühlt sich verkrampft, gewollt und irgendwie künstlich an. Vielleicht kennen Sie diesen Effekt auch von Menschen, die – ob gläubig oder nicht – scheinbar immer positiv denken und selbst in der größten Katastrophe noch ein »Ja, aber schau mal: Das Gute ist doch, dass …« auf der Zunge haben. Was bewirkt das bei Ihnen? Wird die Kata-strophe für Sie dann tatsächlich kleiner? Nimmt es Ihnen die empfundene Last von den Schultern? Oder kommt vielleicht sogar noch eine zweite Last hinzu, weil Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, positiv und leichtfüßig mit der Sache umzugehen und nicht so sehr unter ihr zu leiden?
Meine Erfahrung ist, dass eher das Zweite passiert – sowohl bei mir selbst als auch bei den Menschen, mit denen ich spreche. In einem psychotherapeutischen Ansatz, auf den ich im dritten Kapitel genauer zu sprechen komme, unterscheidet man zwischen »sauberem Leid« und »schmutzigem Leid«. Das »saubere Leid« entsteht durch Schmerzen, Verlust, Ungerechtigkeit usw., gehört also unmittelbar zu dem Erlebnis dazu. Das »schmutzige Leid« wiederum entsteht, wenn wir versuchen, dem Schmerz auszuweichen, ihn zu vermeiden, zu unterdrücken oder bestimmte Gefühle nicht zu fühlen. Und dieses Leid quält uns sehr viel mehr als das ursprüngliche »saubere Leid«. Später werde ich auf diesen spannenden Ansatz noch ausführlich eingehen.
Erst einmal ist es ganz natürlich, dass wir Menschen alles Unangenehme vermeiden wollen und das Angenehme suchen. So sind wir »gebaut«. Allerdings scheint mir, dass Christinnen und Christen das besonders intensiv und engagiert tun. Als wäre der Glaube eine Versicherung gegen Traurigkeit, Unzufriedenheit, Ärger, Einsamkeit und Angst und gleichzeitig eine Garantie für Freude, Mut und Zufriedenheit.
Wenn ich das beobachte oder manchen meiner Glaubensgeschwister zuhöre, wie sie so ausnahmslos positiv gestimmt sind, dann finde ich mich in einer großen Spannung wieder: Einerseits ist der Glaube an Gott und meine Beziehung zu ihm auch für mich die zentrale ermutigende Kraft in meinem Leben. Ich fühle mich von ihm beschenkt und gesegnet, freue mich über vieles, was Gott für mich schon getan hat und weiterhin tut, und habe »zehntausend Gründe«7, ihn zu loben und ihm zu danken! Andererseits passieren auch in meinem Leben und vor allem in der Welt jenseits meines Tellerrandes sehr viele Dinge, denen ich wirklich nichts Positives abgewinnen kann. Dinge, die mir wehtun, mich traurig machen, die mir Angst machen oder mich verärgern. Und was mache ich dann mit der Aufforderung, mich »allezeit zu freuen«? Ein Glaube, der mich langfristig durchtragen und in meinem Alltag eine wichtige Rolle spielen soll, muss für mich vereinbar sein mit meiner Lebensrealität! Er muss auch einen Raum bieten für schmerzhafte Erfahrungen und unangenehme Gefühle. Genauso, wie ich, wenn ich einen Gottesdienst besuche, nicht »meinen Verstand an der Garderobe abgeben« möchte, so möchte ich auch nicht vor der Kirchentür erst einmal mein schweres Herz in den Müllcontainer entleeren müssen, bevor ich dann mit leichtem, fröhlichem Herzen und einem »erlösten« Gesichtsausdruck eintreten darf. Dieses Anliegen treibt mich seit Jahren um, und neben meinen eigenen Erfahrungen haben mich dabei vor allem Gespräche mit gläubigen Patientinnen und Patienten im Rahmen meiner psychotherapeutischen Tätigkeit geprägt.
Das Problem der Christinnen und Christen mit »negativen« Gefühlen
Nach meinem Psychologiestudium war ich fast zehn Jahre an einer psychosomatischen Klinik tätig, deren Konzept es war und ist, wissenschaftlich fundierte Psychotherapie auf der Basis eines aktiv gelebten christlichen Glaubens anzubieten. Der absolut überwiegende Teil der Patientinnen und Patienten, die zu einer stationären Behandlung in die Klinik kamen, war deshalb christlich sozialisiert und hatte sich ganz bewusst für dieses Konzept entschieden. Es war ihnen wichtig, nicht nur für Körper und Seele eine gute Behandlung zu erfahren, sondern auch geistlich aufzutanken, ihre Gottesbeziehung neu zu beleben oder bei Therapiegesprächen auch für Glaubensfragen ein mündiges Gegenüber zu haben. In den fast zehn Jahren als sogenannte Bezugstherapeutin habe ich dort also unzählige Menschen kennengelernt, die bei aller Unterschiedlichkeit hinsichtlich Lebenssituation, Störungsbild, Biografie usw. alle eines gemeinsam hatten: Sie waren bekennende Christinnen und Christen, lebten im Vertrauen auf Gott und fühlten sich gleichzeitig psychisch so sehr belastet, dass sie professionelle Hilfe suchten. Viele sagten von sich, dass sie im Glauben großen Trost, Kraft und Halt erlebten, dass sie aber trotzdem massiv mit Ängsten, Depressionen oder Erschöpfung kämpften.
Für mich war das überhaupt keine Überraschung, denn genauso wie tiefgläubige Christinnen und Christen von Autoimmunerkrankungen, Infektionen oder Krebs betroffen sein können, können sie natürlich auch psychische Erkrankungen entwickeln, wenn die entsprechenden Faktoren zusammenkommen. Keine Sorge: Ich werde hier nicht den Versuch wagen zu erklären, warum das so ist und warum Gott seine Kinder nicht vor solchen Schicksalen bewahrt. Das ist für mich eines der großen Geheimnisse, die ich Gott überlassen möchte, und es wäre anmaßend von mir, es auflösen zu wollen. Mir geht es vielmehr darum anzuerkennen, dass psychische Erkrankungen auch da auftreten, wo Menschen einen starken Glauben haben, eifrig in der Bibel lesen, intensiv mit Gott im Gespräch sind und ihm ihr Leben anvertrauen. Was mich in Therapiegesprächen oft betroffen gemacht hat, waren Zwischentöne von Scham und Schuldgefühlen in Bezug auf ihre psychische Problematik: »Ich weiß ja, ich soll mir keine Sorgen machen, weil Gott für mich sorgt, aber trotzdem werde ich diese furchtbaren Ängste nicht los. Wahrscheinlich habe ich einfach einen zu kleinen Glauben.« Oder: »Gott ist so gut zu mir und ich weiß, ich sollte dankbar sein und mich freuen. Aber irgendwie bin ich trotzdem traurig. Ich müsste wahrscheinlich viel mehr Lobpreis machen. ›Loben zieht nach oben‹ …«
Das Muster ist dabei immer dasselbe: Ich nehme ein »negatives« Gefühl in mir wahr (Angst, Traurigkeit oder auch Ärger). Demgegenüber steht ein Anspruch oder ein Konzept, wie ich sein und was ich fühlen oder nicht fühlen sollte. Auf dieser Grundlage bewerte ich dann das Gefühl als unangemessen, schlecht oder falsch. Und nicht nur das: Ich verurteile mich selbst dafür, dass ich dieses Gefühl habe, obwohl es doch »gar keinen Grund« dafür gibt oder ich es besser wissen sollte. Und ich stelle eine neue Anforderung an mich, was ich besser machen muss, um dieses »negative« Gefühl zu überwinden oder loszuwerden.
Vielleicht fragen Sie sich, warum ich das Wort »negativ« immer in Anführungszeichen setze. Traurigkeit, Angst, Ärger usw. sind doch wohl negative Gefühle – oder etwa nicht? Ich halte diese Bezeichnung für problematisch, weil damit automatisch eine schlechte Bewertung verknüpft ist. Etwas mit dem Label »negativ« ist in den meisten Fällen etwas, was ich ablehne und was »im unteren Bereich einer Werteordnung angesiedelt«8 ist, wie es der Duden sagt. Und damit schieben wir viele unserer Gefühle in eine Ecke, die sie nicht verdienen. Sie bekommen dadurch einen »Pfui«-Stempel oder werden zum Tabu erklärt, obwohl sie äußerst wertvoll und wichtig für uns sind. Wir werden uns noch ausführlich anschauen, worin der unschätzbare Wert solcher Gefühle liegt und warum wir dringend das »Negativ«-Label von ihnen nehmen sollten. Vielleicht können wir uns darauf verständigen, diese Gefühle von nun an als unangenehm zu bezeichnen, denn das sind sie allemal. Ich kenne niemanden, der Traurigkeit, Angst oder Ärger als besonders angenehm erlebt und genießt. Nein, sie sind ungemütlich, stören oder quälen uns und drängen darauf, dass wir auf sie reagieren und irgendwie mit ihnen umgehen. Ich habe weiter vorne schon erwähnt, dass es in der Natur von uns Menschen liegt, unangenehme Erlebnisse vermeiden zu wollen. Was aber ist das besondere Problem von Christinnen und Christen mit unangenehmen Gefühlen? Mein Eindruck ist, dass sie mehr als andere Menschen ihre unangenehmen Gefühle verurteilen und als etwas ansehen, was in ihrem Leben nicht (mehr) vorkommen sollte. Sie können vielleicht noch dazu stehen, dass sie vor ihrer Bekehrung mutlos, ängstlich, verzweifelt oder traurig waren. Dass sie manchmal wütend wurden und schimpften oder ihre Gefühle »nicht im Griff« hatten. Aber spätestens seit sie mit Gott leben, müsste so etwas doch Geschichte sein und dürfte sie nicht länger gefangen nehmen, glauben sie.
Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch mit einer Patientin, die in ihrem Leben schon viel Ungerechtigkeit erlebt hatte. Sie war wiederholt Opfer von Aggressionen und Gewalt geworden, erlebte in Beziehungen immer wieder, dass ihre Grenzen überschritten wurden, und litt seit Jahren an Depressionen. Sie war eine tiefgläubige Frau mit einem großen Herzen für Jesus und für ihre Mitmenschen. Ihre Stimme war ebenso ruhig wie ihr gesamtes Auftreten und sie zeigte sich immer freundlich und zugewandt. Das, was man vordergründig als sehr angenehm wahrnehmen könnte, hatte für mich aber einen »Beigeschmack«, denn die Frau wirkte auf mich nicht frei, nicht entspannt oder in sich ruhend. Und nicht umsonst war sie ja auch in die Behandlung gekommen, denn immerhin kämpfte sie mit Depressionen und psychosomatischen Beschwerden. In den Gesprächen mit ihr, vor allem wenn sie aus ihrer Lebensgeschichte erzählte, spürte ich manchmal einen Ärger in mir aufsteigen, während die Patientin selbst ziemlich unberührt wirkte. Es ist übrigens gar nicht selten, dass Therapeutinnen und Therapeuten im Gespräch Gefühle empfinden, die eigentlich zu ihren Patientinnen und Patienten gehören, von diesen aber nicht ausgedrückt oder gezeigt werden. Da es für die Therapie ungeheuer wichtig ist, so etwas bewusst wahrzunehmen und zu reflektieren, sprach ich es irgendwann an und fragte die Patientin: »Bei all dem, was Ihnen angetan wurde, kann man schon wirklich wütend werden. Wo ist denn eigentlich Ihre Wut?« Die Patientin schaute mich etwas irritiert an und sagte: »Wieso Wut? Ich bin nicht wütend. Jesus ist doch für meine Wut gestorben.«
Es ist schon Jahre her, aber dieser Satz hat sich bei mir eingebrannt: »Jesus ist für meine Wut gestorben.« Bis dahin war mir die Aussage geläufig: »Jesus ist für meine Schuld gestorben.« Es klang so, als seien Wut und Schuld für die Patientin austauschbar. Tatsächlich betrachtete sie Wut bzw. Ärger als etwas Verwerfliches, Sündhaftes, das im Leben einer Christin nichts zu suchen hat. Und sie stand mit dieser Überzeugung nicht alleine da. Inzwischen habe ich viele Menschen mit einer solchen Haltung getroffen – nicht nur im therapeutischen Kontext, sondern auch in meinem privaten Bekanntenkreis. Es scheint eine sehr weit verbreitete Überzeugung zu sein, dass jemand, der mit Jesus lebt, so von Liebe, Geduld, Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft erfüllt sein sollte, dass Ärger dort überhaupt keinen Platz mehr hat. Und wenn sich doch einmal Ärger in mir regt, ist das offenbar ein sicheres Zeichen für eine falsche Herzenshaltung, und ich muss dringend Buße tun …
Damit ich nicht falsch verstanden werde: Dieses Buch ist keine Einladung zu Jähzorn oder hemmungslosem Ausleben von Aggressionen und auch kein Freibrief, sich wie die berühmte »Axt im Walde« zu benehmen und verbal um sich zu schlagen. Ich möchte aber eine Sensibilität dafür wecken, zwischen dem Gefühl von Ärger und dem aggressiven »Wüten« zu unterscheiden. Ohne Zweifel kann Ärger zu Verhaltensweisen führen, die verletzend und brutal sind und zerstörerische Kraft haben. Das Gefühl von Ärger für sich genommen ist aber ein sehr wichtiges und kostbares Gefühl mit sogar kreativem, kon-struktivem Potenzial. Wir werden später noch erfahren, was es damit genau auf sich hat.
Dadurch, dass wir mit Ärger häufig Aggression und Verletzungen verbinden, liegt es also nahe, dass wir dieses Gefühl als Christinnen und Christen besonders ablehnen (zu Unrecht, wie wir noch sehen werden). Aber auch Angst und Traurigkeit werden »in frommen Kreisen« häufig negativ bewertet und der betroffenen Person angekreidet. Zugegeben, es geschieht subtiler und weniger explizit. Das Ergebnis ist aber dasselbe: Ich fühle mich schlecht oder sogar schuldig dafür, dass ich traurig bin oder Angst habe, denn es kann ja nur damit zu tun haben, dass mit meiner Beziehung zu Gott etwas nicht in Ordnung ist.
Viele Christinnen und Christen gehen selbstverständlich davon aus, dass Gottvertrauen und Angst sich gegenseitig ausschließen müssen: Entweder ich glaube und ich vertraue auf Gottes Schutz und seine Liebe, oder ich tue genau das nicht und habe Angst. »Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten«, heißt es auch in einem Lied9, und darin wird Psalm 91 zitiert: »Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen« (Psalm 91,11; LUT). Auch der folgende Vers wird oft zitiert, um aufzuzeigen, dass Angst ein Beweis für meine mangelnde Gottesbeziehung ist: »Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus« (1. Johannes 4,18). Wenn ich also Angst habe, bedeutet das, dass ich Gott nicht liebe oder seine Liebe nicht annehme – und beides darf eigentlich nicht sein! Das ist zumindest eine weitverbreitete Überzeugung. Nicht zuletzt hat Angst für viele Christinnen und Christen auch etwas mit Ungehorsam zu tun. Immerhin lesen wir über 120-mal in der Bibel »Fürchte dich nicht« oder »Hab keine Angst«. Das ist doch eine unmissverständliche Aufforderung, oder? Wenn ich trotzdem Angst habe und mich fürchte, erfülle ich also nicht den Willen Gottes und mache mich ihm gegenüber schuldig! Und ehe ich überhaupt meine Angst verstehe oder ihr sinnvoll begegnen kann, habe ich zusätzlich zu meiner Angst auch noch eine ordentliche Portion Schuldgefühle.
Ich wünschte, diese Gedanken wären alle nur meiner Fantasie entsprungen, aber leider gehen sie auf viele Gespräche und Begegnungen mit Glaubensgeschwistern zurück. Es macht mich richtig traurig zu sehen, wie hart Menschen mit sich ins Gericht gehen, nur weil sie bestimmte Gefühle erleben, die sie sich und anderen nicht erlauben.
Apropos traurig: Was ist mit dem dritten unserer drei unangenehmen Gefühle? Warum fällt es vielen Christinnen und Christen schwer, Traurigkeit zuzulassen? Wie für jeden anderen Menschen ist Traurigkeit ein sehr schmerzhaftes Gefühl, das sich sogar in körperlichen Schmerzen (z.B. in der Herzgegend) niederschlagen kann. Natürlich wollen wir auch Traurigkeit gerne vermeiden – genauso wie Angst. Aber der zusätzliche innere Konflikt für Christinnen und Christen entsteht hier auch wieder durch die Annahme, dass der Glaube an Gott mich über alles hinwegtrösten müsste. Ich bin traurig über eine zerbrochene Beziehung und fühle mich einsam? Ach was, ich habe doch Jesus! »Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich …«10 – so singen wir gerne in einem bekannten Lobpreislied. Wenn Jesus allein genug ist, wenn er alles für mich ist, dann gibt es doch keinen Grund für mich, irgendetwas zu vermissen, mich traurig oder einsam zu fühlen, oder?
Vor vielen Jahren ist meine Großmutter gestorben, die ich sehr geliebt habe. Ich habe damals noch studiert und war gerade im Praktikum 400 km entfernt von zu Hause. Somit konnte ich in den letzten Tagen nicht bei ihr sein. Vor Beginn des Praktikums hatte ich mich schon von ihr verabschiedet in dem Wissen, dass wir uns in diesem Leben nicht mehr wiedersehen würden. Insofern war ich in gewisser Weise vorbereitet, und trotzdem machte mich – als es so weit war – die Nachricht meiner Eltern über ihren Tod unfassbar traurig. An diesem Abend saß ich, um nicht alleine zu sein, mit ein paar anderen Praktikantinnen der Einrichtung zusammen. Als ich weinend erzählte, was passiert war, nahm mich eine von ihnen lächelnd in den Arm und sagte: »Ach, sei nicht traurig! Jetzt ist sie im Himmel – da ist es viel lustiger!« Es war sicherlich lieb gemeint und im Rückblick deute ich es als missglückten Versuch, mir etwas Tröstendes zu sagen. Aber es hat sich in dem Moment angefühlt wie eine Ohrfeige und hat alles eigentlich noch schlimmer gemacht. »Sei nicht traurig!«? – Entschuldigung, wir reden hier nicht darüber, dass es für die Kinovorstellung heute Abend leider keine Karten mehr gibt! Wir reden über meine 97-jährige Oma, die mich mein ganzes Leben lang begleitet hat und die ich geliebt habe!
Ich denke, diese unbeholfene Reaktion der jungen Frau sollte der Situation die Schwere nehmen, und sie steht außerdem für eine Haltung, die in christlichen Kreisen im Umgang mit Trauer oft zu spüren ist: »Wir glauben doch an die Ewigkeit! Der Mensch ist nicht verstorben, sondern ›nach Hause gegangen‹, deshalb sollten wir uns eigentlich mit ihm und für ihn freuen.« Ich habe sogar schon gehört, Trauer um einen Verstorbenen sei egoistisch, weil ich meinen Schmerz damit wichtiger nehme als die Tatsache, dass dieser Mensch nun in der Herrlichkeit Gottes sein darf! Und schon passiert dasselbe wie bei der Angst: Ich habe auf einmal zwei Lasten zu schultern – die Trauer über den Verlust und das Schuldgefühl, weil ich egoistisch bin und trauere, statt meinem Nächsten die Herrlichkeit Gottes zu gönnen.
Ich bin überzeugt: Wir Menschen sind als fühlende Wesen geschaffen. Von Geburt an und unabhängig von Kultur und Bildungsstand kennen wir alle Traurigkeit, Angst und Ärger. Im nächsten Kapitel gehe ich darauf genauer ein. Und wie wir noch sehen werden, kennt Gott selbst auch Gefühle! Warum also versuchen wir manchmal so angestrengt, sie zu unterdrücken, oder halten es für besonders »geistlich«, sie zu überwinden? Warum halten so viele Christinnen und Christen an der Überzeugung fest, »der neue Mensch« (Epheser 4,24) müsse über unangenehme Gefühle erhaben sein, und fühlen sich schlecht, wenn sie sie doch noch immer wieder überraschen? Ich behaupte: Wenn Scham, Schuldgefühle und Selbstverdammnis die Früchte meiner Glaubensüberzeugung sind, dann ist an der Wurzel etwas gewaltig faul! Dann folge ich nicht dem Willen Gottes, sondern allenfalls religiösen Regeln und Gesetzen, die Gottes Wesen sehr verzerrt abbilden. Möglicherweise ist Gott unseren Gefühlen gegenüber sehr viel aufgeschlossener als wir selbst und kann deutlich mehr aushalten, als wir ihm zumuten.
Stellen Sie sich doch einmal vor, ein Gitarrenbauer verkauft Ihnen eine Gitarre und betont mit ernster Miene, dass Sie nur die drei hellen Nylonsaiten spielen dürfen. Die tiefen Frequenzen der Basssaiten schaden angeblich dem Holz und dürfen auf keinen Fall angeschlagen werden. Sie würden sich doch sehr wundern! Sie würden sofort denken, dass dann etwas ganz Wichtiges im Klang fehlt, und vielleicht würden Sie den Gitarrenbauer fragen, warum er überhaupt alle sechs Saiten aufgezogen hat, wenn nur die drei oberen gespielt werden dürfen. Oder Sie kaufen einen Farbkasten und finden darin den Hinweis, dass die Farben Grau, Schwarz und Braun auf keinen Fall verwendet werden dürfen, weil von ihnen giftige Dämpfe ausgehen. Sie würden doch daran zweifeln, ohne diese Farben ein interessantes Bild gestalten zu können, und Sie würden sich wundern, warum Farben in den Kasten eingesetzt werden, die »verboten« sind.
Wenn ich Gott als Schöpfer ernst nehme und den Menschen in seinem ganzen Sein als Gottes Geschöpf ansehe, dann gehören Gefühle zu unserer Grundausstattung, die der Schöpfer uns gegeben hat. Wie könnte er dann von uns wollen, einen Teil davon nicht anzurühren oder zur Seite zu drängen?
Vielleicht regt sich in Ihnen jetzt eine Stimme, die sagt: »Aber es steht doch nun einmal so deutlich im Wort Gottes, dass wir uns nicht fürchten sollen, dass wir lieben und nicht hassen sollen, dass wir getröstet sind usw. Das kann man doch nicht alles wegdiskutieren!« – Das will ich auch gar nicht. Wir beschäftigen uns noch ausführlich damit, welchen Umgang mit Gefühlen wir aus der Bibel lernen können. Im Zweifelsfall finden wir jedoch eine Auflösung der Spannung im »Sowohl-als-auch« und nicht im »Entweder-oder«. Es verlangt uns vielleicht in manchen Punkten ein gewisses Umdenken ab, einen Abschied von alten Denkgewohnheiten und Grundüberzeugungen und den Mut zu einer neuen Perspektive. Aber es lohnt sich, diesen Weg auszuprobieren! Wie schön wäre es, wenn wir in Zukunft ganz gelassen und entspannt unseren unangenehmen Gefühlen begegnen könnten. Wenn wir sie ganz selbstverständlich mit in den Hauskreis und in den Gottesdienst bringen, offen mit Menschen und mit Gott darüber reden und sogar wertvolle Früchte daraus wachsen sehen könnten!
»Herr, ich komme zu dir und ich steh vor dir so, wie ich bin«11, »Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin«12 – wunderschöne Lieder, die viele von uns kennen und schon oft gesungen haben. Ich lade Sie ein, diese Texte wörtlich zu nehmen und Ihren Ärger, Ihre Angst und Ihre Traurigkeit auch im Gottesdienst, im Gebet und im Gespräch mit anderen herzlich willkommen zu heißen.
Gefühle – unsere verkannten Schätze
»Herr Meier, möchten Sie uns ein wenig an Ihren Gefühlen teilhaben lassen?« – »Äh … ja, ich habe das Gefühl, unsere Waschmaschine gibt bald ihren Geist auf.« So oder so ähnlich könnte man wunderbar eine Gruppentherapiesitzung parodieren und dabei alle Klischees bedienen: das der Therapeutin, die mit einfühlsamer, sanfter Stimme nach den Gefühlen ihres Patienten fragt, und das des Mannes, der nicht über Gefühle spricht und mit der Frage nichts anfangen kann.
In meiner psychotherapeutischen Arbeit – mit Gruppen oder auch in Einzelgesprächen – fällt mir immer wieder auf, wie schwer die meisten Menschen sich damit tun, Gefühle zu benennen. Auf die Frage »Wie fühlen Sie sich?« folgt als Antwort meistens »gut«, »nicht so gut«, »schlecht«, »ganz okay« oder Ähnliches. Meine Gesprächspartner geben damit eine Bewertung für ihr Befinden ab, fast so, als würden sie Schulnoten vergeben. Ein Patient hat die Frage tatsächlich immer mit Zensuren beantwortet: »Hm, heute geht es mir so Drei minus.« Man hat als Gegenüber dann zwar eine grobe Ahnung von der eher positiven oder negativen Stimmungslage des anderen, aber über seine Gefühle erfährt man eigentlich nichts. Auch intensives Nachfragen führt oft nicht weiter, und es wird deutlich: Obwohl wir tagtäglich mit Gefühlen unterwegs sind und sie existenziell zu unserem Leben gehören, können wir sie oft gar nicht richtig greifen. Fast so, als wüssten wir überhaupt nicht, womit wir es da eigentlich genau zu tun haben.
Ich behaupte: In den allermeisten Sätzen, die das Wort »Gefühl« beinhalten, wird genau genommen überhaupt kein Gefühl angesprochen. »Ich habe das Gefühl, gleich kommt ein Gewitter«, »Ich habe das Gefühl, du hörst mir überhaupt nicht zu«, »Nach meinem Gefühl ist das ziemlicher Blödsinn«, »Ich habe das Gefühl, meine Kollegin kann das besser als ich« usw. Oder auch in dem berühmten Loriot-Sketch »Das Ei«, wo die Hausfrau es angeblich »im Gefühl« hat, »wann das Ei weich ist«.13 Tatsächlich ist das, was hier jeweils zur Sprache kommt, kein Gefühl, sondern eine Ahnung, eine Meinung, eine Intuition, eine Sichtweise oder ein Gedanke. Aber was genau sind dann Gefühle?