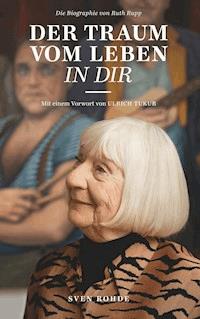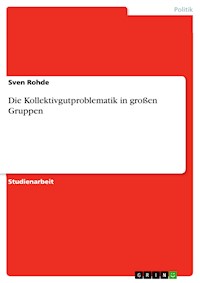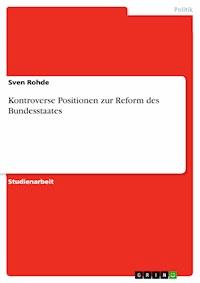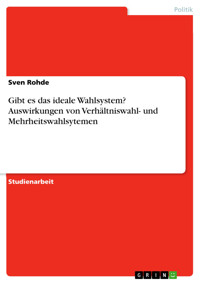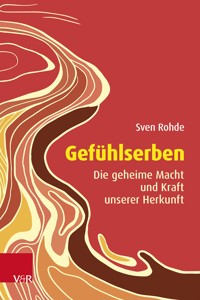
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das 20. Jahrhundert war ein Zeitalter der man-made disasters, die Millionen von Seelen beschädigten. Die Folgen lasten immer noch schwer auf vielen Menschen und ihren Nachkommen, ohne dass dies von ihnen selbst erkannt würde. Das gilt nicht nur für Kriegskinder und Kriegsenkel, sondern auch für Millennials sowie für Nachfahren von nach Deutschland Eingewanderten. Das Selbstbild in unserer Gesellschaft ist geprägt von Selbstbestimmung und Leistungsfähigkeit. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit der eigenen Familie gilt als Zeitverschwendung. In Krisen aber scheitert dieses Selbstkonzept. Mit »Gefühlserben« stellt Sven Rohde, der dazu auch einen gleichnamigen Podcast unterhält, einen Ansatz vor, der ein neues Verständnis der Wechselbeziehung von historischen Ereignissen, individuellem Erleben und transgenerationaler Übertragung herstellt. Er ermöglicht eine Selbsterforschung wie auch die Bearbeitung in Therapie, Coaching und Beratung. So können aus unverstandenen verborgenen Wirkmächten unerwartete Kräfte für das eigene Leben erwachsen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sven Rohde
Gefühlserben
Die geheime Macht und Kraft unserer Herkunft
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2024 Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill BV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill BV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: ANN_UDOD/Shutterstock
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
EPUB-Erstellung: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99292-1
Meiner Familie gewidmet. Na klar.
Inhalt
Dem Schicksal auf der Spur
»Ich verstehe mich selbst nicht …!« · Einstimmung
So klingt ein Gefühlserbe · Sätze aus alter Zeit
Ein optimistischer Blick voraus · Entdeckungsreise Gefühlserben
Einladung zur Reflexion · Fragen und Übungen
Das Gefühlserbe in unserem Leben
Rätselhaftes Erleben · Das Unbewusste im Alltag
Epigenetik & Co. · Die Wege transgenerationaler Übertragungen
Die bestimmende Macht des Unbewussten · Das Gefühlserbe in der Psyche
Die Spätfolgen der Traumata · Das Gefühlserbe im Körper
Die pathologische Normalität der Familien · Das Gefühlserbe in Beziehungen
Drang zur Wiedergutmachung · Das Gefühlserbe im Lebensweg
Einladung zur Reflexion · Fragen und Übungen
Geschichte und Geschichten
»Hier stimmt doch etwas nicht …« · Die leise Stimme der Intuition
Verdrängung, Vermeidung, Verleugnung · Abwehrmechanismen
Das dunkle Erbe · Die Abwehr deutscher Verbrechen
Spaltung und Aufbau · Nachkriegszeit in BRD und DDR
Das laute Schweigen · Abspaltung in drei Generationen
Die Kraft der Ahnen · Traditionen und Ressourcen
Triggerpunkte · Die bedrängende Aktualität der Geschichte
Einladung zur Reflexion · Fragen und Übungen
Expedition ins Gefühlserbe
Licht in das Dunkel bringen · Struktur für die Recherche
»Darf ich das wissen wollen?« · Innere Klärung
Zwischen Loyalität und Autonomie · Im Spannungsfeld der Familie
Daten, Fakten, Emotionen · Wege der Erforschung
Das ganze Erbe würdigen · Zwischen Leid, Wut und Mitgefühl
Einladung zur Reflexion · Fragen und Übungen
Endlich ankommen!
Der Wille zum Wohlbefinden · Wie Heilung gelingen kann
Was jetzt dran ist · Wege der Integration
Achtsam das Neue entwickeln · Selbstheilungskräfte aktivieren
Das Wachstum danach · Transformation und Integration
Einladung zur Reflexion · Fragen und Übungen
Das Gefühlserbe in Therapie, Coaching und Beratung
Warum Sprechen nicht reicht · Die Wirkfaktoren im Prozess
Resonanz ermöglichen · Reflexion der eigenen Betroffenheit
»It’s the relationship that heals« · Die Haltung im Prozess
Neugier und Befremdung · Der Umgang mit dem Anderen
Epilog – Ein persönlicher Blick zurück
Danksagung
Literatur
Dem Schicksal auf der Spur
»Ich verstehe mich selbst nicht …!«
Einstimmung
Es war der schöne kleine Saal eines ehemaligen Kinos im oberbayrischen Ebersberg, neu genutzt als Kulturzentrum. Etwa 100 Zuhörer:innen hatten sich eingefunden. Auf der Bühne saßen mein Kollege Sebastian Schoepp, der aus seinem autobiografischen Buch »Seht zu, wie ihr zurechtkommt« (Schoepp, 2018) vorlas und den Abend moderierte, und ich, zu einem Vortrag zum Thema »Gefühlserben« eingeladen. Man hätte eine Stecknadel fallen hören. Es war eine gebannte Stille, als Sebastian Schoepp Passagen über die Kriegsvergangenheit seiner Eltern vorlas und ich vortrug, wie dieses Gefühlserbe auch heute noch unser Leben bestimmen kann. Indem wir etwa unfähig sind, Dinge wegzuschmeißen, die noch irgendwie brauchbar sein könnten. Indem manche Menschen seit dem russischen Überfall auf die Ukraine einen gepackten Fluchtrucksack im Flur stehen haben. Oder indem wir furchtbar unter Stress geraten, sobald wir für eine Reise packen sollen.
Als das Licht wieder angegangen war, schauten wir in staunende Gesichter. Es dauerte eine Weile, bis Gespräche in Gang kamen. Die Verblüffung über das Gehörte musste sich erst auflösen. Aber dann kamen die Geschichten. Ein Mann erzählte, er habe es nach Jahren aufgegeben, seiner Frau beim Packen zu assistieren. Selbst wenn es nur auf eine Städtereise von wenigen Tagen gehe, erzählte er, brauche sie dafür bis mitten in die Nacht. Er gehe jetzt lieber rechtzeitig ins Bett, einer müsse am nächsten Tag schließlich fit sein. Aber dass die Flucht seiner Schwiegermutter zunächst aus der Ukraine, dann aus Schlesien die Ursache dieses Verhaltens sein könnte – das ließ ihn staunen. Ich konnte sehen, wie diese Information langsam einsickerte und so etwas wie Hoffnung aufkeimte. »Wenn wir das jetzt wissen«, so signalisierte sein Gesichtsausdruck, »vielleicht kann das aufhören?«
Dieses Staunen kenne ich gut. Es begegnet mir immer wieder. Für viele Menschen klingt es gar zu unwahrscheinlich, dass ein Trauma, das die Eltern oder Großeltern im Krieg erleiden mussten, heute noch das Leben der Kinder und Enkel bestimmen könnte. Nicht selten schleicht sich auch Skepsis auf die Gesichter von Klient:innen oder Workshopteilnehmenden. In Gesprächen mit Journalist:innen gilt es immer mal wieder, eine Schwelle des Misstrauens zu überwinden. Auch wenn das Thema in den Medien durchaus präsent ist, kommt es gelegentlich in Esoterikverdacht, höflich verpackt in die Frage nach seriösen Studien.
Es gibt diese Studien in großer Zahl, aber tatsächlich sind die Erklärungen der Wissenschaft für transgenerationale Übertragungen komplex (ich werde in diesem Buch versuchen, sie zu entschlüsseln). Mir scheint der Widerstand aber noch einen anderen Grund zu haben: Es ist eine narzisstische Kränkung, dass wir nicht souverän über unser Fühlen, Denken und Handeln entscheiden können, sondern die Folgen eines Leids ausagieren, das unseren Vorfahren zugefügt wurde; dass wir gleichsam ausbaden müssen, dass sie ihre Trauer oder ihre Schuld abgewehrt haben. Außerdem trägt der Widerstand gegen die Einsicht in eine machtvolle Vergangenheit eine ideologische Komponente in sich. Das Selbstbild des postmodernen Menschen ist schließlich geprägt von Selbstbestimmung und Wirkmächtigkeit. Dieses Selbstbild ist womöglich generell bei Männern sowie in der Generation der Millennials, zwischen 1981 und 1995 geboren, stärker vertreten. Und dieses Bild verstellt den Blick auf transgenerationale Aspekte der eigenen Persönlichkeit. »Traumatisierungen durch Entwurzelung, Entheimatung und Fremdheit werden abgespalten und geleugnet«, konstatiert die Psychoanalytikerin Monika Huff-Müller (2013). Es sei quasi der Versuch, das Unbewusste abzuschaffen.
Die meisten von uns haben von sich das Bild, einigermaßen selbstbestimmt und frei über das eigene Leben zu entscheiden. Okay, es gibt Sachzwänge, die wir nicht ändern können, aber im Großen und Ganzen tun wir doch, was wir tun wollen, oder? Nein, so ist es nicht. Es ist in Studien der Psychologie, der Gehirnforschung und der Soziologie belegt, dass wir viel stärker von unserer Herkunft geprägt sind, als uns bewusst ist. Gabriele Rosenthal, Göttinger Professorin für Soziologie, spitzt die Wirkung früherer Generationen auf unser Leben sogar noch zu: »Die nicht-erzählten Bestandteile der Familiengeschichte wirken sich auf die Lebensgeschichte der Kinder und Enkel aus, ohne dass dies von ihnen erkannt würde. Ganz allgemein formuliert: Je weniger die Nachgeborenen über die Vergangenheit ihrer Eltern oder Großeltern wissen, umso stärker werden sie in ihrem Leben, in ihrem psychischen Befinden, ihrem politischen Handeln und vor allem auch in ihren biographischen Entscheidungen […] von dieser Vergangenheit bestimmt« (Rosenthal, 1999a, S. 5).
Als ich diese Sätze vor einigen Jahren las, war ich elektrisiert. Hier kam in der Einordnung einer Forscherin auf den Punkt, was ich aus vielen Erzählungen in meinen Workshops kannte: dass sich das Leben der Teilnehmenden auf eigentümliche Weise fremdbestimmt und schicksalhaft anfühlte, das eigene Handeln ferngesteuert, dass die Gefühle im Zweifel standen, ob es überhaupt die eigenen seien. Das Rätseln über die Geschichte der Vorfahren hatte sie in die Veranstaltung geführt, die ungeklärten familiären Verstrickungen in das deutsche Erbe von Krieg, Faschismus und Holocaust. Und hier gab es nun die Erklärung. Ihr Verhalten, das ihnen nur zu oft unverständlich und dysfunktional vorkam, war die Folge eines vom Kriegserbe der Familie geprägten Unbewussten. Sie waren in einer Art emotionaler Zeitschleife gefangen. Nicht selten reinszenierten sie das Drama ihrer Eltern oder Großeltern. Als Gefühlserben.
Es war Sigmund Freud, der die Übertragung »bedeutsame[r] seelische[r] Vorgänge« von einer Generation zur nächsten »Gefühlserbschaften« nannte (Freud, zitiert nach Moré, 2013; vgl. Krejci, 2005). Wie stark diese transgenerationalen Weitergaben das Leben der Nachfahren bestimmen können, wurde zuerst bei den Kindern der Holocaustüberlebenden nachgewiesen, später auch bei deren Enkel:innen sowie bei den Nachfahren der Täter:innen. Klinische Forschungen haben gezeigt, dass in diese Gefühlserbschaften bewusst verheimlichte oder unbewusst verleugnete sowie abgespaltene seelische Inhalte einfließen (Moré, 2012, S. 72). Zum Gefühlserbe können sowohl traumatische Erlebnisse und unbetrauerte Verluste als auch Schuldgefühle gehören, mit all ihren negativen Folgen für die Erben. Wobei die Übertragung nicht nur einen individuellen, sondern ebenso einen systemischen Aspekt in sich trägt. Auch Bindungsmuster innerhalb von Familien überdauern oft mehrere Generationen. Sie können darüber hinaus in einer familiären Gerechtigkeitsbilanz manifestiert sein, wie die systemische Familientherapie entdeckt hat. Dann wird Nachkommen eine Art Wiedergutmachung aufgetragen, um eine ungesühnte Schuld der Vorfahren auszugleichen. So mag etwa erklärbar werden, warum viele Kinder aus Täter:innenfamilien in psychosozialen Berufen tätig sind (Ritscher, 2017).
Das emotionale Erbe der Vorfahren definiert unser Leben oft mehr, als wir uns vorstellen können. Im Alten Testament klingt das so: »Die Väter haben saure Trauben gegessen, und den Kindern sind davon die Zähne stumpf geworden« (Ezechiel 18,2). Dass auch die Enkel:innen betroffen sind, zeigt nicht nur die Erfahrung vieler Nachfahren, ihr Erleben wird auch von der Forschung bestätigt. »Die Konsequenzen einer belastenden Gesellschafts- und Familiengeschichte zeigen sich in der Enkelgeneration zum Teil noch deutlicher als in der Generation der Kinder«, schreibt Gabriele Rosenthal (2001, S. 8). Eine lange vor der eigenen Geburt liegende Familiengeschichte könne noch heute die Lebenswege der Nachgeborenen erheblich bestimmen. Tatsächlich waren es auch die Leidensgeschichten der Nachfahren, die den Impuls für die systematische Erforschung der transgenerationalen Weitergabe setzten. Sie begann, als die Nachkommen von Holocaustüberlebenden und die Nachkommen der Täter:innen in die Therapie von Psychoanalytiker:innen und Tiefenpsycholog:innen kamen. In den USA waren es zudem die Kinder der Vietnamveteranen, die mit Depressionen, unerklärlichen Schuldgefühlen oder Suizidgedanken therapeutische Hilfe suchten. Die Not der Betroffenen: immer wieder erdrückend.
Auf diese Zusammenhänge zu stoßen, faszinierte mich. Und je tiefer ich bei der Recherche, in Interviews, Workshops und Coachings kam, umso spannender wurde es. Es war augenöffnend zu verstehen, wie sehr wir Teil einer Ahnenreihe sind und von ihr so lange fremdbestimmt werden können, bis wir diese Zusammenhänge verstanden haben. Es machte mich auch neugierig: Wie geht denn das? Was passiert da? Und wie entkomme ich dem? Was ich auf dieser Expedition herausgefunden habe, ist Inhalt dieses Buches.
Die Erforschung war eng mit meiner Arbeit zum Thema der sogenannten Kriegsenkel verbunden. »Kriegsenkel« ist ein Kunstwort. Es bezeichnet die Menschen, die etwa zwischen 1960 und 1980 geboren wurden. Ihre Eltern waren im Zweiten Weltkrieg Kinder, sind also Kriegskinder, und deren Kinder kann man eben Kriegsenkel nennen. Sie verbindet eine Menge ähnlicher Prägungen und Erfahrungen. Ich selbst bin 1961 geboren, und auch wenn es ein bisschen peinlich ist, kann ich wie die meisten meiner Generation »99 Luftballons« von Nena und »Mamma Mia« von Abba auswendig mitsingen. Uns verbindet aber auch ein ganzes Bündel von Symptomen: Bindungsprobleme mit Eltern und Kindern, innere Einsamkeit, rastlose Suche nach Sinn und Heimat, Ringen um Erfolg im Beruf. Viele von uns hatten oder haben das Gefühl, dass sie nicht so richtig in ihrem Leben angekommen sind, dass viele Sehnsüchte sich nicht erfüllt haben, dass sie ein Leben wie mit »angezogener Handbremse« leben, wie es die Autorin Sabine Bode (2009) in einer schon fast sprichwörtlichen Formulierung ausgedrückt hat. Ohne dass wir eine Erklärung dafür hätten. Im Coaching wird freilich immer wieder deutlich, dass der Widerschein dieser Familiengeschichten längst die nächste Generation erreicht hat. Sie sieht sich mit ganz ähnlichen Rätseln konfrontiert, das Gefühlerbe wurde bereits weitergereicht.
Was ich von Workshopteilnehmenden und Klient:innen im Coaching immer wieder höre, sind Sätze wie diese: »Ich verstehe mich selbst nicht. Warum passieren mir immer wieder dieselben Fehler, warum reagiere ich auf dieselbe Weise, obwohl ich doch schon weiß, dass das nicht funktioniert?« Bei der Suche nach Erklärungen landen wir dann bei traumatischen Erfahrungen der Vorfahren oder auch bei ihren ungesühnten Verbrechen. Diese Gefühlserbschaften sind gleichsam der missing link, um das befremdliche Verhalten und Erleben auf einmal höchst plausibel zu erklären.
Wichtig ist dabei nicht nur die Perspektive auf die allgemeine historische Situation, die den Erfahrungen der Vorfahren zugrunde liegt, sondern auch auf das ganz konkrete Erleben. Das wurde mir deutlich, als eine Klientin, mehr nebenbei, von einer Panikattacke berichtete, die sie im Skiurlaub erlitten hatte. Das Skifahren hatte sie von ihrem Vater gelernt, und der war als Jugendlicher Flakhelfer gewesen. Ganz offenbar triggerte der Aufbruch aus dem engen Skikeller, beladen mit Skiern und Skischuhen, die Erinnerung an seinen Aufbruch aus dem Luftschutzkeller im letzten Kriegsjahr – und diese Angst hatte sich einst auf die kleine Tochter übertragen. Jahrzehnte später wurde sie wach, als zur bedrängenden Situation im Keller noch die Zeitnot kam, den zur Abfahrt bereitstehenden Bus zu erreichen. Bis ihr dieser Zusammenhang deutlich wurde, war die Panikattacke für sie nur ein Beleg gewesen, dem Leben irgendwie nicht gewachsen zu sein. So ergeht es vielen: Was eigentlich eine transgenerationale Weitergabe ist, wird als individuelles Versagen empfunden. Umso entlastender zu erfahren, was die eigentliche Ursache ist.
Der Zugang zu diesen Übertragungen ist naturgemäß nicht immer leicht zu finden. Aus Gründen, die später ausführlich Thema sein werden, decken viele Familien einen Mantel des Schweigens darüber. Das gilt vor allem, wenn eine abgewehrte Schuld von Vorfahren auf Enkel:innen oder Urenkel:innen lastet. Nicht nur soll das jahrzehntelang gehütete Familiengeheimnis die Täter:innen schützen – auch die Nachfahren selbst tun sich sehr oft schwer damit, die Verstrickung von Eltern, Großeltern oder gar Urgroßeltern in Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufzudecken. Sind sie dazu bereit, stellen sich ihnen nicht selten Angehörige in den Weg. Die Loyalität zur Familie kann ungeheuer stark sein. Selbst um den Preis des Leidens unter psychischen und körperlichen Erkrankungen, die von der transgenerationalen Last ausgelöst werden.
Womit wir wieder bei der Macht der Muster angekommen sind, die in Familien von Generation zu Generation weitergegeben werden können (ich möchte schon hier ergänzen: bis einer nicht mehr mitmacht). Die nicht aufgearbeitete Familiengeschichte schafft eine potenziell traumatisierende Atmosphäre. Eine große amerikanische Studie belegt einen engen Zusammenhang zwischen belastenden Erfahrungen der Kindheit und späteren Gesundheitsrisiken, körperlichen Erkrankungen und psychischen Störungen. Die Traumatisierung in der Kindheit zeigt möglicherweise erst Jahrzehnte später ihre Wirkung, das allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit (vgl. Felitti, Fink, Fishkin u. Anda, 2007). Was ihre Behandlung erschwert: Die Zusammenhänge zwischen den Symptomen und ihren Jahrzehnte zurückliegenden Ursachen sind den Patient:innen in der Regel nicht bewusst. Vielen Ärzt:innen und Therapeut:innen freilich auch nicht. Der Traumataloge Bessel van der Kolk schreibt: »Niemand möchte sich an ein Trauma erinnern. In dieser Hinsicht unterscheidet sich die Gesellschaft nicht von den Traumatisierten selbst. Wir alle wollen in einer Welt leben, die sicher, beherrschbar und berechenbar ist, und Traumatisierte erinnern uns daran, dass dies nicht immer zutrifft. Um Traumata zu verstehen, müssen wir unseren natürlichen Widerwillen überwinden, uns mit dieser Realität auseinanderzusetzen, und wir müssen den Mut entwickeln, uns die Zeugnisse von Traumaüberlebenden anzuhören« (van der Kolk, 2023, S. 258).
Um diesen traumatisierten Menschen zu helfen, aber auch um ihre Angehörigen zu schützen. Frauen, deren Männer unter einem Posttraumatischen Belastungssyndrom (PTBS) leiden, werden häufig depressiv. Die Kinder depressiver Mütter wiederum entwickeln sich oft zu unsicheren und ängstlichen Erwachsenen. Waren sie in ihrer Kindheit häufig Gewalttätigkeit ausgesetzt, fällt es ihnen schwer, stabile und vertrauensvolle Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen (van der Kolk, 2023, S. 258). Und aus diesen dysfunktionalen Mustern wird dann eine Gefühlserbschaft. Ein Phänomen, das eine gesellschaftliche Relevanz hat, wie die Epigenetikforscher:innen Ali Jawaid und Isabelle Mansuy betonen: »Die Vorstellung, dass psychologische Traumata zu Effekten führen, die potenziell vererbbar sind, ist von großer Bedeutung für die Gesellschaft, wenn man bedenkt, wie viele Individuen durch gegenwärtige und jüngste menschliche Konflikte traumatisiert wurden« (Jawaid u. Mansuy, 2021, S. 278). Und nicht selten sind es die nicht aufgearbeiteten Schrecken der Vergangenheit, die in aktuellen Konflikten eine schockierende Gegenwärtigkeit bekommen.
Ein weiter Bogen: von der Schwierigkeit, einen Koffer für eine Städtereise zu packen, bis hin zu massiven körperlichen und psychischen Folgen, die von Traumatisierungen ausgelöst werden können, und den Auswirkungen für ein Einwanderungsland wie Deutschland, in dem Menschen Schutz und Zuflucht suchen. Tatsächlich möchte ich den Bogen aber noch weiter spannen. Denn es gibt einen großen Bereich von Gefühlserbschaften, die von der Fixierung auf die Probleme und das Leid verdeckt werden. Wir haben sogar einen positiv konnotierten Begriff dafür: Traditionen. Wie Feste gefeiert, Gerichte gekocht, Leidenschaften für Kultur, Natur oder Technologie gepflegt, wie Lieder gesungen werden – auch das ist ein integraler Teil des Familienerbes. Was ich oft erlebt habe: dass erst die Beschäftigung mit den negativen Aspekten der Familiengeschichte und ihre beginnende Integration den Blick öffnen für diese Ressourcen. Ist das Leid gewürdigt und betrauert, entstehen neue Möglichkeitsräume. Vielleicht auch dafür, sich von alten Dingen zu trennen, weil wir uns nicht mehr vom Mangel bedroht fühlen, und das Packen für eine Reise innerhalb einer Stunde zu bewältigen, weil wir darauf vertrauen können, dass wir in unser Zuhause zurückkehren werden.
Eine Garantie für dieses Gelingen gibt es naturgemäß nicht, aber eine Chance durchaus. Eine Grundregel im Coaching sagt: Wir können nur ändern, wovon wir wissen. Und zu wissen, warum wir für uns selbst befremdliche Haltungen und Handlungen an den Tag legen, bewirkt zweierlei. Wir müssen uns nicht mehr verurteilen für dieses eigentümliche Verhalten, weil wir es als Gefühlserbschaft erkannt haben. Tatsächlich kann schon das Erkennen ihrer transgenerationalen Herkunft ihre Macht entscheidend mindern. Und wenn der Impuls für diese automatisierten Handlungen auftaucht, können wir ihn wahrnehmen und haben eine Entscheidungsmöglichkeit: Wollen wir folgen oder nicht? So entsteht innere Freiheit.
Es gibt vielfältige Beispiele dafür, dass belastende Gefühlserbschaften überwunden werden können. Eine sehr persönliche Erfahrung davon ist in die Entstehung dieses Buches eingeflossen. Ich habe einen Gutteil davon in einem Häuschen in der Bretagne geschrieben. An der Küste unweit der Unterkunft gibt es zahlreiche Reste deutscher Bunker und Geschützstellungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Die nächstgelegene größere Stadt Brest wurde damals fast komplett zerstört. Noch im Ersten Weltkrieg hatte mein Großvater an einer Schlacht auf französischem Boden teilgenommen, bei der 460.000 Soldaten starben. Damals im Glauben an eine »deutschfranzösische Erbfeindschaft«, die ein im 19. Jahrhundert geprägter nationalistischer Topos behauptete.
Erbfeindschaft? Meine französischen Gastgeber, deren Häuschen ich gemietet hatte, hätten freundlicher nicht sein können. Wenn wir um unser Gefühlserbe wissen, können wir entscheiden, welchen Teil davon wir annehmen wollen. Und welchen nicht.
So klingt ein Gefühlserbe
Sätze aus alter Zeit
Finden Sie sich in einigen dieser Sätze wieder? Sie können Ausdruck einer transgenerationalen Übertragung sein.
»Ich verstehe mich selbst nicht – immer wieder laufe ich in dieselbe Falle.«
»Jedes Mal, wenn ich für den Urlaub packen soll, komme ich enorm unter Stress.«
»Ich kann einfach nichts wegschmeißen, auch wenn meine Wohnung schon überquillt.«
»Man kann niemandem trauen!«
»Nur was ich weiß, kann mir keiner nehmen.«
»Ich muss etwas wiedergutmachen, weiß aber gar nicht, was.«
»Ich kümmere mich immer nur um die anderen. Meine eigenen Bedürfnisse kommen viel zu kurz.«
»Man muss mit dem Schlimmsten rechnen, dann kann es nur besser werden.«
»Ich gehe nie, nie, nie ohne etwas zu essen aus dem Haus.«
»Der Teller wird leer gegessen!«
»Karriere ist nur für die anderen.«
»Krank sein heißt faul sein.«
»Auch wenn ich anderer Meinung bin, gebe ich immer nach.«
»Nur wenn ich etwas leiste, bin ich etwas wert.«
»Immer lächeln, aber wie’s drinnen aussieht, geht niemanden etwas an.«
»Was sollen denn die Leute sagen?!«
»Wenn ich einen Fehler mache, passiert etwas Schreckliches!«
»Ich laufe ständig mit einem schlechten Gewissen herum, weiß aber gar nicht, was ich verbrochen haben könnte.«
»Freu dich nicht zu früh.«
»Sei wie das Veilchen im Moose,
sittsam, bescheiden und rein,
und nicht wie die stolze Rose,
die immer bewundert will sein.«
Ein optimistischer Blick voraus
Entdeckungsreise Gefühlserben
»Was können wir, weil wir Kriegsenkel sind?« Mit dieser Frage habe ich Workshopteilnehmende immer wieder überrascht. Die Übung in Gruppen von drei oder vier Teilnehmenden bildete traditionell den Abschluss des Tages. Die Perspektive fanden viele befremdlich. Hatte das Leben ihnen nicht unsanft mitgespielt und sie in dysfunktionale Familien hineingeboren? War es nicht gerade die bedeutende Erkenntnis gewesen, als Mitglied einer Generation das Leid mit anderen zu teilen, also wenigstens nicht allein und ausschließlich an den bedrängenden Problemen des Alltags schuldig zu sein, sondern die Verantwortung dafür zumindest teilweise der Eltern- oder Großelterngeneration, den Verhältnissen, der deutschen Geschichte anlasten zu können? Und jetzt kam einer daher und lud mit fröhlichem Grinsen zu einer Übung mit dieser Frage ein: »Was können wir, weil wir Kriegsenkel sind?« Davor war es um Traumata und Recherche von Kriegsverbrechen gegangen, um blockierende Glaubenssätze und schwarze Pädagogik – was sollte das jetzt? »Nimmt der unser Leid nicht ernst?« Diese Frage schien sich mir nicht selten auf die Gesichter zu schleichen.
Um sie eindeutig zu beantworten: Doch, unbedingt! Jedes Leid muss angeschaut und gewürdigt werden. Das ist meine tiefe Überzeugung. Es passiert mir in Coachings oder Workshops auch immer wieder, dass mir bei manchen Geschichten Tränen aufsteigen. Ist halt so. Die Abwehr des Leids und der Trauer (allerdings auch der Schuld) haben ja gerade diese belastenden Spätfolgen entstehen lassen, mit denen wir uns heute herumschlagen. Sie nicht mehr abzuwehren, ist ein Akt der Befreiung. Wenngleich ein schmerzlicher. Aber die Frage, die sich mir vom Beginn meiner Arbeit an aufdrängte, zuerst mit den Kriegsenkeln, später auch mit jüngeren und jungen Menschen: Was dann?
Luise Reddemann, Pionierin der Traumatherapie in Deutschland und von mir gerade auch für ihre Menschlichkeit verehrt, formulierte dafür in einem Interview mit mir Sätze, die zum Leitmotiv wurden: »Das ist die wichtige Botschaft für alle, die sich diesem Thema zuwenden! Es geht darum zu verstehen: ›So war’s halt. Es war nicht schön, ich hätte mir etwas anderes gewünscht. Aber so war’s eben.‹ Dann ist Trauern wichtig, aber irgendwann muss es auch damit gut sein. Denn jetzt könnt ihr mit euch selbst liebevoll sein, ihr könnt mit euren Kindern liebevoll sein. Ihr könnt ihnen sagen, dass ihr bedauert, was ihr aufgrund eurer Prägungen anders gemacht habt, als es richtig gewesen wäre. Das finde ich mindestens so wichtig, wie sich immerfort mit der Vergangenheit zu befassen. Zu schauen: Was hat es aus mir gemacht – und was möchte ich jetzt an mir verändern. Das ist der nächste Schritt. Man muss in der Gegenwart ankommen!« (Rohde, 2017a).
Und diese Gegenwart können wir nur mithilfe unserer Ressourcen gestalten – mit dem, was wir können, weil wir die sind, die das bisherige Leben aus uns gemacht hat. Wenn wir dazu kommen wollen, unsere Emotionen regulieren zu können, eine Wahrnehmung für Glück und Zufriedenheit zu entwickeln, uns nach destabilisierenden Situationen wieder in die Balance zu bringen, unsere Ängste zu begrenzen, aus Automatismen mithilfe von Bewusstheit und Achtsamkeit auszusteigen, empathisch auf andere zu reagieren und positive und eingestimmte Bindungen einzugehen – wenn wir diesen Ausdruck psychischer Gesundheit für uns realisieren wollen, sind es die Ressourcen, die uns dazu befähigen. Natürlich kommen wir um einen Blick auf die Ursachen der Probleme und des Leids nicht herum. Wie ich aus ganz persönlicher Erfahrung weiß (und im Epilog dieses Buches erzähle), kann die Recherche der eigenen Familiengeschichte sehr schmerzhaft und unangenehm sein. Sie ganz im Sinne Luise Reddemanns zu verstehen, zu akzeptieren und zu betrauern, ist ein unvermeidlicher Schritt. Mindestens so bedeutend ist aber das Bewusstsein für unsere Stärken und die Antwort auf die Frage, wie wir Probleme gelöst und Krisen gemeistert haben. Die Therapie- und Coachingforschung weist nach, wie wichtig diese Aktivierung unserer Ressourcen ist. Dazu gehört auch, uns nicht permanent für unsere dysfunktionalen Muster zu verurteilen. Sie waren einmal die gesunde Reaktion auf ungesunde, wenn nicht toxische Verhältnisse. Ein bisschen zugespitzt (aber nur ein bisschen): Sie haben uns in schwieriger Zeit das Überleben gesichert. Wir haben bisher leider verpasst, sie den aktuellen Bedürfnissen anzupassen. Um dieses Update geht es jetzt. Der klare Blick auf unser Gefühlserbe kann uns zu einem besseren Umgang damit verhelfen.
Die Geschichte der Kinderärztin Nadine Burke Harris, die in einem Brennpunktviertel von San Francisco ein Gesundheitszentrum für Kinder begründete, hat mich sehr beeindruckt. In ihrem Buch »Befreiung finden. Wie Sie die langfristigen Auswirkungen von Kindheitstraumata heilen« schreibt sie darüber, wie wir einen heilsamen und letztlich stärkenden Umgang mit diesen frühen Belastungen finden können. Sie stehen nach Burke Harris’ Überzeugung nicht nur für Leid. »Bei einigen Menschen können diese Belastungen das Durchsetzungsvermögen stärken, die Empathie vertiefen, die Entschlossenheit, andere zu schützen, fördern und Mini-Superkräfte freisetzen, aber allen Menschen gehen sie unter die Haut und in die DNA und werden zu einem wichtigen Bestandteil dessen, was sie sind. Ich bin nicht der Ansicht, dass Menschen, die mit ACEs [Adverse Childhood Experiences – belastenden Kindheitserfahrungen, S. R.] aufgewachsen sind, über ihre Kindheit ›hinwegkommen‹ müssen. Ich bin nicht der Ansicht, dass es nützlich ist, Kindheitsbelastungen zu vergessen oder ihnen die Schuld zuzuschreiben« (Burke Harris, 2020, S. 259). Der erste Schritt bestehe darin, ihr Ausmaß zu bestimmen und mit klarem Blick die Auswirkungen und Risiken weder als Tragödie noch als Ammenmärchen zu betrachten, sondern als aussagekräftige Realität dazwischen. »Sobald wir verstehen, wie unser Körper und unser Gehirn darauf ausgerichtet sind, in bestimmten Situationen zu reagieren, können wir die Art und Weise, wie wir an die Dinge herangehen, in Eigeninitiative verändern. Wir können lernen, Stressauslöser zu erkennen und wie wir uns selbst und die, die wir lieben, unterstützen können« (S. 259).
Die neurobiologische Basis unseres Verhaltens kennenzulernen, ist ein wichtiger Schritt. Auch unsere Gefühlserbschaften sind dort verankert. Sie zu identifizieren, führt uns zum missing link, der uns den Weg aus inneren Blockaden weist. Noch wichtiger scheint mir aber der Aspekt der Beziehungen zu sein. Gefühlserbschaften entstehen in Beziehungen und wirken auf sie. Deswegen ist es so bedeutsam, auch den Prozess ihrer Aufarbeitung im Kontakt mit anderen zu gestalten, vorsichtig zunächst, aber dann mit wachsender Offenheit. Meine Einladung ist daher, über dieses Thema nicht einfach nur zu lesen, sondern mit anderen in Kontakt zu kommen. Ich habe oft erlebt, dass Workshopteilnehmende die gesamte Literatur zum Thema kannten, aber geradezu beseelt waren, endlich mit anderen über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen zu können.
Zunächst über Leidvolles, aber später auch über die eingangs zitierte Frage, was wir können, weil wir Kriegsenkel sind – sie wird in diesem Buch erweitert: weil wir Gefühlserben sind. Lebensgeschichten, in denen sich das unverarbeitete Leid, die abgewehrte Schuld von Vorfahren auf erschütternde Weise spiegeln, gibt es in jeder Generation, in jeder Gesellschaft. Die Mechanismen der Weitergabe sind dieselben. Aber jedes Mal, wenn wir uns ihrer Überwindung zuwenden, gibt es einen interessanten Shift in der Stimmung. Jedes Mal. Nicht nur, dass den Teilnehmenden nach anfänglicher Hemmung viele Ressourcen einfallen und ihnen Dinge bewusst werden, die in ihrem Leben sehr gut gelungen sind. Sie bekommen auch deutlich bessere Laune. Die ziemlich stabile Problemorientierung, die vielen Menschen eigen ist, wird etwas durchlässiger, verliert ein wenig von ihrer Macht. Seien wir nicht naiv: Das sind natürlich Momentaufnahmen, und eine Workshopübung von einer Stunde verändert nicht das gesamte Lebensgefühl. Und doch sind solche Erfahrungen wertvoll und wichtig, weil es eben Erfahrungen sind, nicht nur Gedanken, weil sich damit positive Körperempfindungen und Gefühle verbinden, an die wir später anknüpfen können.
Auch deswegen spricht mir eine Aussage der Psychotherapeutin Katharina Ohana aus der Seele. Ich habe sie oft zitiert: »Wir sind nicht mehr so richtig jung, doch alt sind und fühlen wir uns auch noch nicht: Jetzt ist noch Zeit, etwas zu ändern. Die Wiederholungsmuster sind längst offensichtlich. Und wer nicht den Rest seines Lebens an die fremdbestimmenden Mächte in seinem Unbewussten verlieren will, der schaut sich spätestens jetzt an, warum sich so viele Sehnsüchte unerfüllt aufgestaut haben. Und warum das Leben nicht so geworden ist, als wir damals aufbrachen, es zu erobern« (Ohana, 2015, S. 129).
Jetzt ist noch Zeit, etwas zu ändern! Dieser Satz ist zentral. Und wie viel mehr gilt er für junge Menschen, die ihrem dysfunktionalen Gefühlserbe nicht erst mit 50 oder 60 Jahren auf die Spur kommen, sondern bereits mit 25 oder 30 Jahren!
Einladung zur Reflexion
Fragen und Übungen
Die »Entdeckungsreise Gefühlserben« hat begonnen. Um sie bewusster wahrnehmen zu können, lade ich nach jedem Kapitel dazu, einige Fragen zu beantworten oder kleine Übungen zu machen. Und los geht’s.
Fragen zum Start
–Warum lese ich dieses Buch?
–Warum jetzt?
–Gibt es ein Verhalten oder ein Phänomen, das ich an mir nicht verstehe, aber immer wieder erlebe?
–Was kann ich, weil ich genau mein Leben gelebt habe?
Das Wort »Gefühlserbe«
–Welche der Sätze im Kapitel »So klingt ein Gefühlserbe« (S. 17 f.) haben Resonanz in mir ausgelöst?
–Was könnte sich dahinter verbergen?
–Gibt es Emotionen oder Körperempfindungen, die sich mit dieser Ahnung verbinden?
Übung
Meine Lebenslinie
Diese Übung eignet sich besonders gut, einen umfassenderen Blick auf die eigene Biografie zu bekommen.
1. Schritt:Teilen Sie Ihr Leben in Fünf-Jahres-Abschnitte auf.
2. Schritt:Schreiben Sie für jeden Abschnitt drei Ereignisse auf:
–ein positives
–ein negatives
–eines, bei dem Sie etwas Wichtiges gelernt oder ein Problem gelöst haben
3. Schritt:Nehmen Sie ein großes Stück Papier (oder mehrere) und zeichnen Sie eine Linie, die Ihre emotionale Verfassung in jenen Jahren widerspiegelt und eine Verbindung schafft zwischen den Ereignissen aus Schritt 2. Vielleicht entstehen auch zwei Linien?
4. Schritt:Achten Sie auf die Wendepunkte der Linie, an denen sie ihre Richtung nach oben oder unten ändert – was ist dort passiert?
Weitere Materialien zur Selbsterforschung finden Sie online auf www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com bei der Anzeige dieses Buches unter der Rubrik »Downloads«.
Das Gefühlserbe in unserem Leben
Rätselhaftes Erleben
Das Unbewusste im Alltag
Castings sind für viele Schauspieler:innen der pure Stress. Hier entscheidet sich, ob sie in der kommenden Zeit Arbeit haben, wie viel sie verdienen werden, wie sich ihre Karriere weiterentwickelt, ob sie auf dem Weg, irgendwann keine Castings mehr zu benötigen, einen nächsten Schritt gehen können. Entsprechend gut sind die meisten vorbereitet, kennen ihren Text, sind emotional präpariert, um dann in einer kurzen Zeitspanne die beste Version von sich selbst zu präsentieren. Von einem solchen Casting berichtete mir eine Klientin, längst etabliert, aber dennoch nicht dort angekommen, wo sie ihr Potenzial als Schauspielerin ausgeschöpft sah. Noch auf der Treppe zum Studio hatte sie sich gut gefühlt, oben einige Kolleg:innen begrüßt, um nun fokussiert auf alles Weitere zu warten. Aber dann ging die Tür auf, ein hochgewachsener Mann mit scharf geschnittenen Gesichtszügen betrat den Raum, ließ seinen Blick über die Anwesenden schweifen – und die eben noch selbstbewusste Frau, die sich gut vorbereitet glaubte, sackte innerlich zusammen. Mit großer Kraftanstrengung wahrte sie ihre Fassung. Auf einer Skala des Selbstbewusstseins von 1 bis 10 sei sie in Sekunden von 8 auf 1 gerutscht, berichtete sie mir. Die Rolle bekam eine Mitbewerberin.
Was war passiert? Ganz offenbar hatte die schneidige Ausstrahlung des Schauspielkollegen ihr den inneren Halt genommen. Die Fassungslosigkeit über dieses Erleben stand ihr immer noch im Gesicht, als wir die Situation bearbeiteten. Sie kenne das aus früheren Castings und Dreharbeiten, habe das aber ihrer damaligen Unerfahrenheit zugeschrieben. Heute, fast zehn Jahre später und mit einer respektablen Liste von Referenzen, erschien ihr ihre Reaktion ebenso rätselhaft wie verstörend. Noch tagelang habe sie sich danach kraftlos und deprimiert gefühlt.
Die Übung, zu der ich sie einlud, verbindet die Wahrnehmung von Körperempfindungen und von ihnen ausgelösten inneren Bildern. Im Verlauf tauchte eine dystopische Ruinenlandschaft auf, nichts, was die 1987 geborene Frau schon einmal selbst erlebt hatte. Sehr wohl aber ihr Vater, kurz nach dem Krieg im zerstörten Berlin geboren und aufgewachsen. Die Erinnerung an eine seiner raren Erzählungen über die Nachkriegszeit führte dann zur Erklärung für das seltsame Kollabieren während des Castings: Der Vater hatte als Kind und Jugendlicher mehrfach demütigende Erfahrungen mit Offizieren der Besatzungsmächte gemacht. Das schneidige Auftreten des Kollegen beim Casting hatte dieses Gefühlserbe in der Tochter wachgerufen. Und das, obwohl sie sich kaum je für die Erlebnisse ihres Vaters in der Berliner Nachkriegszeit interessiert hatte.
In seinem Roman »Eurotrash« bringt der Schriftsteller Christian Kracht das Prinzip der transgenerationalen Übertragungen plakativ auf den Punkt: »Was nicht ins Bewusstsein steigt, kommt als Schicksal zurück« (Kracht, 2021, S. 36). Und dafür, was dann passiert, hat der Psychoanalyseforscher Stephen Frosh ein treffendes Bild gezeichnet: »Wenn das Unbewusste existiert, dann wird es, ganz gleich, was wir sagen, um ihm auszuweichen, immer zu uns zurückkehren […] Dinge, die von früheren Geschehnissen übriggeblieben sind oder aus der bewussten Anerkennung ausgeschlossen wurden. Es sind die randständigen Dinge, die uns von der Seitenlinie und aus den Tiefen anspringen und uns verfolgen, während wir unser vermeintlich normales Leben führen« (zit. nach Frie, 2021, S. 86). Tatsächlich erlebte die Klientin ihr Verhalten in der Castingsituation als schicksalhaft, als eine empfindliche Störung aus der Tiefe. Im neu gewonnenen Bewusstsein, eine fast 70 Jahre zurückliegende Erfahrung ihres Vaters zu reinszenieren, entstand ein völlig neuer Blick auf die Situation. Und damit die Möglichkeit, die hochmütige Attitüde von Kollegen einfach ins Leere laufen zu lassen.
So erleichternd Erkenntnisse wie diese für Menschen sein können: Sie sind immer wieder von Skepsis, Zweifeln, ja Abwehr begleitet. Kann das wirklich sein? Sind, wie in dieser Geschichte, die demütigenden Erfahrungen des Vaters ursächlich für das Scheitern der Tochter – und das in einer völlig anderen Situation? Oder ist es vielmehr »verweichlichtes Getue«, das von eigener Unfähigkeit ablenken soll? So wurde es mir von einem Leser anlässlich einer Zeitungsveröffentlichung über transgenerationale Traumata vorgehalten. Wer für eine Aufgabe zu blöd oder zu schwach sei, stilisiere sich eben zum Opfer und schiebe alles auf die Eltern. Mit dieser Polemik, aus der Wissenschaftsfeindlichkeit klingt, muss umgehen lernen, wer öffentlich über diese Themen spricht.
Ein Gefühlserbe liegt nahe, wenn für die erlebte Reaktion – wie im gerade beschriebenen Fall ein inneres Zusammensacken – in der eigenen Biografie oder in der aktuellen Situation keine Ursache zu finden ist. Tatsächlich ist aber ein Beweis, wie sich transgenerationale Übertragung konkret ausgestaltet, nur schwer zu führen. Dazu sind die Faktoren zu individuell, ebenso das traumatische Erleben selbst. Wenn wir Zusammenhänge wie diese aufdecken, dann sprechen wir nicht über Gesetzmäßigkeiten, sondern über Wahrscheinlichkeiten und Plausibilitäten. Es gibt keinen Determinismus. Weder muss das Erleben potenziell traumatisierender Erfahrungen bei jedem Menschen tatsächlich zu einem Trauma führen noch werden Traumata zwangsläufig an zukünftige Generationen übertragen. Aber wenn es eben doch geschehen ist und wir einen Widerschein in schicksalhaft erlebten Situationen von Kindern oder Enkeln beobachten, liegt es nahe, hier genauer hinzuschauen. Angesichts einer Vielzahl von Studien aus unterschiedlichen Fachrichtungen können wir eben doch aus dem individuellen Erleben auf den größeren Zusammenhang schließen und eine sehr persönliche Botschaft formulieren: »Was du erlebst und worunter du leidest, ist nicht deins. Du reinszenierst, was das Leben deiner Vorfahren bestimmt hat.«
Wie sich die Erfahrungen voriger Generationen auf zukünftige übertragen: Das ist Inhalt dieses Kapitels. Es geht dabei sowohl um die Wege der Übertragung, die Gefühlserbschaften selbst als auch um die Bereiche unseres Lebens, in denen sich ihre Wirkungen zeigen:
–in der Psyche,
–im Körper,
–in Beziehungen,
–im Lebensweg.
Naturgemäß lässt sich das nicht trennscharf voneinander abgrenzen. Das wird schon an der Geschichte der Schauspielerin deutlich. Der Kontakt mit dem Kollegen löste zunächst ein inneres Kollabieren aus, also ein psychisches Erleben. Er aktivierte Selbstzweifel, minderte zumindest vorübergehend das Selbstwertgefühl und rief eine Angst vor zukünftigen Castings und Dreharbeiten hervor. Die körperlichen Auswirkungen waren in Form von Kraft- und Antriebslosigkeit noch Tage danach spürbar. In die Beziehung zu anderen Menschen trug das Erleben dieses Typus »schneidiger Mann« eine Unsicherheit und potenzielle Unterlegenheit hinein, auch ein Widerschein der instabilen Persönlichkeit des Vaters. Und dass ein verpatztes Casting sich negativ auf die Schauspielkarriere auswirken kann, liegt auf der Hand.
Der Ausdruck, den sich Erfahrungen früherer Generationen im Denken, Fühlen und Handeln ihrer Nachfahren suchen, kann typischen Mustern folgen oder sich individuell ausprägen. Aber es gibt eine Faustregel: Je dramatischer der Auslöser, umso dramatischer seine späteren Folgen.
Epigenetik & Co.
Die Wege transgenerationaler Übertragungen
»Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm« – diese Redewendung ist uns vertraut. Wir erkennen in der Tochter die Mutter, im Sohn den Vater oder auch in allen vieren die Großeltern. Auf Fotos suchen wir mit Neugier und Vergnügen die Familienähnlichkeit und forschen in Lebensläufen oder Karrieren nach den Analogien. Nicht selten werden wir fündig und sagen dann »ganz der Vater, die Mutter, die Oma«. Je nach Betonung kann sich darin Anerkennung oder Abwertung ausdrücken, Letzteres gern auch in dieser Formulierung: »Du bist genau wie dein Vater!« Dass es in Familien Traditionen gibt, Eigenschaften, die übereinstimmen, Talente und berufliche Neigungen, die sich über mehrere Generationen erhalten, ist eine Alltagserfahrung. Die sozialwissenschaftliche Forschung belegt seit Jahrzehnten Zusammenhänge zwischen den Sozial-, Erziehungs-, Verhaltens- und Wirtschaftsparametern von Eltern und Kindern. Und natürlich erleben wir darin das Phänomen transgenerationaler Übertragung.
Und doch ist die Entwicklung der Psyche eines Menschen nicht einfach das Ergebnis dieser Übertragungen. Tatsächlich ist sie nichts weniger als ein Wunder. Wie sich unser Wesen ausbildet, unsere Fähigkeit zur Kommunikation, zur Interaktion, zur Selbstregulation, später zum Umgang mit Konflikten, gehört zu den faszinierendsten Fragen des Lebens. Und natürlich ist sie Gegenstand zahlloser Forschungen und Theorien, die immer tiefere Einsichten und Erkenntnisse hervorbringen. Lange überholt ist die Vorstellung, ein Mensch komme gleichsam als weißes Blatt, das vom Leben beschrieben werde, zur Welt und relevant seien auch nur die Erlebnisse, die er konkret erinnere. Freilich ist diese Vorstellung für unser Thema von großer Bedeutung, denn sie erklärt die Skepsis vieler gegen das Phänomen der transgenerationalen Übertragung. Immer wieder behaupten Menschen, die im Krieg oder während einer erzwungenen Migration noch Säuglinge waren, das Geschehen sei für sie und ihre psychische Gesundheit vollkommen ohne Bedeutung; sie hätten ja gar nichts mitbekommen.1 Ein Irrtum. Heute wissen wir, dass gerade diese frühen Erfahrungen prägende Spuren in der Psyche hinterlassen. Schon vom dritten Monat der Schwangerschaft an zeigen Ungeborene individuelle Reaktionen auf äußere Reize, und mit jedem Monat prägen sich die Sinne stärker aus. Schon diese vorgeburtlichen Erfahrungen beeinflussen unsere Entwicklung, erst recht aber unsere Erlebnisse, nachdem wir auf die Welt gekommen sind. Abseits des Genmaterials, das wir in uns tragen, entwickelt sich im Kontakt mit den Eltern die Psyche. Alles, was sie uns entgegenbringen, findet in uns Resonanz. Dabei geschieht Transmission, sie ist kein kontrollierter Vorgang. Es gibt natürlich eine bewusste Weitergabe von Haltungen, Handlungen und Werten, aber das allermeiste, das uns übertragen wird, ist unbewusst. »Wir können nicht nichts weitergeben an die nächste Generation«, sagt der Psychoanalytiker Dieter Bürgin. »Transmission ist etwas Unumgängliches« (Bürgin, 2011).
Vier Ebenen der Persönlichkeit
Was wurde, was wird da übertragen? Weiten wir die Perspektive ein wenig und schauen nicht mehr nur auf dysfunktionale und belastende Aspekte der Übertragung aus vorigen Generationen, sondern auf unsere Persönlichkeit als Ganzes, sehen wir vier Ebenen. Sie werden in verschiedenen Phasen unserer Entwicklung geprägt, von der Zeugung bis ins Erwachsenenalter, und sind in unterschiedlichen Gehirnregionen lokalisiert (für die folgende Aufstellung vgl. Roth, 2013).
Die Basis bildet das vegetativ-affektive Verhalten auf der unteren limbischen Ebene. Es macht unser Temperament aus und ist durch genetische, epigenetische und vorgeburtliche Einflüsse bedingt. Hier sind grundlegende Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit, Selbstvertrauen, Kreativität, Vertrauen, der Umgang mit Risiken, Ordnungsliebe, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein angesiedelt. Diese Ebene ist durch Erfahrung und Erziehung kaum zu beeinflussen.
Auf der nächsthöheren Ebene finden wir das unbewusste Selbst, das sich in den ersten Lebensjahren entwickelt. Es ist auf der mittleren limbischen Ebene und in der Amygdala, unserem Angstzentrum, verankert. Elementare Funktionen wie Furcht, Freude, Glück, Verachtung, Ekel, Neugierde, Hoffnung und Erwartung werden hier angebunden an die individuellen Lebensumstände. Zugleich ist die Amygdala der Teil des Gehirns, der unsere unbewusste Wahrnehmung emotionaler Signale wie Blick, Mimik, Gestik und Körperhaltung steuert. Zusammen mit der ersten Ebene bildet das unbewusste Selbst den Kern unserer Persönlichkeit. In späteren Jahren ist es nur über starke Emotionen oder ausdauerndes Üben zu beeinflussen.
Das individuell-soziale Ich formt sich in der späten Kindheit und Jugend und wird vor allem durch sozial-emotionale Erfahrungen beeinflusst. Der Ort im Gehirn ist die obere limbische Ebene. Hier ist angelegt, wie sich Gewinn- und Erfolgsstreben ausprägen, welche Bedeutung Anerkennung und Ruhm, Freundschaft, Liebe, soziale Nähe, Hilfsbereitschaft und Ethik haben. Zusammen mit den beiden unteren Ebenen entstehen grundlegende sozial-relevante Persönlichkeitsmerkmale wie Machtstreben, Dominanz, Empathie, Kommunikationsbereitschaft und die sozialverträgliche Verfolgung individueller Ziele. Zu verändern ist das individuell-soziale Ich vor allem im direkten emotionalen Kontakt mit anderen.
Schließlich das kognitiv-kommunikative Ich. Es ist der Ausdruck der bewussten Kommunikation und im präfrontalen Cortex angesiedelt. Es steuert unsere bewusste Handlungsplanung, die Art, wie wir uns die Welt erklären und unser Verhalten vor uns selbst und anderen präsentieren. Dieser Anteil der Persönlichkeit entsteht relativ spät und verändert sich ein Leben lang, sowohl durch Bewusstseinsprozesse als auch durch Interaktion mit anderen.
Was anhand dieser Aufgliederung deutlich wird: Je früher eine Facette unserer Persönlichkeit angelegt wird, umso tiefer ist sie eingeprägt und umso schwerer ist sie später zu verändern. Der Aufbau und die Entwicklung des Gehirns erfolgen Schicht um Schicht von unten nach oben. Dies verläuft bei jedem Menschen in seiner individuellen Entwicklung genauso, wie unsere Spezies als Ganzes im Laufe der Evolution allmählich ihren aktuellen Zustand erreicht hat (vgl. van der Kolk, 2023).
Transgenerationale Übertragungen
Was anhand der Ebenen der Persönlichkeit ebenso deutlich wird: Ein Gutteil der Facetten ist zumindest teilweise Ergebnis transgenerationaler Übertragungen. Als da sind:
1.Genetik,
2.Epigenetik und vorgeburtliche Prägung,
3.frühe Bindungserfahrungen,
4.Sozialisation im Familiensystem,
5.Prägung durch das Kollektiv.
1. Genetik
Die Genetik sei in aller Kürze abgehandelt. In unserem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass nicht nur Körperbau und Augenfarbe vererbt werden. Auch Intelligenz, spezielle Talente wie ein besonderes Gehör sowie etwa die Bereitschaft, sich engagiert für eine Sache einzusetzen, werden zumindest teilweise vom Erbgut bestimmt. Ebenso kann die Disposition für körperliche und psychische Erkrankungen vererbt werden. Was nicht über das eigentliche Erbgut – das Genom – vererbt werden kann: negative oder gar traumatische Erfahrungen. Eine andere Art der Vererbung ist aber durchaus möglich: über das Epigenom. Und damit sind wir bei einer vergleichsweise jungen Wissenschaft, die völlig neue Einsichten in die Mechanismen der transgenerationalen Weitergabe ermöglichen.
2. Epigenetik
»Traumata sorgen nicht nur für Narben in der Seele, sondern auch für Narben im Erbgut«: Auf diese anschauliche Formel bringt es der Schweizer Depressionsforscher Florian Holsboer (zit. nach Badenschier u. Schwarz, 2020). Aber er meint damit nicht Veränderungen an unserer DNA, also den Genen selbst, sondern an der Art, wie sie aktiviert werden. Es sind epigenetische Marker, die zum Beispiel anfällig für eine Depression machen können. Was geschieht da? Die Gesamtheit unseres Erbguts – unser Genom – umfasst etwa 25.000 Gene. Sie sind in fast jeder Zelle unseres Körpers vorhanden, aber längst nicht in jeder aktiv. So können sich mehr als 250 Zelltypen ausformen, die jeweils vollkommen andere Aufgaben erfüllen. Diese Genexpression wird vom Epigenom gesteuert, einer Informationsebene oberhalb unserer Gene. Und im Unterschied zu unseren Genen verändert sich dieses Epigenom unter dem Einfluss unserer Erfahrungen im Leben. Bei der Untersuchung von eineiigen Zwillingen zwischen drei und 74 Jahren stellten spanische Forscher:innen fest, dass das Epigenom der jüngsten Proband:innen sich kaum unterschied, das der ältesten aber erheblich (Badenschier u. Schwarz, 2020).
Diese Erkenntnisse werden gestützt durch mittlerweile zahlreiche Studien dieser vergleichsweise jungen Forschungsdisziplin. Wichtige Faktoren, die auf das Epigenom wirken, sind:
–Fürsorge in den ersten Lebensmonaten,
–Ernährung,
–Lebensführung,
–prägende Lebensereignisse,
–Krankheiten.
2017 gelang Forscher:innen am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik der Nachweis, auf welche Weise dieses veränderte Epigenom die Grenze der Generationen überschreiten und an Kinder oder sogar Enkel weitervererbt werden kann. Sie lieferten damit die biologische Erklärung für Beobachtungen, die Forschende in ganz anderen Zusammenhängen gemacht hatten:
–warum die Kinder von Holocaustüberlebenden sehr viel häufiger unter Stresserkrankungen leiden als Kinder anderer jüdischer Familien;
–warum im Wohlstand lebende Kinder und Enkel von Frauen, die in der Schwangerschaft über längere Zeit hungern mussten, häufiger unter Diabetes und Adipositas leiden;
–warum Menschen, die in ihrer frühen Prägephase wenig Fürsorge erlebt haben, potenziell vererbbare Störungen im Stresshormonsystem bekommen;
–warum Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft von häuslicher Gewalt bedroht waren, sich als Jugendliche ängstlicher, stressanfälliger und weniger neugierig zeigten.
Grundsätzlich sichert die Epigenetik dem Organismus das Überleben, indem sie ihn anpassungsfähig macht an Umweltbedingungen wie etwa die Verfügbarkeit von Nahrung. Aber sie kann eben auch negative Auswirkungen haben: Traumata, chronischer Stress oder bestimmte Drogen können das Epigenom so verändern, dass etwa die Anfälligkeit für Depressionen, Zwangserkrankungen oder Panikstörungen steigt (Luerweg, 2020). Offenbar ist gerade die Schwangerschaft eine Zeit, in der epigenetische Weichen gestellt werden.
Was im Labor deutlich wurde (und in Tierversuchen mehrfach bestätigt): Genau die Gene, die für die Resilienz und die Regulation von Stress zuständig sind, waren bei den Untersuchten nicht aktiviert. Verschiedene biochemische Vorgänge können das bewirken. Die bekannteste ist die Methylierung. Dabei setzen sich kleine Moleküle an die DNA und verhindern, dass die darin enthaltenen Informationen von der Zelle gelesen werden können. Forscher:innen vermuten, dass diese epigenetischen Veränderungen bei der Zeugung eines Kindes über die Keimzellen der Eltern vererbt werden (Jawaid u. Mansuy, 2021, S. 281).
Die gute Nachricht ist: Die Methylierung ist reversibel. Das Epigenom kann sich nicht nur zum Negativen, sondern auch zum Positiven verändern. Und so gibt es erste Hinweise, dass auch Psychotherapien diesen Effekt haben könnten (Domschke, 2021). Die