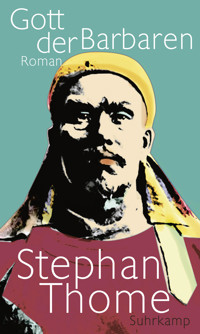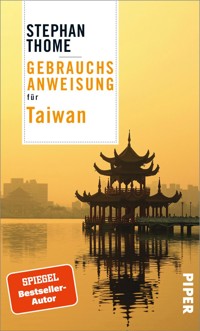11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Maria ist achtzehn und möchte raus aus Portugal. Mitte der Siebzigerjahre bietet das Land einer jungen Frau wenig Perspektiven. Maria will nicht heiraten und Kinder kriegen, sie will mehr vom Leben. Als das neue Jahrzehnt anbricht, geht sie nach Berlin, beginnt ein Studium und eine Beziehung mit einem rebellischen Theatermacher, die bald scheitert. Allen Plänen vom unabhängigen Leben zum Trotz findet sich Maria schließlich als Ehefrau und Mutter in der nordrhein-westfälischen Provinz wieder und schaut ihrem Mann Hartmut beim Karrieremachen zu. Lang arrangiert sie sich mit den Verhältnissen, aber als die Tochter erwachsen ist, trifft Maria eine Entscheidung.
Lissabon nach der Nelkenrevolution, die Hausbesetzerszene in West-Berlin, die deutsche Provinz vor und nach der Wende: Stephan Thome erzählt in markanten, spannungsreichen Szenen eine bekannte Geschichte neu und völlig anders. Gegenspiel ist ein berührender und manchmal verstörender Roman über Aufbruch und Verantwortung, auch gegenüber dem eigenen Leben – ein Roman voller Empathie und psychologischer Raffinesse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Maria ist zwanzig und möchte raus aus Lissabon und raus aus Portugal. Mitte der siebziger Jahre bietet das Land einer jungen Frau wenig Perspektiven. Maria aber will nicht heiraten und Kinder kriegen, sie will mehr vom Leben. Als das neue Jahrzehnt anbricht, geht sie nach Berlin, beginnt ein Studium und eine Beziehung mit einem rebellischen Theatermacher, die bald scheitert. Allen Plänen vom unabhängigen Leben zum Trotz findet sich Maria schließlich als Ehefrau und Mutter in der nordrhein-westfälischen Provinz wieder und schaut ihrem Mann Hartmut beim Karrieremachen zu. Lange arrangiert sie sich mit den Verhältnissen, aber als die Tochter erwachsen und auf dem Sprung aus dem Haus ist, trifft Maria eine Entscheidung.
Lissabon nach der Nelkenrevolution, die Hausbesetzerszene in West-Berlin, die deutsche Provinz vor und nach der Wende: Stephan Thome erzählt in markanten, spannungsreichen Szenen eine bekannte Geschichte neu und völlig anders. Gegenspiel ist ein berührender und manchmal verstörender Roman über Täuschung und Selbsttäuschung, über Aufbruch und Verantwortung, auch gegenüber dem eigenen Leben – ein Roman voller Empathie und psychologischer Raffinesse.
Stephan Thome wurde 1972 in Biedenkopf/Hessen geboren. Er studierte Philosophie und Sinologie und lebte und arbeitete zehn Jahre in Ostasien. Seine Romane Grenzgang und Fliehkräfte standen auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Zuletzt wurde er mit dem Kunstpreis Berlin für Literatur ausgezeichnet. Stephan Thome lebt in Lissabon.
Im Suhrkamp Verlag erschienen zuletzt die Bände:
Grenzgang. Roman, 2009
Fliehkräfte. Roman, 2012
Stephan Thome
Gegenspiel
Roman
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der Ausgabe:
Erste Auflage 2015
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Umschlagfoto: GOZOOMA
eISBN 978-3-518-73992-1
www.suhrkamp.de
Für die vier aus Dortmund: Kathrin, Jörg, Jonas und Julian
Erster Teil
1 »Schatz, was ist los?«
Die Stimme ihres Mannes klingt alarmiert. Auf dem Beifahrersitz nach vorne gebeugt, spürt Maria seine Hand auf ihrer Schulter, aber anstatt sie abzuschütteln, hält sie still und lässt ihren Tränen freien Lauf. Was soll schon los sein. Wochenlang lag der Tag wie eine Prüfung vor ihr, heute hat sie mit Kopfschmerzen in einem überfüllten Zug gesessen und hätte nach dem Wiedersehen lieber geplaudert oder geschwiegen, statt die inquisitorischen Fragen zu beantworten, mit denen Hartmut sie kurz hinter Marburg zu bedrängen begann. Wie die Sitzung war, derentwegen sie den gestrigen Polterabend verpasst hat. Warum ihr Chef so bitter ist und ob er schon immer so war. Nervt sie das nicht? Und überhaupt, haben sich ihre Erwartungen an den Job erfüllt oder …
»Maria?« Er nimmt den Fuß vom Gas und scheint nach einer Haltemöglichkeit zu suchen. Was er hören will, weiß sie ebenso gut, wie er weiß, dass sie es nicht sagen wird. Sie hebt ihre Handtasche vom Boden auf, kann die Tabletten nicht finden und greift nach einem Taschentuch. Die Uhr am Armaturenbrett zeigt Viertel nach zwei. Vor wenigen Minuten hätte ihr Mann fast einen Kreisverkehr überfahren, seitdem konzentriert er sich auf die Strecke, die zwischen abgeernteten Feldern entlangführt und durch Dörfer, die wie ausgestorben in der Nachmittagssonne liegen. Hier und da stehen Traktoren in den Hofeinfahrten. Seit sie einmal in der deutschen Provinz gewohnt hat, kann sie gepflegte Vorgärten nicht betrachten, ohne sich ihre engstirnigen Besitzer vorzustellen. Sie schnäuzt sich und steckt das Taschentuch wieder weg. Rechts der Straße bietet ein verwittertes, von Hand geschriebenes Schild ›Sonnenblumen zum Selbstabschneiden‹ an.
»Was geschieht mit uns?«, fragt sie in die Stille hinein. Für hiesige Verhältnisse ist es ein heißer Sommer. In Berlin waren es früh am Morgen über zwanzig Grad.
»Was meinst du?«
»Was geschieht mit uns? Warum können wir nicht mehr reden?«
»Wir reden schon eine ganze Weile.«
»An einander vorbei. Um einander herum. Was auch immer.« Energisch wischt sie sich die Tränen aus dem Gesicht und spürt neben sich ein Innehalten. Einen Monat lang haben sie einander nicht gesehen und es binnen weniger Minuten geschafft, sich die Wiedersehensfreude durch seine bohrenden Fragen und ihre ausweichenden Antworten zu verderben. »Du tust so«, fährt Maria fort, um einer Erwiderung zuvorzukommen, »als würdest du dich für meine Arbeit interessieren, aber in Wirklichkeit gilt dein Interesse ausschließlich der Frage, wann ich sie an den Nagel hänge.«
»Es geht nicht um die Tatsache, dass du arbeiten willst. Ich hab dich immer –«
»Zu Portugiesisch-Kursen an der Volkshochschule, ja.« Ruckartig wendet sie den Kopf und hält ihm die ausgestreckten Finger der rechten Hand vors Gesicht. Eine merkwürdige Geste, findet sie selbst. »Ich hab fünf solcher Kurse gegeben. Fünf.«
»Was hättest du gerne von mir gehört?«, fragt er. »Geh doch nach Berlin, Schatz. Ruf Falk Merlinger an und frag, ob er Verwendung für dich hat. Hier in Bonn störst du mich sowieso nur. Das?«
Die geröteten Tränensäcke unter seinen Augen erinnern sie an jenen Morgen vor zehn Monaten, als sie zwischen Haustür und beladenem Umzugswagen die ganze Wucht ihres schlechten Gewissens gespürt und zu ihm gesagt hat: Wir sind stark genug, wir schaffen das. Seitdem geschieht etwas, das sie beide nicht wollen, das sie sogar unbedingt verhindern möchten, bloß jeder auf seine Weise, und damit erreichen sie am Ende das Gegenteil. Ihre anfängliche Zuversicht ist jedenfalls dahin.
»Neulich hab ich gedacht«, sagt sie langsam, »es gibt so viele Dinge, die ich gerne mit dir teilen würde. Von denen ich gerne erzählen würde, aber jedes Mal sehe ich schon vor dem ersten Satz den Verlauf des Gesprächs vor mir. Ich weiß genau, wo du einhaken wirst. Sobald ich von Schwierigkeiten spreche, machst du dir Hoffnungen. Wenn ich von Problemen berichte, ernte ich kein Verständnis, sondern bestätige deine Meinung, den falschen Schritt getan zu haben. Außerdem fühle ich mich augenblicklich schlecht, weil ich dir Hoffnungen mache, die ich dann wieder enttäuschen muss.« Diesmal wartet sie, ob er etwas erwidern will, aber er nimmt nur die Hand vom Lenkrad und dreht an der Klimaanlage. Übernächtigt sieht er aus, obwohl er behauptet hat, nach dem Polterabend um halb zwölf ins Bett gegangen zu sein. »Das ist das Zweite: Permanent zwingst du mich in die Rolle derjenigen, die unsere Ehe gefährdet, indem sie ihre eigenen egoistischen Pläne verfolgt.«
»Ich wusste nicht, dass unsere Ehe in Gefahr ist.«
»Doch, das weißt du«, hört sie sich sagen. Wie um die Höhe der inneren Hürde anzudeuten, die sie dabei überwinden musste, macht ihr Herz einen Sprung, und augenblicklich treibt der Schwung sie weiter. »Aber du scheinst nicht zu wissen, inwiefern diese Gefahr von deinem Verhalten ausgeht.«
»Informier mich.«
»Seit einem Jahr treten wir auf der Stelle –«
»Zwei Stellen«, unterbricht er. »Kann ja nicht schaden, es genau zu nehmen.«
»… kommen keinen Schritt vorwärts und verschwenden die kostbare Zeit unseres Zusammenseins damit, immer wieder dieselben ergebnislosen Gespräche zu führen. Dabei könnte das alles eine Bereicherung sein – was ich erlebe und was du erlebst. Wir haben Dinge, über die wir reden können. Wir könnten das teilen. Es könnte schön sein, wenn –«
»Wenn ich endlich diese dämliche Idee aus meinem Kopf bekäme, dass wir am besten in einer Stadt leben sollten.« Er wendet den Kopf, als wollte er sich ihrer Zustimmung versichern, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Der Zug hatte Verspätung, in einer Stunde beginnt die Trauung, ihnen wird gerade genug Zeit bleiben, um das Gepäck ins Hotel zu bringen und sich frisch zu machen. »Richtig? Würde ich endlich einsehen, dass fünfhundert Kilometer die perfekte Distanz zwischen zwei Ehepartnern sind, wäre unser Leben wie Marzipan. Gott, was wir außer Tisch und Bett alles teilen könnten.«
»Hör dir zu, Hartmut! Du klingst – beleidigt.«
Es ist genau das Gespräch, das sie zu vermeiden beschlossen hatte, als sie zwischen lärmenden Jugendlichen im ICE nach Kassel saß. Die Kopfschmerzen kamen davon, dass sie gestern Abend viel Wein trinken musste, um nach der Sitzung am Theater ihre Nerven zu beruhigen. Falk weigert sich zu verstehen, dass ein Schauspieler das Ensemble verlassen will, und wie immer ist es an ihr hängengeblieben, zwischen den Parteien zu vermitteln. Jetzt kann sie nicht mehr. Es ist das letzte Wochenende im Juli, nur noch die Hochzeit von Hartmuts Neffen liegt vor dem ersehnten Beginn der Sommerferien. Morgen werden sie nach Bonn fahren und am Dienstag gemeinsam nach Lissabon fliegen, wo ihnen Joãos Wohnung zur Verfügung steht, bis sie entschieden haben, wohin es danach gehen soll. Im Stillen ärgert sie sich bereits, von einer Gefahr für ihre Ehe gesprochen zu haben. Sätze wie diesen äußert sie gegen ihren Willen, wenn sie sich von ihrem Mann verhört und in die Enge getrieben fühlt. Lass uns ein andermal reden, will sie bitten, aber als hätte er die Unterhaltung rekapituliert und den entscheidenden Fehler entdeckt, hebt Hartmut die Hand. »Moment!«, sagt er lauter als zuvor. »Du beklagst dich, ich würde dir eine Rolle aufzwingen, die der eigensüchtigen Selbstverwirklicherin. Darf ich dazu anmerken: Erstens hast du dir diese Rolle selbst ausgesucht, und du spielst sie auch ziemlich gut. Zweitens verhält es sich umgekehrt: Du zwingst mir eine Rolle auf. Ach was, mehrere! Die des zurückgelassenen Ehemanns, des Bettlers um Zuwendung, der abends auf einen Anruf wartet. Eine schlimmer als die andere. Lauter Scheißrollen!«
»Das ist unser Problem«, sagt sie. »In deiner Wahrnehmung tue ich alles, was ich tue, dir an.«
»Unser Problem ist, dass dich nicht sonderlich kümmert, was du mir antust.«
»Der Name dafür lautet Egozentrik.«
»Fast richtig«, korrigiert er sie. »Er lautet Egoismus.«
Schweigend rollen sie ins nächste Dorf, das genauso aussieht wie die vorigen. Respekt, hat er vor ein paar Minuten gesagt, der Respekt gebiete es, ihm klipp und klar zu sagen, dass sie die Arbeit am Theaterwerk über das erste Jahr hinaus fortsetzen wolle. Worauf ihr keine bessere Erwiderung eingefallen ist als die Frage, ob er es als Respektlosigkeit seiner Person gegenüber empfinde, dass sie neuerdings arbeite. In fast zwanzig Ehejahren war es nie ihre Art, auf so kleinliche Weise zu streiten. Rechthaberisch und mit einem Anflug von Triumph bei gelungenen Attacken. Vor ihnen liegt ein langer Tag inmitten fröhlicher Hochzeitsgäste. Ruth wird sofort merken, dass etwas nicht stimmt, und noch bevor Maria es zeigen muss, spürt sie ihr falsches Lächeln wie eine Maske auf dem Gesicht. »Können wir noch mal von vorne anfangen?«, fragt sie und kann einen Seufzer nicht unterdrücken. Aussteigen will sie und allein über die Felder laufen, statt immer aufs Neue zu erklären, was offensichtlich genug ist, um keiner Erklärung zu bedürfen.
»Der Traum eines jeden älteren Paares, der leider –«
»Können wir!? Kannst du aufhören mit dieser albernen Stichelei. Bitte! Ja?«
»Okay«, sagt er wie ein gescholtenes Kind. »Ich hör dir zu.«
Eben nicht, denkt sie. Sonst müsste er verstehen, dass sie weder wegen Falk nach Berlin gegangen ist noch um von ihrem Mann getrennt zu leben, sondern aus einem einzigen schlichten Grund: weil in ihrem Alter jedes Nein das letzte gewesen sein könnte, dem kein weiteres Angebot mehr folgt. Hartmut hat sein ganzes Leben lang gearbeitet, sie tut es – wenn man von der Volkshochschule und den drei Monaten in Sankt Augustin absieht – zum ersten Mal. Unzählige Diskussionen haben sie in den vergangenen Monaten darüber geführt, bis Maria sich selbst wie einer Stimme vom Band zuhörte, die wieder und wieder dasselbe sagte. »Das Allerwichtigste für mich ist, dass du verstehst, warum ich nicht anders handeln konnte. Damals. Weshalb es nicht um Egoismus geht. Dass ich, als das Angebot kam, nur entweder annehmen konnte oder mir für den Rest meines Lebens vorwerfen, es abgelehnt zu haben. Mir vorwerfen und dir. Und das lag daran, weil das Leben in Bonn –«
»In ›deinem Bonn‹ hast du immer gesagt, aber eigentlich gemeint: das Leben mit mir. Richtig?«
»Es würde uns ein großes Stück weiterhelfen, wenn du nicht hinter jedem Satz einen Vorwurf vermuten würdest.«
»In der Tat, warum sollte ich das tun?« Sein Versuch, nicht zynisch zu klingen, misslingt gründlich. Hartmut ist ein ruhiger, kontrollierter Mensch, der seine wunden Punkte zu verbergen weiß, aber jetzt scheint er sie geradezu präsentieren zu wollen. »Jahrelang habe ich meine Familie zugunsten der Arbeit vernachlässigt und dich nicht bei der Suche nach einer Arbeit unterstützt. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Tatsache. Richtig?«
Sie könnte es sich einfach machen und sagen: So ist es. Genauer gesagt, war es der Preis für ein Leben in materieller Sicherheit, von dem sie ihren Teil bezahlt hat, aber inzwischen haben sich die Dinge geändert. Philippa ist aus dem Haus, und Hartmuts Weigerung, sich mit der neuen Situation zu arrangieren, macht aus der Behauptung, er könne ihren Arbeitswunsch verstehen, ein zu oft wiederholtes Lippenbekenntnis. Beim Wiedersehen am Bahnsteig hat sie ihm auf den ersten Blick angesehen, wie ausgelaugt er ist. Sein jüngstes, hauptsächlich zwischen zehn und zwei Uhr nachts verfasstes Buch soll bald erscheinen, und manchmal spielt er darauf an, dass es ihn den Rest seiner angeblich bescheidenen Reputation kosten werde. Einem analytischen Philosophen stehe es nicht zu, sich auf Filme zu beziehen und Probleme zu untersuchen, die echte Menschen im wirklichen Leben plagen. Wie sie solche Aussagen verstehen soll, weiß sie nicht. Holt ihr Mann mit Ende fünfzig seine Midlife-Crisis nach? Wenn ja, haben ihn die Enttäuschungen eines langen Berufslebens hineingestürzt, oder war es ihr Umzug nach Berlin? Damals hat sie sich geschworen, die Dinge nicht schleifen zu lassen und sich nicht darauf hinauszureden, dass er sich eben anpassen müsse, jetzt sucht sie wie auf einer inneren Klaviatur den richtigen Ton, der die Bereitschaft zur Versöhnung anklingen lässt, ohne ihre Resignation zu verbergen. »Seit wann bist du ein solcher Zyniker, Hartmut?«, fragt sie und erwartet den Hinweis, dass sie auch diesmal das falsche Wort benutzt, aber er zuckt bloß mit den Schultern und murmelt: »Tja, seit wann bloß.«
»Verstehe. Das ist also auch meine Schuld.«
»Wieso auch? Bisher war nur von meinen Fehlern die Rede.«
»Das ist es, was ich meine.« Sie hört ihre Stimme brüchig werden, holt das Taschentuch hervor und hält es sich vors Gesicht. »Wir können nicht mehr reden. Wir können nicht einmal mehr reden über uns.« Für einen Moment gelingt es ihr, den aufkommenden Weinkrampf zu unterdrücken und einfach wegzuhören, als er die Reihe seiner Fehler aufzuzählen beginnt. Die meisten Filme, die er für sein Buch brauchte, haben sie in Bonn zusammen angeschaut, darunter einige von Ingmar Bergman, für die Hartmut seit seiner Jugend schwärmt. Persona war ein Schock, den sie nicht so schnell vergessen wird. Als junge Frau hatte sie die Angewohnheit, sich in den Figuren von Theaterstücken und Romanen zu spiegeln, aber zwei derart gegensätzlichen Doppelgängerinnen war sie nie begegnet. Schweigsam und stolz die eine, forsch trotz ihrer Unsicherheit und ein wenig flatterhaft die andere. ›Kann man zur gleichen Zeit ein und dieselbe Person sein?‹ Alle Themen ihres Lebens in einem Film gebündelt und konturiert durch dieses verstörende, eine ungreifbare Bedrohung signalisierende Schwarzweiß. Hartes Licht, das sogar den Sommer kalt aussehen ließ. Danach haben Hartmut und sie interessante Gespräche geführt, auch wenn Maria nicht verstand, was er aus den Filmen für sein Buch herauszuholen hoffte. »Hör auf«, flüstert sie jetzt, weil er unterdessen lauter wird und sich immer weiter in seine Erregung hineinsteigert. »Hör bitte auf.«
»Als wäre das alles noch nicht genug«, stellt er starrköpfig fest, »stehe ich natürlich auch den Inhalten deiner Arbeit völlig verständnislos gegenüber.«
»Bitte nicht. Das …«
»Seien wir ehrlich: Ich habe hoffnungslos provinzielle Vorstellungen von der modernen Bühnenkunst.«
Als wollte sie sich so klein wie möglich machen, zieht sie die Beine an und umschlingt mit den Armen ihre Knie. Die Bundesstraße beschreibt eine lange Rechtskurve, das Tal öffnet sich, über den Feldern flimmert sommerliche Hitze. Anfang des Jahres haben sie gemeinsam die Premiere von Schlachthaus Europa besucht; Falks Versuch, noch einmal an seine frühen Triumphe anzuschließen, indem er auf alles einschlug und niemanden schonte. Ein Stück, von dem Maria wusste, dass nicht nur ihr Mann es unsäglich finden würde. Der spärliche Schlussapplaus bezeugte die Ratlosigkeit des Publikums, und die anschließende Feier endete schneller als geplant. Damals hat Hartmut versucht, nicht zu zeigen, wie angewidert er war – will er das jetzt nachholen? Sie spürt ein Grummeln im Magen, verursacht von zu viel Wein und wenig Schlaf. In ihrer Handtasche steckt der unterschriftsreife Vertrag des Theaterwerks. Im Zug ist sie vor den lärmenden Jugendlichen in den Speisewagen geflohen, hat faden Filterkaffee getrunken und beschlossen, auf eine bessere Gelegenheit zu warten, um ihrem Mann die Wahrheit zu sagen. Morgen in Bonn oder nächste Woche im Urlaub, nicht auf dem Weg zur Hochzeit, die ihr ohnehin einiges abverlangen wird. Ruth wird so tun, als würde sie ihr das Fehlen beim gestrigen Polterabend nicht verübeln, und sie selbst darf sich nicht anmerken lassen, dass sie ihre Schwägerin durchschaut. Hartmut darauf anzusprechen, kaum dass sie im Auto saßen, war der erste Fehler, den sie heute begangen hat. Der erste Missklang, der seitdem ihr Gespräch durchzieht. Auf wessen Seite stehst du eigentlich, will sie fragen, seit zwanzig Jahren schon, aber das gehört zu den Dingen, die sie –
»Masturbation vor Publikum ist progressiv!«
Erschrocken zuckt sie zusammen. Er hat das nicht einfach gesagt, sondern herausgeschrien. Für eine Sekunde glaubt sie an eine missglückte Parodie, eine Anspielung auf Falks Stück, aber als sie den Kopf wendet, blickt sie in Hartmuts verzerrtes Gesicht. Seine Augen flackern. Vollkommen außer sich brüllt er etwas von Befreiung und Lügen und Fesseln. »Weg mit den bürgerlichen Konventionen! Die Verstellung hat viel zu lange gedauert. Wir alle machen uns was vor. Dankbar sollten wir ihm sein, dem großen Meister, dass er –«
»HÖR AUF!« In ihrer Verwirrung schreit auch sie, so laut sie kann, und wird darüber noch kopfloser. Was um alles in der Welt ist los?
»Ist doch so!«, blafft er zurück. Vor ihnen erstreckt sich eine lange Gerade, und das Auto wird schneller. »Wir ärmlichen Gestalten wissen oft genug selbst nicht, wie unfrei wir sind, und können von Glück sagen, dass der Berliner Kultursenator ein paar einschlägige Experten finanziert, die uns den Spiegel vorhalten. Deren Worte diese Schärfe besitzen, die durch alle Lügen hindurchgeht.« Wie ein Besessener doziert ihr Mann vor sich hin und faselt etwas von Enthemmung und Löchern und Lüsten, das Maria nicht versteht. Eine Viertelstunde haben sie diskutiert und gestritten, jetzt ist er dabei, völlig die Beherrschung zu verlieren. »Oder mit dem ersten Gebot aus des Meisters großer Abendland-Revue«, brüllt er mit sich überschlagender Stimme: »Du sollst ficken!«
Sie hört den Satz und schlägt nach ihm. Hartmut macht eine unkontrollierte Bewegung, der Wagen bricht nach links aus. Die Reifen quietschen, das Bild von berstendem Glas und verklumptem Metall blitzt vor Maria auf, aber irgendwie bleibt das Fahrzeug auf der Straße. »Mehr davon!«, ruft er in hämischem Triumph. Statt nach rechts zu lenken, rast er auf der Gegenfahrbahn dahin. Fassungslos starrt sie auf ihre Handfläche. »Was mache ich in diesem Irrenhaus von einer Ehe?«
»Nichts machst du. Gar nichts. Du bist zu einhundert Prozent mein Opfer.«
»Warum willst du jetzt alles kaputt machen, Hartmut? Sag mir warum?«
»Macht kaputt, was euch kaputt macht, haben wir früher gesagt. Oder nicht ›wir‹, die anderen. Ich saß am Schreibtisch.«
»Lass mich aussteigen.« Einige hundert Meter vor ihnen biegt ein Wagen in die Bundesstraße ein. Zum ersten Mal im Leben hat sie ihren Mann geschlagen, aber der Schock lässt kein Nachdenken darüber zu. Ausgeliefert ist sie ihm, es gibt nichts, was sie tun kann – außer schreien. »FAHR VERDAMMT NOCH MAL ZURÜCK AUF DIE ANDERE SEITE!« Ein langgezogenes Hupen kommt ihnen entgegen. »FAHR NACH RECHTS!« Sie sieht die Knöchel seiner ums Lenkrad gekrallten Hände hervortreten. »FAHR NACH RECHTS!«
Das Auto blendet auf.
»Alles, was du willst.« Noch einmal quietschen die Reifen, als er in letzter Sekunde zurücklenkt. Das Hupen fliegt vorbei, und sobald es verhallt ist, wird ihr Körper von einem Krampf erfasst. Für einen Augenblick fürchtet sie, sich übergeben zu müssen, dann endlich spürt sie die Geschwindigkeit der Fahrt abnehmen. Im Auto wird es still.
Sie schreit nicht mehr. Nur ihr Puls rast weiter.
Ein Autohaus links, eine Tankstelle rechts. Wie von weit weg beobachtet sie sich bei dem Versuch, die Eindrücke zu einem Bild zu formen, aber zuerst kehren nur die Kopfschmerzen zurück, ein vibrierender Druck in den Schläfen. Leere Bürgersteige beiderseits der Straße, dahinter gestutzte Hecken und weiße Gardinen in den Fenstern. Keine Menschenseele. Demonstrativ langsam fährt Hartmut aus dem Dorf hinaus, und wenige Minuten später erreichen sie ihr Ziel. Marias Blick streift Hinweisschilder auf die Polizeistation und ein Hotel namens Berggarten, wo am Abend die Feier stattfinden soll. Erfolglos versucht sie sich an den Namen der koreanischen Braut zu erinnern, der sie nie begegnet ist. Ein Mädchen fährt Fahrrad, und jedes zweite Schaufenster stellt den Firmennamen desselben Immobilienmaklers aus. Sonst nichts, denkt sie, bevor ihre Stimme sie darüber belehrt, dass sie eigentlich etwas anderes gedacht hat. »Komm bloß nicht auf die Idee, jetzt zu deiner Schwester zu fahren.« Sie haben den Marktplatz überquert und folgen der zu Ruths und Heiners Haus führenden Straße. Rechts in der Talsohle liegt die Reithalle, am Hang hocken Wohnhäuser in großzügigen Gärten. Nach allen Seiten wird der Ort von grünen Hügeln umschlossen, auf dem in der Mitte thront das mittelalterliche Schloss. Wie befohlen, lässt Hartmut die Abzweigung zu seiner Schwester links liegen und fährt geradeaus, Brombeerhecken säumen den schmaler und steiler werdenden Weg, bis er auf einem ungeteerten Parkplatz am Waldrand endet. Sobald der Wagen hält, greift sie nach ihrer Handtasche, öffnet die Tür und flieht nach draußen.
Egal wohin.
Mit einem Blick überzeugt sie sich, dass Hartmut im Auto sitzen bleibt. Vor ihr führt ein Fußweg in den Wald hinein, Lichtstrahlen fallen durch die Blätter der Bäume und machen Schwärme tanzender Insekten sichtbar. Der Weg beschreibt einen Bogen und führt auf eine von Gras überwucherte Lichtung, die ihr bekannt vorkommt. In der darunter gelegenen Waldhütte haben sie vor einigen Jahren Heiners sechzigsten Geburtstag gefeiert. Sie läuft über den mit Schotter bedeckten Platz vor der Hütte auf eine Sitzbank zu, die aus einem halbierten Baumstamm ohne Lehne besteht. Davor liegt das Tal offen und weit. Hohe, schlanke Bäume säumen den durch Wiesen mäandernden Fluss, in der Ferne nehmen die Wälder eine bläuliche Färbung an. Maria setzt sich, zieht eine Zigarette aus der Schachtel und macht die ersten Züge. Hinter ihr tröpfelt Wasser aus einem Brunnen.
Ihr Puls rast immer weiter.
Das geblümte Kleid, das sie trägt, hat sie vor drei Tagen am Hackeschen Markt gekauft. Anschließend ist sie mit Peter Karow essen gegangen und hat ihm von dem vergeblichen Versuch erzählt, Vorfreude auf einen Tag zu erzeugen, der unheilschwanger näher rückte. Seit dem Umzug ist Peter ihr engster Freund, aber nach zwei Gläsern Wein verlor sie die Lust, über Probleme zu reden, die ohnehin nur Hartmut und sie lösen können. Zehn Monate liegt jener Montagmorgen zurück, an dem ihr neues Leben begonnen hat. Ein Tag zwischen den Jahreszeiten, kühl, aber heiter. Von den Bäumen entlang der Robert-Koch-Straße lösten sich die ersten Blätter, und über dem Rheinland hing weißlicher Dunst. Vom Schlafzimmerfenster aus schaute sie auf den vorm Haus geparkten Transporter, den Hartmut tags zuvor bei Europcar in der Nordstadt abgeholt hatte. Ein unerwarteter Verstoß gegen seine Ankündigung, sie den Umzug allein machen zu lassen. Mit einem schiefen Lächeln hatte er ihr den Schlüssel ausgehändigt, später beim Einladen der Kisten geholfen und danach sogar angeboten, sie nach Berlin zu fahren; wie er sich kenne, werde er in den kommenden Tagen sowieso nicht arbeiten können. Auch wenn sie so lange Strecken ungern allein fuhr, hatte sie nein gesagt. Es ist mein Umzug, dachte sie am Fenster, ohne das Gefühl identifizieren zu können, das damit einherging. Einer nach dem anderen wurden die Parkplätze vor dem Klinikum besetzt, so wie jeden Morgen.
Im Haus war es vollkommen still. Maria zog die Gardinen zu und stellte sich vor den großen Spiegel neben dem Kleiderschrank. Die Haare hatte sie zum Zopf gebunden, trug blaue Jeans und das trikotartige Oberteil, mit dem sie früher zum Yoga gegangen war. Euphorie und Anflüge von Panik wechselten einander ab, sobald sie nichts tat, also ging sie ins Badezimmer und putzte sich die Zähne. Vor sieben Jahren, als endgültig klargeworden war, dass Hartmut keinen Ruf in eine andere Stadt mehr bekommen würde, hatten sie viel Geld in die Renovierung des Hauses gesteckt. Unter anderem war das Obergeschoss neu tapeziert und das Bad mit weiß-blauen, eigens bei Viúva Lamego in Lissabon bestellten Azulejos ausgestattet worden. Für Hartmut bedeuteten die Kacheln ein Bekenntnis zu ihrer Heimat, dessen es nicht bedurfte, ihr missfiel das Muster, das sie unter hundert Alternativen ausgesucht hatte, und gemeinsam machten sie sich darüber lustig, wie schlecht ein maurisches Bad in ihr Bonner Haus passte. Das kommt davon, hatte sie zu Pilar gesagt, wenn Ehepaare weder Kosten noch Mühen scheuen, um sich über ihre Lage hinwegzutäuschen. Dahinter steckte kein böser Wille, sondern ein Überschuss an gutem, der von außen betrachtet komisch erscheinen mochte, aber in gewisser Weise gefiel ihr das Badezimmer darum eben doch – nach einer besseren Erklärung hatte sie jedenfalls nicht gesucht.
Mit dem Kulturbeutel in der Hand ging sie nach unten. Obwohl Hartmut behauptet hatte, heute nicht zur Uni zu müssen, saß er in Hemd und Jackett am Esstisch. Philippas benutztes Geschirr stand auf der Spülmaschine. Dass auch die Küche neu war, sah man ihr immer noch an.
»Gerade habe ich an Pilar gedacht.« Sie berührte mit der Hand seine Schulter und nahm ihm gegenüber Platz. »Ich hatte ihr versprochen anzurufen, bevor ich losfahre.«
»Sie wird sich melden.«
»Bei dir. Sie ruft nie auf dem Handy an, und die Berliner Nummer hat sie nicht.«
»Was soll ich ihr sagen?«
»Gib ihr die Nummer, sie liegt auf der Anrichte.« Mit dem Kopf deutete Maria auf den Zettel mit der Adresse in Pankow. »Wenn ich mit ihr rede, wird sie mir eine Ansprache halten. Wie sehr sie mich bewundert, was für ein großer Schritt das ist und so weiter.«
»Ist es das nicht?« Er faltete die Zeitung zusammen und legte sie beiseite.
»Ich muss das heute Morgen nicht hören.« Der sanierte Altbau in der Schulzestraße gehörte Peters Lebensgefährten, und die Wohnung im dritten Stock schien in gutem Zustand zu sein, aber besichtigt hatte Maria sie nur einmal. Nachts um halb elf, für zehn Minuten, und das war nicht der einzige Teil des Umzugs, den sie geplant hatte, als würde es sowieso nicht dazu kommen. »Die ganze Zeit denke ich, dass ich was Wichtiges vergessen habe«, sagte sie und schenkte sich Kaffee ein. »Komme ich mit einer Tankfüllung durch bis Berlin?«
»Es ist ein Diesel. Du musst ihn aber voll zurückgeben.«
»Worauf muss ich sonst noch achten?«
»Du weißt, dass sie es dir übelnimmt, wenn du nicht anrufst.«
»Hartmut.«
»Ich erwähne es nur. Da ich ja mit ihr sprechen werde.«
»Sie wird es verstehen«, sagte sie. »Fährst du doch zur Uni? Ich dachte, du hast Ferien.«
Über den Tisch hinweg griff er nach ihrer Hand, aber statt sie ein letztes Mal zu bitten, den Unsinn sein zu lassen und den Wagen wieder auszuladen, streichelte er ihre Finger und führte sie an die Lippen. Es war merkwürdig, dass sie diese kleinen Gesten seit einigen Tagen mehr genoss. So seltsam wie die Hoffnung, ihren Mann stärker zu vermissen, als sie es zu tun erwartete.
»Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, ob es Vorfreude oder Bedenken sind, was du vor mir verbirgst.« Er ließ ihre Hand los und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Bis ich dich gestern pfeifen gehört habe, unten im Keller.«
»Wann?«
»Ich kam gerade mit dem Wagen aus der Nordstadt zurück.«
Ratlos erwiderte sie seinen Blick. »Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll.«
»Das kann ich verstehen. Was, wenn es das Ende ist?«
»Warum sagst du das jetzt?«
»Du hast etwas Wichtiges vergessen«, stieß er hervor und stand auf.
Vor einem halben Jahr war sie erstmals mit der Idee zu ihm gekommen. Anders als ihre Tochter hatte Hartmut nicht gelacht, sondern sofort verstanden, dass sie es ernst meinte, und vielleicht war das die entscheidende Bestätigung gewesen, die aus der Idee schließlich einen Entschluss werden ließ. Sie würde nach Berlin ziehen und an Falks Theater arbeiten. Das klang immer noch verrückt, aber einmal zugelassen, hatte der Gedanke Bleiberecht in ihrem Kopf beansprucht und es gegen alle Zweifel behauptet. Jetzt hörte sie Hartmut ins Arbeitszimmer gehen und die Tür hinter sich zuschlagen, dann kehrte die ungesunde Ruhe zurück, die sie von Philippas Pubertät kannte. In wenigen Wochen würde auch ihre Tochter ausziehen, um in Hamburg zu studieren. Doppelschlag, hatte er das gestern nicht zum ersten Mal genannt. Mechanisch räumte sie das Geschirr in die Spülmaschine und stellte diese an, obwohl sie noch nicht voll war. Vom Titelblatt der Zeitung winkte die künftige Bundeskanzlerin jemandem zu. Genau genommen, dachte sie, war nicht das Vorhaben als solches verrückt, sondern was sie dafür aufs Spiel setzte, aber es musste sein.
Eine halbe Stunde später standen sie zu zweit neben dem weißen Transporter. Die Sonne zeigte sich und verschwand wieder, und Maria blickte die Straße entlang, die inzwischen restlos zugeparkt war. Fünfzehn Jahre Bonn, dreizehn davon hier oben auf dem Venusberg, wo es bis heute kein Geschäft gab, in dem man sie mit Namen kannte. Nur in der Bäckerei war sie einmal mit Frau Professor angeredet worden.
»Wir sind stark genug. Wir schaffen das.« Sie steckte den Autoschlüssel in die Tasche und suchte mit den Händen nach seinen. Hartmuts Nicken bedeutete keine Zustimmung, sondern schien einem Gedanken zu gelten, den er lieber für sich behalten wollte. »Es wird anders sein«, sagte sie, »und manchmal schwierig, aber oft auch schön. Wir werden uns seltener sehen, aber dann mit Zeit füreinander und Lust aufeinander. Es war schön, als du in Dortmund gewohnt hast und ich in Berlin. Oder nicht?«
»Als du Ende zwanzig warst und ich Ende dreißig.«
»Und?«
»Als es neu war und ein Provisorium«, antwortete er widerwillig. »Als wir noch gar nicht wussten, ob wir zusammenbleiben würden.«
»Hartmut, soll ich jetzt Sätze sagen wie: Das ganze Leben ist ein Provisorium? Wir schaffen das, glaub mir. Es wird uns sogar guttun.« Sie legte beide Arme um seinen Hals und küsste ihn, bis er die Liebkosung etwas unwirsch beendete. Beinahe hätte seine Miene sie zum Lachen gebracht.
»Hast du alles?«, fragte er.
»Außer deiner Zustimmung, ja.«
»Da du diesen Zettel auf die Anrichte gelegt hast, weiß ich ja, wohin ich sie schicken kann.«
»Wirst du’s tun?« Sie wusste, welchen Kampf er innerlich ausfocht. Weder wollte er seine Verletztheit zeigen noch sie ohne Vorwurf gehen lassen. Den ganzen Sommer über hatten sie miteinander gerungen, jetzt flogen bunte Blätter durch die Luft, und ihr spärliches Gepäck füllte den Umzugswagen kaum zu einem Drittel. Eine alte Matratze mit Lattenrost, zwei Stühle und ein Küchentisch mit zerkratzter Platte. Klamotten und Bücher. In wenigen Stunden würde sie in der Stadt ankommen, in der sie studiert hatte, und eine schlichte Zweizimmerwohnung beziehen, deren Miete ihr Mann überwies. Diesmal auf der anderen Seite der Mauer, die in ihrem Kopf zu Berlin gehörte wie die Spree. Gerne würde sie noch einmal danke sagen und den Abschied heiter machen, aber Hartmut erwachte aus seiner Erstarrung und murmelte: »Ich bin ein verwirrter alter Mann und weiß nicht, was ich tun werde.« Typisch.
»Vielleicht kannst du mit dem Altwerden noch ein bisschen auf mich warten.« Damit holte sie den Schlüssel aus der Hosentasche, gab ihrem Mann einen Kuss und ging zum Wagen. Auf dem Beifahrersitz ersetzte ein Shell-Atlas das fehlende Navigationsgerät. Maria kletterte hinters Steuer, zog die Tür zu und atmete den unpersönlichen Geruch eines Fahrzeugs ohne Eigentümer. In ihrem Kopf lief eine Uhr rückwärts.
»Es ist vollkommen verrückt.« Mit verschränkten Armen trat Hartmut näher und bedeutete ihr, die Scheibe runterzulassen. »Ich will nicht, dass du gehst. Was soll das für ein Leben werden?«
Seufzend platzierte sie das Handy in der Ablage und wusste, dass ihr eine Minute blieb, bevor sie in Tränen ausbrechen würde. »Wir haben oft darüber gesprochen. Hab ein bisschen Vertrauen in uns.« Der Knopf, den sie drückte, bewegte den rechten Außenspiegel und rückte zwei Hundehalter in grauen Mänteln ins Bild, deren Tiere einander beschnüffelten. Je näher der Zeitpunkt kam, desto schwindelerregender erschien ihr der Gedanke, das alles hinter sich zu lassen. »Ich ruf dich an, sobald ich da bin«, sagte sie durch die Scheibe. Gerne hätte sie in Ruhe die Armaturen studiert, aber ihr Blick verschwamm bereits. Als der Motor ansprang, machte Hartmut einen Schritt zur Seite, und sie winkte, bevor sie sich dem ungewohnt großen Lenkrad und der hakenden Schaltung widmen musste. Wo die Spazierwege zur Casselsruhe abzweigten, beschrieb die Straße eine sanfte Linkskurve. Im Rückspiegel stand eine Gestalt mit hängenden Schultern, erwiderte ihr Winken erst im letzten Moment und verschwand aus dem Bild, dann fuhr Maria rechts ran, um das Gesicht in den Händen zu vergraben.
Das war der Umzug. In Hartmuts Sprachgebrauch: dein Auszug.
Ein Geräusch in ihrem Rücken ruft sie zurück in die Gegenwart. In einer Dreiviertelstunde beginnt die Trauung, sie müsste duschen, sich umziehen und die Haare waschen, stattdessen raucht sie die dritte Zigarette und überlegt immer noch, wie die koreanische Braut heißt. Hartmut nähert sich so langsam, als sei er darauf gefasst, dass sie ihn anschreien und zum Teufel schicken wird. Wie die Reste eines bösen Traums rauschen die Bilder der Fahrt durch ihren Kopf, die Empörung schwillt an und wieder ab, und ihre Finger hören nicht auf zu zittern. Als er schließlich neben ihr Platz nimmt, muss sie an Pilars Standardspruch denken: Jede Ehe ist ein Fall von Stockholm-Syndrom.
Mehrere Minuten lang hat sie damals bei laufendem Motor geheult, aber nachdem sie die Autobahn erreicht hatte, fühlte sie sich besser. Die Erinnerung an ihr Leben in West-Berlin war in den Geruch von Braunkohle und verqualmten Cafés getaucht. Schwarze Fassaden, düstere Treppenhäuser und Badeöfen, die wie verkohlte Litfaßsäulen aussahen. Kreuzberg in den Achtzigerjahren. Bei ihrer Ankunft aus Portugal war die Mauer frei von Graffiti gewesen, beim Abschied ein bunt bemaltes Kunstwerk, jetzt, beim Umzug aus Bonn – manchmal ging ihr unterwegs das Wort Rückkehr durch den Kopf –, war sie längst Geschichte. Ihr Verschwinden hatte eine merkwürdige Durchlässigkeit in den Straßen bewirkt. Es fehlte die vertraute Struktur, der Fernsehturm stand plötzlich in der Mitte statt drüben, und hinter dem Schlesischen Tor ging es einfach weiter. Bis heute wusste Maria nicht, ob das Gerücht stimmte, dass damals in manchen Straßen ihres Viertels keine Post zugestellt worden war, weil sie so nah an der Mauer lagen, dass sie formal zur DDR gehörten und von West-Berliner Beamten nicht betreten werden durften. Von Polizisten folglich auch nicht. Von Bullen. Den Bullenschweinen. Ein aufsässiger Slang, der ihr damals das Gefühl einer neuen Identität gegeben hatte. Selbst gewählt, aufregend fremd und bei genauer Betrachtung nicht ganz passend. Eher eine Verkleidung, so wie ihr grüner Parka aus dem Secondhand-Laden und die schweren Schuhe. Die ständige Erinnerung daran, warum sie ihre Heimat verlassen hatte – oder daran, dass ihr das nie wirklich gelungen war.
Auch das ist ein Thema ihres Lebens: weglaufen zu wollen; voller Entschlossenheit loszulaufen; dann zu spüren, dass die Kraft nicht reicht.
2 Die Luft roch nach brennendem Gummi und Benzin.
Aus gut fünfzig Metern Entfernung beobachteten die beiden Blöcke einander und warteten auf den nächsten Zug des Gegners, die nächste Stufe der Eskalation. Angriffslustige Blicke begegneten sich durch die Schlitze von Stoffmasken und heruntergeklappte Visiere aus Plexiglas, dazwischen lag freier Raum, das von Steinen und Glasscherben übersäte Niemandsland. In den Bürgersteigen klafften Löcher, und unter den schwarzen Pfeilern der Hochbahn lagen die Reste niedergewalzter Barrikaden. Trotz der klaren Fronten spürte Maria eine Gemeinsamkeit, den beinahe sportlichen Geist, der die beiden verfeindeten Lager verband. Von nicht länger hinnehmbaren Provokationen hatte der Innensenator am Vortag gesprochen, aber jetzt wurden für einige Sekunden weder Parolen gebrüllt noch Wurfgeschosse geschleudert. Einsatzfahrzeuge fuhren hinter den Polizisten auf, und Maria sah einen Taubenschwarm über die Dächer segeln. Durch graue Schwaden aus Kohlenstaub, Rauch und Nebel, in ständig wechselnden Formationen, rasend schnell und mit der kühnen Eleganz von Eisläufern in der Kurve. Sie wusste, dass es gefährlich war, hier zu sein, mitten in einem Konflikt, den sie nicht verstand, aber vielleicht hatte dieses Wissen sie hergeführt. In die Menge vermummter Gesichter und geballter Fäuste. Als die Tauben hinter dem Dach des Görlitzer Bahnhofs verschwanden, war der Moment des Innehaltens vorbei, ein Sirren schnitt durch die eiskalte Luft und brach zwei Meter entfernt von ihr ab. Blitzartig stob die Menge auseinander, weg von dem weißen Rauch auf der Straße. »Tränengas!« Sie wurde mitgerissen, zerlegte das Wort in seine Bestandteile und verstand es im selben Augenblick, als ihr eine Rauchwolke ins Gesicht wehte. Von einer Sekunde auf die andere war sie blind. Hinter sich hörte sie Glas splittern und Sirenen heulen und glaubte, heißes Fett würde ihre Augäpfel versengen. Vorwärtsstolpernd versuchte sie sich aus dem Gedächtnis zu orientieren, stieß mit der rechten Schulter gegen ein Hindernis, kam ins Straucheln und wäre gefallen, wenn sie nicht jemand am Arm gepackt hätte. »Geht’s?«
»Ich kann nichts sehen.«
»Lauf weiter!«
Sie wollte blinzeln, aber der Versuch schmerzte, als risse die Hornhaut ein. Eben war noch Licht durch dichte Dezemberwolken gefallen, nun brannte die Luft. Rechts von sich spürte Maria die Nähe einer Hauswand, und wenn sie den Kopf senkte, ahnte sie die Bewegung ihrer Füße, ein Wischen in der Luft. »Sie kommen!«, schrie jemand hinter ihr. Ins Café hatte sie gewollt, weil Ana heute arbeitete, aber am Mariannenplatz war sie ihrer Neugierde und dem anschwellenden Lärm in den Straßen gefolgt. Jetzt ätzte es in ihrem Rachen. Sie musste die Kreuzung an der Manteuffelstraße erreicht haben und erinnerte sich an die Litfaßsäule auf der einen und die große Platane auf der anderen Seite. Panisch rieb sie mit den Handballen über ihre Augen. Vom Kottbusser Tor kamen immer mehr Sirenen, übertönten einander und verteilten sich. Erneut stolperte sie, und wieder griff jemand nach ihrem Arm. »Reiben macht es nur schlimmer.«
»Ich seh nichts.«
»Hast du einen Schal oder ein Tuch? Ich bin’s. Wir müssen hier weg.«
»Falk?« Automatisch streckte sie die Hände aus, sein Kopf fühlte sich merkwürdig glatt und zu groß an. Blinzelnd erkannte sie, dass er einen Helm trug.
»Hier. Bind dir den Schal vors Gesicht. Und hör auf zu reiben!«
»Lass sie stehen«, sagte jemand.
»Nimm.« Er gab ihr ein Stück Stoff, das nach Zitrone roch, fasste sie an der Hand und zog sie mit sich. Nach ungefähr hundert Metern blieben sie stehen.
»Rinn, oder wat?« »Stell endlich die Alte ab!« »Mach auf!« Um sie herum herrschte ein Gewirr aus männlichen Stimmen, von denen nur eine ruhig und überlegt klang. »Sie kommt mit.« Ein Haustor wurde aufgestoßen, und als es wieder ins Schloss fiel, blieb das Chaos auf der Straße zurück. Im Laufschritt hasteten alle die Treppe nach oben, Maria geriet außer Atem und konnte die Umgebung nur schemenhaft erkennen. Ihr wurde übel. Als sie nach dem Geländer greifen wollte, schnitt ihr Stacheldraht in die Haut. »Wenn du Halt brauchst, halt dich an mir fest«, keuchte Falk. Im dritten oder vierten Stock stand eine Tür offen, und die Männer rannten hinein und zu den Fenstern. Sie versuchte, ruhig zu atmen. Der Schmerz drang von den Augen bis unter die Kopfhaut, als steckten Bolzen in ihrem Schädel. Die Übelkeit kam in Wellen, der Schwindel blieb.
»Kommen genau hier lang«, sagte jemand. »Mit Wanne und allem.«
»Nicht reiben, nur tupfen.« Falk gab ihr einen nassen Lappen, den sie sich auf die Augen drückte.
»Alter, bist du vom Roten Kreuz?« »Schwester Falk, ick kann nich schlafen, holste mir einen runter?« »Aber nich reiben, wa, nur tupfen.« Mehr Gelächter, das schnell wieder verebbte. Als Maria den Lappen wegnahm, schlug ihr das hereinfallende Licht in die Augen. Jemand öffnete ein Fenster.
»Besser?« Weil er den Helm und darunter ein Tuch trug, erkannte sie lediglich die Augen. Zu Semesterbeginn hatten sie ein Seminar zusammen besucht, aber nach zwei oder drei Sitzungen war er nicht mehr erschienen. Mit Verspätung wunderte sie sich, dass sie seine Stimme erkannt hatte.
»Danke.«
»Hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen.«
»Ich wollte ins Mescalero.«
»Schluss mit Tupfen!«, rief einer am Fenster. »Es geht los. Erst ma nur Steine?«
Falk gab ihr den Schal zurück. »Muss mich um die Gäste kümmern.«
Was sie blinzelnd von dem Raum erkannte, ließ an eine Küche denken, in der vor Jahren zuletzt gekocht worden war. Ein alter Kohleofen hockte in der Ecke, daneben hing ein Waschbecken aus Emaille schief an der Wand. Vier Matratzen lagen auf dem Boden, zwischen Kisten mit Gerümpel und alten Töpfen. Es gab weder Tapeten noch Teppiche, stattdessen zierten Brandflecken die kahlen Mauern. Die Fensterflügel waren ausgehängt worden, in den Öffnungen standen fünf schemenhafte Gestalten, hatten die Gesichter vermummt und hielten Steine in der Hand. Zu ihren Füßen reihten sich Kisten voller Pflastersteine und erinnerten Maria an Falks Zimmer vor zwei Wochen. Seitdem hatten sie einander nicht mehr gesehen. »Is oben allet offen?«, fragte einer in Lederjacke und schwarzen Stiefeln. »Falls der Besuch rinnkommen will.«
»Alles offen. Dreiundfünfzig auch.«
»Jut, und die Alte? Schreibt ’n Bericht für die Morgenpost, oder wat?«
»Bleib ganz ruhig, Andi«, sagte Falk. »Die macht mit.«
Zwei Minuten lang verharrten alle reglos an ihren Plätzen und warteten. Von der Straße hallten Parolen herauf, ein zitterndes Echo zwischen den Hauswänden, zerschnitten von der scharfen Stimme aus einem Megaphon. Seit Wochen wurde überall von der Demo geredet. Flugblätter lagen in den Kneipen aus, Plakate hingen an Hauswänden und Banner unter den Fenstern besetzter Häuser. Den Vormittag hatte Maria damit verbracht, eine Hausarbeit aus dem letzten Semester zu überarbeiten, die sprachlich so fehlerhaft war, dass der Dozent bis Weihnachten eine neue Fassung sehen wollte. Fritz Kortner und der Wiederaufbau des deutschen Theaters, mit besonderer Berücksichtigung seiner DonCarlos-Inszenierung von 1950. Um drei Uhr hatte sie ihre Neugierde nicht länger bezwingen können und sich gesagt, dass es schließlich nicht verboten war, eine Pause zu machen und auf einen Sprung im Café vorbeizuschauen.
»Na denn. Los geht’s.« Der Mann, den Falk mit Andi angeredet hatte, schleuderte den ersten Stein, und die anderen folgten dem Beispiel. War sie zufällig oder absichtlich hier? Sie hatte weder in Krawalle hineingeraten noch verpassen wollen, was es zu erleben gab, und beim Verlassen des Hauses vorsichtshalber den Parka angezogen. Als Falk sich winkend umdrehte, war ihr Moment gekommen. Sie stand auf und ging zum Fenster, fühlte ihre Angst weichen und spürte das Gewicht des grauen Quaders, an dem noch Erdreste klebten. Es gab keinen Grund, ihn zu werfen, aber ihr blieb kaum Zeit, darüber nachzudenken. Ich bin hier, weil ich es will, dachte sie, holte aus und ließ den Arm nach vorne schnellen. »Erst zielen, dann werfen«, stöhnte ihr Nebenmann. Vor dem Haus war die Straße auf einem Abschnitt von etwa dreißig Metern frei. Links tummelte sich der Pulk der Demonstranten, aus dem einzelne Personen nach vorne rannten, um Steine oder Flaschen zu schmeißen, und sich wieder zurückzogen. Von rechts rückten Polizisten mit hochgehaltenen Schilden vor. Ihr Stein war genau dazwischen aufgeschlagen.
»Das Tränengas«, sagte sie. »Seh nichts.«
Falk beugte sich nach draußen. »Besuch klopft an.«
Andis nächster Wurf stoppte den Vormarsch mehrerer Uniformierter, die einen Demonstranten aus der Menge zerren wollten. Erschrocken sprangen sie zur Seite, wendeten die Köpfe, und im nächsten Moment sah Maria eine Schlagstockspitze, die genau auf sie zu zeigen schien.
»Besuch kommt rein«, meldete Falk, und ein anderer legte seine Hand auf ihre Schulter: »Abmarsch.«
Noch einmal ging es im Laufschritt die Treppe hinauf. Oben führte eine rostige Leiter zur offenen Dachluke, von unten näherten sich schwere Schritte. Marias Herz raste, ihre Schläfen pochten, einen Augenblick später stand sie draußen auf dem Dach. Die graue Weite über der Stadt ließ sie schwindeln. Sie sah die Schneise hinter der Mauer und den Fernsehturm undeutlich im Nebel. Nachdem Falk als Letzter nach draußen geklettert war, wurde die Luke verschlossen und mit einer Kette gesichert. Drei Meter vor ihr endete das Dach, aus der Skalitzer Straße rückten neue Polizeiwagen an, sie hörte die Sirenen und über sich das dumpfe Wummern eines Hubschraubers. Heftiger Wind biss ihr in die Augen. Hinter den anderen her stieg sie über eine Brandmauer auf das nächste Haus, wo Getränkedosen und kaputte Flaschen herumlagen. Ein Paar ausgetretener Schuhe. Wenn sie sich nicht irrte, folgten sie der Straße nach Süden, weg von der U-Bahn, in Richtung Kanal. Aus den Augenwinkeln erkannte sie den Kirchturm am Lausitzer Platz, dann steuerte die Gruppe auf eine offene Tür zu, zwei Häuser vor der nächsten Querstraße, deren Name ihr nicht einfiel. Als sie sich umblickte, lagen nur leere Dächer vor ihr. Schwarz wie die Fassaden, schwarz wie alles in Kreuzberg.
»Bei uns rinn oder runter?«, rief jemand. »Runter!« Das Treppenhaus sah aus wie das vorige. Voller Graffiti, mit Drahtrollen entlang des Geländers. Wenn der Kampf sich nicht verlagert hatte, überlegte sie atemlos, würden sie auf der richtigen Seite rauskommen. Kurz darauf standen alle in einem quadratischen Hinterhof und richteten die Tücher, die beim Laufen von den Gesichtern gerutscht waren. Maria spürte taxierende Blicke, ohne zu wissen, ob Anerkennung oder Herablassung darin lag. Vor allem war sie froh über die Verschnaufpause.
»Wir ham uns doch vor zwee Wochen jesehen«, sagte Andi.
»Ja.«
»Augen wieder okay?«
»Geht so«, sagte sie und zog die Kapuze ihres Parkas über den Kopf.
»Schwester Falk kiekt bestimmt noch ma druff, wa.«
Der Lärm auf der Straße schien von weit her zu kommen. Mülltonnen, Autoreifen und rostiger Metallschrott stapelten sich an den Wänden des Hofes. Maria legte den Kopf in den Nacken und erkannte zwei Kindergesichter, die aus einem der oberen Stockwerke auf sie herabblickten. Sie winkte und kam sich albern vor. Seit zweieinhalb Jahren lebte sie in West-Berlin, aber erst seit wenigen Monaten in Kreuzberg, wo andere Gesetze herrschten als im Rest der Stadt. Falk öffnete die Tür zum Vorderhaus im selben Moment, als der Eingang von außen aufgestoßen wurde. Ein Knall, dann stürmten behelmte Männer herein; zu viele, um sie zu zählen, und zu schnell, um wegzulaufen. Als Maria sich umdrehte, riss ihr ein gezielter Tritt die Beine weg. Sie bekam Stockschläge auf den Rücken und fiel der Länge nach hin. Jemand trat ihr auf die Hand. Mit Blut im Mund blieb sie liegen und hörte um sich herum Schreie und Schläge. Die Tür zum Vorderhaus zersprang, als jemand dagegen flog. Sie wollte sich zusammenkrümmen, aber zwei Hände rissen an ihrer Kapuze und drehten sie auf den Rücken. Schnell nahmen die Kampfgeräusche ab. Ein schwerer Kerl hockte auf ihr und nahm ihr die Luft zum Atmen. Das Visier seines Helms war beschlagen, sie erkannte nur den dunklen Bartansatz. In einer Hand hielt er eine Kamera, mit der anderen zog er den Schal von ihrem Gesicht und rief: »Ick fass et nich, ne Fotze.« Als sie ihn abzuwehren versuchte, rückte er höher, presste beide Knie auf ihre Oberarme und sagte: »Lass dit ma. Wär’ schade um die schönen Zähne.« Er klappte sein Visier nach oben, und Maria blickte in eine vierschrötige Visage mit Narbe unter dem linken Auge. Grell und schmerzhaft blitzte es in ihr Gesicht. Aus den Augenwinkeln sah sie ausgestreckte Gestalten auf dem Boden liegen. Handschellen klickten. Alle keuchten.
»Geh von der Frau runter, du Nazischwein!« Es war Falks Stimme, gefolgt von einem dumpfen Geräusch und seinem gepressten Atem.
»Wieso, is et deine?« Der Kerl blieb auf ihr hocken, zog das Bild aus der Kamera und fächelte es in der Luft. Maria hatte das Gefühl, ihre Armknochen würden zermalmt. Die Kamera gab er an einen Kollegen weiter und nickte ihr zu. »Ick dreh dich jetz um, dit kennste bestimmt. Wenn de dich wehrst, haste dit gleiche Recht wie dein Macker, eins in die Fresse zu kriegen. Is dit klar?« Mit spöttischem Blick wartete er einen Moment, bevor er von ihr abließ. Dass sie versuchte, ihm ins Gesicht zu spucken, entlockte ihm ein müdes Kopfschütteln. »Hör mir doch uff mit dem Weiberkram.« Grob drehte er sie um, bog ihr die Arme auf den Rücken, und zum ersten Mal im Leben bekam Maria Handschellen angelegt. Durch eine Haarsträhne über den Augen erkannte sie Falks Gesicht. Er lag in der gleichen Stellung wie sie, Blut lief ihm aus der Nase und aus einer Platzwunde auf der Stirn. Die Angst, die sie die ganze Zeit über gehabt, aber nicht gespürt hatte, ließ ihre Lippen zittern.
»Alles okay?«, fragte er mit einem schiefen Grinsen.
Auch ihre Hände auf dem Rücken zitterten. Ameisen liefen über den Boden. Gab es im Dezember Ameisen?
»Versuch, ruhig zu atmen«, sagte er.
Es kostete mehr Kraft, als sie zu besitzen glaubte, nicht in Tränen auszubrechen. Falks Kumpel beschimpften die feixenden Polizisten als Nazischweine und bekamen dafür Tritte und Schläge, manchmal ein Lachen. »Bei uns sind et sechs«, sagte einer in sein Funkgerät, »alle fixiert. Dreiundfünfzig, im Hinterhof. Wir warten, bis ihr durchkommt. Jut, Ende.«
»Wo wir schon mal hier liegen und aufs Taxi warten«, sagte Falk, und Maria hatte das Gefühl, dass er mit ihr sprach, damit sie nicht die Fassung verlor. »Ich wollte wegen des Stücks mit dir reden. Das, woran ich gerade arbeite. Erinnerst du dich?«
»Ruhe da unten!«
»Hey! Wir reden über Dinge, von denen du nichts verstehst. Also halt deine verdammte Bullenfresse.« Ein Tritt traf ihn in die Seite, Falk verzog kurz das Gesicht und spuckte aus. »Ich dachte, ob wir am Institut Leute finden, mit denen wir’s auf die Bühne bringen können. Ungefähr acht bis zehn.«
Die Sohle eines Stiefels legte sich auf sein Gesicht. »Letzte Warnung: Schnauze da unten.«
»Was meinst du, interessiert?«, fragte Falk. Sein Gesicht begann sich zu verformen, aber das herausfordernde Lächeln blieb, als schnitte er eine Grimasse. Sie hörte es knirschen und wollte schreien, aber kein Laut kam aus ihrer Kehle. Dass man für Fehler bezahlen musste, wusste sie längst. Vielleicht war sie nach Deutschland gekommen, um es zu vergessen. Irgendwann in den letzten Monaten hatte sie es tatsächlich vergessen und prompt den nächsten Fehler begangen. Und jetzt?
Über ihr wurde gelacht.
»Du verdammtes Arschloch!«, presste Falk hervor, dann schloss Maria die Augen.
Genau zwei Wochen zuvor, am Nachmittag des 25. November, war sie losgegangen, um einen Brief einzuwerfen und ihre Eltern anzurufen. Ein Berliner Spätherbsttag, an dem der Wind schwere Wolken und das Aroma billiger Eierkohlen über die Dächer trieb. Um halb vier brach die Dunkelheit herein, und schneien sollte es außerdem; seit ihr an einem Zeitungskiosk die Überschrift ›Baldiger Wintereinbruch angekündigt‹ ins Auge gefallen war, schickte Maria mehrmals täglich prüfende Blicke gen Himmel. Die ganze Woche über hatte sie das nötige Kleingeld für den Anruf gesammelt, das jetzt ihre Taschen schwer machte. Unschlüssig blickte sie die Waldemarstraße entlang und spürte das Rumoren von Nervosität und Hunger im Magen. Im Laden gegenüber brannte bereits die Innenbeleuchtung. ›Ein schöner Tag beginnt mit einem Frühstücks-Ei von Eier-Schulz‹ stand auf dem Schild am Eingang. In der Nähe der Mauer fuhren kaum Autos, und soweit ihr Blick die Straße entlangreichte, sah sie nur eine Handvoll parkender Fahrzeuge. Hundert Meter links von ihr endete der Teil der Stadt, der sich für frei hielt, obwohl er noch dichter eingemauert war als der andere. Vor nichts hatte man sie in der Schule so eindringlich gewarnt wie vor den Gefahren des Kommunismus, jetzt hörte sie manchmal Stimmen von drüben, meist kurze Befehle, Kommandos und Hundegebell. Die nächste Telefonzelle befand sich am Mariannenplatz, aber als sie dort ankam, warteten bereits drei Leute, also beschloss sie, erst den Brief an Luís einzuwerfen, im Café vorbeizuschauen und es auf dem Rückweg noch einmal zu versuchen. Oder morgen.
Sie werden es verstehen, sagte sie sich.
Zehn Minuten später zog sie die Tür des Mescalero auf und freute sich, die brasilianische Bedienung hinter der Theke zu entdecken. Seit dem Umzug nach Kreuzberg kam sie jede Woche ein paarmal hierher. Wenn der Betrieb es zuließ, wechselten Ana und sie ein paar Sätze auf Portugiesisch, oder sie brachte ein Buch mit und hockte stundenlang auf ihrem Lieblingsplatz am Fenster. Rauchen, lesen, träumen. Das Mescalero war ihre Insel der Zuflucht, hier hatte sie sich angewöhnt, Milchkaffee zu trinken, der in einem französischen Bol serviert wurde und an kalten Tagen die Hände wärmte. Um den Lausitzer Platz herum sprangen die Laternen an.
»Oi menina. Alles gut?« In ihrem entspannten Schlendergang kam Ana an den Tisch. Sie war groß gewachsen, trug einen Haarschopf aus dunklen Locken und wischte mit der Handfläche ein paar Krümel vom Tisch.
»Olá«, sagte Maria. »Immer, wenn ich Heimweh habe, komme ich hierher.«
Ein Stichwort, das Ana Souza einen versonnenen Blick auf ihre Fingernägel richten ließ, als wollte sie sagen: Heimweh haben wir alle. Sie stammte aus Bahia, hatte sie erzählt, sprach das melodiöse Portugiesisch brasilianischer Telenovelas und sah ein bisschen aus wie Sônia Braga. Den ganzen Nachmittag hatte Maria gelesen, statt zu lernen, und würde Ana gerne erzählen, warum sie an Tagen wie heute am liebsten japanische Romane las. Schon seit Monaten hatte sie das Gefühl, zu wenig zu reden; sie ging allein in die Mensa und mit dem Wörterbuch ins Theater, schlief mit keinem Mann und hatte aus einer Laune heraus angefangen zu rauchen. Das Haar trug sie kurz, verzichtete auf Schmuck und hatte in einem Secondhand-Laden am Schlesischen Tor einen gefütterten Parka gekauft, den nicht nur Cristina unmöglich finden würde. Armeegrün, mit aufgenähten Flicken an den Ellbogen. Aus dem trüben Badezimmerspiegel in der WG schaute ihr eine junge Frau entgegen, die nicht alle Regeln verstand, denen sie zu gehorchen versuchte. In Kreuzberg flirteten Männer so wenig, wie Frauen sich schön machten. Am Institut hörte sie den Debatten der anderen lieber zu, statt mitzureden, außerdem hatte sie sich einen entschlossenen Gang angewöhnt, der ihrer Umwelt das Gegenteil dessen signalisierte, was sie empfand. Den schwarz-rot-goldenen Aufnäher am Ärmel des Parkas hatte sie abgetrennt, nachdem sie in der U-Bahn angepöbelt worden war. Es müsste nicht SchönheitundTrauer sein, dachte sie jetzt, es könnte auch um Männer, das Theater oder die Vorzüge von angolanischem Kaffee gehen. Nichts fehlte ihr so sehr wie eine Freundin zum Reden.
Ana brachte den dampfenden Bol und sagte, »gegen dein Heimweh«, bevor sie an die Theke zurückkehrte, um in einer Zeitschrift zu blättern.
Lag es an ihr? Ihr Deutsch jedenfalls war immer noch schlecht. In Gesprächen wurde sie schnell nervös, weil die anderen Lückentext redeten und sie über Flexionen und die Wahl des richtigen Artikels stolperte. Manche Gesprächspartner machte das ungeduldig, andere fanden es anziehend, wie sie an ihren Lippen hing, um nichts zu verpassen. Den Akzent hielten die meisten für französisch, also sexy. Dazu ihre helle Haut, die aufrechte Haltung und die dunkelgrünen Augen; irgendwann fiel sogar Berliner Männern auf, dass sie schöne, hoch sitzende Brüste hatte. Ihr Mitbewohner Roman würde die WG gerne in eine Ménage-à-trois verwandeln, und vielleicht würde Gudrun einwilligen, um ihren Freund nicht zu verlieren. In Kreuzberg herrschte eine merkwürdige Mischung aus losen Sitten und den strengen Etiketten der Subkultur. Wehe, man siezte den Falschen. In den letzten Monaten war Maria ins Café gegangen, um Anas Gesellschaft zu suchen und vor Romans zweideutigen Bemerkungen zu fliehen, vor angelehnten Türen und der schlecht gespielten Überraschung, wenn er ihr halb nackt in der Küche begegnete. Ich habe einen Freund, sagte sie sich, als bedürfte es der Erinnerung. Dass sie vergessen hatte, den Brief einzuwerfen, fiel ihr erst jetzt ein.
Sie setzte den Bol ab und bestellte ein Croissant. Auf der Uhr über der Theke verfolgte sie die Bewegung des großen Zeigers, bis es für den Anruf zu Hause zu spät war, weil ihre Eltern in der Küche zu tun hatten. An der Bar unterhielt sich Ana mit einem Mann in schwarzer Lederjacke, ab und an erklang ihr dunkles, beinahe männliches Lachen. Als die Blicke der beiden sich auf sie richteten, drehte Maria den Kopf weg und fühlte sich kindisch. Vor zwei Wochen hatte sie in der U-Bahn einen wildfremden, in sein Buch vertieften Mann angesprochen und gefragt, ob ihm das Buch gefalle.
Ja, hatte er gesagt und weitergelesen.
Als sie das Café verließ, ging es auf halb sechs zu. Trotz der Kälte lief sie durch die Straßen, weg von ihrer Wohnung, und weil niemand fragte, erklärte sie es sich selbst: Romane wie die von Kawabata konnten die Einsamkeit für einige Stunden in ein schwer fassbares, wohliges Gefühl verwandeln. Am Nachmittag hatte sie sich vorgestellt, die junge Malerin Keiko zu sein, die mit einer Frau zusammenlebte, männlichen Liebhabern in die Finger biss und einen bizarren Racheplan verfolgte, aus Liebe zu Otoko oder blankem Narzissmus, das verstand man als Leser nicht. Sie sagte merkwürdige Dinge wie: Ich brauche jemanden, der meinen Stolz zerstört. Am nächsten Briefkasten küsste Maria die Adresse auf dem Umschlag und warf ihn ein. Eine Woche würde er unterwegs sein, falls die portugiesische Post nicht streikte, in zwei Wochen konnte sie beginnen, auf eine Antwort zu warten, und in drei würde sie wissen, ob Luís ihr grollte, weil sie an Weihnachten nicht nach Lissabon kam. Ich lebe jetzt hier, dachte sie. Vor einem Türk Discount wurden die Obstkisten abgebaut, und ohne nachzudenken, ging sie hinein, um von dem Telefongeld eine Flasche bulgarischen Rotwein zu kaufen. Ihre Finger waren klamm, sie besaß keine Handschuhe.
Zurück in der Manteuffelstraße, versuchte sie sich an seine Hausnummer zu erinnern. Einige Male hatten sie im Institutscafé gesessen und übers Theater diskutiert, nicht sie beide allein, sondern eine größere Runde von Kommilitonen. Beim letzten Mal war es um Grüber gegangen; jemand hatte dessen jüngste Inszenierung gelobt, und Falk hatte dagegengehalten, es sei idiotisch, dem Zuschauer gefallen zu wollen. Bürgerliche Scheiße, nannte er das, zu definieren als den Versuch, sich aus Bequemlichkeit in einer kaputten Welt einzurichten, ruhiggestellt durch den Konsum von Luxusgütern und notfalls von Kunst. Maria hatte weder widersprechen wollen noch zustimmen können und im Stillen überlegt, was Schönheit anderes sein sollte als eine Form von Trost. Dachte sie so, weil sie aus einem Land kam, das schon im letzten Jahrhundert den Anschluss verloren hatte? Ein für sich stehendes, von der Straße zurückgesetztes Gebäude kam ihr richtig vor. ›Mord bleibt Mord‹ stand über der von Ruß verschmierten Kohlenluke, zwei Fahrradrahmen ohne Räder lehnten gegen die Hauswand. Als sie die Eingangstür aufdrückte, sprang die Beleuchtung an und tauchte den Durchgang in ockerfarbenes Licht. Im vierten Stock drängten sich Schuhe vor einer Wohnungstür wie Einlass begehrende Tiere. Sie wusste nicht mehr, ob er erwähnt hatte, in einer WG zu leben, aber sie vermutete es. Alle lebten in WGs.
Sie klingelte.
Die Fremdheit machte sie scheu, die Scheu einsam und die Einsamkeit wagemutig – heute jedenfalls war es so. In manchen Momenten fand sie ihn ein wenig unheimlich. Er hatte ein Gesicht mit groben Zügen, zu großer Nase und rötlichem Bartwuchs, und wenn er Gesprächspartner in die Enge trieb, spielte ein überhebliches Grinsen um seine Mundwinkel. Er schien viel zu wissen, gern zu streiten und selten an sich zu zweifeln.
Hinter der Tür näherten sich träge Schritte. Die junge Frau, die Maria gegenübertrat, hatte schwarze Haare und trug mehrere Wollpullover übereinander. »Ja«, sagte sie, als antwortete sie auf eine zuvor gestellte Frage. Auf ihrer Oberlippe schimmerte die Andeutung eines Damenbarts.
»Hallo«, sagte Maria. »Ich wollte zu Falk.«
Nickend verharrte die Frau in der Tür. Wahrscheinlich war sie nicht dick, sondern sah der vielen Kleidungsstücke wegen so aus. Am Kragen zeigten sich die Träger eines grauen Overalls, den sie darunter trug.
»Ist er da?«, fragte Maria.
»Dit würd’ ick ma vermuten. Um die Zeit.«
»Und … kann ich reinkommen?«
»Weeß ick nich. Wer biste?«
»Bitte?«
»Wer du bist.« Der Blick der Frau war auf den Boden gerichtet, als zählte sie die dort stehenden Schuhe.
»Eine Kommilitonin von ihm.«
»Kannste dit ooch auf Deutsch und mit Namen?«
»Maria. Wir studieren zusammen.«
»Wusst’ ick jar nich, dit der ’n Studi is. Aber jut, ick hol ihn, wa.« Bevor sie ging, schloss sie sorgfältig die Tür. Weiter oben im Haus schien jemand auf einen Topf zu schlagen, außerdem glaubte Maria das Geschnatter von Gänsen zu hören. Nach einer Minute wurde die Tür erneut geöffnet, und Falk brauchte einen Moment, bevor er den Besuch einordnen konnte. »Wolltest du zu mir?«, fragte er in einem Ton, der weder Überraschung noch Freude verriet. Die Ärmel seines schwarzen Hemdes waren bis über die Ellbogen aufgekrempelt, darunter trug auch er einen Overall, ein dunkelblaues Teil mit Flicken an den Knien.
»Ja«, sagte sie.
»Und weswegen?«
»Um zu … einfach reden. Oder Wein trinken.« Statt sich von ihrem Gestammel aus dem Konzept bringen zu lassen, hob Maria die Flasche und hielt sie ihm entgegen. »Sozialistischer Wein.«