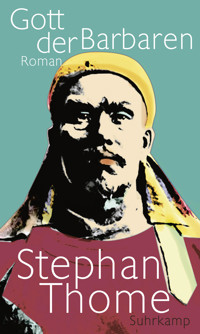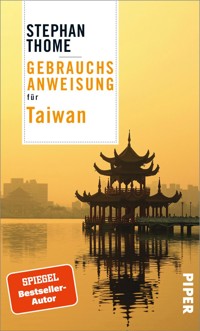
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Stephan Thome blickt tief in die Seele seiner zweiten Heimat: Taiwan ist eine ebenso junge wie umkämpfte Demokratie, geprägt von Kolonialherrschaft, Diktatur und neuer Freiheit. Hier mischt sich das japanische Erbe mit chinesischem Brauchtum und den Traditionen der Ureinwohner. Reisende erwartet eine auf ihre Unabhängigkeit pochende Nation, die sich im Meistern von Krisen bewährt und zu deren größten Obsessionen Essen und Baseball zählen. Dazu grandiose Naturlandschaften mit Nationalparks, imposanten Bergen und Steilküsten, heißen Quellen und wilden Schluchten. Eine außergewöhnliche Dichte an alten Tempeln und unzählige Nachtmärkte mit der köstlichsten Küche Asiens – und so verlockenden Speisen wie »Stink-Tofu«. Der preisgekrönte Autor lebt seit vielen Jahren in Taiwan und erzählt kundig und unterhaltsam von seiner Liebe zum geschichtsträchtigen Inselstaat im Pazifik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Gebrauchsanweisung für Taiwan« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Für Jo-chiao (若喬)
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Redaktion: Tabea Kalb, München
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas
Coverabbildung: Lotusteich (Lianchitan) mit Wuli-Pavillon bei Kaohsiung (lookphotos / age fotostock)
Karten: Peter Palm, Berlin
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Karten
Prolog am Schalter Nummer 20
Ankunft: Das andere, das bessere oder gar kein China?
Die vielen Gesichter Chinas
Zwei Erzählungen von Taiwans Geschichte
»Hitlers größter Fehler«
Die wilden Jahre der taiwanischen Demokratie
Proteste: Lasst hundert Sonnenblumen blühen!
Die Angst vor der kommunistischen Unterwanderung
Chen Shui-bian und Ma Ying-jeou: Die feindlichen Brüder
Die neuen AktivistInnen
»Die Demokratie verteidigen, das Handelsabkommen zurückziehen«
Postscriptum 2016: Taiwans erste Präsidentin
Taihoku und Taipei: Metamorphosen einer Stadt
China en miniature
Vom chinesischen zum japanischen Kaiserreich
Bolero und Bomben
Diktatur und Demokratie: Der lange Marsch der Süßkartoffeln
Aufruhr in den heiligen Hallen
Die Kunst der historischen Schönheitschirurgie
Dr. Guo hat Wut im Bauch
Bastarde im Neuen Park
228 und die Vorgeschichte
228 und die Folgen
Baseball: Kurze Geschichte einer nationalen Obsession
Baseball und Feldball
Kanō: Das legendärste aller Teams
Die kleinen Soldaten aus Hongye
Wir sind Weltmeister: Taiwans Erfolge in der Little League
Die Profiliga und ihre Skandale
Die schönste Hauptsache der Welt: Taiwaner und das Essen
Kulinarische Evolution: Das Überleben des Leckersten
Essen made in Taiwan: Reich an Geschmack und Symbolik
Nachtmärkte: Flanieren und Probieren
Exotische Genüsse: Die Warteschlange
Wahlsieg mit Knoblauch: Besonderheiten taiwanischer Politik
Der große Bruder in Washington
Präsidentschaftswahlkampf 2019: Der unheimliche Aufstieg eines Grasballs
Diplomatie oder Die umstrittene Identität von eins und zwei
»Gefrorener Knoblauch! Gefrorener Knoblauch!«
Eingaben an die himmlische Bürokratie: Religion in Taiwan
Oma Mazus vielsagendes Lachen
Religion und die Frage der taiwanischen Identität
Im Geistermonat ruft die Banane
Buddhistische Laienorganisationen und Taiwans Zivilgesellschaft
Vom Diktator bis zu den Ureinwohnern: Christen in Taiwan
Wushe und Hongye: Die Insel der Ureinwohner
Ein tapferer Beamter verliert den Kopf
»Why you want to walk?«
»Sie vergossen ihr Blut für die gerechte Sache«
»Eine Kopfjagd im großen Stil«
Mit Stöcken und Steinen
Lüdao und Tainan: Die Insel des Widerstands
Der Weiße Terror in Aktion
Der König der Piraten
Koxinga und der deutsche Alkoholiker
PS: Schüsse in New York
Epilog mit Blick auf die Zukunft
Postskriptum: Und dann erwischt es Taiwan doch
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Karten
Prolog am Schalter Nummer 20
Am 25. März 2020 morgens um kurz vor zehn beträgt meine Körpertemperatur 36,4 Grad. Das jedenfalls bescheinigt mir die uniformierte Person im Foyer des Verwaltungsamts von Songshan, einem Stadtviertel im Osten Taipeis, wo meine Freundin (36,2 Grad) und ich seit fünf Jahren wohnen. Wie in allen öffentlichen Gebäuden Taiwans gibt es auch hier strikte Eingangskontrollen. Wir müssen Gesichtsmasken tragen, uns die Temperatur messen und ein Desinfektionsmittel auf die Hände sprühen lassen, dann erst werden wir zum Empfangsschalter vorgelassen und nach dem Zweck unseres Besuchs gefragt. Den haben wir uns zum Glück gut überlegt. »Wir wollen heiraten.«
Die Dame am Schalter nickt: »Vierter Stock.« Ihre guten Wünsche für die Zukunft begleiten uns zum Aufzug.
Mit Gesichtsmaske zu heiraten ist nicht gerade der Inbegriff von Romantik. Heute allerdings steht mit der offiziellen Registrierung sowieso nur ein Verwaltungsakt an. Feiern wollen wir unsere Hochzeit erst im nächsten Jahr, in der Hoffnung, dass die Pandemie dann auch in Deutschland vorbei und das Reisen wieder möglich sein wird. Hier in Taiwan hat man es glücklicherweise verstanden, die Krise durch entschiedenes Handeln im Keim zu ersticken. Einen Tag bevor im Januar der erste Infektionsfall bestätigt wurde, hat das nationale Krisenzentrum seine Arbeit aufgenommen. Die Verlängerung der Neujahrsferien, durch die landesweit alle Schulen für zwei weitere Wochen geschlossen blieben, trat in Kraft, als die Gesamtzahl der Infizierten auf zehn geklettert war. Dass zu diesem Zeitpunkt alle Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln Gesichtsmasken trugen, versteht sich von selbst. Statt darüber zu diskutieren, ob Masken mit der Menschenwürde vereinbar sind, wurde ihre Produktion gesteigert und ein effizientes Verteilungssystem eingerichtet. So konnte innerhalb Taiwans zu keiner Zeit von einer Epidemie die Rede sein.
Einige präventive Maßnahmen habe ich selbst zu spüren bekommen: Bei meiner letzten Einreise aus Deutschland galt noch Reisewarnstufe II, was mir für zwei Wochen leichte Einschränkungen auferlegte, die als Empfehlungen formuliert waren: keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, Menschenansammlungen meiden, nicht auswärts essen. Acht Tage später war die Lage in Europa derart außer Kontrolle, dass ich, den Regeln von Stufe III entsprechend, nicht mehr vor die Tür durfte. Zweimal am Tag wurde ich angerufen und nach meinem Befinden gefragt. Auf dem gelben Formblatt, das mir ein Mitarbeiter der Behörden persönlich an die Tür gebracht hatte, musste ich meinen Gesundheitszustand protokollieren, außerdem fand ich dort aufgelistet, welche Strafen ein Verstoß gegen Quarantäne-Auflagen nach sich ziehen würde, die nun keine Empfehlungen mehr waren. Auf Zuwiderhandlungen gegen § 58 des Gesetzes zur Kontrolle übertragbarer Krankheiten stand ein Bußgeld von umgerechnet drei- bis dreißigtausend Euro. Es waren strikte, aber transparente Maßnahmen, die der taiwanische Gesundheitsminister in seiner täglichen Pressekonferenz erklärte und deren Wirksamkeit schnell sichtbar wurde. Als sich die Fallzahlen in Deutschland der Zwanzigtausendermarke näherten, gab es in Taiwan gerade mal 169 Infizierte, größtenteils Rückkehrer aus dem Ausland. Um es vorwegzunehmen: Als im Herbst 2020 die Zahl der deutschen Corona-Toten auf über zwanzigtausend anstieg, waren es auf der Insel immer noch sieben(!).
Kaum in Zahlen ausdrücken lässt sich der gestärkte soziale Zusammenhalt. Zu Recht sind die Menschen stolz auf den Erfolg ihrer kollektiven Anstrengung und registrieren zufrieden, dass das in internationalen Medien anerkannt wird, wo das Land sonst nur vorkommt, wenn Erdbeben oder Taifune wüten oder das Regime in Peking wieder mal mit Krieg droht. Obwohl Letzteres seit einiger Zeit mit steigender Tendenz geschieht, haben die Menschen das Gefühl, im sichersten Land der Welt zu leben. Nachdem die jüngsten Präsidentschaftswahlen die Gräben innerhalb der Gesellschaft offengelegt haben, sorgt der erfolgreiche Kampf gegen Covid-19 – hier nach wie vor »die Lungenentzündung aus Wuhan« (wuhan feiyan) genannt – für ein neues positives Wir-Gefühl. Allenfalls Neuseeland könnte Taiwan den inoffiziellen Titel des Corona-Weltmeisters streitig machen. Weil die Regierung schnell und planvoll agiert und die Bevölkerung diszipliniert mitgezogen hat, mussten die Maßnahmen am Ende nicht annähernd so radikal ausfallen wie in Europa. Keineswegs wurde, wie gelegentlich zu lesen ist, die Gesundheit der Menschen auf Kosten ihrer Freiheit geschützt. Kein landesweiter Lockdown, weder Hotels noch Bars, noch Fitnessstudios muss-ten wegen des Virus dichtmachen, und die Spiele der Baseball-Profiliga fanden nach kurzer Unterbrechung wieder vor Zuschauern statt. Der Hochzeitsreise rund um die Insel, die meine Frau und ich in zwei Tagen antreten wollen, steht nichts im Weg.
Vorher müssen wir unsere Ehe nur noch offiziell schließen.
Im vierten Stock empfängt uns ein neonbeleuchtetes Großraumbüro mit über zwanzig Schaltern. Der Andrang ist gering, im Wartebereich sitzen lediglich meine Schwiegermutter sowie mein Schwager mit seiner Frau und zwei Kindern. Die Begrüßung fällt kurz aus, denn kaum haben wir eine Nummer gezogen, werden wir auch schon aufgerufen. Schalter Nummer 20.
Feierlichkeit, große Gefühle, ein Bewusstsein der Zäsur im Leben, die eine Eheschließung bedeutet – all das stellt sich in der nächsten halben Stunde nicht ein. Zunächst präsentieren wir eine Reihe von Dokumenten, darunter mein ins Chinesische übersetztes, beglaubigtes und von der taiwanischen Vertretung in Deutschland legalisiertes Ehefähigkeitszeugnis. Volle elf Arbeitstage hat das Standesamt Biedenkopf gebraucht, um mir zu bescheinigen, dass ich in meiner Heimat nicht bereits verheiratet bin. Zwischendurch schicken meine Eltern übers Handy ein Foto der Sektflasche, die sie um drei Uhr nachts deutscher Zeit öffnen, um auf unser Glück anzustoßen, ansonsten ist der Vorgang an Nüchternheit kaum zu überbieten. Weder eine Rede noch Ringe sieht das Protokoll vor, wir werden nicht einmal expressis verbis zu Mann und Frau erklärt, geschweige denn gefragt, ob wir unsere Ehefähigkeit wirklich an genau dieser Person testen wollen. Kein Jawort, nur eine Reihe von Unterschriften.
Die einzige Verzögerung entsteht am Schluss: Soll ich die Eheurkunde mit meinem deutschen oder dem chinesischen Namen unterschreiben? Das Gesetz lässt beides zu, meine Frau zuckt mit den Schultern, auch die Standesbeamtin wirkt einen Augenblick lang ratlos. Schon klar, es ist bloß die letzte Formalität des Ganzen, und vielleicht zögere ich aus dem inneren Bedürfnis heraus, den Moment doch noch als Zäsur zu markieren und ihn mit den Weihen einer bewusst gefällten Entscheidung zu versehen.
»Was sagt denn Ihr Gefühl?«, fragt die Beamtin, um mir die Sache zu erleichtern.
Ausgesprochen viel, bin ich versucht zu antworten. Irgendwie kulminiert am heutigen Tag auch die Geschichte, die mich mit der Insel Taiwan verbindet. Zum ersten Mal besucht habe ich sie vor 24 Jahren, für ungefähr die Hälfte dieser Zeit war sie seitdem mein Hauptwohnsitz, aber warum bisher jeder Versuch, sie zu verlassen, in eine Rückkehr mündete, ist nicht so leicht zu sagen. Beim ersten Besuch vertraute mir ein betrunkener Amerikaner an: »Taiwan saugt dich auf wie ein schwarzes Loch, Mann, wenn du einmal hier bist …«. Was man eben so redet in den Bars von Ostasien, diesen traditionellen Ballungszentren männlicher Einfalt. Eine Anziehungskraft der Art, für die unser Wort »exotisch« steht, besitzt die Insel zumindest auf den ersten Blick nicht. In taiwanischen Städten dominiert grauer Beton, und wer das Besondere entdecken will, braucht scharfe Augen und ein gutes Ohr. Zum Beispiel erklingen in der U-Bahn von Taipei alle Ansagen viersprachig, auf Chinesisch, Taiwanisch, Hakka und Englisch: ein erster Hinweis darauf, dass sich in Taiwan seit Langem Ethnien und Kulturen mischen, wobei die Einflüsse keineswegs auf den asiatisch-pazifischen Raum beschränkt geblieben sind.
Portugiesische Seefahrer tauften das dünn besiedelte Eiland im 16. Jahrhundert Ilha Formosa, die schöne Insel. Der Süden wurde im 17. Jahrhundert von Holland besetzt, der Norden von Spanien, im 19. Jahrhundert fühlten sich auch Frankreich und Preußen von den Reizen der Insel angezogen, vor allem von ihrer Lage im Kreuzungspunkt wichtiger Handelsrouten. Die aufkommende Regionalmacht Japan umwarb die Schöne mit rasselnden Säbeln. Erst dieses Interesse von außen veranlasste den Hof in Peking, den bisher kaum beachteten, von Menschenfressern und giftigen Schlangen bewohnten Flecken – als »Klumpen Dreck« schmähte ihn ein Kaiser – administrativ stärker zu integrieren. 1887 wurde Taiwan zur chinesischen Provinz aufgewertet, aber bereits acht Jahre später verlor das Kaiserreich einen Krieg gegen Japan, und für die kommenden fünfzig Jahre war Formosa, wie der Westen inzwischen sagte, eine japanische Kolonie. Wer heute gedankenlos behauptet, Taiwan habe »schon immer« zu China gehört, sollte einen zweiten Blick auf die Geschichte werfen.
Auf den Punkt gebracht, verlief sie so: Immer wollte irgendwer die Insel haben, nur nach den Wünschen der Bewohner fragte niemand. Als Japan 1945 den Pazifikkrieg verlor, wurde Taiwan aufs Neue ins Gefüge der chinesischen Nation eingegliedert. Offiziell hieß das »glorreiche Rückkehr« (guangfu), aber da die Geschichte keinen Rückwärtsgang kennt, verblasste der Glorienschein des Slogans schnell. Aus dem Kaiserreich, zu dem die Insel einmal gehört hatte, war eine vom Krieg gegen Japan und von inneren Kämpfen aufgeriebene Republik geworden, die sich dem drohenden Zusammenbruch durch Flucht entzog. Geschlagen von den Kommunisten, floh Chinas militärischer Oberbefehlshaber Chiang Kai-shek mit seinem Heer nach Taiwan, knapp zwei Millionen demoralisierte Menschen, die voller Argwohn auf ihre vermeintlichen Landsleute schauten, die größtenteils nicht einmal Chinesisch verstanden. Während der Kommunist Mao Zedong 1949 in Peking die Volksrepublik China ausrief, begannen Generalissimus Chiang und seine Getreuen damit, alle Taiwaner gewaltsam zu Chinesen umzuerziehen. Heute heißt die Zeit, die bis zur Aufhebung des Kriegsrechts 1987 dauerte, Weißer Terror (baise kongbu).
Bis ins späte 20. Jahrhundert hinein handelt die taiwanische Geschichte vor allem von Leid und Unterdrückung. Inzwischen allerdings schauen viele Menschen in Ostasien bewundernd auf eine Nation, in der die Zivilgesellschaft gedeiht wie nirgendwo sonst in der Region: Seit 1996 demokratisch regiert, seit 2016 angeführt von einer unverheirateten Frau, seit 2019 das erste asiatische Land, das gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe erlaubt. Leider ist diese Erfolgsgeschichte dem großen Nachbarn China ein Dorn im Auge, und nach den jüngsten Ereignissen in Hongkong stellt sich die bange Frage, ob die Zerstörung der taiwanischen Demokratie als Nächstes auf Pekings To-do-Liste steht. Am entsprechenden Willen des Regimes ist kaum zu zweifeln; ob es seinen Willen bekommt, wird von vielen Faktoren abhängen, nicht zuletzt vom Agieren der viel beschworenen westlichen Staatengemeinschaft, falls es die gegenwärtig noch gibt. Welches Schicksal Taiwan im 21. Jahrhundert ereilen wird, ist zwar von größter weltpolitischer Relevanz, aber einstweilen völlig ungewiss.
Wie leben die Menschen mit dieser Ungewissheit, und wie leben sie überhaupt? Woran glauben und worauf hoffen sie? Warum sind sie so begeistert vom Baseballspiel? Woher kommen die weltberühmten Taiwanese Beef Noodles, und wie schmeckt der berüchtigte Stinktofu? Solchen und anderen Fragen werde ich auf den folgenden Seiten nachgehen, ohne jedes Mal den kürzesten Weg zur Antwort einzuschlagen. Die schöne Insel im Pazifik hat die Form einer Süßkartoffel – worauf im Volksmund oft angespielt wird – und nicht nur eine Geschichte voller abrupter Wendungen, sondern auch über zweihundert Gipfel von mehr als dreitausend Metern Höhe. Wer dieses anspruchsvolle Terrain erkunden will, muss manchen Umweg in Kauf nehmen.
Die letzte Unterschrift leiste ich schließlich mit meinem deutschen Namen. In einem anderen Land und Kulturkreis zu leben verändert einen in vielerlei Hinsicht, aber nicht in jeder. Den verschiedenen Anteilen der eigenen Identität gerecht zu werden verlangt einen ähnlichen – ebenso bewusst wie beiläufig ausgeführten – Balanceakt wie die Ehe. Unabdingbar ist ein waches Gespür, nicht nur für die andere Person, mit der man sein Leben teilt, sondern auch für jene anderen, die in den tieferen Schichten des eigenen Ichs wohnen. Taiwanerinnen und Taiwaner, die im Verlauf ihrer Geschichte schon vieles gewesen sind, wissen nur zu gut, dass ungemischte Identitäten eine ideologische Abstraktion darstellen. Eine gleichmacherische Zumutung, gegen die es sich mit Entschiedenheit und Humor zu wehren gilt.
»Was sind Taiwaner?«, lautet eine beliebte Scherzfrage.
Antwort: »Taiwaner sind Chinesisch sprechende Japaner.«
Witzig und nicht ganz unwahr, wie Sie bei der Lektüre dieses Buches feststellen werden.
Nun bin ich also verheiratet und habe auch offiziell so etwas wie eine zweite Heimat. Grund genug, deren Geschichte in den nächsten Kapiteln noch einmal etwas gründlicher aufzuarbeiten. Schließlich kenne ich Taiwan lange genug, um bei einigen historischen Wendungen selbst dabei gewesen zu sein.
Ankunft: Das andere, das bessere oder gar kein China?
Wir schreiben das Frühjahr 1996, wenige Monate trennen mich von meinem 24. Geburtstag. Seit dem vorigen Herbst bin ich als Sprachstudent an der Universität Nanjing in China eingeschrieben, einer Stadt am Unterlauf des Yangzi mit drückend heißen Sommern, nasskalten Wintern und rund einer Million Baustellen. Das winzige Doppelzimmer, das ich mir mit einem japanischen Kommilitonen teile, hat weder Heizung noch Klimaanlage, nur undichte Fenster, durch die der Staub hereindringt, der die Stadt das ganze Jahr über in ein seltsames Zwielicht taucht. Auch wenn die Sonne scheint, sieht man sie nicht. Im ersten Semester bin ich jeden Vormittag zum Unterricht gegangen und habe danach neue Schriftzeichen gepaukt, oft bis spät in die Nacht. Das zweite Semester schwänze ich, um auf Reisen zu gehen. Im März war ich im äußersten Südwesten, an der Grenze zu Myanmar, im Sommer will ich nach Sichuan und Tibet reisen, um von Kathmandu aus nach Hause zu fliegen, aber jetzt im Frühjahr mache ich mich auf den Weg nach Taiwan. Ein Freund aus Berlin wohnt dort, genau wie ich für ein Jahr als Student. Wir kommunizieren per Brief, denn das World Wide Web steckt in den Kinderschuhen, in China wurde es noch nicht geboren. Handys sind so groß wie ein Föhn und haben eine Antenne. Da es zwischen China und Taiwan keine Direktflüge gibt, muss ich über die Kronkolonie Hongkong reisen und den Flug nach Taipei dort buchen.
Über mein Reiseziel weiß ich fast nichts, im Kopf nenne ich es »das andere China«. Seines rasanten wirtschaftlichen Aufschwungs wegen wird es zu den vier asiatischen Tigerstaaten gezählt, neben Singapur, Südkorea und Hongkong, und im März wurde zum ersten Mal der Präsident frei gewählt. Da ich in Nanjing vom internationalen Nachrichtenfluss abgeschnitten bin (kein Fernseher, keine ausländische Zeitung), habe ich bloß beiläufig mitgekriegt, dass Peking mit dieser Entwicklung nicht einverstanden ist, obwohl die Taiwaner lediglich den bisherigen Präsidenten Lee Teng-hui von der Nationalpartei Kuomintang (KMT) im Amt bestätigt haben. Die KMT, sage ich mir, ist eben der historische Erzfeind der Kommunistischen Partei, der Gegner in einem zwar fünfzig Jahre zurückliegenden, aber nie offiziell beendeten Bürgerkrieg. Also hat die Volksrepublik Manöver in der Taiwanstraße abgehalten und sogar Raketen in taiwanische Gewässer gefeuert, gleichsam Schüsse vor den Bug der Insel. Klingt nach Säbelrasseln, für mich in diesem Moment nicht wichtig.
Die vielen Gesichter Chinas
Hongkong ist ein Schock. So modern und glitzernd und dennoch unverkennbar asiatisch. An den überfüllten U-Bahnhöfen stehen die Passagiere schon in Reih und Glied, bevor der Zug kommt. Trotz der Enge läuft alles wie am Schnürchen, die Stadt ist international und schick, wahrscheinlich sehe ich innerhalb von zehn Minuten mehr Männer mit Krawatte als in China in einem halben Jahr. Überall begegne ich Menschen, die sich weigern, meinen vorgefassten europäischen Kategorien zu entsprechen. Es ist ein merkwürdiger Gedanke, in einer Kolonie zu sein. Was für ein Anachronismus! Tatsächlich sind die Tage der britischen Herrschaft gezählt, Hongkongs Rückgabe an China ist beschlossene Sache. Später mache ich mit der Fähre einen Ausflug nach Macau, wo Straßen und Gebäude portugiesische Namen tragen und ich nicht mehr weiß, in welchem Sinne ich mich noch in China befinde.
Nach vier Tagen steige ich ins Flugzeug nach Taipei.
Ankunft am Chiang Kai-shek International Airport.
Im Rückblick scheint es mir ein passendes Symbol zu sein: Die junge Demokratie, deren wichtigster Flughafen weiterhin dem Diktator gewidmet ist, der die Insel jahrzehntelang mit eiserner Hand regiert hat. Bei meiner Ankunft ist es bereits spät, und ich bin froh, dass mein Freund Knut in der Ankunftshalle auf mich wartet; ob mein Brief aus Hongkong angekommen war, hatte ich nicht wissen können. Die Fahrt in die Stadt dauert fast eine Stunde, erst mit dem Bus zum Hauptbahnhof, dann mit dem Taxi in die Shida Lu, eine Straße, die ich anderthalb Jahre später täglich entlanglaufen werde, um zum Sprachunterricht an der Uni zu kommen. Erste Eindrücke: Es gibt so viele Motorroller wie in China Fahrräder, die Fassaden der Geschäfte sind bunter und heller, außerdem kann ich noch weniger Schriftzeichen lesen als in Nanjing. In Taiwan benutzt man sogenannte Langzeichen, also Schriftzeichen in ihrer traditionellen Form, nicht die Kurzzeichen, die die Kommunistische Partei eingeführt hat, um den Analphabetismus zu bekämpfen.
Den ersten Abend verbringen wir in einer Schwulenbar namens The Source. Keiner von uns beiden ist schwul, aber erstens ist es eine coole Bar, und zweitens tut es gut, in einer Stadt zu sein, wo es so etwas gibt. Taiwan, das spüre ich, ohne den Eindruck in Worte fassen zu können, ist anders als die Volksrepublik. Es herrscht ein anderes soziales Klima, ein anderer Vibe, man sieht kaum Uniformierte und überhaupt keine Propagandaslogans. Auf der Straße begegnen mir zwar neugierige Blicke, aber niemand starrt mich an oder ruft mir »Hello, hello« hinterher, wie es drüben allenthalben geschieht. In Geschäften und Restaurants schallt mir stattdessen ein freundliches Huanying guanglin entgegen, was ich zuerst nicht verstehe, weil ich es nie gehört habe. Wörtlich heißt es »Gegrüßt sei die Annäherung Ihres Glanzes«, aber es ist bloß eine gängige Grußformel, und seit ich einige Jahre später in Tokio das allgegenwärtige Irasshai-mase gehört habe, weiß ich auch, woher die Sitte kommt (wie ich in Japan überhaupt oft denken werde: Das kenne ich doch aus Taiwan!). Knut wohnt in einem kleinen Zimmer nahe der Uni, nicht wie ich in einem Wohnheim nur für Ausländer, wo einheimische Bekannte ihren Ausweis vorzeigen müssen, wenn sie zu Besuch kommen. Vom ersten Tag an fühle ich mich in Taipei wohltuend unbeobachtet. Frei.
Zwei Erzählungen von Taiwans Geschichte
In den kommenden Tagen erkunde ich die Stadt, die an manchen Tagen im Smog verschwindet, so wie Nanjing im Staub der Baustellen. Nach einigen Stunden im Freien bilden sich schwarze Ränder um die Nasenlöcher, und ich habe einen metallischen Geschmack im Mund. In den Hügeln am Stadtrand besuche ich das Palastmuseum und bewundere die Kunstschätze, die ich im Winter beim Besuch der Verbotenen Stadt in Peking vermisst habe – tonnenweise hat die KMT sie vor ihrer Flucht vom Festland nach Taiwan gebracht. Jade und Porzellan, Kalligrafien und Gemälde, Opfergefäße und alte Münzen. Es sind Kostbarkeiten, die lange Zeit den Anspruch untermauern sollten, die Republik China auf Taiwan sei das bessere und wahre China, der Hüter einer jahrtausendealten Kultur, die auf dem Festland verkam, wenn sie nicht gar aktiv zerstört wurde. Inzwischen ist die chinesische Kulturrevolution (1966–1976) mit ihren Exzessen zwar vorbei, aber die Anzahl der Tempel, die ich auf meinen Spaziergängen passiere, ist hier um ein Vielfaches höher als in chinesischen Städten. Immer wieder weht mich der Duft von Räucherstäbchen an, höre ich Gongs und buddhistische Sprechgesänge, in fast allen Geschäften steht ein rot leuchtender Hausaltar. In gewisser Weise, denke ich, ist Taiwan sogar chinesischer als die Volksrepublik.
Mitten im Stadtzentrum steht das Memorial für den Generalissimus Chiang Kai-shek. Ein riesiger freier Platz, flankiert von der Nationalen Konzerthalle auf der einen und dem Nationaltheater auf der anderen Seite. Mit ihren säulengestützten Fassaden und geschwungenen Dächern sind sie kaum voneinander zu unterscheiden. Am Kopfende erhebt sich eine protzige Pagode aus weißem Marmor mit blauem Dach, den Farben der KMT. Dutzende Stufen führen hinauf in die Haupthalle, und dort sitzt er, in Bronze gegossen, mehrere Meter groß und unwillentlich an den despektierlichen Spitznamen erinnernd, den der amerikanische General Stilwell ihm verpasst hat, sein verhasster Stabschef während des Kriegs gegen Japan: »Peanut«. Der kahle Kopf ähnelt tatsächlich einer Erdnuss, und statt richtungsweisend die Hand zu heben wie Mao Zedong auf fast allen Statuen, die es von ihm gibt, sitzt Chiang Kai-shek mit angelegten Armen auf einem Sessel und wirkt wie ein gütiger Landesvater, der würdige Nachfolger seines Förderers Sun Yat-sen. In der Erzählung der KMT war Chiang der Garant des Überlebens der chinesischen Republik, ein kluger Stratege in Kriegszeiten und später der Initiator des taiwanischen Wirtschaftswunders. Westliche Beobachter zeichnen meist ein anderes Bild. In Barbara Tuchmans allerdings einseitigem Buch Stilwell and the American Experience in China gibt Chiang Kai-shek das Musterbeispiel des orientalischen Despoten ab, paranoid, selbstherrlich und realitätsblind. In seiner Jugend war er bekanntlich in die dunklen Geschäfte der Shanghaier Unterwelt verstrickt, aber der Ausstellung im Inneren der Pagode zufolge bestand sein Leben aus nichts als Triumphen – was die Frage heraufbeschwört, weshalb sein Memorial in Taipei steht und nicht in Nanjing, der verfassungsmäßigen Hauptstadt der Republik China (übrigens bis heute), wo Sun Yat-sen begraben liegt. Das demütigende Kapitel der Flucht auf die kleine Insel wird einfach übergangen.
Das auf den ersten Blick so sichere, wie in Stein gemeißelte Selbstbild der KMT hat am Ende des 20. Jahrhunderts längst Risse bekommen. Jahrzehntelang war der Bevölkerung auf der Insel eingetrichtert worden, der Rückzug nach Taiwan sei strategischer Natur und diene der Vorbereitung der kurz bevorstehenden »Rückeroberung des Festlands«. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren stand dieser Slogan auf unzähligen Hauswänden und in jedem Schulbuch, aber glaubwürdig war er schon damals nicht, und mit dem Tod Chiang Kai-sheks verschwand er aus dem Straßenbild wie aus der offiziellen Rhetorik. Danach klammerte sich die KMT an die Gewissheit, das bessere China zu sein, dessen Erbe es zu bewahren galt – ein bereits eher konservatives als visionäres Selbstbild, an dem der wirtschaftliche Aufstieg der Volksrepublik bald zu nagen begann. Außerdem hat in den letzten zwei Jahrzehnten hier in Taiwan eine andere Erzählung Gestalt angenommen, erst im politischen Untergrund, aber mit der fortschreitenden Öffnung der Gesellschaft tritt auch sie offener hervor. 1996 stellt die KMT zwar noch den Präsidenten, sogar demokratisch legitimiert, aber der Bürgermeister von Taipei gehört der oppositionellen DPP (Democratic Progressive Party) an. Als ich vom Memorial zum Präsidentenpalast gehe, kann ich erste Spuren des sich vollziehenden Umschwungs besichtigen. Der Palast stammt aus der Kolonialzeit und war früher der Sitz des japanischen Generalgouverneurs, das Straßenstück davor wurde nach dem Abzug der Japaner umbenannt in »Lang-lebe-Chiang-Kai-shek-Straße«. Auf Chinesisch umfasst dieses Wortungetüm nur drei Zeichen, aber im März 1996 kam die nächste Umbenennung, und seitdem hat der Name sechs Zeichen und lautet Ketagalan-Boulevard. Das klingt überhaupt nicht chinesisch, denn der Name bezeichnet einen Ureinwohnerstamm, der lange vor den chinesischen Siedlern die Ebene bewohnt hat, in der das heutige Taipei liegt. Man muss das als politische Botschaft verstehen, beinahe als Kampfansage: Es gibt etwas, das auf dieser Insel tiefere Wurzeln hat und deshalb länger leben wird als die Erinnerung an einen chinesischen Diktator.
Es ist ein tolles Stück historisch und politisch aufgeladener Architektur: Am einen Ende des Boulevards der von den Japanern erbaute Präsidentenpalast, am anderen die Parteizentrale der KMT, ein unansehnlicher Zweckbau mit zwei vorstehenden Mauern, die den Hof einfassen und wie steinerne Greifarme auf den Palast gerichtet sind – unverfrorener kann man seinen Machtanspruch nicht symbolisieren. Dank des widerspenstigen Bürgermeisters führt der Weg vom Partei- zum Machtzentrum allerdings über eine Straße, die denen gewidmet ist, die schon vor den Chinesen hier waren, und verweist auf die Möglichkeit eines anderen, nicht chinesischen Taiwan. Dass Bürgermeister Chen Shui-bian vier Jahre später selbst in den Präsidentenpalast einziehen wird, davon träumen KMT-Kader im Frühjahr 1996 auch in ihren wildesten Albträumen nicht.