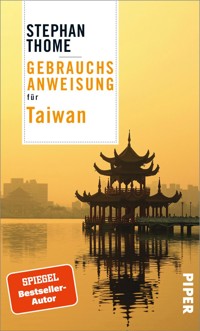Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Griot Hörbuch Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
China, Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine christliche Aufstandsbewegung überzieht das Kaiserreich mit Terror und Zerstörung. Ein junger deutscher Missionar, der bei der Modernisierung des riesigen Reiches helfen will, reist voller Idealismus nach Nanking, um sich ein Bild von der Rebellion zu machen. Dabei gerät er zwischen die Fronten eines Krieges, in dem er am Ende alles zu verlieren droht, was ihm wichtig ist. An den Brennpunkten des Konflikts – in Hongkong, Shanghai, Peking – begegnen wir einem Ensemble so zerrissener wie faszinierender Persönlichkeiten: darunter der britische Sonderbotschafter, der seine inneren Abgründe erst erkennt, als er ihnen nicht mehr entgehen kann, und ein zum Kriegsherrn berufener chinesischer Gelehrter, der so mächtig wird, dass selbst der Kaiser ihn fürchten muss.
Angeführt von einem christlichen Konvertiten, der sich für Gottes zweiten Sohn hält, errichten Rebellen in China einen Gottesstaat, der in verstörender Weise auf die Terrorbewegungen unserer Zeit vorausdeutet. Ein großer und weitblickender Roman über religiösen Fanatismus, über unsere Verführbarkeit und den Verlust an Orientierung in einer sich radikal verändernden Welt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stephan Thome
Gott der Barbaren
Roman
Suhrkamp
Für meine Eltern
Gedanken eines Unbekannten
Niemand weiß etwas über sie. Manche nennen sie langhaarige Banditen, andere die Gottesanbeter, aber warum rasieren sie sich die Stirn nicht, und welchen Gott beten sie an? Zuerst sollen sie in der Provinz Guangxi aufgetaucht sein, in einer abgelegenen Gegend namens Distelberg, wo die Menschen so arm sind, dass sie schwarzen Reis essen und in Hütten mit undichten Dächern leben. Zugezogene Bauern vom Volk der Hakka, die von den Alteingesessenen verachtet werden. Einer meiner Kollegen hat sie Erdfresser aus dem Süden genannt, die nur darauf gewartet hätten, dass jemand kommt und sie mit aufwieglerischen Reden verwirrt. In diesem Fall ein gescheiterter Prüfungskandidat, von denen es bei uns so viele gibt. Dreimal durchgefallen und danach verrückt geworden, sagen die Leute, aber stimmt es auch? Ich bin selbst einmal bei den Prüfungen gescheitert und weiß, wie es sich anfühlt, wenn der große Traum platzt. Dornen hat man sich in die Schuhe gesteckt, um nicht über den Büchern einzuschlafen, und dann war alles umsonst?
Nicht wenige glauben, dass es mit den ausländischen Teufeln zu tun hat. Auch von ihnen weißniemand, wer sie sind. Eines Tages kamen sie über den Ozean und ließen sich an unserer Küste nieder, als wäre es ihre. Sie handeln mit Opium, stellen Forderungen und drohen mit Krieg, wenn sie nicht erfüllt werden. Dem Himmel missfällt ihre Anwesenheit, doch leider ist unser Reich nicht mehr so stark wie früher. Gegen die Barbaren an unseren Grenzen kämpfen wir seit jeher, aber nie hatten sie Kanonen von solcher Feuerkraft. Im südlichen Meer haben die Fremden eine Insel besetzt, um noch mehr Opium zu schmuggeln und ihren fremden Gott anzubeten. Shang Di, der Herrscher in der Höhe, angeblich ist es derselbe, den auch die Langhaarigen verehren. Als ihr Anführer zum dritten Mal durch die Prüfung fiel, sollen die ausländischen Teufel ihm ein Buch gegeben haben, um ihn zu verhexen. Nach der Rückkehr in sein Dorf wurde er prompt krank, und als er fiebernd im Bett lag, träumte er davon, dass Shang Di ihn zu sich in den Himmel rief, ihm ein Schwert gab und ihm befahl, die Dämonen zu töten. So hat es begonnen, heißt es. Ein Traum platzt, und ein anderer beginnt. Seitdem hält er sich für Gottes Sohn und für Dämonen all jene, die den Zopf tragen und dem Kaiser in der Hauptstadt dienen ‒ so wie ich.
Hat das Auftauchen der Fremden die kosmische Ordnung zerstört? Inzwischen besitzen die Rebellen ihre eigene Hauptstadt, in der einst die Kaiser der Ming residierten und die nun Himmlische Hauptstadt genannt wird. Als junger Mann habe ich ihre prächtigen Gärten und Straßen bewundert und sehnsüchtig auf die Blumenboote am Qinhuai-Fluss geblickt. Wenn eine solche Stadt erobert wird, hat es etwas zu bedeuten, aber was? Wie können arme, ungebildete Bauern Gebiete besetzen, die größer sind als ihre Heimatprovinz? Ihren Anführer verehren sie als Himmlischen König, und ich kann nicht aufhören, mich über sie zu wundern. Wenn die Kollegen im Yamen sie beschimpfen, denke ich insgeheim, dass auch der Kaiser im Norden ein Fremder ist, ein Mandschu von jenseits der Großen Mauer. Dann frage ich mich, ob es nicht besser wäre, wir würden von unseresgleichen regiert. Früher habe ich darüber nicht nachgedacht, warum tue ich es jetzt? Der Himmel hat keine Vorlieben, heißt es im Buch der Geschichte, er bevorzugt allein die Tugendhaften.
Es gibt Tage, da erkenne ich mich selbst nicht wieder. Der Gouverneur, für den ich arbeite, ist so korrupt wie viele hohe Amtsträger, und manchmal wünsche ich, dass jemand kommt und den ganzen Schmutz hinwegfegt. Obwohl ich am liebsten in einem stillen Zimmer sitze und lese, träume ich von der großen reinigenden Flut. Ein Junzi muss die heiligen Texte studieren, den Ahnen opfern und seine Kinder zu Pietät und Bescheidenheit erziehen. All das tue ich, so gut ich kann, und dennoch findet mein Herz keine Ruhe. Warum ist das so? Woher kommt diese Wut in mir?
Vor dreihundert Jahren lebte der berühmte Beamte Hai Rui. Frustriert über den Zustand des Reiches, verfasste er eine Eingabe an den Kaiser und machte ihn für die vielen Missstände verantwortlich. ›Schon vor geraumer Zeit‹, schrieb er, ›haben die Menschen begonnen, Eure Majestät für unwürdig zu halten.‹ Bevor er den Text abschickte, kaufte er sich einen Sarg. Er wurde verhaftet und nur deshalb nicht hingerichtet, weil der Kaiser kurz darauf starb, aber als man Hai Rui die Todesnachricht überbrachte, soll er nicht etwa gejubelt haben, sondern vor Trauer in Tränen ausgebrochen sein. Nach der Entlassung stieg er in höchste Ämter auf, und trotzdem hinterließer bei seinem Tod nicht genug Geld für ein ordentliches Begräbnis. Viele nennen ihn exzentrisch und töricht, für mich ist er ein Vorbild, schließlich werde ich auch oft für verrückt erklärt, weil ich meiner Tochter lesen und schreiben beibringe, statt ihr die Füße zu binden.
Was würde Hai Rui an meiner Stelle tun? Wie es heißt, wollen die Rebellen den Feldzug bald fortsetzen, dann wird auch um unsere Stadt gekämpft werden. Sind sie die Rettung oder unser Untergang? Sollen wir fliehen oder bleiben? Meine Kinder schauen zu mir auf und ahnen nichts von der Verwirrung in meinem Herzen. Wehe uns! Wir leben in einer Zeit der Zweifel und der bösen Omen, niemand ist mehr sicher.
1 Der Hafen der Düfte
Shanghai, im Sommer 1860
Als ich noch eine Frau und zwei Hände hatte, war ich ein glücklicher Mann. Das wird mir erst bewusst, seit ich in Shanghai bin und viel Zeit habe nachzudenken. Der Juni neigt sich dem Ende zu, und in dem Haus, in dem ich liege, stöhnt das Gebälk unter der Hitze. Vom nahen Hafen dringt das Gebrodel der Massen herüber, die Shanghai verlassen wollen, bevor die Rebellen kommen. Bis zu zehn Silberdollar, wurde mir erzählt, verlangen die Bootsbetreiber, nur um Passagiere auf die andere Seite des Flusses zu bringen, wo sie keineswegs sicher, sondern sich selbst überlassen sind. Aus dem Yangtze-Tal strömen immer neue Flüchtlinge herbei, wie eine riesige Bugwelle treibt sie der Krieg vor sich her. Wäre mir unterwegs nicht das Unglück zugestoßen, das mich seit einem Dreivierteljahr ans Bett fesselt, wäre ich längst in Nanking, der Himmlischen Hauptstadt am Unterlauf des großen Flusses. Oder nicht? Wäre etwas anderes dazwischengekommen, das mich mehr als die linke Hand gekostet hätte?
Wenigstens bin ich Rechtshänder. Zwischen den Fieberattacken, die mich in regelmäßigen Abständen heimsuchen, gibt es nichts zu tun, und meine Gastgeber ‒ Reverend Jenkins von der London Missionary Society und seine Frau Mary Ann ‒ haben mir ein paar Bögen Papier ins Zimmer gelegt. Für Briefe, meinten sie, aber wem sollte ich schreiben? Mit Elisabeth rede ich zwar gelegentlich, aber nur nachts, wenn der Schlaf ausbleibt und Erinnerungen an die Stelle der Träume treten. Dann denke ich über alles nach, was seit dem Beginn meiner Reise geschehen ist. Für jeden von uns gibt es eine Grenze dessen, was er aushalten kann, ohne ein anderer zu werden, und ich hatte meine schon lange vor jenem verhängnisvollen Tag auf dem Poyang-See überschritten. Ohne es zu merken. Nachdem die Revolution zu Hause gescheitert war, wollte ich in Amerika ein neues Leben beginnen, aber es kam anders, und jetzt bin ich nicht mehr sicher, ob es das überhaupt gibt ‒ ein neues Leben. Wir folgen unserem Weg, ohne zu wissen, wohin er führt. Mich verschlug es über Rotterdam und Singapur nach Hongkong, wo ich für kurze Zeit glücklich war, dann immer tiefer hinein in dieses vom Krieg geschundene Land. Auf dem See war ein chinesischer Pirat schneller mit der Waffe als ich, und nicht einmal Alonzo Potter konnte meine Hand retten. Jetzt habe ich alles verloren, wenig zu bereuen und keine Ahnung, wie es weitergehen soll.
Kann man mit einer Hand helfen, den Kaiser von China zu stürzen?
Wann und in welcher Stärke die Rebellen Shanghai erreichen werden, weiß niemand. Bis vor wenigen Wochen waren sie in Nanking eingeschlossen, nun überrennen ihre Armeen das Yangtze-Tal und sorgen für Panik in den Städten. Wie einst Napoleons Soldaten in Italien tauchen sie immer im Rücken des Feindes auf, ohne sich von Flüssen oder Bergen aufhalten zu lassen. Dem North China Herald zufolge soll ihnen Suzhou bereits gehören, und die Rauchsäule über Hangzhou habe ich mit eigenen Augen gesehen. Ein Aufstand von armen Bauern und Köhlern aus dem Süden, die glauben, Gottes Sohn zu folgen, dem Himmlischen König, der außerdem der Vetter meines besten Freundes ist. Das Schreiben, das mich nach Nanking einlädt, steckt in der Tasche meines Gewands, zerfleddert und aufgeweicht, aber das Siegel kann man noch erkennen. Fragt sich nur, ob von mir genug übrig ist, um den Weg zu wagen. Stromaufwärts, mitten durch die große Flut, die ganz China zu verwüsten droht.
Philipp Johann Neukamp ist mein Name. Ältester Sohn eines Zimmermeisters aus dem Märkischen, aber ohne Beruf, seit ich vor einem Jahr aus der Basler Missionsgesellschaft ausgeschieden bin. Was danach passiert ist, habe ich noch nie jemandem erzählt, und um die Geschehnisse verständlich zu machen, muss ich ein wenig ausholen. Die Ereignisse von 48 darf ich als bekannt voraussetzen; meine Rolle darin war nicht wichtig, trotzdem musste ich, als alles vorbei war, für eine Weile aus dem Gebiet des Deutschen Bundes verschwinden. In den Niederlanden wollte ich mir das Geld für eine Schiffspassage ins einzige Land der Welt verdienen, das nicht von einem Fürsten regiert wird, sondern von freien Männern. Mit den Händen zu arbeiten, war nicht neu für mich. In Scheunen, überfüllten Schlafsälen oder unter freiem Himmel zu schlafen, machte mir wenig aus. Zwei Gaben sind in meinem Leben hilfreich gewesen, vor allem später, nach der Ankunft in China: ein Talent für fremde Sprachen und eine robuste Gesundheit. Im Hafen von Rotterdam gab es ausreichend Kisten zu schleppen, und nach ein paar Monaten verstand ich genug Holländisch, um eine bessere Arbeit zu finden. Jong & Söhne, eine Werkstatt, die die Innenräume von Schiffen ausstattete, stellte mich ein, aber die Summe, die ich für die Überfahrt nach Amerika gebraucht hätte, blieb ein fernes Ziel. Dann traf ich einen Mann, der mit einer einzigen Bemerkung meinem Leben buchstäblich eine neue Richtung gab. Vielleicht ist das meine dritte Gabe, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Mann zu treffen. Auf meiner deutschen Wanderschaft war ich Robert Blum begegnet, der mich, obwohl ich nur sechs Jahre die Schule besucht hatte, zu den Treffen der Schillerfreunde mitnahm. Blum sorgte dafür, dass ich vom obersten Rang des Leipziger Theaters aus den Don Carlos sehen durfte, und sagte mir jenen Satz, dessen Wahrheit ich vorher nur gespürt hatte, ohne sie zu verstehen: Monarchie ist Hochverrat am Volk. Wenn ich könnte, würde ich heute noch nach Wien fahren und dem alten Windisch-Grätz einen Dolch in sein verdorrtes Herz stoßen, aber das ist ein anderes Thema.
In Rotterdam traf ich Karl Gützlaff.
Es war Ende 1849, in einem milden, verregneten Winter. Auf dem Weg zur Arbeit sah ich den Aushang für den Vortrag eines deutschen Missionars, der über seine Erlebnisse in China berichten sollte, und nach Feierabend hatte ich nichts Besseres zu tun. Gützlaff reiste damals durch Europa, um Geld für seinen Chinesischen Verein zu sammeln, und wo er auftrat, füllte er die Säle, auch die Laurenskerk in Rotterdam. Im Gewand eines chinesischen Fischers sprach er wie ein Prophet des Alten Testaments, allerdings auf Deutsch und Holländisch und mit so vielen Einsprengseln in fremden Zungen, dass mir beim Zuhören schwindlig wurde. Er erzählte von bitterer Armut und korrupten Mandarinen, die das zu sein schienen, was ich als Polizeiinspektoren und Zensoren kannte, von Eltern, die ihre Kinder zum Betteln zwangen, damit sie nicht verhungerten, was oft genug trotzdem geschah. Die Zuhörer hingen an seinen Lippen, nach dem Vortrag stiegen sie förmlich übereinander, um Geld in die Spendenbüchsen zu stecken. Für mich war es ein Erlebnis wie der Don Carlos wenige Jahre zuvor, aber da ich kein Geld hatte, sprach ich den Vortragenden an und fragte, was ich sonst tun könnte. Ich wusste selbst nicht, woran ich dachte. Karl Gützlaff hatte eine Idee. »Gesund und kräftig?«, fragte er und musterte mich.
Ich nickte entschieden.
»Gläubig?«
Ich nickte.
»Komm nach China«, sagte er. »Dort brauchen wir Männer wie dich.« Er trug einen breiten Schnurrbart, hatte ein einnehmendes Lächeln, und sein Vorschlag war so verrückt, dass ich noch einmal nur nicken konnte.
Dass der Chinesische Verein zu keiner Kirche gehörte, gefiel mir. Er wurde finanziert von Spenden, die entweder Gützlaff selbst einsammelte oder die Unterstützervereine, die in fast jeder Stadt entstanden, die er besuchte, denn niemand beherrschte die Klaviatur von Not und Trost, Mitleid und Hoffnung besser als er. Wo Gützlaff sprach, sahen seine Zuhörer eine Welt, die auf Rettung wartete und deren Rettung nahte. Der Berliner Frauen-Missionsverein für China, der Elisabeth später nach Hongkong schicken sollte, ging ebenso auf Gützlaff zurück wie die niederländische Missionsbrüderschaft, der ich als fünfzehntes Mitglied und mit dem erklärten Ziel beitrat, so bald wie möglich nach Fernost aufzubrechen. Vorher besuchte ich dasselbe Seminar in Rotterdam, das Gützlaff als junger Mann absolviert hatte. Ein gutes Wort seinerseits und ein geschönter Lebenslauf von mir genügten, und man nahm mich auf, die Kosten trug der Verein. Mangelnde Bildung war kein Hindernis, in Missionskreisen hielt man nicht viel von Universitäten, und unter meinen Mitschülern gab es einige, die nicht nur mit der Rechtschreibung im Lateinischen ihre Mühe hatten. Über China lernte ich in den kommenden Monaten nichts, selbst die Sprache fehlte im Curriculum, das aus Bibelkunde, Predigtlehre und der Geschichte des Christentums bestand. Anfangs fühlte ich mich wie ein Parasit, beinahe wie ein Betrüger. Ich ein Missionar? Die Lehrer waren streng, aber in Glaubensfragen herrschte ein offener Geist, der lediglich auf die Abgrenzung zum verhassten ›Papismus‹ Wert legte, und mit der Zeit machte mir die Sache Freude. So saubere Laken wie im Wohnheim der Schule hatte ich selbst zu Hause nicht gekannt. Ab und zu erhielt ich Post von meinen Eltern, die froh waren, dass ihr schwieriger Sohn auf den rechten Weg zurückgefunden hatte; und ich sagte mir, dass ich notfalls auch von China aus nach Amerika gehen konnte. Als der Verein mir mitteilte, dass das Geld für die Überfahrt beisammen war, fühlte ich mich wie in den magischen Tagen im Frühjahr 48, als die Nachrichten aus Paris uns hatten glauben lassen, die Welt werde sich für immer verändern.
Übrigens bin ich es nicht gewöhnt, so viel von mir zu erzählen. Je mehr ein Mann erlebt hat, desto schweigsamer wird er, habe ich von Alonzo Potter gelernt. Nachdem Reverend Jenkins morgens zur Arbeit aufgebrochen ist, wird es still in seinem Haus, das in einer langen Reihe ähnlicher Anwesen steht: ummauerte Gärten mit knorrigen Platanen, Maulbeerbäumen und gestutzten Hecken. Die britische Siedlung von Shanghai sieht aus wie John's Wood, sagt mein Gastgeber gern, das muss ein Vorort von London sein, aber ich war nie in England. Wo ich herkomme, standen die Häuser eng beieinander und hatten niedrige Kammern über den Werkstätten von Schmieden, Fassmachern und Schreinern. Feuer waren eine ständige Gefahr, aber wer davon verschont blieb, hatte gute Chancen, sein Leben im selben Haus zu beenden, in dem er geboren worden war (was im Brandfall natürlich erst recht galt). Wahrscheinlich wäre ich nie von dort weggegangen, hätte ein bestimmtes Ereignis meiner Kindheit mir nicht die Überzeugung eingegeben, die mich seither begleitet: dass es mir vorherbestimmt ist, mein Leben einer großen Sache zu widmen. Mit zehn Jahren hatte ich die Masern, und eines Morgens, den ich nie vergessen werde, wachte ich auf, und die Welt war dunkel. Der Herbst hatte begonnen. Ich hörte Schritte im Haus und rieb mir die Augen. Meine jüngere Schwester kam ans Bett, um zu fragen, ob ich wieder gesund sei. Mach die Fensterläden auf, sagte ich. Die sind auf, antwortete sie. Noch einmal rieb ich mir die Augen und blinzelte, ich spürte Luises Nähe und roch, dass sie heiße Milch getrunken hatte. Sogar ihre Blicke auf meinem Gesicht konnte ich spüren, aber ich sah nichts, nicht einmal flimmernde Punkte. Gar nichts.
Hier, sagte sie, deine Milch.
Das Wort ›blind‹ kannte ich aus der Geschichte, in der Jesus einen Blinden sehend macht. Außerdem gab es im Ort einen alten Mann, der nur an der Hand seiner Frau aus dem Haus ging, aber von blinden Kindern hatte ich nie gehört. Am dritten Tag kam der Arzt und meinte, er könne es zwar nicht erklären, habe es aber schon zweimal erlebt, beide Male bei Jungen mit Masern. Er empfahl Umschläge mit heißem Essig und absolute Ruhe, manchmal kehre das Augenlicht zurück. Pfarrer Arnold besuchte mich ebenfalls und schien eine Erklärung zu haben, die er flüsternd mit meinen Eltern besprach. Ich sollte liegen bleiben, beide Hände über der Bettdecke falten und beten. Sein Tonfall legte nahe, dass ich für das Unglück selbst verantwortlich war. Den ganzen Winter über lag ich mit frierenden Händen im Bett, betete stundenlang und hatte unbeschreibliche Angst. Um jede Ruhestörung zu vermeiden, wurde mein Bett in die Kammer neben der Waschküche gestellt, meine Geschwister durften nur hereinschauen, um mir etwas zu essen zu bringen. Manchmal schlief ich tagsüber ein und horchte nachts in die Stille des Hauses. An Weihnachten brachten mich meine Eltern in die Kirche, wo ich ohnmächtig wurde, weil ich so lange gelegen hatte, danach wurde das Regiment schrittweise gelockert. Die Kur hatte nichts gebracht, und der Arzt war mit seiner Weisheit am Ende. Als der Schnee taute, beschloss mein Vater, dass es Zeit wurde, sich ins Unvermeidliche zu fügen und das Beste daraus zu machen. Manche Arbeiten in der Schreinerei könne er mit geschlossenen Augen ausführen, warum also ein Blinder nicht auch. Etwa zur selben Zeit stellte ich das Beten ein. Ich hatte alle Sünden bekannt, an die ich mich erinnerte, aber keine gefunden, die nach solcher Bestrafung verlangt hätten. Ab und zu war ich grob zu meinen Geschwistern gewesen oder in der Schule durch schlechtes Betragen aufgefallen, einmal hatte ich aus der Speisekammer ein Stück Kuchen stibitzt. Warum lag ich blind im Bett, während meine Freunde draußen herumtollten?
In meinem letzten Gebet sagte ich: Mach mich wieder gesund, dann bete ich weiter.
Ein Hang zur Aufsässigkeit war mir schon immer zu eigen gewesen. Als Ältester sollte ich meinen Geschwistern ein Vorbild sein, aber die Rolle lag mir nicht. Gleichzeitig war ich ein so guter Schüler, dass der Direktor davon gesprochen hatte, ich könnte das Lehrerseminar in Potsdam besuchen, aber nun verpasste ich den Unterricht, und der Hang zur Auflehnung wurde stärker. Wenn mein Vater das Tischgebet sprach, löste ich die Hände. Las meine Mutter mir aus der Bibel vor, dachte ich mit aller Kraft an etwas anderes. In der Schreinerei lernte ich, Holzsorten durch Betasten zu unterscheiden und einfaches Werkzeug zu gebrauchen, aber wenn mir jemand einen Streich spielte, wurde ich so wild, dass es zwei erwachsene Männer brauchte, um mich zu bändigen. Es war, als ob die Dunkelheit um mich herum eine dunkle Seite in mir zum Vorschein gebracht hätte. Nicht wenige im Ort dachten, ich sei besessen.
Dann, kurz vor Ostern, glaubte ich plötzlich einen hellen Fleck zu sehen. Genau da, wo sich das Fenster der Werkstatt befand. Wenn ich die Augen schloss, verschwand er, und wenn ich zur anderen Wand blickte, sah ich nichts. In den nächsten Tagen wurde die Wahrnehmung schärfer, andere Kontraste kamen hinzu. Die Angst, ich könnte mich täuschen, war ebenso groß, wie der Horror der Erblindung gewesen war, aber ich täuschte mich nicht. Langsam tauchte die Welt aus der Dunkelheit auf, und an Ostern ‒ wirklich genau zum Osterfest ‒ war sie wie zuvor, ein Meer aus Farben und Formen. Heute träume ich davon, eines Morgens aufzuwachen und wieder zwei Hände zu haben, aber selbst dieses Glück würde nicht an das heranreichen, was mich als Kind erfüllte. Mit ausgebreiteten Armen rannte ich über die Felder. Der ganze Ort sprach davon, man hielt mir Finger vors Gesicht und fragte, wie viele es seien, und später erwähnte mich Pfarrer Arnold in seiner Predigt über das Pfingstwunder.
Alles schien wieder in Ordnung zu sein, aber so einfach war es nicht. Eine innere Unruhe hielt mich gefangen, ich war gleichzeitig übermütig und ängstlich, hatte Flausen im Kopf und wurde von Alpträumen geplagt, in denen sich die Welt schlagartig verfinsterte. Statt stillzusitzen, wollte ich rennen, und manchmal schloss ich mitten im Lauf die Augen, fiel hin und fühlte eine rätselhafte Erleichterung. Meine Leistungen in der Schule ließen nach, niemand schlug mich mehr für den Lehrerberuf vor, aber das war mir nur recht. Ich misstraute allen, denen zu gehorchen man mir beigebracht hatte, den Lehrern wie dem Pfarrer, der behauptete, Gott habe mir eine Gnade erwiesen. Gespielt hatte er mit mir, oder nicht? Ich verließ die Schule und kehrte in die väterliche Werkstatt zurück, aber bald wurde es mir auch dort zu eng.
Im dritten Lehrjahr beschloss ich, als Zimmermann auf die Walz zu gehen.
Es war die Zeit, in der es vielerorts zu gären begann. Sogar in der märkischen Provinz hatte ich davon erfahren, nun ging ich nach Thüringen und Leipzig, wo ich für eine Saison als Kulissenbauer am Alten Theater angestellt wurde und zum ersten Mal den Namen Robert Blum hörte. Auf der großen Schillerfeier in Gohlis hörte ich ihn selbst, einen kräftigen Mann mit tiefer Stimme, Rheinländer von Geburt, dem man ansah, dass er gerne aß und trank. Er sprach über die Freiheit als höchsten Ausdruck der Menschenwürde und wurde nach jedem Satz von Bravo-Rufen unterbrochen. Obwohl er aus einfachen Verhältnissen stammte, wie ich später lernte, stand er auf dem Podest, als gehörte es ihm. Niemals hätte ich zu hoffen gewagt, ihn persönlich zu treffen, geschweige denn sein Freund und Mitstreiter zu werden, doch genau das geschah. Eines Abends im Herbst sah ich ihn ins Theater gehen. Bis zum Beginn der Vorstellung war es noch mehr als eine Stunde, und statt Abendgarderobe trug er einen alten braunen Überrock. Ich zögerte kurz, dann fasste ich mir ein Herz und folgte ihm.
Noch nie hatte ich das Haus durchs Hauptportal betreten, nun fand ich mich in der leeren Eingangshalle wieder. Von Blum war nichts zu sehen. Ehrfurchtsvoll betrachtete ich die gewölbten Decken und die Ölbilder an den Wänden und wollte gerade den Rückzug antreten, als im Kassenhäuschen vor mir eine Lampe angezündet wurde. Zuerst traute ich meinen Augen nicht: Robert Blum, der stadtbekannte Freiheitskämpfer, entledigte sich seines Überrocks, zog ein Buch aus der Tasche und wartete lesend auf die ersten Besucher. Als mich sein Blick traf, erwartete ich einen Verweis, aber er seufzte nur und sagte, dass es für den Don Carlos noch viele Karten gebe. Dass ich bekannte, kein Geld zu haben, nahm er nickend zur Kenntnis, und als ich hinzufügte, dass ich in der Werkstatt des Theaters arbeitete, winkte er mich heran und begann ein Gespräch. Niemand hatte mich je auf so wohlwollend teilnahmsvolle Weise ausgefragt wie er. Wo ich herkam, was mich nach Leipzig verschlagen hatte, ob ich gern las. All die Jahre hindurch hatte ich in der Hoffnung gelebt, dass irgendwo eine große Sache wartete, der ich mein Leben widmen konnte, und als ich eine Stunde später im dunklen Theatersaal saß, wurde daraus Gewissheit. Das Leipziger Haus verfügte über 1300 Plätze und einen mit Gaslicht ausgeleuchteten Bühnenraum, der dem Geschehen einen besonderen Zauber verlieh. Vor Spannung wagte ich kaum zu atmen, aber als der Marquis de Posa seinen berühmten Satz sagte, sprang ich vor Begeisterung auf, und bei unserer nächsten Begegnung fiel ich Robert Blum um den Hals. In den folgenden Monaten, in denen die große Sache Gestalt annahm und uns alle mitriss, traf ich ihn fast täglich, im Theater, auf Versammlungen oder bei ihm zu Hause in der List-Straße. Er gab mir den Hessischen Landboten zu lesen und erklärte mir den Freiheitskampf der Polen, für die er eine besondere Bewunderung hegte. Mein Jähzorn nach der Erblindung, sagte er, sei kein Ausdruck von Wut, sondern von Angst gewesen, und als ich fragte, woher er das wisse, meinte er, es sei ihm ebenso ergangen. Ja, auch er hatte die Masern gehabt und ein halbes Jahr blind im Bett gelegen, auch er hatte auf einmal das Augenlicht zurückerlangt und nicht gewusst, wie ihm geschah. Ab sofort war er mein älterer Bruder, aber als er nach Frankfurt und schließlich nach Wien ging, konnte ich ihn nicht begleiten. Wir hatten beide kein Geld, außerdem begannen sich die Ereignisse zu überschlagen. Kurz besuchte ich meine Familie und eilte weiter nach Berlin, wo ich zum ersten Mal Schießpulver roch und feststellte, dass im Moment der Gefahr alle Angst von mir abfiel. Wenn die Kugeln pfiffen, handelte ich ruhig und besonnen, manchmal überkam mich ein erhebendes, fast rauschhaftes Gefühl. Wir kämpften für die richtige Sache. Am 19. März war ich dabei, als man den König zwang, die auf dem Schlossplatz aufgebahrten Gefallenen zu ehren. »Hut ab!«, rief jemand aus der Menge, und siehe da, der Monarch gehorchte! Alles schien möglich. Roberts Frankfurter Reden wurden als Flugschriften in ganz Deutschland verteilt, und bis heute verstehe ich nicht, wie sich kurz darauf alles zum Bösen wenden konnte. Schneller als in den Bergen das Wetter umschlägt, zeigten die Herrschenden ihr wahres Gesicht. Als ich von den Ereignissen in Wien hörte, war ich bereits auf dem Weg nach Holland. In meiner linken Schulter steckten Metallsplitter, und die Nachricht von Robert Blums Hinrichtung traf mich wie ein Stich ins Herz. Statt eine Republik zu werden, setzte Deutschland seine Kleinstaaterei fort, den Popanz der Höfe und das geistige Muckertum, damit wollte ich nichts zu tun haben. Wenn ich heute zurückschaue, erstaunt es mich, was zwei Jahre politischer Kampf aus mir gemacht hatten. Als Jüngling mit dem ersten Flaum im Gesicht war ich nach Leipzig gekommen, in Rotterdam traf ich mit frischen Narben ein, einem Vollbart und der festen Überzeugung, dass meine Zukunft ‒ ich war noch keine zwanzig ‒ im fernen Amerika lag.
Stattdessen also brach ich im Sommer 1850 nach China auf. Dass meine Ausbildung kaum begonnen hatte und ich über das Land nichts wusste, schien niemanden zu stören. Gützlaff schrieb mir einen aufmunternden Brief, in dem wenig von Theologie und viel von dem die Rede war, was man gerade die soziale Frage zu nennen begann. Mir gefiel das, ich wollte mithelfen, ein Land aus seiner Rückständigkeit zu befreien. In Singapur, einem britischen Handelsposten mit vielen chinesischen Einwanderern, sollte ich Station machen, um die fremde Sprache zu lernen, vorher verbrachte ich achtundneunzig Tage auf See. Seit es die Eisenbahn über den Sinai gibt, nehmen Asienreisende die sogenannte Overland Route, ich umrundete auf einem P&O Clipper das Kap der Guten Hoffnung. Meine Koje war zwei Fuß breit und kürzer als mein Körper, so dass ich weder ausgestreckt liegen noch die Position ändern konnte, ohne mich zu stoßen. Eingeklemmt zu sein, erklärte man mir, war bei hohem Wellengang am sichersten, und tatsächlich gerieten wir mehrmals in schwere See und mussten tagelang im Hafen liegen, um die zerstörten Segel zu reparieren. Wollte ich mich waschen, ging ich frühmorgens an Deck, wo es den dunkelhäutigen Bootsleuten egal war, ob sie ihren Wassereimer über den Planken oder einem ›Sahib‹ der zweiten Klasse ausgossen. Nur die erste Klasse hatte Anspruch auf ein Wannenbad pro Woche.
Je weiter wir nach Osten kamen, desto größer wurde die Hitze. Einmal brach in der Küche Feuer aus und vernichtete die Verpflegung für zwei Tage. Mitten in einem Sturm, der uns in der Hafeneinfahrt von Galle überraschte, hörte ich zum ersten Mal den Ruf ›man overboard!‹. Streitigkeiten zwischen betrunkenen Passagieren waren so alltäglich wie der Klatsch, der sich um das Geschehen in den Kabinen der ersten Klasse drehte. An Bord befanden sich mehrere junge Engländerinnen, die in Indien einen Kolonialbeamten oder Offizier heiraten wollten und von männlichen Passagieren ‒ meist Kolonialbeamten oder Offizieren ‒ eifrig umworben wurden. Die Stewards hatten oft alle Hände voll zu tun, um Schlägereien zu verhindern, und ich verbesserte mein Englisch, indem ich alles beobachtete. Als eine ältere Dame aus Kent ihrem Fieber erlag, wurde heftig darüber gestritten, ob die Spieltische im Salon für einen Abend geschlossen bleiben sollten.
Sie blieben geöffnet. Ich lernte jeden Tag etwas Neues.
Bei der Ankunft in Singapur wog ich sieben Kilo weniger als vor der Abreise. Es dauerte lange, bis mich nachts das Gefühl verließ, mein Bett treibe auf den Wellen, trotzdem genoss ich es, nicht länger zwischen hölzernen Bettstreben eingezwängt zu sein. Im ehemaligen Anglo-Chinese College fand ich ein Quartier und begann den Unterricht bei einem hohlwangigen Chinesen namens Yen. Angeblich hatte er schon viele Missionare auf ihre Arbeit vorbereitet, aber wie sich herausstellte, erwarb ich in den nächsten Monaten einen Dialekt, von dem ich bis heute nicht weiß, wo in China er gesprochen wird. Von der Vielzahl der Sprachen und Dialekte, die Gützlaff unter der Bezeichnung ›Chinesisch‹ zusammengefasst hatte, sollte ich erst auf Hongkong eine Vorstellung bekommen; in Singapur wurde ich zunächst mit den Eigenheiten des tropischen Klimas bekannt. Statt Jahreszeiten gab es nur den Unterschied zwischen Regen- und Trockenperioden, aber die Hitze blieb stets gleich. Moskitos hatten es auf mein Blut abgesehen, und nie wurde es nachts still, überall zirpte, kreischte und quakte es. Der Hafen lag ein paar hundert Yards entfernt an einer Bucht, die wegen der Inseln, die sie vom Meer abschirmten, einem See glich. Wenige Meilen landeinwärts begann der Dschungel. Einheimische warnten mich, dass jedes Jahr Hunderte Menschen von Tigern gefressen würden, aber ich bekam nur ein totes Tier zu Gesicht, das an einer Holzstange zum Government House getragen wurde. Fünfzig Dollar zahlte man dort für jedes erlegte Exemplar.
Lehrer Yen war mit meinen Fortschritten zufrieden, und ich auch. Mit einem feinen Pinsel chinesische Schriftzeichen zu malen, empfand ich als merkwürdig befriedigende Tätigkeit, auch wenn das Ergebnis aussah wie die Schreibversuche eines kleinen Kindes. Die ersten drei Zeichen, die ich lernte, bildeten meinen neuen Namen: Fei Lipu, eine vage Annäherung an Phi-lipp. Anfangs klangen die Laute so fremd, dass ich lachen musste, aber mit der Zeit gewöhnte ich mich daran und versuchte, auch außerhalb des Unterrichts mit Einheimischen in Kontakt zu kommen.
Die gelb getünchten Häuser im chinesischen Viertel sahen hübsch aus, aber die Bewohner waren arm und fuhren erschrocken zusammen, wenn ich sie ansprach. Im englischen Teil der Stadt erntete ich vorwurfsvolle Blicke, weil ich statt der Kleidung von zu Hause das lange Gewand eines chinesischen Magisters trug. Auch das verstand ich erst später auf Hongkong: In den Augen der weißen Herren war es ein schweres Vergehen, die Grenze zu verwischen, die zwischen ›ihnen‹ und ›uns‹ verlief und die zu bewachen sie als ihre wichtigste Aufgabe ansahen. Aus der Heimat kannte ich feudale Vorrechte und die Anmaßung derer, die sie genossen, hier waren es tabakkauende Indigo-Pflanzer, die sich in Sänften tragen ließen oder mit dem Gehstock auf alle einschlugen, die ihnen den Weg versperrten. Auf der Veranda des London Hotels saßen Reisende in steifen Anzügen, tranken Gin und Port und blickten auf die Händler herab, die vor ihnen ihre Waren ausbreiteten. Einmal beobachtete ich, wie drei Halbwüchsige eine Schlange feilboten, die sie gefangen hatten. Ein prächtiges Tier, zehn Fuß lang, mit ölig glänzender schwarzer Haut. Nach einigem Handeln kaufte ein Engländer sie für einen Dollar, verlangte aber, dass man sie für ihn tötete und häutete, anders könne er sie nicht mit aufs Schiff nehmen. Die Jungen ersäuften die Schlange in einem Fass und zogen ihr an Ort und Stelle die Haut ab. Halb amüsiert, halb angeekelt sahen die Hotelgäste zu. Auf der Straße trugen alle Weißen eine müde Verstimmung im Gesicht, über deren Grund ich nur mutmaßen konnte. Am eigenen Überlegenheitsgefühl festzuhalten, schien eine auszehrende Tätigkeit zu sein ‒ ich beschloss, mich damit nicht zu belasten.
Das Leben in der Fremde gefiel mir, alles war neu. In den Sümpfen beim Hafen sah ich Alligatoren, die träge im Wasser lagen, und jeden Tag aß ich eine Ananas. Die Frucht wuchs überall und kostete fast nichts. Auf den Märkten roch es nach Anis und Muskat, es gab Kakerlaken von der Größe einer Feldmaus, die Gassen waren laut und voll, aber meistens friedlich, und sogar im Sitzen lief mir Schweiß über die Stirn. Als im August ein Brief von Gützlaff eintraf, der mich dringend nach Hongkong rief, war ich wenig erfreut. Ich wollte den Unterricht nicht schon wieder vorzeitig abbrechen und ließ mir einige Wochen Zeit, bevor ich ein Handelsschiff namens Madras bestieg. Da in der Vorwoche ein anderes Schiff ausgefallen war, hatte die Madras mehr Passagiere an Bord als Plätze, und ich bekam nur eine Koje in der Kabine des Schiffsarztes, direkt neben den Turbinen. Vier Nächte lang ertrug ich den Lärm, dann suchte ich mir einen Platz zwischen den Beibooten an Deck. Einen schöneren Sternenhimmel hatte ich nie gesehen. Eine Woche später erreichten wir Hongkong.
Es war der 9. November 1851, der dritte Todestag von Robert Blum.
Die Insel bot einen ernüchternden Anblick. Schroffe Felsen erhoben sich aus dem Wasser, deren Gipfel im Nebel verschwanden, und noch bevor wir in den Hafen einliefen, begann ich die üppig grüne Bucht von Singapur zu vermissen. Vom Meer aus gesehen, wirkte Hongkong so karg wie eine Gefängnisinsel, die einzige Stadt hieß wie die englische Königin, Victoria, und bestand aus wenig mehr als zwei Kirchtürmen und ein paar Handelshäusern. Erst seit zehn Jahren gab es die Kolonie, sie war die Beute eines Krieges, den viele als Opiumkrieg bezeichneten und der nicht der letzte Waffengang bleiben sollte. Der merkwürdige Name der Insel bedeutete Hafen der Düfte, und soweit ich erkennen konnte, war er das Schönste, was sie zu bieten hatte.
Niemand kam ans Pier, um mich abzuholen. Da es auf Hongkong keinen Telegrafen gab, hatte ich meine Ankunft per Brief angekündigt, nun wartete ich verloren zwischen Kulis, Passagieren und Schaulustigen. Das faulige Aroma von Tang und Salz hing in der Luft. Alle Chinesen, die ich sah, hatten die Stirn rasiert und trugen die Haare zum Zopf gebunden, der ihnen bis zum Gesäß reichte. Über die graue See wehte ein kühler Wind, und nach zwei Stunden des untätigen Wartens nahm ich mir ein Zimmer in einer billigen Pension. Dass Gützlaff gestorben war, erfuhr ich erst, als ich am nächsten Tag Erkundigungen einholte. Wassersucht, hieß es. Sein Chinesischer Verein, für den ich hätte arbeiten sollen, besaß keine feste Adresse, er war durch nichts als Gützlaffs rastlose Tätigkeit zusammengehalten worden, und wie ich bald feststellte, wollte keine andere Missionsgesellschaft den drohenden Verfall aufhalten. Karl Gützlaff, der zu Hause als Retter Chinas aufgetreten war, galt hier in der Kolonie als ein fintenreicher Betrüger. Auf seinen Reisen hatte er dutzendweise Gemeinden gegründet und jeden Einheimischen getauft, der nicht davonlief, oft nach nur zweitägiger Unterweisung, ohne dass die Konvertiten Jesus und Jesaja unterscheiden konnten. Männer wie Reverend Legge von der London Missionary Society nannten den Mann, dem ich nach China gefolgt war, ›the greatest humbug of all time‹.
Hier war ich also, gestrandet auf einem winzigen Eiland vor der chinesischen Küste. Ich hatte keine Arbeit und kannte niemanden, die Post nach Hause brauchte zwei Monate, also waren vorerst keine neuen Instruktionen zu erwarten. Mein Geld immerhin würde für ein Jahr reichen, und nachdem ich den ersten Schreck überwunden hatte, empfand ich das Ganze als Abenteuer. Im Vergleich zu Singapur war Victoria ein Dorf, eingeklemmt zwischen hohen Felsen und dem Meer. Die Handelshäuser und der Turm der St.-John's-Kathedrale verliehen dem Ort ein europäisches Gepräge, aber es gab Opiumhöhlen an jeder Straßenecke und so viele Bordelle wie Schiffe an den Docks. Etwa fünfhundert Europäer lebten hier inmitten von mehreren zehntausend Einheimischen, die sich über die gesamte Insel verteilten. Einige waren Fischer oder Handwerker, die meisten arbeiteten als Hausmädchen und Kulis, Prostituierte und Köche, Schmuggler und Räuber. Täglich kam es zu Überfällen, und ich hatte noch keine Woche auf der Insel verbracht, als ich miterlebte, wie ein Dutzend Piraten an den Haaren zusammengebunden zum Galgen geführt wurde. Finster dreinblickende Sikhs versahen den Polizeidienst, von den Schiffen stiegen Matrosen aus allen Gegenden der Welt, und die inoffizielle Landessprache war ein Kauderwelsch aus englischen, portugiesischen und hindustanischen Wörtern, das man Kanton-Englisch oder Pidgin nannte. Letzteres war die verballhornte Form des Wortes ›business‹ und brachte den Zweck des Ganzen auf den Punkt. Ich lernte die Sprache binnen weniger Wochen, indem ich durch die Straßen schlenderte und die Ohren offenhielt. Wantchee catchee extra dolla, you go chop-chop, riefen weiße Herren den Trägern ihrer Sänfte zu, um sie zur Eile anzutreiben. Flugschriften, die vor Bordellen aushingen, verkündeten eine Kurzversion der frohen Botschaft ›Papa-joss lovee allo man‹. ›Joss‹ hieß Gott, ein ›joss-house‹ konnte ein Tempel oder eine Kirche sein, Missionare und Priester wurden ›joss-men‹ genannt, und der Beruf, dem ich hätte nachgehen sollen, hieß ›joss-pidgin‹. Einstweilen beschränkte ich mich darauf, sonntags die Union Church zu besuchen. Außer Zeitungen waren Predigten das beste Mittel, um richtiges Englisch zu lernen. In der Messe blieben die weißen Herren unter sich, es gab keine Chinesen und fast keine Frauen ‒ auf zehn Männer kam in Victoria kaum eine Frau, und das schloss bereits die vielen Prostituierten ein. Die Familien der meisten Kaufleute wohnten in Macao, auf der anderen Seite des Perlflussdeltas, wo es sauberer und sicherer war. Bei uns verließ niemand das Haus ohne Waffe, und wenn sich die Gemeinde nach dem Gebet setzte, hörte man das dutzendfache Aufschlagen von Pistolenläufen auf der Kirchbank. Auch ich hatte begonnen, mich bei Pfandleihern nach den Waffenpreisen zu erkundigen.
Im März traf ich vor der Union Church einen melancholisch dreinblickenden Schweden namens Hamberg, der mir erzählte, dass die Basler Missionsgesellschaft dringend neue Mitarbeiter suchte. Er selbst hatte einige Jahre im Inland missioniert, bereitete nun aber seine Heimreise vor, wegen gesundheitlicher Probleme und einer allgemeinen Auszehrung, die ihm deutlich ins Gesicht geschrieben stand. Zwei Basler Brüder waren kürzlich in der Bucht von Sai Ying Pun angeschwemmt worden, nahe der Stelle, wo später Elisabeths Findelhaus entstand. Die Todesumstände blieben ungeklärt. Hamberg versprach, meine Bewerbung nach Europa mitzunehmen und ein gutes Wort für mich einzulegen. Meine Verbindung zu Gützlaff nahm er ‒ wie alles, was ich sagte ‒ mit einem erschöpften Nicken zur Kenntnis.
Nach dem Frühjahrsmonsun begann der Sommer. Je heißer es wurde, desto früher stand ich morgens auf, lernte Schriftzeichen und machte einen Spaziergang entlang der Docks. Ein Kowloon genannter Zipfel des Festlands kam der Insel so nahe, dass er die Hafeneinfahrt in zwei Fahrrinnen teilte, und wenn ich das Ufer aus dem Dunst auftauchen sah, fragte ich mich, wie die Menschen dort lebten. Nachmittags ging ich in die Bibliothek der Londoner Mission, wo es Zeitungen und ein Englisch-Deutsch-Wörterbuch gab, und las alle verfügbaren Artikel über das fremde Land. China war älter als Rom und so riesig wie ein Kontinent. Die herrschende Dynastie hatte das Territorium bis nach Zentralasien und an die Grenze zu Indien ausgedehnt, innerhalb seiner Grenzen lebten Dutzende Völker, und zu meiner Überraschung erfuhr ich, dass ausgerechnet der Kaiser im fernen Peking kein Chinese war. Er gehörte zu einem Reitervolk aus dem hohen Norden, das vor zweihundert Jahren das Reich erobert hatte; Mandschus lautete die korrekte Bezeichnung, die Zeitungen schrieben fälschlicherweise von Tataren und nannten ihre Herrschaft grausam und korrupt. Ihretwegen versank das Land in Armut, sie verlangten, dass alle Chinesen zum Zeichen ihrer Unterwerfung den hündischen Zopf trugen, den ich überall sah. Lange bevor ich chinesischen Boden betreten hatte, begann ich die hiesige Elite ebenso zu hassen wie die adligen Herren zu Hause. Bloß, was konnte ich tun? Mein Geld ging zur Neige, und ich dachte bereits daran, mit dem Rest die Überfahrt nach Amerika zu bezahlen, als unerwartet Post aus Basel eintraf. Meine Bewerbung war angenommen worden, wenn auch mit Vorbehalt. Angesichts meines Hintergrundes komme vorerst nur eine Anstellung auf Probe in Betracht, schrieb mir ein Generalinspektor namens Josenhans und meinte entweder meine kurze Ausbildung oder die Verbindung zu Gützlaff. Es klang, als sollte ich die Stelle übernehmen, bis ein besserer Kandidat gefunden war, aber das kam mir gelegen. Dass mein Einsatzort ein Dorf auf dem Festland sein sollte, gefiel mir ebenfalls. Lange genug hatte ich zwischen arroganten Engländern und betrunkenen Matrosen gelebt und brannte darauf, das Land kennenzulernen, das ich bisher nur in Gedanken bereist hatte.
Mit der Fähre setzte ich über nach Kowloon, lief ein paar Meilen zu Fuß, durchquerte auf einer zweiten Fähre eine flache Bucht, lief noch etwas weiter und erreichte mein Ziel. Tongfu war ein ärmliches Dorf mit fünfzig Häusern, umgeben von Reisfeldern und langen, waldlosen Bergketten. Flüsse mäanderten durch die Landschaft, Regen fiel reichlich, aber den Boden bedeckten nur dünne Schichten von Sand und Ton, die kaum etwas abwarfen. Zu Hause war ich selbst in den Hungerjahren vor der Revolution keiner solchen Armut begegnet. Die dreihundert Dorfbewohner gehörten zur Volksgruppe der Hakka, von der ich nie gehört hatte, ehe der Brief aus Basel mich anwies, meine Arbeit auf sie zu konzentrieren. Wegen ihrer Außenseiterstellung in der Gesellschaft seien Hakka besonders empfänglich für die frohe Botschaft, schrieb Inspektor Josenhans, der es wissen musste, schließlich war er nie in China gewesen. Nachdem ich in Singapur einen Dialekt erworben hatte, den niemand verstand, stellte ich nun fest, dass die wenigen Brocken Kantonesisch, die ich inzwischen beherrschte, mir auch nicht weiterhalfen. Die Hakka hatten ihre eigene Sprache. Um mich verständlich zu machen, musste ich mit dem Stock Schriftzeichen in den Boden malen und hoffen, dass mein Gegenüber lesen konnte. Es gab keine Kirche und nur eine Bibel, die bei Zusammenkünften von Hand zu Hand ging. Alle küssten sie oder hielten sie sich kurz an die Stirn. Den Vorsitz führte ein zahnloser Greis mit sonnengegerbtem Gesicht, genannt der alte Luo, der mich beäugte, als wäre ich gekommen, um seine Autorität zu untergraben. In gewisser Weise stimmte das.
Ich begann meine Arbeit im Frühjahr, mitten in der Regenzeit. Die Flüsse führten Hochwasser, und obwohl es pro Jahr drei Ernten gab ‒ einmal Gerste, zweimal Reis ‒, lebten die Menschen in Häusern, die an Ställe gemahnten. Meist bestanden sie aus einem einzigen Raum, in dem außer der Familie auch Hühner und Schweine ein und aus gingen. Die Wände waren aus Backstein, der Boden aus festgetretenem Lehm, und im ersten Quartalsbericht schrieb ich, die Bewohner von Tongfu lebten im wahrsten Sinn des Wortes parterre. Mir wies man ein Häuschen zu, in dem es nach verschimmelten Kartoffeln roch, aber immerhin lag kein Tierkot herum wie überall sonst. Junge Männer halfen mir, aus geriebenen Muscheln, Hanföl und Sand einen Putz herzustellen, mit dem ich die Wände abdichtete, außerdem baute ich mir aus Bambusrohren ein Bett und spannte das mitgebrachte Moskitonetz auf. Ein einziger Gegenstand in meinem Zuhause erfüllte keinen praktischen Zweck: ein in Bernstein gefasstes Porträtbild von Robert Blum, das meine Mutter mir vor der Abreise aus Rotterdam geschickt hatte. Eines Tages würde in jeder deutschen Stadt ein Platz nach ihm benannt sein, auf dem sich freie Bürger begegneten, die wussten, wer für ihre Freiheit gestorben war. Dann, vielleicht, würde auch ich zurückkehren.
Vorher hatte ich in Tongfu einiges zu tun. Für den Hakka-Dialekt gab es kein Wörterbuch, also ging ich durchs Dorf, half den Leuten bei der Arbeit und ließ mir für jeden Gegenstand, den ich in die Hand nahm, das Wort sagen. Manchmal besuchten mich Bewohner, die auf eine Anstellung und die entsprechende Bezahlung hofften und enttäuscht wieder abzogen, wenn ich ihnen nichts als Tee anbot. Die Zentrale in Basel enttäuschte ich ebenfalls. Auf meinen ersten Quartalsbericht antwortete Josenhans, die geographischen Angaben seien zwar durchaus instruktiv, aber ihn interessiere mehr, wie viele Heiden ich inzwischen getauft hatte. Ich las den Bericht auf dem Rückweg von Victoria, wohin ich alle zwei Wochen reiste, um einzukaufen und nach Post zu fragen. Über Josenhans' Ansinnen musste ich lachen. Der Mann wollte Konvertiten, Taufen, wachsende Gemeinden, aber wie sollte ich Menschen missionieren, deren Sprache ich nicht verstand?
Zunächst unterband ich das Betatschen der Bibel und bat den alten Luo, das Amulett abzunehmen, das er um den Hals trug. Daraufhin gab er mir zu verstehen, dass es ihn vor Krankheiten schützte, die mein Gott nicht kannte, da er von jenseits des Ozeans kam. Solche in Zeichensprache geführten Debatten nannte ich in meinen Berichten theologische Unterweisung. Speiste ich einen Bittsteller mit Tee und warmen Worten ab, schrieb ich von Erbauungsstunden mit einzelnen Gemeindemitgliedern, und als solche zählte ich alle Bewohner, die nicht demonstrativ wegsahen, wenn ich ihnen begegnete. Ansonsten tat ich, was ich konnte. Auf den Feldern herrschte Not am Mann, es gab zu wenig Zugtiere, und manchmal ließ ich mich selbst vor den Pflug spannen, bis meine Beine vor Erschöpfung einknickten. Immerzu mussten Dächer repariert werden, wofür ich aus Hongkong das nötige Werkzeug mitbrachte. Die Leute waren mir dankbar, und mit mehr Zeit wäre in Tongfu vielleicht eine Gemeinde entstanden, die den Namen verdiente. Warum es anders kam, erzähle ich später; jetzt will ich berichten, wie ich zum ersten Mal von den gewaltigen Umwälzungen hörte, die sich in jenen Jahren im Landesinneren zutrugen.
Es war wenige Wochen nach meiner Ankunft. Um das Vertrauen der Bewohner zu gewinnen, passte ich mich dem dörflichen Leben so weit wie möglich an. Statt westlicher Kleidung trug ich das Gewand eines Dorfschullehrers, meine Füße steckten in Stoffschuhen, und Aufzeichnungen datierte ich doppelt, auf unsere Weise und nach dem chinesischen Kalender, dessen Jahr mit dem Frühlingsfest begann. 1853 war das dritte Jahr der Herrschaft Xianfeng, und das Ende des vierten Mondes fiel auf den Übergang vom Mai in den Juni.
Am späten Nachmittag kehrten die Bewohner von den Feldern zurück. Ich saß in meinem Haus und machte Notizen, als das Knallen von Feuerwerkskörpern die Stille zerriss. Erstaunt hörte ich, wie sich Jubelrufe unter die Explosionen mischten. Aus Hongkong kannte ich solchen Lärm, der an jedem Feiertag erklang, aber in den Tagen zuvor waren mir keine Vorbereitungen aufgefallen. Eine Hochzeit stand auch nicht an. Als ich vor die Tür trat, sah ich, dass sich das gesamte Dorf vor dem Haus des alten Luo eingefunden hatte, blauer Rauch stieg in die Luft, und ich bekam ein ungutes Gefühl. Die Anweisungen aus Basel waren klar: Heidnische Rituale mussten rigoros unterbunden werden. In jeder Ausgabe des Evangelischen Heidenboten wurden Missionare dafür gefeiert, dass sie Einheimische davon abhielten, ihre Tempel zu besuchen oder Götzenstatuen anzubeten. In Rotterdam hatte ich gelernt, dass die Jesuiten in China einst große Schuld auf sich geladen hatten, als sie dem Kaiserhof die Durchführung gewisser Rituale erlaubten, andererseits hatte Gützlaff gesagt, dass man nicht alle fremden Gebräuche auf einmal abschaffen konnte, und das erschien mir einleuchtend. Wie sollten die Bewohner mir vertrauen, wenn ich ihnen verbot, was sie seit Jahrhunderten zu tun gewohnt waren? Die Berichte im Heidenboten endeten meist so, dass die Missionare mit Steinwürfen verjagt wurden und über die verstockten Herzen der Einheimischen klagten. Was war damit gewonnen?
Langsam näherte ich mich der Versammlung. Aus dem Haus des alten Luo wurde eine Statue getragen, die ich vorher nie gesehen hatte. Sie sah aus wie von Kinderhänden gemacht, aus rot bemaltem Ton geformt und auf ein altes Holzbrett montiert. Sobald die Bewohner mich bemerkten, wurde ich umringt und mit Worten überschüttet. Nanking sei erobert worden, verstand ich, ohne die Information einordnen zu können. Das ganze Dorf befand sich im Freudentaumel, der alte Luo schenkte Hirseschnaps aus. Erobert von wem und warum, fragte ich und weiß heute nicht mehr, was ich damals erfuhr und was später. Der große Aufstand, der inzwischen ganz China erfasst hatte, war einige Jahre zuvor ausgebrochen und erreichte mit der Eroberung von Nanking seinen vorläufigen Höhepunkt. Dass die Anführer Hakka waren und mehrere Männer aus der Familie des alten Luo in ihrer Armee kämpften, erzählte man mir zwar, aber wie alles, was ich hörte, klang es verrückt. Nanking war ebenso berühmt für seine lange Geschichte wie für die uneinnehmbaren Mauern. Arme Hakka aus dem Süden sollten die Stadt erobert und in Himmlische Hauptstadt umbenannt haben? Aufgeregt deutete der alte Luo immer wieder auf die Statue und machte das Kreuzeszeichen, wie um mir zu sagen, dass die Aufständischen Christen seien.
Tian Wang, Himmlischer König, stand in zwei Schriftzeichen auf der Brust der Figur.
Jemand drückte mir einen Schnaps in die Hand, und ich trank ihn. Dann noch einen. Er brannte im Hals, die Umgebung begann sich zu drehen, und auf einmal musste ich an die Zeit denken, als ich nach der Erblindung wieder sehen konnte: Wie ich hatte rennen müssen, immerzu rennen, trotz der Angst, die Blindheit könnte zurückkehren und mich mitten im Lauf zu Fall bringen. Ich rannte und rief innerlich: Mach mich blind, mach mich doch blind! Dann schloss ich die Augen, rannte weiter und fiel hin. Rappelte mich auf, rannte erneut los und fiel wieder hin. Die Dunkelheit, die mich monatelang umgeben hatte, ließ mich nicht los, aber Angst war nicht das einzige Gefühl, das sie auslöste. Warum verschaffte es mir solche Erleichterung, zu fallen? Wieso fühlte ich mich in diesem Moment lebendig und stark, beinahe unverwundbar, und warum kehrte das Gefühl zurück, als ich in Tongfu die Statue des Himmlischen Königs betrachtete? Gab es auch hier in China eine große Sache, die auf mich wartete? Auf die Antwort kam ich erst später, oder glaubte es zumindest, nachdem ich der Lockung noch einmal nachgegeben und mich auf den Weg nach Nanking gemacht hatte. Das Risiko kannte ich, aber ich wollte es eingehen, um jeden Preis ‒ wie hoch er sein würde, konnte ich damals nicht ahnen.
Hong Jin
Im Dorf Guanlubu riefen ihn alle den kleinen Hong. Von Kindheit an hatte er zusammen mit seinem Vetter für die Prüfungen gelernt, aber die Hoffnungen der Bewohner ruhten allein auf dem Älteren. Von ihm erwartete niemand die Erlösung aus der Armut, er war nur der brave Gefährte, den jeder mochte und kaum jemand beachtete, und manchmal ärgerte ihn das ‒ bis zu jenem Tag, an dem der Vetter zum dritten Mal aus Kanton zurückkehrte. In seiner Abwesenheit hatte Hong Jin im Dorftempel gebetet und gewacht. Noch war er zu jung, um selbst an den Prüfungen teilzunehmen, aber was auf dem Spiel stand, wusste er so gut wie alle anderen. Ein drittes Scheitern wäre das Ende aller Träume.
Nach achtzehn Tagen kehrte Hong Xiuquan ins Dorf zurück, nicht zu Fuß, sondern in einer gemieteten Sänfte. Wie ein Schwerkranker wurde er zu Hause ins Bett gelegt. Als sich die Familie um ihn versammelte, bat er mit dünner Stimme um Verzeihung für sein Versagen. Dann schloss er die Augen, um zu sterben. In den nächsten Wochen lag er mal stumm im Bett, mal gebärdete er sich so wild, dass Eltern und Geschwister entsetzt aus dem Haus flohen. Nur Hong Jin wich nicht von seiner Seite, sondern schrieb alles auf, was er hörte und sah. Mit der Zeit ergaben sich die Umrisse eines Bildes: Der Vetter kämpfte mit dem Schlangenteufel Yan Luo, dem Fürsten der Unterwelt. Seine Waffe war ein gewaltiges Schwert, und an seiner Seite focht ein zweiter Mann, den er den älteren Bruder nannte. Wenn er nach einem Kampf in die Kissen sank, zeigten sich auf seinen Armen frische Wunden. Eines Morgens standen über dem Türbalken vier Zeilen in einer fremden Handschrift:
Mit dem Schwert in der Hand bringe ich Frieden auf die Erde.
Die Bösen werden geköpft, die Guten verschont und die hundert Namen beruhigt.
Mein Blick schweift nach Norden und Süden, über Berge und Flüsse.
Meine Stimme dröhnt von Ost nach West, bis hinauf zu Sonne und Mond.
Als der Vetter nach vierzig Tagen erwachte, hatte sein Bart die Farbe von Sand. Auch die Stimme klang anders, und sein Blick war so bohrend, dass die Kinder davonrannten, wenn er das Haus verließ. Viele im Dorf glaubten, er sei vom Fuchsgeist verhext worden. Hong Jin allein ahnte, dass es eine andere Erklärung geben musste. In alten Büchern suchte er nach Geschichten über Yan Luo, der sich in ein Tier verwandeln konnte, um seine Feinde zu täuschen, aber wenn er den Vetter fragte, bekam er keine Antwort. Jahre vergingen, ohne dass er herausfand, was geschehen war. Felder mussten bestellt und Familien ernährt werden, und außer ihm wollte niemand an alten Wunden rühren. Eines Tages jedoch fiel sein Blick auf ein ungelesenes Buch im Regal. Ausländische Teufel hätten es ihm in Kanton geschenkt, erzählte der Vetter, aber der Verfasser war ein Landsmann aus dem Süden. Gute Worte zur Ermahnung des Zeitalters stand auf dem Einband. Hong Jin nahm es mit nach Hause und las vom großen Schlangenteufel, der die Menschen mit einer List dazu verführte, verbotene Früchte zu essen. Von einer gewaltigen Flut las er, die geschrieben wurde wie der Familienname Hong und alle hinwegspülte, die an Götzen und Geister glaubten. Er las vom Gott Shang Di, dem Herrscher in der Höhe, der die Menschen liebte und über ihre Abwege in Zorn geriet, so dass sie die Felder bestellen mussten im Schweiße ihres Angesichts, genau wie die Hakka in Guanlubu. Vieles in dem Buch klang vertraut, anderes unerhört. Lu Ban, der Meister der Holzarbeiter, und Guanyin Pusa, die Göttin der Gnade, Frau Goldblume, die Hoffnung der Kinderlosen, der Gelbe Kaiser, der Nordkaiser und die Himmelsmutter, sie alle, stand dort, waren hölzerne Statuen ohne Macht.
Hatten seine Gebete deshalb nichts bewirkt?
Zuerst wollte sein Vetter ihn nicht anhören. Der Ältere träumte noch immer davon, die Scharte auszuwetzen und die Prüfung abzulegen, aber Hong Jin war nicht mehr der brave Gefährte von einst. Sieben Jahre hatte er nach dem Schlüssel gesucht, nun war er überzeugt, ihn gefunden zu haben. Gemeinsam studierten sie das Buch und die Notizen von damals, und zum ersten Mal erzählte der Vetter von seinen Erlebnissen während der vierzig Tage. In einer goldenen Sänfte war er in den Himmel getragen worden, wo ein Mann mit langem Bart ihn empfangen und seinen Sohn genannt hatte. Von ihm hatte er ein Schwert erhalten, um auf der Erde die Dämonen zu töten. Je länger sie sprachen, desto klarer wurde alles. Als sie ihren Auftrag erkannten, zögerten sie nicht, sondern gingen in den Dorftempel und schlugen die Ahnentafeln in Stücke. Hong Xiuquan ließsich ein Schwert schmieden und zertrümmerte auch den Familienaltar zu Hause. Sieben Jahre lang hatte er sich geschämt, jetzt trat er auf den Dorfplatz und schrie laut heraus, dass er der Sohn des Höchsten war. Die Bewohner bewarfen ihn mit Steinen. Hong Jin wurde von seinen Brüdern halb totgeschlagen, und als er wieder laufen konnte, war der Vetter verschwunden. Niemand wollte ihm verraten wohin. Eine Zeitlang glaubte er, die Dorfbewohner hätten ihn umgebracht. Als die Nachrichten von den Gottesanbetern das Dorf erreichten, die weit weg auf dem Distelberg lebten und ihren Anführer den Himmlischen König nannten, brach er sofort auf, aber es gab bereits kein Durchkommen mehr. Überall lauerten Soldaten des Kaisers, die Jagd auf die Hakka machten. Rastlos wanderte er durchs Land. In Shanghai traf er englische Missionare und studierte mit ihnen die Heilige Schrift, bis die Aufständischen eines Tages Nanking eroberten und er nirgends mehr sicher war. Mit knapper Not erreichte er Hongkong, wo er Unterschlupf bei denen fand, die er bald seine ausländischen Brüder nannte. Er lernte ihre Sprache und ließsich taufen, aber was die Ausländer ihm beibrachten, verwirrte ihn. Hatte der Gott Shang Di einen Sohn oder zwei? Er predigte und träumte insgeheim davon, mit Waffen zu kämpfen statt mit Worten. Von Tag zu Tag wuchs seine Unzufriedenheit, weil er nicht zu glauben wagte, was er im Herzen wusste: Dass es denen mit dem Namen Hong vorherbestimmt war, den Kaiser zu stürzen. Wir sind die große Flut, sagte er sich, die das Alte hinwegspülen wird. Wir müssen uns nur trauen.
Einstweilen blieb er auf Hongkong, fand einen Freund und wartete auf seinen Mut.
2 Die große Flut im Land Sinim
Shanghai, Sommer 1860
Seit jenem Tag in Tongfu sind sieben Jahre vergangen. Die Provinzen südlich des Yangtze habe ich inzwischen ausgiebig bereist, aber auf die Frage, was China ist, wüsste ich keine Antwort außer: ein Rätsel. Manche behaupten, es gebe zwei Chinas, das nördliche und das südliche, in Wahrheit sind oft sogar die Unterschiede innerhalb einer Provinz gewaltig. Meine deutsche Heimat zerfällt in unzählige kleine Fürstentümer, aber in den Köpfen lebt die Idee eines Volkes, das sich zur Republik zusammenschließen will. China dagegen besteht seit Jahrhunderten als ein Reich, und trotzdem glaubt niemand an die Existenz eines chinesischen Volkes. Der gemeine Mann fühlt sich seiner Familie verpflichtet, seinem Clan oder Dorf, alle haben ihre eigenen Erd- und Herdgötter, und in jeder Präfektur wird ein anderer Dialekt gesprochen. Deutschland existiert als Idee, nicht als Realität, mit China ist es umgekehrt, und ich weiß nicht, was merkwürdiger ist. Mit meinem Freund Hong Jin habe ich oft darüber geredet. Er hat jedes Buch in der Bibliothek der Londoner Mission gelesen und kam zu folgendem Schluss: Völker entstehen durch Schienen und Straßen, durch Zeitungen, Telegrafen und die Post, während das Reich der Mitte auf der Unterdrückung der Menschen durch korrupte Beamte basiert. Erst müssen wir den Kaiser stürzen und die Mandarine davonjagen, folgerte er, dann können wir als ein Volk leben und frei sein. Hong Jin stammte aus einem armen Dorf im Süden und war Revolutionär durch und durch. Wenn wir uns trauen, sagte er, bestimmen wir alles selbst.
Nachdem ich zum ersten Mal von der Rebellion gehört hatte, vergingen zwei Jahre, ehe ich Hong Jin begegnete. Den Hakka-Dialekt beherrschte ich inzwischen gut genug, um mit den Bewohnern Tongfus zu reden, aber je besser wir uns verständigen konnten, desto weniger verstanden wir einander. Von einem Gemeindeleben konnte keine Rede sein. Was zu Hause ein Gottesdienst heißen würde ‒ und in meinen Berichten nach Basel auch so hieß ‒, war eine lockere Zusammenkunft, die bei gutem Wetter im Freien stattfand, bei Regen in meinem Haus. Leute kamen und gingen, knabberten Sonnenblumenkerne und schwatzten, während zu ihren Füßen halbnackte Kinder spielten. Schon auf der Missionsschule war ich ein schlechter Prediger gewesen. Erbaulich zu reden, lag mir nicht, ich glaubte an einen Gott, der kleine Kinder erblinden ließ und wieder sehend machte, wenn sie aufhörten, zu beten. Die Bewohner Tongfus mochten am liebsten Geschichten von der Sintflut, der Zerstörung Babels oder den Wunderheilungen. Lots Frau, die zur Salzsäule erstarrte, war ein Favorit. Der alte Luo saß vor mir, und manchmal ergriff er das Wort, als hätte ich die Sache zwar im Grundsatz richtig dargestellt, aber die Pointe vergessen. Einmal, als es um die Schöpfungsgeschichte ging, stand er auf und lieferte mit gewichtiger Miene den Beweis dafür, dass Gott zuerst den Mann und dann aus seiner Rippe die Frau geschaffen hatte: Alle Männer besaßen eine Rippe weniger als die Frauen. Sofort sprangen die Leute auf, betasteten sich und kamen zu dem Schluss, dass es stimmte. Jubel brach aus. Man klopfte mir auf die Schulter und begab sich auf einen Gang durchs Dorf, um die Entdeckung weiterzugeben. Kurz zuvor hatte Inspektor Josenhans in einem Brief gefragt, ob sich die Chinesen auch so schwer damit täten, den Unterschied zwischen ›gottähnlich‹ und ›gottgleich‹ zu erfassen. Er vermutete, dass es sich um ein linguistisches Problem handelte.
Am härtesten waren die Nächte. Auch im Sommer ging die Sonne zwischen sechs und sieben Uhr unter, danach erstarben alle Geräusche außer dem Quaken der Frösche im Dorfteich. Tongfu schlief, ich hockte über meinen Sprachstudien und schlug nach Moskitos. Ein junger Mann von vierundzwanzig, fünfundzwanzig, dann sechsundzwanzig Jahren. Die endlosen Nächte meiner Kindheit kehrten zurück, aber die Einsamkeit war von anderer Art. Wenn ich nicht genug Lampenöl gekauft hatte, blieben mir zu später Stunde nur noch Träume, in denen ich anderswo lebte und nicht allein war.
Über die Rebellion erfuhr ich vorerst wenig Neues. Was der alte Luo erzählte, klang nach Aufschneiderei, und die anderen Bewohner wussten nichts. Bei Besuchen in Victoria stieß ich auf vereinzelte Zeitungsartikel, die größtenteils auf Hörensagen beruhten, aber eines Tages bestätigte der North China Herald, dass Nanking gefallen war. Dem Bericht nach hatten die Rebellen eine neue Dynastie ausgerufen, die sie Taiping Tianguo nannten, das Himmlische Reich des Großen Friedens. Ihr Ziel war es, ganz China zu unterwerfen ‒ das sollte für lange Zeit alles bleiben, was die Zeitungen berichteten. Die Aufmerksamkeit der Reporter wurde in jenen Jahren größtenteils von der sogenannten Kanton-Frage beansprucht. Die Stadt lag eine Tagesreise entfernt am Ufer des Perlflusses. Vor dem Krieg, der Hongkong zur britischen Kolonie gemacht hatte, war sie das Zentrum des Opiumhandels gewesen, und dazu wollten die ausländischen Kaufleute sie auch wieder machen, aber der Gouverneur von Kanton ließ es nicht zu. Er behauptete, die Bevölkerung hasse die Fremden so sehr, dass er nicht für ihre Sicherheit garantieren könne. In der Tat musste jeder von uns, der sich aufs Festland begab, mit tätlichen Angriffen rechnen, auch ich wurde auf dem Weg nach Tongfu mehrmals von Jugendlichen verfolgt, die Steine nach mir warfen und mich als ausländischen Teufel beschimpften.