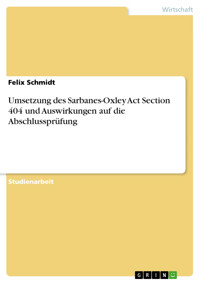12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eich, Thomas
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch spielt in deutschstämmigen Kreisen Amerikas und ist die Lebensbeschreibung einer jungen Frau, die von allen nur „Geigele“ genannt wird. Sie verfügt über besondere Gaben und besitzt eine innige Verbindung zum geistigen Reich. Ähnlich wie die großen Mystiker Emanuel Swedenborg oder Jakob Lorber hat auch Geigele Zugang zu jener Welt, die wir Menschen als Jenseits bezeichnen und die unsere eigentliche Heimat ist. Sie wird zu einer Wanderin zwischen den Reichen, besucht an der Seite eines jenseitigen Führers die unterschiedlichen Sphären und erfährt viel über die göttlichen Schöpfungsgesetze. Dieses Lebensbild einer Medialveranlagten ist ein wunderbares Zeugnis für die Einheit von Diesseits und Jenseits, für das Weiterleben nach dem Tod und für die große Weisheit, mit der der Herrgott die Schöpfung gebaut hat. Es gibt tiefe Einblicke in die geistigen Zusammenhänge des Lebens und in die diesseitigen wie jenseitigen Welten. Eine einzigartige Kostbarkeit für jeden Gottsucher.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Geigele
Lebensbild einer Medialveranlagten
Bearbeitet
von
Felix Schmidt
Eich-Verlag
Bitte respektieren Sie das Urheberrecht. Sie dürfen dieses E-Book
nicht kopieren, verbreiten, reproduzieren oder zum Verkauf anbieten.
Das betrifft sowohl kommerzielle als auch nicht-kommerzielle Zwecke.
Danke für Ihr Verständnis.
1. E-Book-Auflage 2018
© Thomas Eich-Verlag, Werlenbach 2010
Alle Rechte vorbehalten
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Umschlagfoto: © Jürgen Kramke
Umschlaggestaltung, Satz und Datenkonvertierung E-Book: Thomas Eich
Vorwort und Korrektorat 2010: Bernd Körner
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.eich-verlag.de
ISBN 978-3-940964-49-6
Gewidmet meiner
unermüdlichen
Mitarbeiterin,
meiner lieben Frau Julie
Inhalt
Vorwort zur Neuauflage 2010
Vorwort zur Erstauflage 1954
I. Geigeles Kindheit und Jugend
1. Die Familie Schreiber
2. Eine Heilung
3. Heilen verboten
4. Abschied von zwei Kindern
5. Der Spuk bei Maiers
6. Erwachen der Hellsichtigkeit Geigeles
7. Brauer Ronners Ende
8. Geigele und Fred
9. Dr. Lehmann
II. Einblicke in die jenseitigen Welten
10. An der Eingangspforte zum Jenseits
11. Im Bereich des Höllischen
12. In der Stadt der Gottlosen und Betrüger
13. Aufruhr in der Höllenstadt
14. Dirne und Hexe
15. Ein Blick ins höllische Flammenmeer
16. Vorübergehend wieder in dieser Welt
17. Auf dem Vorplatz zum Himmel
18. In den individuellen und kollektiven himmlischen Eigenwelten
19. Das Kinderreich
20. Im Weisheitshimmel
21. Der Liebehimmel
III. Geigeles letzte Lebensjahre
22. Herrn McCooks und Mutter Schreibers Heimgang
23. Das Medium von Chicago
24. Geigeles Heimkehr
Vorwort zur Neuauflage 2010
Als eine Freundin von mir vor nun 25 Jahren von einem verstorbenen Bekannten viele Bücher erbte, befand sich darunter auch ein Buch – „Geigele“ –, das mich sofort in seinen Bann zog, als ich es durchlas. Es beschrieb sehr überzeugend und faszinierend, was uns erwartet, sobald wir unseren Körper abgelegt haben und in die andere Welt hinübergewechselt sind. Ich kannte zwar schon die Bücher von Dr. Moody und Elisabeth Kübler-Ross, die in ihren Schriften viele eindeutige Beweise dafür erbracht haben, dass der Tod nicht das Ende ist. Die Lebens- und Jenseitsbeschreibung des jungen Mädchens Geigele ging jedoch noch viel weiter und erzählte sehr anschaulich von den vielen Fortschrittsstufen, die wir nach dem Tod im Jenseits zu bewältigen haben, um uns dem Himmel zu nähern und ihn endlich betreten zu dürfen. Insofern sehe ich diese Beschreibungen auch in einer Reihe mit den beiden Bänden der „Reise in die Unsterblichkeit“ von Robert James Lees.
Als ich einer interessierten Gesellschaft „Geigele“ vorstellen wollte, nahm ich beim Durcharbeiten des Buches wahr, dass das doch recht amerikanische Deutsch, in dem es geschrieben wurde, zu Verständnisschwierigkeiten führen konnte. So beschloss ich, es zu überarbeiten und in ein zeitgemäßes bzw. korrektes Deutsch zu bringen, um es anschließend neu herausbringen zu lassen.
Mit Hilfe des Eich-Verlages kann dieses Vorhaben nun realisiert werden, und somit steht einer Ausgabe in Deutschland nichts mehr im Wege. Das Buch ist 1954 in den USA in deutscher Sprache erschienen und in Deutschland auch über Antiquariate nicht mehr erhältlich. Umso mehr freue ich mich, dass eine Neuauflage nun, nach über 50 Jahren, möglich geworden ist.
So wünsche ich allen, die dieses Buch lesen, dass es ihnen über das, was uns im Jenseits erwartet, die Augen öffnet. Wie wir hier auf der Erde leben – im menschlichen Körper – bestimmt die Art unseres Lebens nach dem sogenannten Tod. Es ist viel Trost in diesem Buch, aber auch viel Klarheit darüber, dass jeder Augenblick unseres Lebens wichtig ist und wir möglichst achtsam leben sollten, um später – drüben – nichts bereuen zu müssen.
Bernd Körner, im Dezember 2009
Vorwort zur Erstauflage 1954
Dieses Buch stellt eine Zusammenfassung aller Fortsetzungen von „Geigele“, dem Lebensbild einer Medialveranlagten, dar, wie sie im Verlauf von mehreren Jahren allmonatlich in der vom unterzeichneten Bearbeiter herausgegebenen deutsch-amerikanischen Monatsschrift „Geistiges Leben“ („Spiritual Life“) erschienen sind.
Da neue Abonnenten der letzten drei Jahre nicht den Beginn des Lebensbildes nachgeliefert erhalten konnten, weil die Monatshefte der vorausgegangenen zwei Jahre schnell vergriffen waren, so wurde aus dem Kreise der Leserschaft heraus der Wunsch verlautbart, das Lebensbild im vollen Zusammenhang in Buchform erhalten zu können.
Das ist nun mit diesem Buch: „Geigele“, Lebensbild einer Medialveranlagten, zur Tatsache geworden. Im Hinblick auf das große Interesse, das „Geigele“ bereits während der Veröffentlichung in Fortsetzungen im „Geistigen Leben“ erweckte, unterliegt es keinem Zweifel, dass dieses Buch allgemeinen Beifall finden dürfte. Über die Entstehung der Aufzeichnungen, die dann vom Unterzeichneten geordnet, in logischer Reihenfolge zusammengefügt und redaktionell bearbeitet wurden, wird in den Einführungen über einen jeden der drei Teile, in die das Buch zerfällt, näher berichtet.
Gleichzeitig sei all denen aufs Allerherzlichste gedankt, die durch Sonderspenden die Herausgabe dieses Buches überhaupt erst ermöglicht haben.
Cleveland, Ohio, ausgangs 1954
Felix Schmidt
I. Teil
Geigeles Kindheit und Jugend
Das nachfolgende Lebensbild – in drei Teilen – spielt in deutschstämmigen Kreisen Amerikas. Die darinnen auftretenden Personen sind anders benannt worden. Die Handlung spielt sich hauptsächlich im oberen Mississippital ab. Die Ortschaften haben ebenfalls andere Namen erhalten, und zwar solche, die im oberen Mississippital nirgends zu finden sind, mit Ausnahme der Großstädte St. Paul und Minneapolis. Zweck aller Umbenennungen ist der, die Nachkommen der deutschstämmigen Familie, in der sich das Lebensbild „Geigeles“ abspielte, vor aufdringlichen Nachfragen zu schützen, die nicht erwünscht sind. Nur unter dieser Bedingung ist es dem Verfasser erlaubt worden, das nachfolgend Mitgeteilte zu veröffentlichen, das bei allen Lesern der deutsch-amerikanischen Monatsschrift „Geistiges Leben“ Interesse wachgerufen hat.
Felix Schmidt
1. Die Familie Schreiber
Es war ein heißer Augustnachmittag. Die Sonne brannte erbarmungslos auf das Mississippital hernieder, welches um das etwa zwanzigtausend Einwohner zählende Waterville herum von oft recht steilen, meistens mit Laubbäumen bewachsenen Hügeln umgeben ist. Auf dem breiten Mississippi fuhr ein Dampfer gemächlich stromab und begegnete einem stromauf dampfenden Schlepper, wobei sie sich gegenseitig mit Pfeifensignalen begrüßten, die über das Mississippital bei Waterville hinwegtönten und den Bewohnern des Städtchens ankündeten, dass selbst die sengende Nachmittagssonne das Leben auf dem breiten Strom nicht unterbinden konnte.
Waterville hat genau den gleichen Charakter wie alle Städtchen von derselben Größe da oben im nördlichen Teil des ausgedehnten Westens, wo sich der „Maisstaat“ Iowa mit dem „Staat der Tausend Seen“, dem Staat Minnesota, berührt und wo der Mississippi die Grenze nach dem Staat Wisconsin zu bildet. Waterville hatte, obgleich durchschnittlich nur Mittelstandsbevölkerung, doch auch eine Schicht von besonders Reichen, deren Eltern und Großeltern mit der Abflößerei der in den dichten Wäldern der oberen Nebenflüsse gefällten Baumstämme fette Gewinne erzielt, diese gut angelegt hatten und dann mit dem natürlichen Wachstum der Städte im Westen weiter hochgekommen und reich geworden waren. Das Städtchen hatte aber auch, genau wie alle anderen solcher Art, sein Armenviertel oder, wie man es hierzulande zu bezeichnen pflegt, die Gegend „jenseits der Bahngleise“ – „on the other side of the tracks“ –‚ wo diejenigen wohnen, die es trotz ehrlichster Arbeit zu nichts bringen können, weil entweder die Familie zu schnell gewachsen ist oder Krankheiten ein Hochkommen unmöglich gemacht hatten. Es gab dort „jenseits der Bahngeleise“ aber auch einige Familien, die nicht gerade im besten Ruf bei der Bevölkerung standen, doch das waren zur Ehre Watervilles immerhin nur einige vereinzelte, die sonst keine Ruhestörungen verursachten außer während gelegentlichem Betrunkensein und dann einsetzenden Schlägereien, die aber meistens von den Umwohnenden selbst geschlichtet wurden, ohne dass erst die Polizei einzuschreiten brauchte.
Eines der Häuser in der Gegend „jenseits der Bahngeleise“ stand derart nahe am Eisenbahnbett, das nicht hochgelegt war, dass jeder vorbeifahrende Zug das ganze Haus erbeben ließ, namentlich nachts, wenn zwei Expresszüge nach und von der Pazifischen Küste, ohne anzuhalten, durchdonnerten. Doch die in dem Haus Wohnenden waren so an diesen Lärm gewöhnt, dass ihnen etwas gefehlt hätte, wenn die Züge nicht mehr vorbeigefahren wären. Die Bewohner, Schreiber mit Namen, waren erst vor kurzem aus dem Staate Montana nach dem südlichen Minnesota übergesiedelt, weil es da oben in Montana zwei Jahre hindurch auf der Farm nur Missernten gegeben hatte und den Schreibers schließlich die harten Winter mit ihrer großen Kälte und die große Hitze im Sommer, die in Montana gewöhnlich im Juli und August zu verzeichnen ist, die Sehnsucht nach einer besseren Gegend wachgerufen hatten. Man verbrachte zunächst einen Winter in Norddakota. Aber da waren die Verhältnisse fast die gleichen wie in Montana, nur mit dem Unterschied, dass es dort bei großer Kälte meistens auch noch stürmisch war. Schließlich fuhr Vater Schreiber mit seiner Familie aufs Geratewohl nach dem Osten. In Minneapolis hörte er von Waterville, wo sich eine kleine Industrie zu entwickeln schien und außerdem ein Stapelplatz für die Holzfällerei war.
Die Familie Schreiber gehörte zu jenen deutschen Pionieren, die sich überall, wohin sie das Schicksal verschlägt, ihr deutsches Wesen bewahrten und danach lebten. Vor jeder Mahlzeit, vor dem Schlafengehen, nach dem Aufstehen wurde gemeinsam gebetet, und an Sonntagabenden wurden oftmals gemeinsam die hübschen deutschen Kirchenchoräle gesungen. Das Familienoberhaupt, Michael Schreiber, entstammte einer Familie, die vor über hundert Jahren aus Süddeutschland in das Wolgagebiet ausgewandert war. Dort war durch die eingewanderten Deutschen in kurzem eine blühende Landwirtschaft geschaffen worden. Als aber die Russen anfingen, den eingewanderten Deutschen das Privileg zu nehmen, nicht in der russischen Armee dienen zu müssen, setzte eine Auswanderung der Deutschen aus den russischen Kolonien nach Nordamerika, und im geringeren Maße auch nach Argentinien ein. Michael hatte nicht gleich auswandern können, als er herangewachsen war, weil er eine kranke Mutter zu unterstützen hatte. So musste er denn auch noch in der russischen Armee dienen. Doch als seine Dienstjahre um waren und er nach der Heimkehr in sein Heimatdorf erfuhr, dass seine Mutter inzwischen gestorben war, da machte er sich nachts auf und schlug sich durch bis nach Bessarabien. Dort ging er bei einem deutschen Bauern für ein Jahr in Stellung, sparte sich Geld und machte sich dann weiter auf die Reise nach Amerika. Unterwegs wurden ihm jedoch seine Ersparnisse geraubt, und er musste nochmals ein Jahr in der Batschka bei einem Bauern eine Stellung annehmen. Dort lernte er dann sein „Sophie’erl“ kennen, in das er sich verliebte und sie im Frühjahr heiratete. Darauf traten beide die Reise in die Neue Welt im Zwischendeck an, landeten in Montreal und versuchten erst eine Heimstätte in Saskatchewan zu bekommen. Das ging aber infolge irgendwelcher Umstände, die sich das junge Pärchen einfach nicht erklären konnte, nicht schnell genug, und so reiste man hinüber über die Grenze in die „Staaten“ und nahm im Staat Montana eine Heimstätte auf.
Es wurden Michael und Sophie sechs Kinder geboren, drei Söhne und drei Töchter, nämlich: Georg, Joseph, Magdalena, Margareta, Philipp und Josephine. Sie waren dreizehn, elf, acht, sechs, drei und ein Jahr alt, als die Schreiberfamilie nach Waterville kam. Michael, das Familienoberhaupt, fand gleich Beschäftigung in der Brauerei am Ort. Georg, der Älteste, hatte es schnell verstanden, sich beim Eisenbahnstationsvorsteher beliebt zu machen und hielt sich fast seine ganze freie Zeit hindurch auf der Station auf, wo er bei allen Bahnbeamten der durchfahrenden Züge schnell bekannt und bei ihnen auch beliebt wurde, weil er jederzeit zu kleinen Gefälligkeiten bereit war. Seine Sehnsucht war, später einmal Eisenbahnschaffner zu werden, weil diese eine so schmucke Mütze tragen, den Zug sozusagen kommandieren und alle Fahrgäste einem Schaffner ihre Fahrkarten vorzuweisen haben. Joseph, der Zweitälteste, war nicht an der Bahn interessiert. Er spielte oft mit dem Sohn Rudi des Nachbarn, der ein notorischer Trunkenbold war und ging oft mit in die Wirtschaft, wenn Rudi seinen Vater „abholen“ musste, was aber nicht so leicht war, da Rudi immer erst eine „Szene schauspielern“ musste, ehe er seinen Vater vom Schanktisch wegbekommen konnte. Meistens heulte Rudi dem Vater was vor, dass zu Hause irgendetwas geschehen sei oder jemand erkrankt wäre, ehe sich Rudis Vater endlich entschloss, mit Rudi und Joseph heimzugehen, die den meistens Starkbetrunkenen „stützen“ mussten, wobei die Jungen alle ihre Kräfte aufzuwenden hatten. Magdalena half der Mutter in der Küche, maßte sich aber eine herrschende Stellung an, wenn Mutter nicht da war, und tyrannisierte dann die jüngeren Geschwister. So musste die zwei Jahre jüngere Schwester Margareta dann alle die grobe Küchenarbeit machen, und Magdalena sah einfach zu und gab Befehle. Von den beiden Jüngsten, dem dreijährigen Philipp und der einjährigen Josephine, konnte aber Margareta noch keine Hilfe erwarten, da ja beide noch zu klein waren. Josephine war außerdem Mutters „Nesthäkchen“.
Und das war so gekommen. Mutter Schreiber, immer noch eine stattliche, kräftige Frau, mit hübschen, man möchte fast sagen, durchgeistigten Zügen, war von Natur aus fromm. Außerdem war sie auch mit dem „Zweiten Gesicht“ begabt. Sie konnte „Dinge vorhersehen“. Als sie ihr Jüngstes, die Josephine, erwartete, hatte sie einen seltsamen Traum. Ein Engel erschien und sagte ihr, dass ihre Frömmigkeit dem Herrgott gefalle und dass sie deswegen ein Kind gebären würde, das genau wie sie das „Zweite Gesicht“ besitzen würde. Außerdem würden durch das Kind später auch viele Menschen zu Gott geführt werden.
Nach diesem Traum betete Sophie Schreiber noch inniger dankerfüllten Herzens zu Gott. Und als dann das Kindchen geboren war, ein Mädchen, das auf den Namen Josephine getauft wurde, da bemerkte Mutter Schreiber sehr bald, dass die kleine Josephine dem entsprach, was ihr im Traum verkündet worden war. Die kleine Josephine lernte bald, wenn Mutter am Abend vor ihrer Wiege niederkniete, ebenfalls ihre Händchen zu falten und so anscheinend mitzubeten, obgleich Josephinchen anfangs sich natürlich noch nicht bewusst war, was es bedeutete. Der Mutter fiel dabei auf, dass Josephine beim Falten ihrer kleinen Händchen immer an der Wand hochsah. Dort befand sich ein Wandkalender aus einem längst vergangenen Jahr, der dort von den früheren Bewohnern zurückgelassen worden war und den die Schreibers hatten hängen lassen.
Das Bild über dem Wandkalender zeigte in der Mitte Gott auf einem Thron sitzend, umgeben von Engelchen, die alle die Geige spielten. Den Hintergrund bildeten Wolken. Die Engelchen waren, wie oft auf solchen Bildern üblich, nur mit entzückenden lockigen Kinderköpfchen abgebildet, darauf Schultern, einem Flügelpaar daran und mit Armen, mit denen sie die Geige zur Ehre Gottes spielten. Der übrige Teil der Engelkörperchen ging in die Wolkenbänke im Hintergrund über. Als die Mutter die Vorliebe ihrer Jüngsten für das Wandkalenderbild sah und Josephinchen älter geworden war, fing sie an, ihr das Bild zu erklären. Sie sagte: „Sieh, Phinchen (Abkürzung für Josephine), dort ist der liebe Gott, und um ihn herum sind alles Engerle, und sie spielen alle das Geigele.“
Seltsamerweise blieb bei Phinchen von alledem nur das Wort „Geigele“ haften. Und wenn Mutter sich über ihre Wiege beugte, um sie zu herzen und zu küssen, da richtete sich Phinchen oft auf, zeigte auf das Bild und stammelte „Geigele“. Es war das erste Wort, das Phinchen aussprechen konnte, und so vergaß man bald den Namen Josephine und nannte Phinchen fortan nur noch das Geigele.
An dem zu Beginn geschilderten Augustnachmittag saß nun Geigele im Stühlchen neben ihrem zwei Jahre älteren Brüderchen Philipp wie immer neben der Türschwelle vor dem Haus, als das Glockensignal des Abendschnellzuges vernehmbar wurde. Immer, wenn dieser am Hause von Schreibers vorbeifuhr – er fuhr dann schon langsam, weil sich bald dahinter die Station befand – sah der Lokomotivführer vom Führerstand heraus und winkte den Kindern zu.
Als jetzt das Glockensignal lauter wurde, jubelte Geigele auf, und Philipp rannte ins Haus mit den Worten: „Mutti, Mutti, ’s Zügle koamt.“
Mutter Schreiber trocknete sich schnell die Hände ab – sie hatte gerade Wäsche gewaschen und eilte vor das Haus. Schon kam der Zug an. Vom Führerstand der Lokomotive herab beugte sich der Lokomotivführer und winkte freundlich den Kindern zu. Philipp und Geigele winkten wieder, doch Mutter Schreiber war weiß im Gesicht geworden.
Sie kniete nieder, umfing die beiden Kinder mit ihren Armen und murmelte etwas vor sich hin.
„Das war Papa Krause auf der Lokomotive, Mutti“, bemerkte Philipp. „Er winkt uns immer, wenn er vorbeifährt.“
„Er hat zum letzten Mal gewinkt“, sagte da als Antwort Mutter Schreiber leise vor sich hin, die Kinder noch immer fest umschlungen haltend. Das freundliche Gesicht von Papa Krause auf dem Führerstand hatte sich für sie beim Vorbeifahren des Zuges plötzlich in einen Totenkopf verwandelt, ein sicheres Zeichen für Mutter Schreiber, dass ihm der Tod drohe!
Am nächsten Morgen durcheilte die Hiobsbotschaft Waterville, dass Lokomotivführer Krause tödlich verunglückt sei. Auf der nächsten Station habe er sich beim Abfahren zu weit aus dem Führerstand zur Seite hinausgelehnt, weil etwas an der Maschine nicht in Ordnung zu sein schien und war dabei von einem Signalmast gegen den Kopf getroffen worden, was den augenblicklichen Tod zur Folge hatte.
Wiederum hatte das „Zweite Gesicht“ Mutter Schreiber nicht getäuscht.
...
2. Eine Heilung
Es hatte sich übrigens verhältnismäßig schnell in Waterville herumgesprochen, dass Mutter Schreiber das „Zweite Gesicht“ hatte. Sie bekam deswegen öfter Besuch von solchen, die Krankheit im Hause hatten und die sonstige Sorgen drückten. Aber nicht immer war die um Rat Gefragte in der Lage, irgendeinen Aufschluss zu geben. Sie teilte das dem Besucher oder der Besucherin auch ehrlich mit. So kam es, dass man in Waterville geteilter Meinung über Mutter Schreibers hellseherische Begabung war. Die, denen Auskunft erteilt worden war, welche stimmte, schworen, dass das alles eingetroffen sei, was ihnen gesagt worden wäre. Diejenigen dagegen, die unverrichteter Sache hatten abziehen müssen, behaupteten steif und fest, die Hellseherin sei nichts wert, denn wenn jemand wirklich das „Zweite Gesicht“ besäße, so müsste eine solche Person doch immer Aufschluss geben können. Die so Urteilenden verstanden es eben nicht besser und wussten nicht, dass mit der Gabe des „Zweiten Gesichts“, wie überhaupt mit allen übersinnlichen Anlagen, auch eine gewisse Verantwortung verbunden ist, die freilich nur diejenigen intuitiv spüren, die keinen Missbrauch mit der ihnen von Gott als ein Geschenk verliehenen Gabe treiben.
Kurz nach dem geschilderten Unfall des Lokomotivführers Krause erhielt eines Nachmittags Mutter Schreiber hohen Besuch, nämlich den von Frau McCook, der Gattin des Besitzers der größten Holzflößerei am Ort. Da Magdalena noch in der Schule war und die anderen Kinder, Margaret, Philipp und Geigele draußen spielten, so war Mutter Schreiber allein im Haus.
Als sie die nach der neuesten Mode der damaligen Zeit gekleidete Dame vor sich stehen sah, wusste Mutter Schreiber gar nicht, was sie sagen und wie sie sich benehmen sollte.
„Kann ich ins Haus kommen?“, nahm da freundlich lächelnd die Besucherin das Gespräch auf, indem sie die noch immer sie anstarrende Mutter Schreiber aufs Geratewohl ansprach.
„Aber natürlich“, beeilte sich die Angeredete nun zu versichern, wobei sie, wie aus der Erstarrung erwachend, höflich zur Seite trat und Frau McCook ins Zimmer hineinließ und bat, auf einem der Stühle Platz zu nehmen, während sich Mutter Schreiber selbst ihr gegenübersetzte.
„Ich weiß nicht recht, wie ich beginnen soll“, nahm etwas verlegen Frau McCook die Unterhaltung auf. „Wie man sich in der Stadt erzählt, haben Sie die Gabe des ‚Zweiten Gesichts‘?“
„Wie man es nimmt“, entgegnete bescheiden lächelnd die Angeredete.
„Natürlich, natürlich können Sie nicht alles wissen! Das ist mir klar und …“
„Entschuldigen Sie“, unterbrach da Mutter Schreiber die Sprecherin, „das ist nicht so, wie Sie es sich denken. Ich weiß in jedem Falle sehr wohl, um was es sich handelt, doch ich darf manchmal nicht darüber reden und schweige deswegen.“
„Wer verbietet Ihnen das Reden?“
„Eigentlich niemand! Doch in manchen Fällen spüre ich, dass es das Beste für alle Beteiligten ist, nichts zu sagen, da es doch nur Unangenehmes sein würde und ich damit vielleicht Verbitterung schaffen könnte.“
„Wann wäre das zum Beispiel?“, fragte Frau McCook teils neugierig, teils ängstlich.
„Wenn ich beispielsweise gefragt werde, wo sich jetzt Verstorbene von Fragestellern befinden. Manchmal sehe ich diese glücklich und zufrieden; manchmal sehe ich sie auch bitter leiden. Und in solchen letzteren Fällen schweige ich gewöhnlich.“
„Ach so“, kam es wie eine Art von Erleichterung von den Lippen der Besucherin. „Na, wegen solcher Auskunft komme ich nicht zu Ihnen.“
„Was ist es, was Sie wissen möchten?“
„Ich habe einen Sohn von acht Jahren, der mir Sorgen macht. Er ist nicht wie andere Kinder. Er sitzt oft stundenlang da und stiert wie geistesabwesend vor sich hin. Nichts interessiert ihn. Oft bricht er in bittere Weinkrämpfe aus, worauf sich sein Zustand zu bessern scheint und er eine ganze Zeit hindurch wieder ein ganz normales Kind ist, bis plötzlich ganz unvermutet ein neuer Anfall über ihn kommt. Ich dachte, Sie könnten mir da mit Hilfe des ‚Zweiten Gesichts‘ eine Auskunft geben, was es für eine Bewandtnis mit dem Kind hat und wie ihm geholfen werden könnte. Ich will Sie auch gut bezahlen für Ihre Hilfe.“
Mutter Schreiber hatte aufmerksam zugehört, doch bei der letzten Bemerkung mit dem „guten Bezahlen“ verfinsterte sich ihre Miene wie im Unwillen und, schärfer vielleicht, als sie gewollt hatte, antwortete sie: „Bitte, meine Gabe, die mir unser Herrgott verliehen hat, ist nicht verkäuflich und käuflich. Wenn ich Ihnen helfen kann, dann tue ich das gern aus Menschenpflicht und aus keinem anderen Grund.“
Frau McCook war etwas peinlich berührt. Sie wollte einerseits nicht beleidigen, andererseits war es ihr aber auch unverständlich, warum jemand für einen Dienst, den er vielleicht leistete, nichts bezahlt haben mochte. Ihr erschien das etwas unfasslich, da sie ja schottischer Herkunft war und es in ihrer Familie stets üblich gewesen war, für geleistete Dienste Bezahlung zu nehmen und für solche auch selbst zu zahlen. Aus Angst jedoch, Mutter Schreiber vielleicht so zu kränken, dass sie sich weigern würde, ihr zu raten oder zu helfen, lenkte sie schnell ein mit den Worten: „Es lag mir vollkommen fern, liebe Frau Schreiber, Sie irgendwie beleidigen zu wollen; doch helfen Sie bitte meinem Sohn. Wenn ich von ‚bezahlen‘ sprach, so meinte ich damit nicht, dass ich Sie einfach wie einen Händler abfertige, sondern ich wollte damit nur meine Bereitschaft zeigen, Ihnen Ihre Mühe und eventuellen Kosten zu vergüten.“
„Nichts davon kommt hier in Frage“, lautete die freundliche, aber ernste Antwort. „Wenn ein Mitmensch krank ist und es liegt in der mir von unserm Herrgott verliehenen Gabe und Macht, ihm zu helfen, werde ich das ungeachtet aller Mühen als selbstverständliche Menschenpflicht tun.“
Damit erhob sich Frau Schreiber und deutete so an, dass sie bereit wäre, mit Frau McCook, die sich ebenfalls erhoben hatte, zum Kranken zu gehen.
Da jedoch vom Mitgehen bis jetzt nichts direkt gesagt worden war, so war Frau McCook über das plötzliche Aufstehen von Frau Schreiber etwas erstaunt und dachte, sie wolle damit andeuten, dass sie den Besuch als erledigt betrachtete. Die Besucherin blieb daher unentschlossen stehen, da sie ja noch nicht wusste, ob ihrem Sohn geholfen werden würde oder nicht. Frau Schreiber wiederum konnte sich das einfache Stehenbleiben der Besucherin im Zimmer auch nicht erklären. Da fiel ihr plötzlich Geigele ein, das sie nicht gern völlig der Obhut der beiden nur wenige Jahre älteren Geschwister anvertrauen wollte. Sie bemerkte daher, wie entschuldigend: „Verzeihen Sie, Frau McCook, Sie haben wohl nichts dagegen, wenn ich mein jüngstes Kind mitnehme. Es ist ja nicht so sehr weit zu Ihnen, wenn wir weiter unten über die Bahngleise gehen.“
„Oh, Sie wollen mit mir mitkommen, Frau Schreiber!“, kam es da wie eine Erlösung von Frau McCooks Lippen.
„Aber natürlich, deswegen stand ich ja auf. Ich muss doch den Jungen erst mal sehen.“
Nur zu gern war die Besucherin nun zum Fortgehen bereit. Sie versicherte, dass sie ganz und gar nichts dagegen hatte, Geigele mitzunehmen. So hob Frau Schreiber Geigele auf den Arm, das ihr Püppchen an sich drückte, und nahm sie mit.
Unterwegs fiel Frau McCook das primitive Püppchen von Geigele auf, und sie gelobte sich, wenn ihrem Sohn geholfen würde, ein anderes Püppchen zu kaufen. Geigele liebte nun aber gerade dieses Püppchen, weil es ihre Mutti für sie aus Stoffresten gemacht hatte. Die Augen waren zwei schwarze Knöpfe, der Mund und die Nase waren zwei schwarze Garnlinien, und die Ohren waren zwei angenähte Flicken.
Die McCooks bewohnten ein elegantes 14-Zimmer-Haus, das mitten in einem ausgedehnten Garten lag, der von einem eisernen Geländerzaun umgeben war, so, wie man zur damaligen Zeit die großen Besitztümer zu umzäunen pflegte.
Beim Öffnen der Gartentür kam ihnen ein großer Schäferhund bellend, aber schweifwedelnd entgegengesprungen.
„Sei still, Pluto!“, befahl Frau McCook dem Hund, der immer noch schwanzwedelnd die fremden Besucher umsprang.
Geigele, das keinerlei Angst vor dem großen Hund hatte, schien Pluto gleich ganz besonders ins Herz geschlossen zu haben, denn er trabte neben Frau Schreiber her und blickte immer nur zu Geigele hoch.
Man ging durch mehrere Zimmer bis in einen saalartigen Vorderraum, wo vor dem Fenster ein Lehnstuhl stand, in dem ein hübscher, achtjähriger Junge apathisch vor sich hinstarrend ruhte. Auch als Pluto, der mit hereingekommen war, seine Hände leckte, änderte der Junge nicht seine Stellung.
Mutter Schreiber nahm Geigele vom Arm und setzte sich dem Jungen gegenüber, während Frau McCook sich neben sie stellte und gespannt auf das wartete, was kommen würde. Aber es geschah vorläufig nichts. Geigele drückte sich an ihre Mutter und sah interessiert zu dem Jungen hinauf, während Pluto versuchte, Geigeles Händchen und Gesicht zu lecken.
Nach längerem Schweigen bemerkte Mutter Schreiber, sich wie im Halbschlaf an Frau McCook wendend:
„Ihr Sohn wird geheilt werden.“
Dann schwieg sie aber plötzlich, obgleich ihr Mund noch halb geöffnet war, als ob sie noch mehr hätte sagen wollen, doch es kam kein Wort mehr über ihre Lippen.
Frau McCook, so hocherfreut sie über das Gehörte war, konnte das weitere Schweigen nicht verstehen, zumal sie bemerkt hatte, dass Frau Schreiber anfänglich noch hatte weitersprechen wollen, dann aber wie auf Kommando schwieg.
Sie wartete, bis Frau Schreiber wieder vollkommen bei sich war und drückte ihr dann dankbar die Hand mit den Worten: „Vielen innigen Dank für den Trost, den Sie mir geben! Sie ahnen ja gar nicht, welche Freude Sie mir damit bereiten.“
Sie schwieg darauf und hoffte, dass nun Frau Schreiber etwas sagen würde. Als das aber nicht geschah, setzte sie hinzu: „Können Sie sehen, was wir, das heißt mein lieber Mann und ich, tun müssen, um den Zustand unseres Sohnes zu bessern?“
Doch ehe Frau Schreiber antworten konnte, bewegte sich der Sohn im Lehnstuhl, war plötzlich wach und streckte seine Hände nach der Mutter aus, die schnell zu ihm eilte und ihre Arme um ihn schlang.
„Fred, mein lieber Fred, oh wie freue ich mich!“, jubelte sie, während sie ihren Sohn noch fester an sich drückte. Dieser bemerkte jetzt Frau Schreiber und sah diese neugierig an.
„Oh, Fred“, versuchte die Mutter aufzuklären, „diese gute Frau kann in die Zukunft sehen und hat gesagt, dass alles noch gut mit dir werden würde.“
„Ich weiß das jetzt auch“, bemerkte zum höchsten Erstaunen der Mutter der Junge. „Weißt du, ich habe einen merkwürdigen Traum gehabt. Ich träumte, eine Frau – es war die da –“, wobei er auf Frau Schreiber deutete, „würde ins Haus kommen und noch jemanden mitbringen, der mir Heilung gibt.“
Nach diesen Worten richtete sich Fred hoch und sah sich um. Da bemerkte er das sich ganz an das Kleid der Mutter anschmiegende Geigele, sprang auf und rief: „Da, die da, das Mädchen ist es, das mich heilen wird!“
Damit bückte er sich zu Geigele, die ihm erstaunt, aber furchtlos entgegensah und sich ruhig von ihm umarmen und küssen ließ, wobei sie wie beglückt lächelte.
Frau McCook und auch Frau Schreiber sahen ruhig, wenn auch etwas erstaunt, dieser überraschenden Szene zu.
Plötzlich wandte sich Fred bettelnd an seine Mutter: „Kann das Mädchen nicht hier bei uns bleiben?“
Frau McCook sah Frau Schreiber an, und da sie bei ihr keine zusagende Geste bemerkte, so antwortete sie dem Fragenden zögernd: „Ich glaube, das wird wohl nicht gehen. Sieh mal, was würdest du wohl dazu sagen, wenn jetzt ein Fremder kommen und sagen würde: ‚Fred, du kommst nun zu uns‘. Würde dir das gefallen?“
„Nein“, antwortete zögernd und enttäuscht der Gefragte.
„Siehst du, so will auch das Mädelchen – ihr Name ist Geigele – bei seiner Mutter bleiben. Nicht wahr, Geigele?“
Damit beugte sich Frau McCook zu Geigele, das verlegen den Finger in den Mund gesteckt hatte, während sie in der andern Hand ihr Püppchen hielt, wobei sie sich ganz an ihre Mutter anschmiegte.
Geigele blieb stumm, nickte auch nicht. Deswegen ergriff ihre Mutter das Wort: „Warum kann denn es nicht so gemacht werden, dass Fred uns ab und zu besucht. Da kann er mit Geigele spielen.“
„Oder“, fiel da Frau McCook ein, „warum kann denn Geigele nicht zu uns herübergebracht werden und hier im Garten mit Fred spielen? Hier sind die Kinder keinerlei Gefahren ausgesetzt, und der Hund bewacht sie außerdem.“
„Na, überlassen wir es der Zeit“, wehrte Mutter Schreiber ab, ohne weder zuzustimmen noch abzulehnen.
Beim Fortgehen wollte Frau McCook den Scheidenden Gebäck mitgeben, doch auch das wurde sanft abgewehrt: „Ich verstehe Ihre Gefühle, Frau McCook, doch bitte, auch keine Geschenke!“
Frau McCook gab nach; aber da fiel ihr plötzlich noch ein: „Können Sie mir nicht sagen, was ich tun soll, wenn sich die Anfälle bei Fred wieder einstellen?“
„Zunächst nichts weiter als innig zu Gott beten. Was später getan werden kann, vermag ich augenblicklich noch nicht zu sagen.“
3. Heilen verboten
Von da ab verging kein Tag, an dem nicht Fred herüberkam, um Geigele zu sehen und mit ihr und ihrem Bruder Philipp zusammen zu spielen. Öfter brachte er auch seine eigenen Spielsachen mit. Anfänglich kam die Mutter mit, die sich ruhig ins Gras setzte und den Kindern zusah, wenn Frau Schreiber nicht zu Hause war. Manchmal kam auch nur das Hausmädchen von McCooks mit. Nur selten ging Mutter Schreiber mit Geigele zu McCooks hinüber, wo beide auch von Herrn McCook freundlichst willkommen geheißen wurden. Doch es war nicht oft der Fall, dass man McCooks besuchte. Und das hatte seinen Grund, der nur Mutter Schreiber bekannt war.
Was Mutter Schreiber beim ersten Besuch sah, hatte sie für sich behalten, diente ihr aber als Richtschnur. Sie hatte nämlich gesehen, dass irgendein Zusammenhang zwischen der seltsamen Krankheit Freds und ihrem Geigele bestanden hatte. Ferner hatte sie auch gesehen, dass Fred wohl ganz geheilt werden, aber jung sterben würde, und zwar eines gewaltsamen Todes. Daher ihr Schweigen, denn die mit ihrer Gabe gleichzeitig stets auftretende innere Eingebung hatte ihr den Mund verschlossen, der Mutter Freds mehr zu sagen.
Das „Gesicht“ bezüglich Freds war leider nicht bis in alle Einzelheiten deutlich gewesen. Daher war Mutter Schreiber vorsichtig beim Umgang Geigeles mit Fred. Sie wollte nicht gern ihr eigenes Kind mit ihm zusammen gefährdet sehen. Und bisher hatte sie keine weiteren erklärenden „Gesichte“ bezüglich Freds gehabt. Soviel ließ sich nur feststellen, dass dieser durch das Spielen und Zusammensein mit Geigele ganz anders geworden war. Seine Anfälle wurden immer seltener und traten eigentlich nur auf, wenn er infolge schlechter Witterung mehrere Tage hindurch nicht mit Geigele hatte zusammensein können. Es war, als ob von Geigele eine geheimnisvolle Heilkraft ausströmte.
Und allmählich ging auch mit Geigele eine Veränderung vor sich. Wenn es längere Zeit mit Fred nicht zusammen war, büßte das Kind an Lebhaftigkeit ein. Das war es, was Mutter Schreiber ganz besondere Sorgen bereitete. Sie wusste durch ihre mediale Begabung, dass es Menschen gibt, die andern Menschen Lebenskraft rauben, ohne es zu wissen. Allerdings schien das zwischen Fred und Geigele nicht so sehr ein Rauben zu sein, als ein verstärkter gegenseitiger Lebensstromaustausch, der beim längeren Nichtzusammenkommen eben einfach unterbrochen war.
Freds schneller Heilungsprozess sprach sich durch die Familie McCook natürlich auch in den „besseren Kreisen“ von Waterville herum. Die McCooks hatten ja alle Ärzte nicht nur Watervilles, sondern auch aus der Umgebung wegen des Zustandes ihres Sohnes befragt, ohne dass nur ein einziger Arzt wirklich richtigen Aufschluss hätte geben können. Die Gesundung Freds nach dem Besuch von Mutter Schreiber rief daher umso größere Aufmerksamkeit hervor. Mutter Schreiber erhielt jetzt auch Besuch von außerhalb und wurde besonders bei unheilbaren Krankheiten viel um Rat gefragt. Intuitiv fragte sie aber in jedem Fall immer erst, ob der Patient in ärztlicher Behandlung sei und bei wem. Aus einfachem Anstands- und Taktgefühl riet Mutter Schreiber dann immer jeder sie um Rat aufsuchenden Person, den Arzt weiter zu behalten und auch seinem Rat zu folgen. Sie selbst heilte nur mit Gebet und Handauflegen, und ließ sich von den Kranken versprechen, nicht mehr bewusst zu sündigen, wenn sie gesund werden wollten. Die, welche ihr Versprechen ernst nahmen, gesundeten auch, oft in den schwierigsten Krankheitsfällen. Das erregte schließlich die Aufmerksamkeit der gesamten Ärzteschaft. Doch da Mutter Schreiber niemals etwas für ihre Ratschläge an Vergütung forderte, nicht mit Medikamenten irgendwelcher Art oder gar Patentmedizinen heilte und auch nie abriet, weiter zu dem Arzt zu gehen, den ein Patient gerade hatte, so konnte die Ärzteschaft nichts gegen sie unternehmen oder es ihr verbieten, für Kranke zu beten, um solche zu heilen.
Eines Tages wurde Vater Schreiber bei der Arbeit aufgefordert, zu seinem Arbeitgeber, dem Brauer Ronner, ins Privatbüro zu kommen. Der so Gerufene konnte sich diese Ehre nicht erklären.
„Mein lieber Herr Schreiber“, begann nach Betreten des Privatbüros der Brauereibesitzer den verschüchterten Schreiber anzureden. „Ich höre da ja ganz seltsame Dinge von Ihrer Frau. Sie soll allerhand Kranke heilen können. Stimmt das?“
„Ja, Herr Ronner“, antwortete Vater Schreiber, verlegen seine Mütze in den Händen drehend.
„Na, dann sagen Sie Ihrer Frau, sie soll das von nun an sein lassen“, donnerte Ronner plötzlich den völlig verdutzten Schreiber an, der nur stammelnd fragen konnte: „Warum denn aber?“
„Warum? Und da fragen Sie noch? Weil es natürlich Unsinn ist! Kürzlich erst hatte ich eine Abendgesellschaft, zu der mehrere Ärzte geladen waren, und diese erzählten mir, dass die Frau eines in meiner Brauerei arbeitenden Angestellten den Ärzten hier arge Konkurrenz mache. Die Besucher baten mich, etwas dagegen zu tun. Und ich werde etwas dagegen tun.“ Hierbei schlug Ronner mit der Faust auf den Tisch! „Sagen Sie Ihrer Frau, sie soll mit dem Mumpitz aufhören und das Heilen den Ärzten überlassen, die diesen Beruf gelernt haben, verstanden?“
„Ja, aber warum denn, warum denn?“, stammelte Vater Schreiber erneut, der das nicht begreifen konnte.
„Warum, warum? Das ist alles, was ich von Ihnen höre! Mag sein“, und er mäßigte damit seine erregte Redeweise, „dass Sie als ehemaliger Farmer nicht wissen, was Ihre Frau mit ihrem Heilblödsinn in Wirklichkeit anstellt. Also erstens, es gibt kein Heilen durch Gebet! Wenn ich mir den Arm gebrochen habe, so brauche ich einen Arzt, der mir den Arm zurechtsetzt und kein Gebete murmelndes ‚olles Weib‘! Zweitens haben die Ärzte, die sich irgendwo für ärztliche Praxis niederlassen, viele Jahre studiert, ehe sie als Ärzte zum Praktizieren zugelassen werden. Sie wissen also immer, was sie in Krankheitsfällen zu tun haben. Und drittens hat es viel, oft sehr viel Geld gekostet, ehe sie ihre ärztlichen Studien beenden konnten, und dann haben sie auch ein Recht, sich durch ihren Beruf einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und diesen nimmt Ihre Frau mit ihrer Gesundbeterei nun den Ärzten fort! Dämmert’s jetzt?“
„Meine Frau sagt doch aber immer allen, sie sollen bei ihren Ärzten bleiben und nimmt keinem Arzt das Honorar fort, denn sie nimmt niemals etwas für ihre Dienste! Ich verstehe das Ganze nicht.“
„Da muss ich es Ihnen eben noch klarer machen“, erhob Ronner jetzt wieder seine Stimme. „Wenn Sie es durchaus nicht begreifen können, dann suchen Sie sich woanders eine Stellung, und bis Sie eine gefunden haben, werden Sie genug Zeit zum Nachdenken gefunden haben. Verstehen Sie jetzt? Ihre Frau hört sofort mit ihrem Gesundbetereiblödsinn auf oder aber Sie hören auf, bei mir zu arbeiten. Das ist alles, und jetzt machen Sie, dass Sie hinauskommen.“
Vater Schreiber hatte noch immer nicht alles voll begriffen. Kopfschüttelnd entfernte er sich und grübelte auf dem Nachhausewege vor sich hin, was er tun sollte. Jetzt merkte er erst, was es heißt, im Angestelltenverhältnis zu stehen. Vorher als Farmer hatte er wohl manchmal sehr, sehr schwere Zeiten durchgemacht, doch er war sein eigener Herr gewesen und hatte sich nichts gefallen lassen müssen. Nun war alles anders!
Als er zu Hause sein Erlebnis am Abendtisch mitgeteilt hatte, herrschte zuerst allgemeines Schweigen, und jeder sah zu Mutter Schreiber hin. Nach einer Weile sagte diese ruhig: „Vater, du gehst morgen zu Ronner und sagst ihm, dass deine Frau nicht mehr heilen würde.“
„Nein, das tue ich nicht“, begehrte Vater Schreiber auf. „Du tust niemandem Unrecht, und außerdem hast du die Gabe zum Heilen von Gott. Und niemand kann uns etwas verbieten, was uns Gott zu tun beauftragt hat.“
„Du hast recht, Vater,“ besänftigte Mutter Schreiber; „aber eine innere Stimme sagt mir, dass es das Beste ist, was ich dir rate. Du gehst morgen zu Ronner und sagst ihm, dass deine Frau das Heilen aufgibt.“
Die am Tisch sitzenden Kinder hatten ruhig zugehört. Nun mischte sich der Älteste, Georg, ein: „Mutter, du brauchst keine Angst zu haben. Vater bekommt jederzeit eine Stelle bei der Bahn. Du weißt, McAllister, der Stationsvorsteher, kann mich gut leiden. Er würde sofort Vater eine Stelle geben.“
„Und ich“, bemerkte Magdalena, „kann schon irgendwo im Haushalt aushelfen, wenn es sein muss.“
Vater und Mutter Schreiber sahen sich erfreut an, als die Kinder sich so hilfsbereit zeigten; doch Mutter Schreiber blieb bei dem, was sie gesagt hatte: „Es ist lieb von euch, Kinder, dass ihr uns alle helfen wollt, doch Vater geht morgen zu Herrn Ronner und sagt, was ich ihm mitgeteilt habe. Ich fühle, es ist so das Beste, und wir brauchen auch noch den Verdienst, denn ihr seid noch nicht groß genug, um die Last auf euch zu nehmen, auch noch uns Erwachsene miternähren zu müssen.“
„Übrigens“, fiel da Georg wieder ins Wort, „habt Ihr, Vater und Mutter, etwas dagegen, wenn ich als Hilfsschaffner mit dem Nachmittagsgüterzug bis nach Corellville mitfahre und dann von dort noch denselben Abend mit dem hierher kommenden Güterzug als Hilfsschaffner zurückkehre? Ich kann so die Woche fünf Dollar verdienen und lerne schon alles, was ein Schaffner für einen Schnellzug wissen muss; man will mich anlernen.“
Die Eltern nickten sich lächelnd zu; wussten sie doch, dass es Georgs Herzenswunsch war, einmal Schaffner auf dem Schnellzug zu werden.
„Wenn du uns versprichst, stets vorsichtig zu sein, haben wir nichts dagegen“, antwortete Vater Schreiber, was einen Jubelruf bei Georg auslöste.
Des Brauers Ronner Gesicht glänzte vor gesättigter Zufriedenheit, als ihm am nächsten Morgen sein Angestellter Schreiber mitteilte, dass seine Frau nicht mehr heilen würde. „Da ist es also doch möglich, in den Dickschädel eines Farmers Vernunft zu bringen! Hier, nehmen Sie sich eine Zigarre“, womit Ronner seinem Arbeiter Schreiber jovial eine seiner besten anbot. Dieser lehnte jedoch zum höchsten Erstaunen mit der Bemerkung ab: „Der Farmerdickschädel ist noch immer derselbe, und wenn ich nicht will, will ich nicht! Doch meine Frau selbst hat erklärt, dass sie nicht mehr heilen würde. Das ist der Grund; Ihre angeblichen Vernunftgründe jedoch waren es nicht!“ Damit ging Schreiber stolz erhobenen Hauptes aus dem Privatbüro Ronners. Er hörte nicht mehr, was dieser ihm wegen seiner Bemerkung noch nachrief.
Mutter Schreiber lehnte von jetzt ab alle Fälle ab, in denen man sie um Hilfe bei Krankheitsfällen anging. Sie war taktvoll und sagte nicht den wahren Grund, sondern gab als Erklärung nur an, dass sie unerklärlicherweise die Gabe zum Heilen verloren habe. Der Besuch bei ihr ließ nach. Doch irgendwie – wahrscheinlich durch die Arbeiter in der Brauerei – musste es sich herumgesprochen haben, dass der Brauer Ronner etwas damit zu tun hatte, dass Mutter Schreiber nicht mehr heilen wolle.
So vergingen Monate, und nichts Besonderes ereignete sich. Fred kam regelmäßig, wenn immer das Wetter es erlaubte, sein Geigele besuchen, brachte Bilderbücher und anderes Spielzeug mit, und da meistens der nur zwei Jahre ältere Bruder Geigeles, Philipp, zu Hause war, so spielten die drei gemeinsam. Nie gab es Zank oder Streit zwischen den drei Kindern. Geigele und Philipp überließen Fred gern die Leitung bei allem.
Fred hatte seine Anfälle fast überhaupt nicht mehr. Niemals hatten die Ärzte feststellen können, was ihm eigentlich gefehlt hatte. Mutter Schreiber ahnte es, sagte aber nie etwas darüber. Sie glaubte, dass es sich bei Fred um eine Art von Besessenheit gehandelt hatte, und dass ihr Geigele die Anlage und Gabe hatte, die oder das Wesen, das zeitweise Besitz von Fred nahm, zu vertreiben. Daher auch der merkwürdige Lebenskraftaustausch zwischen den beiden Kindern. Warum das so war, konnte sich Mutter Schreiber trotz ihres „Zweiten Gesichts“ aber nicht erklären.
Da, an einem bitterkalten Februarabend, der einen blizzardartigen Schneefall mit sich brachte, hielt ein Schlitten vor Schreibers Haustür. Auf das kräftige „Herein“ Vater Schreibers trat ein Besucher in das von einer Petroleumlampe matt erleuchtete bescheidene Heim und nahm gleich neben dem offenen Feuerherd Platz, wo mehrere Holzstücke eine angenehme Wärme verbreiteten.
„Mein Name ist Knorr, Dr. Knorr“, stellte er sich vor. „Ich komme aus Corellville – trotz des Hundewetters – und wollte Ihre Hilfe, Frau Schreiber, in Anspruch nehmen. Der Sohn von Richter John ist schwer erkrankt, und ich kann nicht recht herausfinden, was ihm fehlt; aber er siecht langsam hin, und ich kann nichts tun. Da hat mich der Vater beauftragt, Sie, Frau Schreiber, um Rat zu fragen. Er wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie helfen würden.“
„Ich habe versprochen, nicht mehr zu heilen“, bemerkte ruhig Mutter Schreiber.
„So, wem denn?“
„Brauer Ronner.“
„Und warum?“
„Er forderte es und wollte meinen Mann entlassen, wenn ich weiter heilen würde.“
„Ist das so! Na, das überlassen Sie mal mir und Richter John!“
„Sie täuschen sich, Herr Doktor. Wenn unsereins sein Wort gibt, hält man es auch!“
„Aber was soll ich denn dann tun? Oder Richter John?“
„Das ist Ihre Sache! Sie wissen ja, warum ich nicht mehr heile.“
Nach kurzem Nachdenken antwortete Dr. Knorr, wie vor sich hin hinredend:
„Ich verstehe! Doch sagen Sie mal, liebe Frau Schreiber, würden Sie wieder heilen, wenn Brauer Ronner Sie von Ihrem Versprechen entbindet?“
Mutter Schreibers Antlitz verklärte sich förmlich, als sie versicherte: „Gewiss!“
„Gut, dann komme ich morgen wieder.“
„Wohin wollen Sie denn jetzt bei dem schlimmen Wetter“, mischte sich Vater Schreiber ein.
„Einen freundschaftlichen Besuch beim Brauer Ronner will ich machen und dabei gleichzeitig auch bei ihm übernachten. Gute Nacht!“
Und richtig, am nächsten Mittag kam Dr. Knorr wieder und legte Mutter Schreiber einen Zettel vor, auf dem Brauer Ronner eigenhändig geschrieben hatte, dass er Frau Schreiber ihres Versprechens entbinde.
Nun setzte sich Mutter Schreiber hin und verfiel in eine Art von Trance. Es gelang ihr nicht so leicht, den Fall des Sohnes des Richters John richtig zu erkennen. Sie war aus der Übung heraus, weil sie lange nicht mehr geheilt hatte. Doch plötzlich schien sie Kontakt zu haben: „Sagen Sie dem Vater, Herr Doktor, dass er sich nicht zu sorgen brauche. Sein Sohn benötigt vor allem Ruhe; er soll viel Wasser trinken. Aber die Eltern müssen oft gemeinsam für ihren Sohn beten.“
Dann brach Mutter Schreiber ab, doch man merkte, dass sie noch etwas hatte zusetzen wollen. Auch Dr. Knorr bemerkte das und ermutigte dazu mit den Worten: „Immer heraus mit der Sprache, wenn Sie noch was sagen wollen!“
„Ja, aber der Richter mag das nicht gern haben.“
„Sie sagen es ja mir!“
Nach einer Weile des Zögerns setzte Mutter Schreiber hinzu: „Und sagen Sie dem Herrn Richter, dass er die Politik aufgeben und sich wieder dem Anwaltsberuf widmen solle!“
„Warum denn das? Und was hat denn das mit dem Gesundwerden des Sohnes zu tun?“
„Sehr viel! Der Richter ist in seinem Amt parteilich. Und das fällt auf seinen Sohn, der infolge einer besonderen Veranlagung immer für die Sünden seines Vaters gleich büßen muss.“
„Das verstehe, wer will“, murmelte Dr. Knorr, etwas enttäuscht über die letzte Mitteilung, die er für glatten Blödsinn hielt, vor sich hin. Er bedankte sich jedoch höflich, fragte, was er schuldig sei, und bedankte sich nochmals, als er erfuhr, dass man kein Geld annehmen wolle.
Da es Richter John nicht einfiel, die Politik aufzugeben, so half auch Mutter Schreibers Ratschlag nicht viel. Drei Monate später starb der Sohn von Richter John. Kein Arzt hatte ihm helfen können.
In seinem Schmerz suchte Richter John nach einem Schuldigen für den schweren Verlust, den er durch den Tod seines Sohnes erlitten hatte und schrieb an Brauer Ronner, dass er glaube, er hätte damals sehr weise gehandelt, als er der Frau seines Angestellten das Heilen verboten hatte. Das war Wasser auf die Mühle des Brauers. Er erkundigte sich, ob Mutter Schreiber weiter heile, und als er erfuhr, dass das geschehe, seit er den Brief dem Dr. Knorr gegeben hatte, ließ er erneut Vater Schreiber zu sich ins Büro kommen und eröffnete ihm:
„Herr Schreiber, Ihre Frau heilt weiter und kümmert sich nicht um ihr gegebenes Wort. Sie sind entlassen!“
„Aber, Herr Ronner“, stammelte Vater Schreiber ganz erschrocken, „Sie haben es doch sogar schriftlich erlaubt, dass meine Frau wieder heilen könne.“
„Nichts dergleichen! Die Erlaubnis galt nur für den Fall John. Und wie Sie ja selbst wissen, hat das Heilen Ihrer Frau dort nichts geholfen. Da sie trotzdem weiterheilt, so haben Sie sich die Folgen selbst zuzuschreiben. Lassen Sie sich auszahlen, was Sie zu bekommen haben, und dann lassen Sie sich hier nicht mehr sehen.“
Vater Schreiber tat, wie ihm geheißen.
Auf dem Nachhausewege ging er wie betäubt die Straße entlang. Mit seinem Kummer beschäftigt, sah er nicht Herrn McCook vorbeigehen, bis dieser ihn ansprach: „Nanu, Vater Schreiber, was ist denn mit Ihnen los?“
Der Gefragte schilderte sein Missgeschick.
Herr McCook hörte Vater Schreiber ruhig zu und sagte dann tröstend: „Vielleicht ist das zum Besten für Sie. Wären Sie bereit, für mich zu arbeiten?“
„Aber gewiss“, jubelte Vater Schreiber auf.
„Nun, dann vergessen Sie nur Ihren Kummer. Nächsten Montag können Sie unten an der Levee des Flusses anfangen, Schiffe auszuladen. Ich gebe Ihnen noch etwas mehr als Sie in der Brauerei hatten. Zufrieden?“
„Und ob.“
Freudig schlug er zustimmend in die dargebotene Hand von Herrn McCook.
Leicht beschwingten Herzens machte sich Vater Schreiber auf den Heimweg. Da sah er von fern seine Frau auf sich zueilen, lebhaft mit den Armen wie abwehrend winkend. Er dachte, sie habe vielleicht auch schon die frohe Nachricht von seiner neuen Stelle gehört und winkte freudig zurück. Als er dabei ein nach der Brauerei abbiegendes Seitengleis überschritt, kam gerade ein Güterwagen leise angerollt, dessen Kupplung gerissen war, erfasste Vater Schreiber, warf ihn aufs Geleis nieder und zermalmte ihn. Ohne einen Laut ausgestoßen zu haben, ging Vater Schreiber hinüber in die Ewigkeit.
4. Abschied von zwei Kindern
Mutter Schreiber war ihrem Mann entgegengeeilt, weil sie von einer furchtbaren inneren Angst getrieben worden war. Sie hatte das Gefühl, ihm drohe eine große Gefahr. Sie wusste nicht, welcher Art die Gefahr sein könne, und hatte deswegen, als sie ihren Mann fröhlich die Straße heraufkommen sah, das instinktive Gefühl gehabt, dass er stehen bleiben solle, bis sie bei ihm sein könnte. Ihr Mann hatte das Winken aber nicht verstanden und war dadurch sogar von der unmittelbaren Umgebung abgelenkt worden, so dass er sich beim Kreuzen der Schienen zu den Industrieanlagen nicht umgesehen hatte, wie er es sonst stets tat.
Mutter Schreiber brach an der Leiche zusammen und musste in der Ambulanz nach Hause gebracht werden. Die Leiche von Vater Schreiber wurde zum Leichenbestatter geschafft. Frau McCook eilte gleich, als sie von dem Unglück hörte, zu Schreibers und nahm Geigele und Philipp in ihr Haus, wo diese durch Spielen mit Fred bald von dem Geschehnis abgelenkt wurden. Frau Schreiber brauchte jedoch Pflege. Frau McCook ließ deswegen eine Krankenschwester kommen, während Magdalena und Margarete den Haushalt besorgten.
Am Tag der Beisetzung hatte sich Mutter Schreiber wieder so weit erholt, dass sie an der Trauerfeier beim Leichenbestatter teilnehmen konnte. Pastor Knecht von der deutsch-evangelischen Kirche hielt die Trauerrede. Dann wurde die Leiche nach dem Friedhof zur Beisetzung hinausgefahren. Mutter Schreiber war noch zu schwach, um mitzufahren. So nahmen an der kurzen Feier auf dem Friedhof nur die vier ältesten Kinder teil: Georg, Joseph, Magdalena und Margarete; ferner waren Herr McCook und frühere Kollegen des Verstorbenen aus der Brauerei zugegen.
Nun begann eine ernste Zeit für Mutter Schreiber und die Kinder, obgleich ihnen manche Hilfe zuteil wurde. So konnte Magdalena im Haushalt von Familie McCook helfen; Margarete besorgte Auslieferungsgänge für den Händler an der Ecke an dessen Kundschaft; Joseph verkaufte Zeitungen, und Georg arbeitete an der Eisenbahn. Die Kinder brachten ihre Verdienste nach Hause. Mutter Schreiber nahm davon nur das Allernötigste für den Haushalt. Den Rest legte sie heimlich und ohne Wissen der Kinder in Sparguthaben für jedes einzelne an, das verdiente. Es waren nur immer kleine Einzahlungen, die gemacht werden konnten, ergaben aber mit der Zeit doch Spargroschen. Mutter Schreiber selbst ging täglich als Waschfrau aus und verdiente den Hauptlebensunterhalt für die Familie. Geigele und Philipp verbrachten deswegen die meiste Zeit im Haus von McCook – zur Freude von Fred, der von seinem Leiden ganz geheilt zu sein schien und ein wundervoller Spielkamerad für die beiden Schreiberkinder war. Erst spät am Nachmittag, wenn Mutter Schreiber von der Arbeit heimgekommen war, holte sie sich ihre Kinder wieder. Da Mutter Schreiber von fast überall her, wo sie den Tag über gerade gearbeitet hatte, Lebensmittel nach Hause mitbekam – Fleischwaren und Gemüse waren zur damaligen Zeit in kleineren Ortschaften im Mittelwesten spottbillig – so blieb der Familie wirkliche Not erspart.
Die schönsten Stunden für Mutter Schreiber waren die Abendstunden, wenn sie mit Geigele und Philipp zusammen auf der Schwelle vor ihrem kleinen Häuschen saß und sich den beiden Jüngsten widmen konnte. Und die hatten meistens sehr viel zu erzählen, was sie am Tag alles mit Fred erlebt und von diesem gelernt hatten. Besonders Philipp, ein kräftiger, sonst aber stiller und etwas schwerfällig veranlagter Junge, sah in Fred beinahe einen kleinen Gott und verehrte ihn auch wie einen solchen. Geigele dagegen liebte Fred so, wie eben Kinder einander liebgewinnen. Konnte sie aber einmal für einen oder gar zwei Tage mit Fred nicht zusammen sein, so weinte Geigele, wurde traurig und konnte nicht recht essen. Ebenso erging es jedoch auch Fred. Er vermisste Geigele ebenfalls sehr. Sah er sie nicht täglich, so kam es ihm so vor, als ob ihn eine Krankheit beschleichen würde.
Drei Jahre gingen so dahin. Die Kinder wurden größer und selbständiger. Georg, der Älteste, war jetzt achtzehn Jahre alt, bereits als Hilfsschaffner auf Personenzügen angestellt und konnte so seiner Mutter mit seinem Verdienst gut aushelfen. Er wusste nicht, dass der größte Teil davon immer weiter auf sein Sparkonto ging. Magdalena war zwar immer noch in Stellung bei McCooks, doch waren diese nicht mehr recht zufrieden mit ihr, da sie manchmal sehr schnippisch war und naseweise Bemerkungen machte. Sie wurde zwar freundlich zurechtgewiesen, doch das half nicht viel, so dass Frau McCook schließlich, so leid ihr das tat, Mutter Schreiber davon in Kenntnis setzen musste. Das machte Magdalena aber nur noch störrischer, und sie drohte Frau McCook, wenn diese ihr wieder mal was sagte, einfach: „Sie werden es noch so weit treiben, dass ich fortlaufe, aber dorthin, wo mich dann niemand findet. Und daran sind Sie schuld, Frau McCook!“
Kurz, es war mit Magdalena einfach nichts anzufangen. Auch Mutter Schreibers Mahnungen nutzten nichts. Im Gegenteil prahlte Magdalena dann nur, dass sie genug vom Haushaltführen und Kochen verstehe, um auch irgendwo anders eine Stelle in einem Haushalt ausfüllen zu können. Wenn sie gefragt wurde, wo, antwortete sie schnippisch: „Da gibt es noch andere Städte als gerade Waterville, zum Beispiel Correllville und dann St. Paul oder Milwaukee oder Davenport oder Chicago.“
Wenn Mutter Schreiber dazu bemerkte, dass sie, Magdalena, doch noch nicht einmal ganze vierzehn Jahre alt sei, wurde nur erwidert: „Was macht denn das? Ich bin groß und stark. Wenn ich mir lange Kleider anziehe, merkt niemand, wie alt ich bin.“
„Woher willst du das Geld für Kleider nehmen?“
„Das lasse nur meine Sorge sein“, lächelte auf solche Bemerkung hin verschmitzt Magdalena.
Margarete und Philipp gingen zur Schule und waren ruhige und gesittete Kinder. Nur der Zweitälteste, Joseph, der jetzt sechzehn Jahre alt war, schien ganz und gar aus der Art zu schlagen. Er fühlte sich merkwürdigerweise auch am meisten zu der schnippischen Magdalena hingezogen. Joseph arbeitete jetzt bei der Zeitung, die er nach Vaters Tod auszutragen begonnen hatte, als „All Around Man“, das heißt als Bürojunge, Laufbursche und gelegentlicher Helfer beim Abladen von Papier und bei Reparaturarbeiten. Sein bester Freund war noch immer Rudi, von dem man nicht recht wusste, was er trieb. Von Zeit zu Zeit verschwand er aus Waterville, manchmal auf Wochen. Dann, wenn er wiederkam, verbrachte er die meiste Zeit in Kneipen und hatte vor allem immer Geld und ging auch anständig gekleidet. Er wohnte mit seinem Vater zusammen, der immer noch trank und in einem schäbig aussehenden und halb verfallenen Haus dahinvegetierte. Wann immer Rudi in der Stadt war, kam auch Joseph spät – manchmal sogar angetrunken – nach Hause. Alles Mahnen von Mutter Schreiber half nichts. Sie konnte so halt nichts weiter tun als nur immer wieder und wieder mahnen und für Magdalena und Joseph beten, die darüber aber nur lächelten.
Eines Abends im Herbst, als Mutter Schreiber vom Wäschewaschen nach Hause kam, fand sie dort außer Geigele und Philipp auch Frau McCook vor, die auf sie zu warten schien. Die Kinder waren schon das ganze letzte Jahr hindurch allein nach Hause gekommen.
Mutter Schreiber ahnte irgendetwas Unangenehmes, und ihre Ahnung war auch richtig.
„Es tut mir so leid, liebe Frau Schreiber, Ihnen diesen Schmerz bereiten zu müssen“, begann Frau McCook, „aber Ihre Tochter Magdalena ist seit gestern abend nicht nach Hause gekommen. Ich wollte erst mit Ihnen sprechen, ehe ich die Polizei vom Verschwinden in Kenntnis setze.“
„Haben Sie eine Ahnung, wo Madgalena sein kann?“, fragte Frau Schreiber gefasster, als Frau McCook erwartet hatte.
„Nein. Nur war mir die letzten Tage aufgefallen, dass sich Magdalena geradezu betont frech aufgespielt hatte, und als ich sie einmal zurechtwies, antwortete sie mir: ‚In kurzem können Sie Ihre Arbeit allein machen‘, eine Bemerkung, die mich stutzig machte und der ich durch weiteres Fragen auf den Grund zu kommen versuchte, doch leider vergeblich. Mir scheint es, als ob sie da schon irgendeinen Plan für das Fortgehen gehabt hatte.“
„Fehlt Ihnen etwas an Geld oder Sachen?“, fragte Mutter Schreiber besorgt. „Falls es so ist, lassen Sie es mich wissen, denn ich ersetze Ihnen alles. Sie haben wirklich nur Gutes an uns getan und sollen keinen Schaden erleiden.“
„Nein, aus meinem Haushalt ist nichts entwendet worden, weder Geld noch Sachen, soweit ich es wenigstens weiß. Und sollte etwas fehlen, Frau Schreiber, machen Sie sich deswegen nur keine Sorgen. Wir werden nicht verarmen. Allerdings kann ich nachfühlen, wie Sie empfinden; soll ich die Polizei verständigen?“
„Nein, liebe Frau McCook, bitte noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich von Magdalena bald hören werde.“
„Nun, wie Sie wünschen. Ich hoffe nur, Ihre Ahnung ist richtig, denn wenn Madgalena irgendwie verschleppt sein sollte, dann wäre jede Minute kostbar.“
Mutter Schreiber erschrak bei dieser Bemerkung. Ein solcher Gedanke war ihr noch nie gekommen. Doch sie blieb trotzdem dabei, die Polizei noch nicht zu benachrichtigen, da sie bestimmt fühlte, dass sie bald Näheres von Magdalena erfahren würde.
Und Mutter Schreiber behielt auch recht. Nach zwei Tagen erhielt sie einen Brief von Magdalena aus Chicago, worin diese ihr mitteilte, dass sie dort eine Stellung in einem Haushalt angetreten hätte und „besser dran sei als bei den hochnäsigen McCooks“. Der Brief enthielt aber keine sonstige Aufklärung, woher Magdalena das Reisegeld erhalten haben konnte. Mutter Schreiber schrieb zurück und bat Magdalena, doch zurückzukommen, sie brauche ja nicht mehr zu McCooks zu gehen. Wenn sie Geld brauche, so solle sie schreiben. Damit teilte Mutter Schreiber zum ersten Male Magdalena etwas von dem für sie angelegten Sparkonto mit. Dieser Brief wurde schnell von Magdalena beantwortet. Sie blieb dabei, dass sie nicht zurückkehren würde und forderte ihre Mutter in einem fast befehlsmäßigem Ton dazu auf – ohne ein Wort des Dankes für das angelegte Sparbuch –, ihr sofort den gesparten Betrag zuzusenden, da sie ihn gut gebrauchen könne, unter anderem zum Abzahlen einer kleinen Schuld.
Es blieb längere Zeit ein Rätsel, woher Magdalena das Reisegeld gehabt haben konnte, da sie ihren Verdienst bei McCooks immer prompt an ihre Mutter abgeliefert hatte. Doch das Geheimnis klärte sich auf, als einige Wochen später auch Joseph verschwand und dann später ebenfalls aus Chicago schrieb, dass er das „Nest“ Waterville bis zum Erbrechen satt hätte und mit Rudi zusammen nach Chicago übergesiedelt sei. Anscheinend hatte Rudi – wie jetzt Joseph – vorher auch Magdalena mit Geld ausgeholfen. Joseph schrieb nicht, was er in Chicago arbeite oder mache. Da sowohl von Magdalena wie auch von Joseph dann weiter keine Briefe mehr kamen, so musste Mutter Schreiber eben beide ihrem selbstgewählten Schicksal überlassen. Später berichtete einmal Georg, der Älteste, als er regelrechter Schaffner auf Durchgangszügen zwischen den Zwillingsstädten St. Paul-Minneapolis und Chicago war, dass er einmal in Chicago beim Schichtwechsel länger als sonst Zeit hatte und beim Schlendern durch die Stadt zufällig Joseph und Rudi in einer Kneipe getroffen hätte. Beide seien gut gekleidet gewesen. Man habe aber nicht mehr als ein paar Worte gewechselt, und Joseph habe Grüße an „Ma“ und „die andern“ mitgegeben.
5. Der Spuk bei Maiers
Ab und zu erhielt Mutter Schreiber abends noch Besuche von solchen, die über die allerverschiedensten Dinge gern beraten werden wollten. Obgleich Brauer Ronner ihr das Beten für Kranke nicht mehr verbieten konnte, seit ihr Mann tot war und nicht mehr bei ihm arbeitete, so blieb Mutter Schreiber aber doch wie bisher korrekt und mahnte weiter, wie früher, in Krankheitsfällen stets auch einen Arzt zurate zu ziehen und diesen auch zu behalten, wenn man schon einen hatte.
Unter den Besuchern stellte sich einmal eine Frau ein, deren Mann Kirchenältester in der Gemeinde von Pastor Knecht war, der beim Begräbnis von Vater Schreiber die Trauerrede gehalten hatte. Dieser Kirchenälteste Maier hatte einen Sohn Karl von fünfzehn Jahren, in dessen Gegenwart sich im Elternhaus immer die merkwürdigsten Dinge ereigneten, die niemals vorkamen, wenn Karl nicht da war. Und das Allermerkwürdigste dabei war, dass Karl über alle die seltsamen Vorkommnisse weder erschreckt noch erstaunt war. Sie ließen ihn völlig gleichgültig. Da sich diese Verhältnisse ständig verschlimmerten anstatt zu bessern schienen, so schickte jetzt Maier seine Frau, um herauszufinden, ob vielleicht Frau Schreiber etwas dagegen tun könne.
Mutter Schreiber hörte Frau Maier ruhig an. Sie hatte aber, als sie zuhörte, das Gefühl, dass sie größte Vorsicht üben müsste, weil sie sonst Unannehmlichkeiten haben könne.
Als Frau Maier geendet hatte und nun Mutter Schreiber fragend ansah, blieb diese erst eine Weile, wie überlegend, still und fragte dann die Besucherin: „Was sagt denn der Herr Pastor dazu?“
„Dem haben wir noch nichts gesagt. Wir fürchten, ausgelacht zu werden, wenn es sich in seiner Gemeinde herumspricht, dass es bei uns angeblich ‚nicht mit rechten Dingen‘ zugehe.“
„Sprechen Sie erst mit Ihrem Herrn Pastor“, bestand Mutter Schreiber, „eher kann ich in dieser Angelegenheit nichts tun.“
Alles Bitten von Frau Maier half nichts. Mutter Schreiber blieb fest. Sie wusste selbst nicht warum; doch es war, als ob eine innere Stimme sie warnte.
Am nächsten Abend kam Herr Maier persönlich und versuchte, Mutter Schreiber umzustimmen, freilich ebenfalls vergeblich.
Nun wandte sich Herr Maier, der mit Herrn McCook in geschäftlicher Verbindung stand, an diesen, da er wusste, dass dessen Sohn durch Mutter Schreiber geheilt worden war.
Er kam daher am darauffolgenden Tage nochmals wieder, diesmal in Begleitung von Herrn McCook, der über Mutter Schreibers Weigerung sein Erstaunen aussprach und ihr Verhalten nicht begreifen konnte.
„Frau Schreiber“, so bemerkte er, „Sie haben doch Fred so wunderbar geholfen; warum können Sie denn da für Maier nichts tun?“
„Ich weiß nicht, Herr McCook“, antwortete die Angeredete freundlich, denn sie wusste ja, dass dieser es wirklich nur gut meinte, „hier liegen aber ganz andere Verhältnisse vor.“
„Inwiefern?“
„Das kann ich leider nicht sagen; doch ich fühle es.“
„Sieht Ihr Gefühl irgendeine Gefahr für jemanden?“
„Ich weiß nicht“, entgegnete Mutter Schreiber zögernd. „Es kommt mir alles so seltsam vor. Mir scheint, als ob ich mich auf ein ganz fremdes Gebiet begebe und dort Gefahren irgendwelcher Art lauern, von denen ich noch keine Ahnung habe!“
„Beruhigen Sie sich, Frau Schreiber“, tröstete Herr McCook, „die Verantwortung übernehme ich und werde stets für Sie eintreten. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinem Freund Maier helfen würden.“
Das gab den Ausschlag. Mutter Schreiber versprach, am nächsten Abend Maiers zu besuchen.
Am Abend des Besuches von Herrn Maier und Herrn McCook hatte sich aber in Maiers Heim während dessen Abwesenheit etwas ereignet, was die merkwürdigen Vorkommnisse in des Kirchenältesten Hause plötzlich stadtbekannt machte.