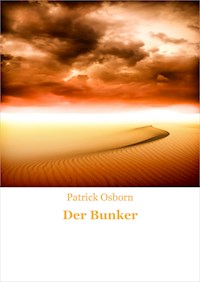Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Anlässlich seines Autorenjubiläums erfreut Patrick Osborn seine Leser mit einem Sammelband mit fünfzehn unterschiedlichen, mystischen Kurzgeschichten. Dafür hat er sich Unterstützung von zwölf Autoren gesucht. Egal ob es sich um gestrandete Schiffe, alte Häuser oder geisterhafte Erscheinungen handelt. Alle Autoren beherrschen das Handwerk des Schreckens auf ihre Art. Mitwirkende: Patrick Osborn, Ellen Geus, Janina Huber, Body Clarke, Dirk Weber, Caro Berg, Petra Kleinhenz, R. A. Altena, Lorelay Lost, Martina Lichtenfeld, Lissy Dixon, Karina Holländer, Bryan C. Kavanagh.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Leser
Danke für fünfzehn unglaubliche Jahre!
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Gezeitentod von Patrick Osborn
Das Buch der Leiden von Patrick Osborn
Gestrandet von Patrick Osborn
Zurück ins Leben von Ellen Geus
Das Haus am See von Janina Huber
Carmen von Body Clarke
Das Klavier von Dirk Weber
GeisterstundeN von Caro Berg
Zehn leere Seiten von Petra Kleinhenz
Marlene von R. A. Altena
Mary´s Tears von Lorelay Lost
Die Trophäe von Martina Lichtenfeld
Blind von Lissy Dixon
Das neue Haus von Karina Holländer
In den Tiefen des Waldes von Bryan C. Kavanagh
Vorwort
Als ich vor fünfzehn Jahren meinen ersten Roman „Das Bambini-Projekt“ veröffentlicht habe, ging für mich ein großer Traum in Erfüllung: Das eigene Buch in Händen zu halten. Damals war mir noch nicht bewusst, dass dies erst der Auftakt zu einer langen Reise sein sollte.
Fünfzehn Jahre sind eine lange Zeit. Sehr viel ist seitdem von mir geschrieben worden. Mit Stolz blicke ich auf diese Zeit zurück, die ich vor allem durch euch so gestalten konnte, wie ich es letztlich getan habe.
Für dieses Jubiläum wollte ich nunmehr ein Werk präsentieren, das dem Anlass würdig und trotzdem vollkommen anders ist, als all meine vorherigen Bücher. Und so habe ich mich an die Anfänge meiner Autorenkarriere erinnert. Meine allererste jemals veröffentlichte Kurzgeschichte „Gezeitentod“ eröffnet dieses Jubiläumsbuch. „Das Buch der Leiden“ stammt aus der gleichen Epoche, hat aber damals nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt.
Mit „Gestrandet“ liegt dann eine brandneue Kurzgeschichte vor, in der ich mich an etwas Neues gewagt habe.
Da sich mit drei Kurzgeschichten kein Buch füllen lässt, habe ich kurzerhand zwölf befreundete Autorinnen und Autoren gefragt, ob sie Lust hätten, mein Jubiläum mit mir zu feiern.
Das Ergebnis könnt ihr auf den folgenden Seiten lesen. Ich bin mir sicher, dass ihr beim Lesen so viel Spaß haben werdet, wie wir alle beim Schreiben.
An dieser Stelle möchte ich all meinen Gastautoren für ihre tollen Geschichten danken!
Wie gesagt, fünfzehn Jahre sind eine lange Zeit, aber noch keine Ewigkeit. Vielmehr sind sie erst der Anfang einer Zeit, auf die ich später in tiefer Verbundenheit gegenüber euch, meinen Lesern, zurückblicken werde.
Es gibt noch viele Geschichten zu erzählen und viele Projekte, die ich noch umsetzen möchte. Ich hoffe und wünsche mir, dass ihr weiterhin so interessiert an meinem Schaffen bleibt.
Für den Moment wünsche ich euch gruselige, spannende und unterhaltsame Momente.
Auf alles, was war und alles, was noch kommen wird!
Herzlichst
Euer
Patrick Osborn
September 2016
Gezeitentod
von Patrick Osborn
Mike Conlay war glücklich. Endlich war der Tag der Klassenreise gekommen. Seit fünf Uhr war der Bus unterwegs, der die Kinder und ihren Klassenlehrer von London nach Bridport brachte, einem malerischen Küstenort im Süden Englands. Fremde kamen selten hierher. Die Einzigen, die den Ort besuchten, waren Schulklassen, die im nahegelegenen Schullandheim ihre Klassenreisen verbrachten.
Im Bus war es erstaunlich ruhig. Der Klassenlehrer Mr. Miller hatte endlich für Ruhe gesorgt. Eine halbe Stunde zuvor glich der Bus noch einem Tollhaus. Jetzt saßen alle Kinder auf ihrem Platz und warteten auf das Ende der Fahrt.
Die Einwohner von Bridport waren ruhige, einfache Leute. Sie arbeiteten hart und wollten von äußeren Einflüssen in Ruhe gelassen werden. Stress und Hektik der Großstadt waren ihnen fremd. Und doch gab es ein dunkles Geheimnis, dass alle sieben Jahre von dieser Stadt Besitz ergriff.
“Verdammter Mist!”, rief Jeff Graham. Die Öllampe begann zu blinken. Graham fuhr den Rover an den Straßenrand, öffnete die Motorhaube und kontrollierte den Ölstand. Wie er schon vermutet hatte, war fast kein Öl mehr vorhanden.
Graham hatte geschäftlich in Plymouth zu tun und war auf dem Heimweg nach Brighton. Er erinnerte sich an ein Schild, dass er vor Kurzem gelesen hatte und hoffte, die zwei Meilen nach Bridport noch zu schaffen.
Das Öllämpchen leuchtete weiter, als er das Ortsschild von Bridport passierte und den auf eine Tankstelle zusteuerte. Er war froh, die Strecke geschafft zu haben. Graham stellte den Motor ab und überlegte, ob es überhaupt noch Sinn machen würde, weiter zu fahren. Er war hungrig und in weniger als zwei Stunden würde es dunkel werden. Daher beschloss er, den Tankwart auch nach einem Motel zu fragen. Der Tankwart war ein alter Mann mit einem sonnengegerbten Gesicht, in dem ein riesiger Vollbart wucherte. Sein Overall hatte schon bessere Tage erlebt.
“Volltanken, Sir?”, fragte der Alte.
“Ja. Ich brauche aber vor allem Öl. Der Wagen verliert sehr viel.”
“Kein Problem, Sir.” Der Alte ließ den Zapfhahn in die Tanköffnung gleiten und ging in eine alte Baracke, die wohl als Werkstatt diente. Wenige Augenblicke später kam er mit einer Ölflasche zurück und ließ sie schwarze Flüssigkeit vollständig in den Stutzen laufen.
“Das macht acht Pfund.” Graham zog seine Geldbörse heraus und entnahm eine Zehn-Pfund-Note. “Sagen Sie, gibt es hier im Ort ein Motel? Ich muss erst morgen früh nach weiterfahren.”
Die Miene des alten Mannes verdunkelte sich. “Es ist besser, wenn Sie den Ort so schnell wie möglich verlassen. Es ist für Fremde nicht ratsam, heute Nacht in Bridport zu sein.”
“Was ist denn heute Nacht?”
“Sie kommen! Alle sieben Jahre kommen die Gezeiten, um sich ein Opfer zu holen.”
Graham glaubte, dass der Alte ihm einen Bären aufbinden wollte.
“Die drei Seelenlosen der Gezeiten kommen alle sieben Jahre. Sie sind auf der Suche nach einem Opfer, dass sie mit ins Meer nehmen können.” Graham war sich nun ganz sicher, dass der Alte ihm mit seiner Geschichte einen Schrecken einjagen wollte. “Wenn die drei Seelenlosen kommen, werde ich schon mit ihnen fertig!” Er grinste den Tankwart an, drückte ihm den Geldschein in die Hand und stieg in seinen Wagen.
Der Tankwart sah, wie der Rover die Tankstelle verließ. Hoffentlich fuhr der Narr weiter. Er konnte die Reaktion des Mannes durchaus verstehen. Jetzt musste er sich aber beeilen. Die Dämmerung setzte ein und er musste vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein.
In der Tiefe des Meeres lauerten sie auf ihre große Stunde. Die Zeit des Wartens war fast vorbei. Langsam wurde das Meer unruhig. Sämtliches Leben war verschwunden. Die Prophezeiung würde sich wieder erfüllen.
Sieben Jahre waren wieder einmal vergangen. Vor über hundert Jahren war ein Piratenschiff gesunken. Die Besatzung hatte einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Drei Besatzungsmitglieder überlebten das Unglück. Ihr Fluch war es, alle sieben Jahre zu erwachen, um ein neues Opfer in die Fluten des Meeres zu holen.
Ein Zittern erfasste den Meeresboden.
Sand wurde aufgewühlt.
Eine Hand erschien.
Es begann! Bald würden die drei Seelenlosen wieder auf dem Weg nach Bridport sein.
Das Zimmer war alles andere als luxuriös. Es glich mehr einer Kammer und roch entsprechend muffig. Graham lag auf dem Bett und starrte die Decke an. Irgendetwas stimmte in diesem Ort nicht. Von der Straße war kein einziges Geräusch zu hören. Er erinnerte sich noch mal an die Worte des Tankwarts. Waren das wirklich nur Spinnereien? Die Geschichte mit den drei Seelenlosen wollte er nicht glauben. Daher entschloss er sich dazu, sich den Ort noch einmal anzusehen.
Mike Conlay und sein Freund Kevin hatten beschlossen, die Umgebung des Schullandheimes zu erkunden. Dass sie schon schlafen sollten, störte die Zwölfjährigen nicht.
Als sie aus dem Haus traten, führte links ein Weg zum Strand. Sie waren nur wenige Minuten unterwegs, als sie drei unheimliche Gestalten am Strand entdeckten.
“Das sehen wir uns genauer an. Vielleicht ist das eine Schmugglerbande.” Mike folgte seinem Freund, der schon einige Meter Vorsprung hatte.
Auf einmal stand einer der Drei vor ihnen! Der Junge wusste vor Schreck nicht, was er sagen sollte. Eine solche Gestalt hatte er noch nicht gesehen. Die Haut war schuppig und aufgequollen. Die Kleidung hing in nassen Fetzen an ihr herunter. Das Gesicht war schrecklich entstellt. Als der Unheimliche seine Hand nach Mike ausstreckte, begann dieser zu schreien! “Hol` Hilfe Kevin! Beil dich!”
Die beiden anderen Kreaturen waren inzwischen bei Kevin und brachten auch ihn in ihre Gewalt. In ihrer Verzweiflung begannen die beiden Jungen, wie verrückt zu schreien. Doch die Seelenlosen beeindruckte das nicht. Sie nahmen ihre Opfer und gingen zurück in Richtung Meer.
Der gesamte Ort wirkte wie ausgestorben. Nirgendwo war auch nur ein Licht zu sehen. Graham sah jedoch nichts Verdächtiges. Er wollte gerade umdrehen, als er einen verzweifelten Schrei aus Richtung des Strandes hörte. Graham rannte los! Was er sah, ließ ihn das Blut in den Adern gefrieren. Drei Typen hatten zwei Kinder gepackt, um sie ins Meer zu zerren. Plötzlich musste er wieder an die Worte des Tankwarts denken. Sollte dieser wirklich Recht behalten? Jetzt keine Zeit darüber nachzudenken.
“Lassen Sie die Kinder los!” Graham rannte die Dünen hinunter. Dass er allein gegen drei Gegner stand, war ihm nicht bewusst. Er hob einen dickeren Ast auf, damit er wenigstens etwas hatte, womit er sich verteidigen konnte. Mit wenigen Schritten hatte er die Typen erreicht. Mit pochendem Herzen musste er sich eingestehen, dass der alte Mann an der Tankstelle scheinbar die Wahrheit gesagt hatte. Mit aller Kraft schlug er der ersten Gestalt den Knüppel in den Rücken. Überrascht ließ dieser den Jungen los.
“Bring` dich in Sicherheit! Ich versuche, deinem Freund zu helfen.” Kevin rannte ein Stück in die Dünen, um sich dort zu verstecken.
Graham begriff, dass seine Situation ausweglos war. Sie hatten den zweiten Jungen losgelassen. Plötzlich war er umzingelt! Aus dem Augenwinkel bekam er mit, wie sich auch der Junge in Sicherheit brachte. Jetzt bekam er die Gelegenheit, sich die Kreaturen näher anzusehen. Die drei Seelenlosen existierten wirklich! Sie hatten ihn eingekreist und Graham wusste, was sie von ihm wollten. Er sollte das nächste Opfer werden! Er war so geschockt, dass er sich ohne Gegenwehr von den Kreaturen ins Meer zerren ließ, als er eine energische Stimme hörte.
“Nehmt eure dreckigen Hände von dem Mann!” Graham glaubte, seinen Augen nicht zu trauen. Aus heiterem Himmel stand der alte Tankwart da. In der Hand hielt er einen selbstgebauten Flammenwerfer. Mit einem Feuerzeug entzündete er das Ende der Waffe. Wie bei einem Bunsenbrenner schoss sofort eine Flamme empor. Die Kreaturen ließen von Graham ab. Sie merkten, dass das Feuer eine unbezwingbare Kraft darstellte. Der alte Mann richtete den Feuerstrahl auf die erste Kreatur, die sofort in Flammen aufging. Sie gab schauerliche Laute von sich, doch das Feuer war stärker. Die anderen beiden versuchten das rettende Wasser zu erreichen. Doch der alte Mann war schneller. Die Flammen hatten nun auch sie erreicht. Der Kraft des Feuers hatten sie nichts entgegenzusetzen. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis sie vollständig verbrannt waren. Zufrieden blickte der Alte auf die Aschehaufen.
“Das hätten wir schon vor langer Zeit tun sollen.”
Der alte Mann ging zu den beiden Jungen, die sich um Graham kümmerten. “Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie den Ort verlassen sollen. Aber ich habe mir schon gedacht, dass Sie hier noch herumschnüffeln würden.”
Graham blieb noch zwei Tage bei George Downey. Der alte Mann erzählte ihm alles über die Prophezeiung der drei Seelenlosen. Auch Mike und Kevin hatten das Ganze mit einem Schrecken überstanden. Als Mr. Miller erfuhr, was sich ereignet hatte, sah er von einer weiteren Bestrafung der beiden Jungen ab.
Den Bewohnern von Bridport fiel allerdings die größte Last vom Herzen. Denn sie brauchten keine Angst mehr vor den drei Seelenlosen zu haben.
Das Buch der Leiden
von Patrick Osborn
Fasziniert blickte Gerd Eichhoff auf das Buch. Der Korpus war aus festem Leder und reichlich verziert. Mit goldener Schrift war der Titel ins Leder gestanzt. Das Buch der Leiden - Die unheimlichen Erzählungen des Baron Le`Fuet. Eichhoff wusste sofort, dass er dieses Exemplar für seine Sammlung wollte, koste es was es wolle.
“Nehmen Sie es ruhig in die Hand und blättern Sie ein wenig darin.” Der Verkäufer blickte Eichhoff gütig an. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und nahm das Buch vorsichtig in die Hände.
“Es ist über vierhundert Jahre alt und vergleichbar mit den Erlebnissen des Marquis de Sade.” Aufgeregt blätterte Eichhoff in dem Buch. Er konnte kaum glauben, so ein schönes Stück auf einem Flohmarkt gefunden zu haben.
“Die erste Eintragung stammt aus dem Jahr 1608. Wer das Buch geschrieben hat, ist bis heute nicht bekannt. Auf jeden Fall spiegelt es die Taten des Baron Le`Fuet wieder. Der Baron lebte vor über dreihundert Jahren in Frankreich. Er soll sich mit Hexerei und Schwarzer Magie beschäftigt und in seinem Schloss unzählige Menschen gefoltert haben.”
“Woher haben Sie das Buch?”, fragte Eichhoff.
“Mein Urgroßvater war ein angesehener Bibliothekar und besaß viele alte Schriften. Unter anderem auch dieses Buch. Ein alter Antiquitätenhändler lachte mich beinahe aus, als ich ihm das Buch verkaufen wollte.”
Der Ansicht war Eichhoff ganz und gar nicht. Sein großes Hobby waren antiquarische Bücher und sein Sachverstand sagte ihm, dass er hier ein echtes Goldstück für seine Sammlung gefunden hatte.
“Wie viel möchten Sie dafür haben?” Eichhoff tat so, als interessiere ihn das Buch nicht besonders. Der Verkäufer legte seine Stirn in Falten und blickte Eichhoff an.
“Ich weiß nicht, was man dafür nehmen kann. Schauen Sie es sich ruhig noch etwas an und wenn Sie es nehmen wollen, geben Sie mir so viel, wie Sie für angemessen halten, einverstanden?” Eichhoff glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen. Der Narr wollte ihm tatsächlich ein kleines Vermögen zu einem Spottpreis überlassen. Er blätterte noch ein wenig in dem Buch herum, kramte in seiner Hosentasche und holte einen zerknitterten Fünfziger hervor.
“Sind Sie mit fünfzig Mark einverstanden?” Eichhoff hoffte, dass der Verkäufer nicht mit mehr gerechnet hatte.
“Das ist mehr, als ich erwartet hatte! Soll ich es Ihnen noch einpacken?”
“Nein, es geht schon.” Eichhoff steckte das Buch in seine Tasche und gab dem Verkäufer den Fünfziger. Mit einem zuckersüßen Lächeln nahm er sie entgegen.
“Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.” Dankend wandte sich Eichhoff ab und schlenderte zum nächsten Stand. Am liebsten hätte er einen Luftsprung gemacht. Wenn das Buch nur halb so viel wert war, wie Eichhoff dachte, würde sich der Trottel in den Allerwertesten beißen. Er war so mit seiner Neuerwerbung beschäftigt, dass er das diabolische Grinsen des Verkäufers nicht mehr wahrnahm.
Zu Hause angekommen warf er nochmals einen bewundernden Blick auf seine kostbare Neuerwerbung und konnte immer noch nicht glauben, nur fünfzig Mark dafür bezahlt zu haben. Der Verkäufer würde sicherlich im Dreieck springen, wenn er herausbekam, welch wertvolles Stück er weggegeben hatte.
Eichhoff setzte sich an seinen Schreibtisch und schaltete seine Lampe an. Der Halogenspot überflutete die massive Tischplatte. Er griff in eines der Schubfächer und holte einen Leitzordner hervor. In diesem Ordner hatte er seine gesamte Sammlung antiquarischer Bücher archiviert. Von einem Computer, der ihm diese Arbeit abnahm, hielt Eichhoff nicht viel.
Vorsichtig blätterte er die Seiten um, bis er zur Letzten vorgestoßen war. Der letzte Eintrag war zehn Tage alt. Naturwissenschaftliche Theorien von Kopernikus bis zu Leonardo da Vinci. Vierhundert Mark hatte er dafür auf einer Sammlerbörse gezahlt, aber seine heutige Neuerwerbung war sicher doppelt so viel wert.
Zärtlich strichen seine Finger über den Einband und ein wohliger Schauer rann über seinen Rücken. Er konnte es kaum erwarten, das erste Kapitel im Buch der Leiden zu lesen. Sein Blick blieb bei dem Titel hängen und seine Gedanken kreisten um den Autor. Obwohl er sich für einen Experten auf diesem Gebiet hielt, war ihm ein Baron Le´Fuet bisher nicht bekannt. Aber an irgendetwas erinnerte ihn der Name des Barons. Eichhoff kam aber nicht mehr dazu, den Gedanken zu Ende zu führen. Moritz, sein achtjähriger Kater, sprang auf seinen Schoß und beschnüffelte das neue Buch.
Plötzlich, als hätte er sich verbrannt, schreckte der Kater zurück und rannte aus dem Zimmer. Etwas ungläubig blickte Eichhoff ihm hinterher. Bestimmt hatte Moritz Hunger. Er folgte seinem Kater in die Küche und bereite das Abendessen zu. Das Buch der Leiden musste noch ein wenig warten. Nach dem Abendessen würde er anfangen darin zu lesen.
Müde legte Eichhoff das Buch zur Seite. Sein Wecker zeigte bereits drei Minuten nach ein Uhr. Hatte er tatsächlich so lange gelesen? Die Aufzeichnungen des Baron Le´Fuet waren schauderhaft. Eichhoff konnte kaum glauben, dass ein Mann zu solchen Gräueltaten fähig gewesen war. Er klappte das Buch zu und hatte kaum das Licht ausgemacht, als er schon in tiefem Schlaf versank.
Jäh schreckte er nach oben! Schweißtropfen standen auf seiner Stirn und es dauerte einen Moment, bis er sich in der Dunkelheit orientieren konnte. Er hatte ein Geräusch gehört. Er konzentrierte sich einen Moment und hörte es dann wieder.
Ein schwaches Kratzen, als ob etwas durch das Fliegengitter vor seinem Fenster zu kriechen versuchte. Eichhoff blickte auf Moritz, doch der Kater schien das Geräusch nicht zu hören. Er wollte sich gerade wieder hinlegen, als er das Geräusch abermals vernahm. Doch diesmal war es nicht am Fenster, es kam aus dem Zimmer! Ein Scharren, als ob etwas über den Holzboden huschte.
Eine Maus?
Eichhoff erhob sich und schaltete seine Nachttischlampe an. Das warme Licht vertrieb die Dunkelheit. Für einen Moment entspannte er sich, nahm dann aber aus den Augenwinkeln eine huschende Bewegung war. Sein Kopf ruckte so stark herum, dass die Halswirbel ein knackendes Geräusch von sich gaben. Er wollte in seine Pantoffeln schlüpfen, als er zwei fette Käfer sah, die in Windeseile unter dem Bettgestell verschwanden. Er ließ sich auf Hände und Knie nieder und spähte unter sein Bettgestell. Er glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als er Dutzende von Käfern darunter entdeckte. Er sprang hoch und überlegte, was er jetzt machen sollte.
Die Küche!
Eichhoff erinnerte sich daran, ein Insektenmittel im Schränkchen unter der Spüle zu haben. Er wollte gerade das Schlafzimmer verlassen, als er von irgendetwas am Kopf getroffen wurde. Blut sickerte aus einer kleinen Wunde an der Schläfe. Eichhoff hob gerade wieder den Kopf, als er eine Fledermaus auf sich zukommen sah.
Was zum Teufel war hier los? Die Fledermaus stieß auf ihn herab und er konnte sich im letzten Augenblick ducken. Sein Fuß verfing sich im Läufer. Er stolperte, stürzte und schlug mit dem Kopf gegen eine Kommode. Schmerzen schossen durch seinen Körper und er wimmerte leise vor sich hin. Die Fledermaus stieß abermals auf ihn nieder. Eichhoffs Hände tasteten nach irgendetwas, mit dem er sich verteidigen konnte. Auf der Kommode stand ein kleines Schälchen, indem er jeden Abend seine Manschettenknöpfe aufbewahrte. Eichhoff griff zu und warf es der Fledermaus entgegen.
Krachend traf das Porzellanschälchen den dunklen Besucher. Polternd flog es auf den Boden und zerbärste in kleinen Splittern. Die Fledermaus war so schnell verschwunden, wie sie gekommen war, doch dafür erhob sich aus den Splittern der kleinen Dose ein Schwarm von Fliegen. Dutzende mussten es sein und sie formierten sich zu einer Wolke, die erbarmungslos auf Eichhoff zuflog. Er schaffte es gerade noch die Hände vors Gesicht zu pressen, als er gänzlich von der Wolke verschluckt wurde. Eichhoff schrie auf und würgte, als einige der Fliegen in Mund und Nase drangen. Das Surren um seinen Kopf hatte eine Lautstärke erreicht, die ihn fast in den Wahnsinn trieb. Immer mehr Fliegen drangen in seinen Mund und plötzlich konnte Eichhoff nicht mehr. Der Würgereflex wurde immer schlimmer und er erbrach sich.
So schnell, wie sie gekommen waren, waren die Fliegen auch wieder verschwunden.
Totenstille umgab die Wohnung.
Mit blut- und tränenverkrustetem Gesicht saß Eichhoff in seinem Erbrochenen.
Mühsam rappelte er sich wieder auf und taumelte zum Badezimmer. Er tastete nach dem Lichtschalter und wurde im ersten Augenblick von dem Licht der Halogenspots geblendet. Er starrte in den Spiegel und was er sah, hatte keine Ähnlichkeit mit seinem Gesicht. Eine Fratze starrte ihn an. Das gesamte Gesicht war blutverkrustet. Die Augen lagen tief in den Höhlen und waren vollkommen leblos. Seine Hände tasteten nach dem Wasserhahn und öffneten ihn. Aber anstelle des kühlen Wassers wand sich eine Schlange zischend aus der Armatur. Eichhof schreckte zurück und sah, wie die Schlange im Ausguss verschwand.
Verzweifelt hämmerte er seine Fäuste gegen den Badezimmerspiegel und Scherben regneten in das Waschbecken und auf den Boden. Er blickte seine blutigen Hände an und sah, wie kleine Tropfen auf die Fliesen patschten.
Ein Schrei löste sich aus seiner Kehle und er wankte zur Tür. Er hatte Mühe sich auf den Beinen zu halten. Eichhoff trat in den Flur, als er plötzlich Stimmen vernahm. Die Stimmen waren noch zu weit entfernt, als das er sie verstehen konnte, aber instinktiv wusste er, dass er von hier verschwinden musste. Aber wohin? Um sich herum, sah er nur Dschungel!
Die Stimmen kamen näher und Eichhoff drehte sich um, sank auf die Knie und schluchzte. Er hielt das alles für einen Albtraum, aus dem er jeden Moment erwachen musste. Aber er wurde einfach nicht wach!
Wieder vernahm er die Stimmen und wieder waren sie ein Stück nähergekommen. Eichhoff blickte sich um. Er brauchte unbedingt einen Unterschlupf. Er ahnte, dass die Männer, denen die Stimmen gehörten, ihm nichts Gutes wollten.
Auf allen Vieren kroch er vorwärts. Tränen liefen über sein Gesicht. Er war völlig verzweifelt. Was er in den letzten Minuten erlebt hatte, sprengte jede Vorstellungskraft.
Die Stimmen waren erneut zu hören und jetzt war sich Eichhoff sicher, dass sie ihm ans Leder wollten. Er konnte eine der Stimmen klar und deutlich erkennen.
“Das Schwein muss hier ganz in der Nähe sein, Baron. Er kann uns nicht entkommen!”
Baron!
Also war Baron Le`Fuet hinter ihm her! Panisch blickte sich Eichhoff in dem dichten Dschungel um. Wenige Meter vor sich entdeckte er eine Höhle! War das die Rettung? Eilig krabbelte er darauf zu. Die Häscher kamen immer näher und Eichhoff konnte beinahe ihren Atem in seinem Nacken spüren.
Er betrat die kleine Höhle, kauerte sich in eine dunkle Ecke und hoffte, dass seine Verfolger die Höhle nicht entdeckten. Er versuchte zu überlegen, was er als Nächstes tun sollte, aber es war ihm nicht möglich, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Der Höhlenboden begann sich zu drehen und Eichhoff hörte ein teuflisches Lachen. Er vergrub sein Gesicht in seinen Händen, als er plötzlich einen Biss spürte. Kurz, als wenn er sich mit einer Stecknadel gepiekt hätte. Er blickte hoch, konnte aber in der Dunkelheit nichts entdecken.
Wieder ein Biss!
Eichhoff stöhnte auf. Seine Hände tasteten seine Beine entlang, konnten aber immer noch nichts finden. Wieder ein Biss! Diesmal aber auf seiner Schulter. Abermals stöhnte er auf. Von einer Sekunde auf die andere wurde er von Bissen übersät! Eichhoff schrie und seine Hände tasteten in sein Gesicht. Er spürte eine klebrige Flüssigkeit an seiner Wange und bemerkte ein Krabbeln, das langsam von seinem gesamten Körper Besitz ergriff. Was zur Hölle krabbelte an ihm herum?
Die Bisse schmerzten so sehr, dass er benommen wurde. Er musste hier raus! Egal wer draußen auf ihn lauerte. Wenn er noch eine Minute hier drinnen blieb, würde er an diesen Bissen elendig zugrunde gehen. Mit letzter Kraft schleppte er sich aus der Höhle.
Sein gesamter Körper brannte wie Feuer und manche Körperteile begannen schon taub zu werden.
Unmittelbar vor dem Höhleneingang brach er zusammen. Im fahlen Licht konnte er sehen, was ihm diese Schmerzen zugefügt hatte und immer noch zufügte.
Hunderte kleiner Ameisen krabbelten über seinen Körper und übersäten ihn weiterhin mit Bissen. Nur am Rande nahm Eichhoff war, dass seine Häscher nicht vor der Höhle warteten. Obwohl er nicht mehr sicher war, was schlimmer gewesen wäre. Unerbittlich krabbelten die Ameisen weiter und überzogen jeden Millimeter seines Körpers mit ihren tödlichen Bissen. Eichhoff wollte schon aufgeben, als er in nicht allzu weiter Entfernung ein Rauschen hörte.
Wasser!
Das konnte die Rettung sein!
Der letzte Funke Lebenswillen glomm auf und mit allerletzter Kraft rappelte er sich auf die Füße. Die Ameisen bissen zwar unerbittlich weiter, aber Eichhoff war fest entschlossen das Wasser zu erreichen. Er schleppte sich durch die Dunkelheit und konnte sich nur am Rauschen des Wassers orientieren. Aber die zunehmende Lautstärke sagte ihm, dass er sich auf dem richtigen Weg befand. Jeder Schritt verursachte ihm Höllenqualen, aber er zwang sich, weiter durchzuhalten.
Das Rauschen war bereits greifbar nahe, als er endlich die Klippe erreichte! Am liebsten hätte er laut aufgeschrieen, aber dazu fehlte ihm die Kraft. Das Gift der Ameisen tat seine Wirkung. Benommen blickte er nach unten und erkannte das rettende Wasser. Was konnte er noch verlieren? Wenn er nicht sprang, würde er in wenigen Minuten tot sein. Eichhoff holte noch einmal tief Luft, bevor er den Schritt über die Klippe wagte und ins rettende Wasser sprang.
Für die Polizei war der Tod Gerd Eichhoffs ein Rätsel. Es konnte sich niemand erklären, warum der zweiundvierzigjährige Chemiker aus dem Wohnzimmerfenster seiner Wohnung gesprungen war.
In seiner Wohnung gab es keinerlei Spuren, die auf einen Einbruch oder ein Kampf hingewiesen hätten. Auch die Nachbarn konnten sich sein Verhalten nicht erklären. Eichhoff lebte zwar allein, war bei Kollegen, Freunden und Nachbarn gleichermaßen beliebt. Niemand konnte sich erklären, was ihn zu dieser Wahnsinnstat getrieben hatte.
Zwei Tage später
Die dunkle Gestalt schlich durch die Dunkelheit. Ihre Sinne waren angespannt, aber sie war sich ihrer Sache absolut sicher. Vorsichtig betrat sie den Neubau und stand nun unmittelbar vor Gerd Eichhoffs Wohnungstür. Mit wenigen geschickten Handgriffen hatte die Gestalt sie geöffnet und trat ein.
Schemenhaft erkannte sie die Umrisse der Einrichtung. Obwohl die Gestalt noch nie in dieser Wohnung war, wusste sie genau, wohin sie gehen musste. Sie passierte den Flur und das Badezimmer und erreichte das Schlafzimmer.
Sie musste es wieder an sich bringen! Ihr Blick wanderte im Zimmer umher. Die Gestalt entdeckte das gesuchte Objekt auf dem Nachttisch. Zufrieden umrundete sie das Bett und erreichte den Nachttisch. Wieder umspielte ein diabolisches Lächeln die Lippen des Flohmarktverkäufers, als er das Buch der Leiden an sich nahm.
Baron Le`Fuet!
Sein Buch hatte sich um ein Kapitel erweitert! Der Narr hatte nicht gewusst, wer der Baron war. Die Augen der Gestalt blitzten kurz auf, als sich der Schriftzug auf dem Buchdeckel kurz verwandelte und der wahre Name des Barons mit roten, leuchtenden Lettern darauf zu lesen war.
Das Buch der Leiden war um ein Kapitel reicher! Die Gestalt lachte schallend, nahm das Buch der Leiden an sich und verschwand wieder in der Dunkelheit, bis der nächste Unwissende in seinen Besitz gelangte und so ein weiteres Kapitel im Buch des Teufels geschrieben wurde!
Gestrandet
von Patrick Osborn
„Marian!”
Der Wind peitschte plötzlich auf, kündigte ein Unwetter an und zerzauste Marians Haare. Jedoch war er so in Gedanken versunken, dass er es nicht spürte. Sein Blick wanderte über die endlose Weite des Meeres.
„Marian, muss ich dir wirklich erst Beine machen?” Sein Kopf wirbelte herum, als er jäh aus seinem Tagtraum gerissen wurde.
„Entschuldigung, Sir. Ich war mit meinen Gedanken woanders.
„Verdammt, Marian. Zum letzten Mal: Rauf mit dir! Deine Kameraden sind längst in der Takelage.”
Der erste Offizier war puterrot im Gesicht, aber Marian kam nicht mehr dazu, einen Gedanken daran zu verschwenden, ob die Röte vom Rum her stammte. Blitzschnell kletterte er in die Rahnen, wo die anderen bereits auf ihn warteten. Gemeinsam kämpften sie gegen den Wind an. Dabei peitschte ihnen das Segel einiges an Regenwasser, das sich in den Falten angesammelt hatte, ins Gesicht. Immer wieder griffen die Matrosen ins Leere, bis sie endlich ein Stück Stoff zu fassen bekamen und es hochziehen konnten. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, das Tuch zu bändigen und zu vertäuen.
Der Sturm frischte weiter auf und trieb den schneidenden Wind vor sich her. Von ihrem Platz aus konnte Marian sehen, wie ein Brecher über die Reling der Annacostia schoss. Er spürte, wie sich das Schiff schwer nach Backbord legte und seine Füße zu rutschen begannen. Doch kaum hatte er Halt gefunden, war die nächste Welle heran und ging gnadenlos über die Reling. Marian wusste, dass ihr Kentern den sicheren Tod bedeuten würde. Das Wasser war eiskalt und nur die wenigsten Matrosen konnten schwimmen.
War eben noch die Küste von Paragonien in der Ferne zu erkennen gewesen, war jetzt nur noch ein grau in grau am Horizont zu sehen. Ein Grau, das sich immer fester um sie herumzog. Ein Grau, das zunehmend eine eisige Kälte und die Schwärze der Nacht mitbrachte. Marian war überrascht, dass der Kapitän und sein erster Offizier den Sturm nicht früher erkannt hatten. Doch jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, um sich darüber Gedanken zu machen. Zusammen mit seinen Kameraden begann er, das Marssegel einzuholen. Marian drehte sich ein Stück nach hinten, während er die Arme vor lauter Kraftanstrengung kaum noch spüren konnte. In der immer stärker werdenden Dunkelheit konnte er nur noch schemenhaft erkennen, dass die meisten Matrosen in den Wanten des Großmastes hingen und mit den Segeln kämpften.
Kaum einer seiner Kameraden behandelte Marian noch als das, was er war: ein Schiffsjunge, der erst vor wenigen Tagen seinen achtzehnten Geburtstag gefeiert hatte. Sogar Kapitän Pellerman hatte ihm gratuliert und für einen Moment die übliche Distanz zur Mannschaft aufgegeben. Für die restliche Mannschaft war Marian ein vollwertiger Matrose, der seine Arbeit genauso gut verrichtete, wie der Rest der Truppe. Von seinen gelegentlichen Tagträumereien einmal abgesehen. Aber nach und nach verloren sich immer mehr Matrosen in eben diesen Tagträumen. Sie waren einfach schon zu viele Monate von der Heimat weg. Im Augenblick segelte die Annacostia vor der Küste Paragoniens. Sie hatten Weizen und Hirse geladen. Schlechte Ernten hatten dafür gesorgt, dass in Paragonien Hunger und Elend herrschten.
Marian sah, dass nunmehr Mars und Royals vertäut waren und der Steuermann krampfhaft versuchte, das Schiff auf Kurs zu halten. Calderon, der Mann im Ausguck schrie etwas herunter, was wegen des Sturms jedoch nicht zu verstehen war. Dafür erkannte Marian, dass Calderon wild mit den Armen ruderte und immer wieder nach Backbord wies.
Weitere Brecher schossen über die Reling. Hätten sich die Männer nicht irgendwo festgehakt, wären sie allesamt über Bord gegangen. Der Sturm hatte an Intensität zugenommen und alles, was nicht verzurrt oder festgebunden war, ging über Bord. Ein weiteres Mal beugte sich die Annacostia schwerfällig nach vorn. Kaum hatte das Schiff den Boden der Welle erreicht, als eine Ladung Wasser über den Bug krachte. Inzwischen floss das Wasser nicht mehr ab und Marian konnte sich vorstellen, wie es unter Deck aussehen musste. Mit einem Knall lösten sich mehrere Taue, mit denen der Koch ein paar Fässer unweit der Kombüse gesichert hatte. Wie Kanonenkugeln schlitterten sie über Deck und landeten krachend im Wasser.
Genau in diesem Augenblick zerriss ein greller Blitz das Inferno und erhellte für den Bruchteil einer Sekunde die Umgebung. Mit schreckgeweiteten Augen erkannte Marian, dass die Steilküste zum Greifen nah war. Und der Sturm trieb sie unnachgiebig weiter auf die Küste zu. Wie ein Ball schlingerte die Annacostia mal nach Backbord, mal nach Steuerbord.
„Land in Sicht!”, schrie Calderon aus dem Fockmast, wobei Marian ihn dafür bewunderte, dass er sich bei diesem Sturm immer noch festhalten konnte.
„Hart Backbord!”, brüllte der Kapitän und Marian wurde bewusst, dass es ihre einzige Chance war. Sie mussten das Schiff irgendwie auf Sand setzen. So war vielleicht ihr aller Leben und wenigstens ein Teil der Ladung noch zu retten. Während der Kapitän weitere Befehle ausrief, mischte sich ein knirschendes Geräusch in das Gebrüll des Orkans. Marian sah, wie der Fockmast brach, als wäre es ein morscher Ast. Auch konnte er Calderon erkennen, der mit seinen Füßen in den Webleinen gefangen war. Marian war sich sicher, dass sein Ende gekommen war. Er schloss die Augen, um den alles vernichtenden Schlag in Empfang zu nehmen, doch nichts passierte. Ruckartig riss er die Augen wieder auf und sah, dass der Mast kurz vor seinem Kopf zur Seite geschwenkt war und wie ein Speer in die tosende See geschleudert wurde.
„Mann über Bord!”, schrie Marian. Doch niemand schien ihm Gehör zu schenken. Zu sehr waren sie von dem abgelenkt, was jetzt auch Marian entdeckte.
Die Annacostia schoss auf den Strand zu, doch plötzlich erhob sich etwas aus den Fluten des Meeres. Marian glaubte einen Kopf zu sehen, dessen spitze Reißzähne sich so in die Planken des Schiffes bohrten, als ginge ein heißes Messer durch ein Stück Butter. Der Wucht, mit der die Annacostia zermalmt wurde, konnte sich niemand entziehen. Menschen, Ladungsteile und Schiffstrümmer wurden durch die Lüfte katapultiert. Alles war so plötzlich geschehen, das niemand von der Besatzung die Gelegenheit bekam, das Ausmaß und die Konsequenz dieser Tragödie zu erfassen. Gierig fiel der Tod über das Schiff her und tat sich gütlich...
Marian erwachte in einer Felswand und spürte, wie eine warme Flüssigkeit über sein Gesicht ran. Er schob die Zunge zwischen seine Lippen und schmeckte Eisen und Salz. In dem Moment realisierte er, dass es sich um Blut, um sein Blut handelte. Gleichzeitig spürte er schmerzhaft einen merkwürdigen Druck unter seinen Achselhöhlen. Wie zwei Hörner standen zwei Felsvorsprünge hervor, die ihn genau zwischen den Armen aufgefangen haben mussten.
Mit dem rechten Fuß ertastete Marian einen Vorsprung, der breit genug war, um sich abzustützen. Vorsichtig setzte er den Fuß auf den Vorsprung und hielt sich mit beiden Händen am Felsen fest. Schließlich atmete er tief durch und fasste mit der rechten Hand über sich.
Noch immer war so gut wie nichts zu sehen, jedoch hatte der Sturm abgenommen. Zwar donnerten die Wellen gegen die Klippen, aber der Wind hatte deutlich nachgelassen. Marian war vollkommen durchnässt und seine Kleidung hing mehr in blutigen Fetzen an seinem geschundenen Körper. Jetzt merkte er auch die Erschöpfung, doch ähnlich wie das Geschrei einer Möwe im Lärm der Brandung unterging, drängte er die aufkommenden Gefühle von Schmerz und Kälte in den Hintergrund. Er musste von hier verschwinden. Seine Fingerspitzen griffen ein Stück höher und bekamen etwas zu fassen. Allerdings war es kein Fels, sondern ein Stück Holz. Es war feucht, schien aber in der Felswand fest verankert zu sein.
Würde es halten? Marian musste es riskieren. Er stieß sich ab, packte das Holz und zog sich ächzend hoch. Auf den rutschigen Felsvorsprüngen fanden seine Füße nur schwierig hält, aber er ertastete weitere Wurzeln. Erde rieselte auf ihn herab, aber er war sich sicher, es zu schaffen. Marian mobilisierte seine letzten Kräfte und krallte seine Finger in das Wurzelgeflecht. Stück für Stück zog er sich weiter hoch. Und tatsächlich, er schaffte es über die Kante. Mühsam rappelte er sich auf. Der Boden war feucht und rutschig, wurde aber immer flacher. Marian bewegte sich ein paar Schritte vorwärts, kam dann jedoch ins Straucheln und brach unter einem Holunderstrauch zusammen.
Summer Edwardsen fand Marian kurz nach Sonnenaufgang. Noch immer blies ein kräftiger Wind über die grünen Hügel der Küste. Jedoch war dies nichts im Vergleich zu dem Orkan, der in der vergangenen Nacht gewütet hatte. Jetzt war die Sonne wieder im Osten aufgegangen und es war keine einzige Wolke mehr zu sehen.
Summer hatte sich heimlich aus dem Haus geschlichen. Mitten in der Nacht hatte jemand heftig an die Tür ihres Hauses geklopft. Ihr Vater, Pfarrer Joshua Edwardsen hatte geöffnet und sie mit einem barschen Befehl in ihre Kammer geschickt. Doch Summer hatte den nächtlichen Besucher mit der flackernden Öllampe als Jon Martin erkannt. Allerdings verstand sie kein Wort von dem, worüber sich die beiden Erwachsenen unterhielten. Sie musste aber auch nichts verstehen, denn jetzt, wo sie an der Klippe stand, war ihr klar, was geschehen war. Wieder einmal war an der Steilküste von Hampton Hill ein Schiff gesunken. Aus den umliegenden Dörfern sammelten sich die Männer, um mit Fackeln, Seilen und Karren das zu sichern, was die Ebbe noch freigeben würde.
Kaum hatte Summer gesehen, wie sich ihr Vater und Jon Martin auf den Weg machten, hatte sie ihre Stiefel und ihre Jacke angezogen und gelauscht, ob ihre Mutter wach geworden war. Behutsam schloss sie die Tür hinter sich und lief der Steilküste entgegen.
Jetzt stand sie hier und vor ihr lag ein fremder, junger Mann, der kaum älter als sie war.
„Hier ist ein Überlebender!”, rief sie mit fester Stimme, als sie sah, dass sich die Brust des Bewusstlosen schwach, aber gleichmäßig bewegte. „Hierher!” Summer wedelte mit den Armen, um auf sich aufmerksam zu machen. Es war ihr ein Rätsel, wie es ihm gelungen war, die Klippe hochzuklettern. Doch seine Spuren deuteten direkt auf den Abgrund.
„Hierher!” Abermals machte sich Summer bemerkbar und registrierte zufrieden, dass ihr Rufen nunmehr vernommen worden war.
„Verdammt, was machst du hier?” Keuchend kam ihr Vater auf sie zu. „Hatte ich dir nicht ausdrücklich gesagt, dass du im Haus bleiben sollst?” Unmittelbar hinter dem Pfarrer folgten weitere Bewohner des Dorfes.
„Ein Überlebender!”, rief jetzt auch der Pfarrer. „Gott war ihm gnädig. Vorwärts Leute, tragt ihn schnell ins Pfarrhaus.” Er beugte sich zu Summer herunter, die neben dem Jungen kniete. „Wenn er überlebt, hat er dir seine Rettung zu verdanken. Trotzdem bin ich böse, dass du das Haus verlassen hast, obwohl ich es dir ausdrücklich verboten hatte.”
„Vater, ich...”
„Sei still! Wir sollten uns jetzt lieber um den Burschen hier kümmern.” Summer erkannte an der Stimme ihres Vaters, dass sein Zorn bereits im Abklingen war.
„Ich helfe, ihn zu tragen. Je mehr anfassen, desto besser.” Mit vereinten Kräften trugen sie ihn zum Pfarrhaus, das der Steilküste am nächsten lag.
Marian öffnete die Augen, als unverständliche Laute an sein Ohr kamen. Er erkannte, dass er in einem Bett lag, an dessen Fußende zwei Personen standen. Bei der linken handelte es sich um eine junge Frau mit dunkelblonden Haaren, die Marian aufmerksam musterte. Die rechte Person war ein hoch aufgewachsener Mann mittleren Alters, dessen Haar erste graue Strähnen zeigte. Kinn und Wangen wurden von einem Vollbart bedeckt. Er trug gebürstete Kleidung und einen langen Gehrock.
„Wie geht es dir?”, fragte er. Marian spürte, wie sein Mund antworten wollte, es aber nicht konnte.
„Hab keine Angst, du bist in Sicherheit”, sagte jetzt das Mädchen. Sie hatte eine angenehme, warme Stimme. „Das ist mein Vater, Joshua Edwardsen. Er ist der Pfarrer von Hampton Hill. Ich bin übrigens Summer und ich habe dich vor drei Tagen...”
„Lass gut sein, Summer”, unterbrach sie ihr Vater. „Er ist noch zu schwach. Aber danken wir dem Herrn, dass er wieder erwacht ist.” Mit diesen Worten wandte er sich ab, um die Kammer zu verlassen.
„Nein! Gehen Sie bitte nicht. Ich möchte wissen, was passiert ist.” Marian staunte selbst, wie die Worte aus ihm heraussprudelten.
„Hat er noch Fieber?” Der Pfarrer drehte sich auf der Türschwelle noch einmal um.
„Etwas, Vater. Aber es ist deutlich zurückgegangen.”
„Gut. Erzähl ihm, was du für richtig hältst.” Die Tür schloss sich hinter Joshua Edwardsen. Doch bevor Summer auf dem Bett Platz nehmen konnte, öffnete sich die Tür erneut und eine rundliche Frau stürmte ins Zimmer.
„Warum sagt mir keiner, dass er aufgewacht ist?”, rief sie aufgeregt.
„Weil es noch keine fünf Minuten her ist, Mutter”, antwortete Summer. Sie ignorierte ihre Tochter und wandte sich direkt an Marian. „Mein Name ist Annie Edwardsen. Wie heißt du? Wir kennen nicht einmal deinen Namen.
„Marian. Marian Tyrol”, antwortete er mit geschwächter Stimme. „Was ist mit meinen Kameraden, was mit der Annacostia geschehen? Eine gespenstische Stille legte sich über den Raum. Marian konnte sehen, wie Summer und ihre Mutter immer wieder Blicke austauschten. Schließlich räusperte sich die Frau. „Ich gehe in die Küche und hole dir etwas zu essen. Du bist bestimmt hungrig.” Mit diesen Worten verließ sie das Zimmer und überließ es Summer, ihn über das Ausmaß der Katastrophe zu informieren.
„Mein Vater hat die sterblichen Überreste deiner Kameraden, soweit sie angespült wurden, auf dem Friedhof beerdigt.