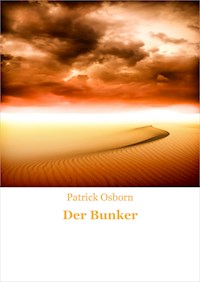Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einem geheimen Labor im europäischen Nordmeer suchen Wissenschaftler nach alternativen Energiequellen. Plötzlich kommt es zu einem Störfall und sämtlicher Funkkontakt reißt ab. Hat einer der Mitarbeiter das System manipuliert? Oder war es ein terroristischer Anschlag? Auf Wunsch des amerikanischen Präsidenten erhält der ehemalige Agent Jack Reilly den Auftrag, die Wahrheit herauszufinden. Eine Wahrheit, die er nicht für möglich gehalten hätte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick Osborn
Operation Eismeer
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Epilog
Widmung und Danksagung
Impressum neobooks
Prolog
Europäisches Nordmeer
Wie ein Gespenst huschte der Mann durch die Gänge. Alle Sinne waren geschärft. Er hatte sein Ziel fast erreicht. An einer Ecke blieb er stehen, blickte vorsichtig in den nächsten Gang und als er sicher war, dass ihm niemand in die Quere kommen würde, setzte er seinen Weg fort.
Es war kurz vor sechs Uhr morgens und alle anderen Mitarbeiter schliefen noch. Rasch ging er weiter, bis er fand, wonach er gesucht hatte: Die Tür, die ihm die benötigte Hilfe zukommen lassen und ihm den Weg in die Freiheit einbringen sollte. Er gab seinen Code ein und mit einem leisen Zischen öffnete sich die Metalltür. Er blickte sich nochmals um und trat ein.
Der viereckige Raum war das Herzstück der Anlage. Dicke schwarze Kabel schlängelten sich an der Decke entlang und mündeten in einem großen Pult, das mittig im ersten Drittel des Raums stand.
Wie viele Stunden hatte er in letzter Zeit hier verbracht? Er konnte nicht mehr sagen, ob es Wochen, Monate oder sogar schon Jahre waren. Sein Zeitgefühl war seit seiner Ankunft hier völlig aus dem Gleichgewicht geraten.
Der Mann trat an das Pult und ließ den Computer hochfahren.
Statusüberprüfung:
Initialisiere System
Bitte Passwort eingeben.
Der Mann gab sein Passwort ein. Mit klopfendem Herzen beobachtete er, wie der Bildschirm nach und nach freigegeben wurde. Er setzte sich an die Tastatur und gab in unglaublicher Geschwindigkeit eine Vielzahl von Zahlencodes ein. Er verharrte kurz, überlegte ob es richtig war, was er tat. Blitzartig schob er den Gedanken beiseite. Er hatte keine andere Wahl, denn nur so konnte er sein Ziel erreichen. Seine Finger flogen wieder über die Tastatur.
Noch acht Minuten.
Ein Lächeln umspielte seine Lippen, als er aufstand und sich zurück in seine Kammer begab.
Gleich würde nichts mehr sein wie zuvor. Und dann konnte er nur abwarten.
Florida, USA
Sie war es gewohnt, dass ihre Aufträge schnell erledigt werden mussten. Aber dieser stellte alle bisherigen in den Schatten.
Vor etwa vier Stunden hatte sich ihr Handy gemeldet, dessen Nummer nur ihrem Auftraggeber bekannt war. Ein neuer Job wartete auf sie. Die Besonderheit war, dass dieser innerhalb der nächsten sechs Stunden erledigt sein musste. Anfangs lehnte sie ab, da es zu ihrer Maxime gehörte, alles akribisch vorzubereiten. Nur deswegen war sie eine der Besten in ihrem Metier. Doch die eiskalte, keine Ablehnung erlaubende Stimme ihres Auftraggebers und die zusätzliche Summe von einer Million Dollar überzeugten sie schließlich.
Ein Hubschrauber hatte sie nach Orlando gebracht, wo schon ein Mercedes Coupé am Flughafen auf sie wartete. Von dort hatte sie die Interstate 3 genommen und war dann kurz vor Tampa Richtung Süden abgebogen. Wenige Meilen später hatte sie ihr Ziel erreicht: Eine Halbinsel, die zu einem Bollwerk der Reichen und Schönen gehörte. Dort erstreckten sich luxuriöse Appartements, sündhaft teure Villen und hervorragende Golfplätze. Sie war noch nie hier gewesen, aber vielleicht würde sie sich an genau so einem Ort später zur Ruhe setzen. Und der heutige Auftrag trug nicht unwesentlich dazu bei, dass sich dieser Traum erfüllen sollte.
Einem Schild mit der Aufschrift „The Palace“ folgend, bog sie in einen von Palmen gesäumten Boulevard ein, der vor dem Eingang eines imposanten Hotels endete. Sie machte den Motor aus, streckte ihre langen Beine aus und stieg unter den gierigen Blicken des Hotelpagen aus. Sie ging die Stufen zur Rezeption hoch, wo sie ein junger Mann freundlich begrüßte. Er schob ihr ein Anmeldeformular herüber und sie hatte kurz Zeit, den jungen Mann zu beobachten. Er sah ausgesprochen gut aus, mit seinen kurzen, schwarzen Haaren und den braunen Augen. Über der linken Brusttasche seines Blazers prangte das Logo von „The Palace“, die Silhouette eines orientalischen Palastes.
„Haben Sie reserviert?“
„Ja“, sagte sie. „Ich bin Jennifer Clark.“
„Wenn Sie das bitte ausfüllen würden“, sagte er und deutete auf das Formular. „Ich registriere inzwischen Ihre Kreditkarte. Bradley kann dann Ihr Gepäck auf Ihr Zimmer bringen.“ Anschließend tippte er etwas in seinem Computer, griff unter die Theke und holte eine kleine, lederne Mappe hervor, der er ein rosafarbenes Plastikkärtchen entnahm.
„Das ist Ihr Schlüssel“, sagte er und reichte ihn Jennifer. „Sie können mit dieser Karte alle Angebote unseres Hotels nutzen – Drinks, Wellness, Shopping – was Sie wollen.“
„Danke!“, antwortete Jennifer und griff mit einem strahlenden Lächeln nach der Karte.
„Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Palace.“
Kurz darauf trat sie aus dem Foyer und erblickte Bradley, der im Schatten einer mächtigen Palme mit ihrem Gepäck wartete.
Gemeinsam gingen sie den Weg entlang zu Jennifers Suite und plauderten Belangloses über das Wetter, die Leistung der Dolphins und über die anstehende Präsidentenwahl.
Als sie vor dem Fahrstuhl warteten, klingelte ihr Handy. Der Page lächelte. „Schalten Sie es aus“, schlug er vor.
„Das geht leider nicht so einfach!“
„Wir sind hier in Florida! Sie sollen hier relaxen...sich treiben lassen. Vergessen Sie für ein paar Tage Ihre Termine.“
Sie lächelte höflich und wenn Bradley gewusst hätte, mit wem er sich unterhielt, wäre er sicherlich nicht zu solchen Ratschlägen aufgelegt gewesen.
Jennifer kannte den polyphonen Ton ihres Handys zu genau, der keinen Anrufer ankündigte, sondern ein Zeichen war.
Die Fahrstuhltüren glitten auf und die beiden stiegen ein. Langsam setzte sich der Fahrstuhl in Bewegung und hielt schließlich im sechsten Stock. Nachdem sie einmal nach links und einmal nach rechts abgebogen waren, erreichten sie eine Tür mit der Aufschrift B-612. Der Page schob die Karte ins Schloss und wartete kurz, bis die Leuchtdiode grün blinkte. Dann stieß er die Tür auf und ließ Jennifer den Vortritt.
„Wow!“, entfuhr es ihr, als sie die Suite betraten. „Es ist herrlich!“.
Und das war es wirklich. Die Suite war überaus geräumig mit einem imposanten Balkon, teuren Ledermöbeln und einem herrlichen Blick aufs Meer. Jennifer öffnete die hohen Balkontüren und trat hinaus ins Sonnenlicht.
„Möchten Sie, dass ich Ihnen alles zeige?“, fragte der Page.
„Nein, danke“, antwortete Jennifer und trat zurück ins Zimmer. „Ich komme schon zurecht.“
Der Page zuckte enttäuscht mit den Achseln. „Ganz wie Sie möchten.“ Bewundernd ließ er den Blick an Jennifers atemberaubenden Körper heruntergleiten und Jennifer musste bei dem Gedanken lächeln, dass sie den Burschen mit einem Handgriff hätte das Genick brechen können. Sie schob ihm einen Fünfer in die Hand und begleitete ihn hinaus. „Danke für Ihre Hilfe“, sagte sie und schloss die Tür hinter ihm. Dann machte sie auf dem Absatz kehrt.
Aus der Minibar nahm sie sich eine Flasche Evian und sah sich in ihrer Suite um. Alles war groß und elegant: Auf dem schweren Sekretär stand der Willkommenkorb mit Obst, im Badezimmer, ein Traum in Marmor und Gold, lagen ein flauschiger Bademantel, ein kleines Nähset und diverse Flaschen mit ätherischen Ölen.
Nachdem sie alles begutachtet hatte, ging sie zu ihrer Computertasche, zog den Laptop heraus und stellte ihn neben das Telefon auf den Wohnzimmertisch. Sie kippte den Monitor so an, dass das Sonnenlicht nicht störte und schaltete das Gerät ein. Der Laptop brauchte nur ein paar Sekunden um hochzufahren. Als er fertig war, klickte sie das AOL-Logo an und wartete erneut. Schließlich erklang die vertraute Fanfare und sie war online.
Sie haben Post!
Sie klickte die Mailbox an, um zu sehen, von wem die Nachrichten kamen. Ohne die Mails zu öffnen, tippte sie in das Feld für die Web-Adresse www.sumacorporation.com
und wartete.
Während sie an ihrem Evian nippte, erschien im linken unteren Rand des Bildschirms die Meldung:
Dokument wird übermittelt.
Und dann ein nahezu leerer Bildschirm mit der Meldung:
Browser kann URL: http://www.sumacorporation.com nicht finden.
Sie griff in die Tragetasche des Laptops und holte einen durchsichtigen Plastiküberzug hervor, der genau über den Bildschirm passte. Es war eine Art Kalender, der mit mehreren Achsen dreihundertsechsundsechzig Kästchen ergab. Mit dem Touchpad bewegte Jennifer den Pfeil auf das Kästchen, das dem heutigen Datum entsprach. Dann bewegte sie den Pfeil zu einem anderen Kästchen, das dem neunundzwanzigsten März, dem Geburtstag ihrer Mutter, entsprach. Anschließend entfernte sie den Überzug und wartete, bis die Website erneut geladen war. Wieder kroch der blaue Balken nach rechts, und dann war sie drin:
Hallo Jennifer
Der Cursor blinkte unterhalb der Begrüßung. Jennifer leerte das Evian, bevor sie „Bitte Informationen“ eingab.
Sofort erschien die Sanduhr in der Mitte des Bildschirms. Nach einer Weile nahm ein Bild Gestalt an, Zeile für Zeile, bis das Foto eines Mannes zu erkennen war. Er war etwa sechzig Jahre alt, hatte kurze rote Haare und ein sonnengebräuntes Gesicht. Unter dem Foto standen weitere Informationen, die Jennifer in Erstaunen versetzten. Ihr Auftraggeber hatte wirklich ausgezeichnete Arbeit geleistet.
Jennifer erhob sich und ging zu einem wasserdichten, kaminroten Schalenkoffer. Sie stellte die Kombination des Zahlenschlosses ein, ließ den Riegel aufschnappen, öffnete den Deckel und warf einen Blick auf ihre Ausrüstung.
Eingebettet in exakt eingepassten Schaumstoffkammern lag in Einzelteile zerlegt eine der besten Scharfschützenausrüstungen, die derzeit auf dem Markt waren: Ein M-24-Lauf mit Zylinderverschluss, der mit einem satten Klicken an einem kunstfaserverstärkten Fiberglasschaft einrastete, ein Leupold-Zielfernrohr, ein B-Square-Laser, der auf den Gewehrlauf aufgeschraubt wurde und einen hochwertigen Schalldämpfer aus belgischer Produktion.
Jennifer setzte die Waffe mit geübten Handgriffen zusammen, was nicht einmal eine Minute dauerte und legte mehrere teflonbeschichtete .308er Patronen ein und lud durch. Komplett wog die Waffe fast fünf Kilo, so dass nur eine zusätzliche Stütze die notwendige Präzision garantieren konnte.
Jennifer ging auf den Balkon und ließ ihren Blick über die Weite des Meeres schweifen. Es war später Nachmittag und die Sonne stand günstig, so dass sie Jennifer nicht weiter störte.
Kurz vor der Strandpromenade war ein weißer Pavillon aufgebaut, in dem eine größere Feierlichkeit stattfand.
Jennifer legte sich auf den Bauch und schob die Mündung durch die Streben der Balkonbrüstung. Der Gewehrlauf ruhte auf der Gabelstütze, so dass ihr Arm nicht zu viel Gewicht halten musste. Sie blickte durch das Zielfernrohr und ließ ihren Blick über die Gäste in dem Pavillon schweifen. Schließlich entdeckte sie ihre Zielperson und schaltete den Laser ein. Ihr Ziel war weniger als zweihundert Meter entfernt, ein leichter Schuss. Sie atmete tief durch und krümmte dann den Zeigefinger ihrer rechten Hand. Das Gewehr zitterte kurz und sie hörte ein Geräusch, als sei eine Sektflasche entkorkt worden. Die Zielperson zuckte kurz auf und sackte dann in sich zusammen.
Es gab keinen Rauch und kein Mündungsfeuer, das irgendjemand hätte sehen können. Das Geschoss war eine Ultraschall-Patrone, die so gut wie keine Geräusche verursachte.
Jennifer setzte sich auf und zerlegte das Gewehr, während die Gäste nunmehr den Vorfall bemerkten.
Dann packte sie die Einzelteile wieder in den Koffer, klappte den Deckel zu und verstellte das Zahlenschlösschen.
Der erste, schwierige Teil des Planes hatte perfekt geklappt. Der zweite Teil war ein Kinderspiel. Das Päckchen, das Sie nach New York versenden sollte, war schon fertig gepackt. Sie würde es nachher bei der Rezeption abgeben. Alles lief perfekt.
Jennifer lümmelte sich auf das weiche Sofa und zappte durch die Kanäle, bis sie bei MTV an einer Folge von Jackass hängen blieb.
Zehn Minuten später trafen ein Rettungswagen und vier Polizeiautos ein. In der Nähe des Pavillons hatte sich eine Menschentraube gebildet. Die anderen Gäste standen unter Schock und wurden von Polizisten vernommen.
Es dauerte fast eine Stunde, bis ein Polizist auch an Jennifers Tür klopfte, um zu fragen, ob sie irgendetwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört hatte. Sie verneinte und fragte, was denn passiert sei.
„In dem Strandpavillon ist auf einen Mann geschossen worden“, antwortete der Polizist.
„Das ist ja schrecklich. Aber ich habe nichts gehört.“
„Niemand hat etwas gehört“, sagte der Polizist. „Jedenfalls soweit wir bisher ermitteln konnten.“
„Ist er schwer verletzt worden?“, fragte Jennifer.
„Er ist tot.“
„Wirklich?“ Jennifer tat schockiert.
„Es ist furchtbar“, sagte der Polizist. „Er ist mit einem einzigen Schuss förmlich hingerichtet worden. Der Killer muss ein absoluter Profi gewesen sein.“
„Ist das Opfer denn ein Prominenter gewesen?“
Kapitel 1
Vermont, USA
Jack Reilly vernahm das Brummen schon, als es noch einige Meilen entfernt war. Er lehnte an der Brüstung seiner Terrasse und genoss die kühle Morgenluft.
Seit etwas mehr als drei Jahren lebte er auf einer Farm an den Ufern des St. Lorenz River. Jack hatte sich dieses Gebiet als Domizil ausgesucht, weil es noch nicht so stark bevölkert war, wie die großen Städte, die am nicht weit entfernten Eriesee lagen. Nur selten zog es Jack nach Utica, der nächst größeren Stadt, und nach Syracuse oder Albany fuhr er nur zweimal im Jahr. Er hatte die Einsamkeit gesucht und beschlossen, hier den Rest seines Lebens zu verbringen.
Sicher, es gab auch Tage, an dem er sich die Gesellschaft anderer Menschen wünschte. Besonders eines Menschen, doch Stephen lebte nicht mehr, und dies hatte Jack im Laufe der Zeit gelernt zu akzeptieren.
Das Brummen wurde deutlicher und Jack war überrascht, als er am Horizont die Silhouette eines Hubschraubers entdeckte, der zielstrebig auf Jacks Farm zusteuerte.
Jacks Blick folgte dem Helikopter, der scheinbar in der Luft stand. Er erkannte, dass es sich um einen stupsnasigen MH-60G Pave Hawk Hubschrauber handelte, der von aller Welt nur Black Hawk genannt wurde.
Der Pilot setzte den Hubschrauber gut zwanzig Meter vor der Terrasse auf und Jack staunte nicht schlecht, als er auf dem Pave Hawk die Insignien des amerikanischen Präsidenten entdeckte.
Sein Pulsschlag erhöhte sich nur unwesentlich, als der Pilot den Black Hawk verließ und zielstrebig auf ihn zusteuerte. Er musterte den Mann mit einem durchdringenden Blick.
„Jack Reilly?“, fragte der Pilot, in einem Ton, der Jack verriet, dass es der Mann gewohnt war, Befehle zu geben.
„Der bin ich“, antwortete Jack. „Allerdings muss ich Sie enttäuschen, wenn Sie Treibstoff von mir kaufen wollen.“
„Ich bin Captain Greg Kinnear und habe den Auftrag Sie abzuholen.“
„Ich wüsste nicht, dass ich ein Taxi bestellt hätte.“, sagte Jack.
„Ich soll Ihnen das hier geben und Sie bitten, unverzüglich mitzukommen.“ Der Pilot reichte Jack einen Umschlag, dessen zugeklebte Lasche das Dienstsiegel des amerikanischen Präsidenten zierte.
Jack zögerte einen Augenblick, öffnete dann vorsichtig den Umschlag und nahm einen Brief heraus, der nur wenige, handgeschriebene Sätze enthielt.
Jack las die Zeilen, blickte den Piloten an und fragte: „Wie viel Zeit habe ich zum Packen?“
Kapitel 2
Washington D.C.
Rachel Anderson hörte das Telefon nach dem dritten Klingeln. Die Melodie passte zu ihrem Traum, in dem sie, umringt von zwei gut gebauten, muskulösen Latinos an einem traumhaften Pool in Acapulco lag.
Verschlafen griff sie nach dem Telefon und hielt das kleine Nokia an ihr Ohr.
„Ja, bitte?“, meldete sich Rachel verschlafen.
„Hallo Rachel. Hier ist Bob Roberts. Ich hoffe, ich habe Sie nicht geweckt?“
„Wie spät ist es?“
„Kurz nach acht Uhr. Frauen in Ihrer Position müssten schon längst auf den Beinen sein.“
„Es ist Samstag, Bob. Auch Sicherheitsbeauftragte haben ein Recht auf Wochenende.“
Rachel Anderson war Nationale Sicherheitsbeauftragte von Präsident Nathan Frederik Spencer und somit eine der einflussreichsten Frauen der aktuellen Weltpolitik. Sie hatte den Präsidenten kennen gelernt, als er noch Vizegouverneur von Florida gewesen war. Er war Gastredner, als Rachel im Abschlusssemester im Fach politische Wissenschaften an der Stanford Universität studierte. Sie war sofort von seiner charismatischen Ausstrahlung begeistert gewesen. Nach Spencers Rede hatte sie, zusammen mit ein paar anderen Studenten, Gelegenheit dem Vizegouverneur ein paar Fragen zu stellen. Rachel lobte die Vorhaben Spencers und hatte sofort einen guten Draht zu dem Mann, den schon damals viele als zukünftigen Präsidenten sahen.
„Sie gefallen mir, Rachel“, sagte Spencer und drückte ihr, kurz bevor die Veranstaltung zu Ende war, seine Visitenkarte in die Hand. „Setzen Sie sich mit mir in Verbindung, wenn Sie Ihr Studium abgeschlossen haben. Vielleicht habe ich einen Job für Sie.“
Rachel starrte Nathan Spencer mit offenem Mund an, doch brachte sie keine Silbe heraus. Ohne eine Antwort abzuwarten, ging Spencer weiter. In den folgenden Monaten beobachtete Rachel die Karriere Spencers ganz genau. Er zog in den Senat ein, als Rachel ihr Studium beendete. Die Visitenkarte hatte Rachel aufgehoben und eines Tages entschloss sie sich, ihr Glück zu versuchen. Sie rechnete nicht wirklich mit einer Chance, umso überraschter war sie gewesen, als Spencer sie in sein Büro einlud. Zu Rachels großer Überraschung konnte sich Spencer noch an die damalige Veranstaltung erinnern. Und wie versprochen, gab er ihr einen Job in seinem Team.
Von diesem Augenblick an, glaubte Rachel in einem Traum zu leben. Spencers Wahl zum Gouverneur von Florida erlebte sie als stellvertretende Wahlkampfleiterin. Aber immer gehörte sie zum engsten Kreis des Gouverneurs, der der jungen Frau vorbehaltlos vertraute und in vielen Fragen ihre Meinung hören wollte. Natürlich gab es anfangs immer wieder Gerüchte, dass Spencer mehr wollte, als nur die geistigen Fähigkeiten der gutaussehenden Brünetten. Doch darüber konnten Rachel und er nur lächeln, denn nur wenige Menschen wussten, dass Rachel kein sexuelles Interesse am männlichen Geschlecht hatte. Im Laufe der Zeit hatte sich Rachel auch mit Spencers Frau Caroline angefreundet, so dass alle Gerüchte in dieser Richtung alsbald verstummten.
Als Spencer sich entschloss, als Präsident zu kandidieren, wurde Rachel seine Wahlkampfmanagerin und hatte nicht unerheblichen Anteil daran, dass er ins Weiße Haus einzog. Ihre umgängliche Art mit den Medien und ihr messerscharfer Verstand, waren eine Mischung, der sich nur wenige entziehen konnten. Als Dank, aber auch als Referenz an die hervorragende Arbeit, ernannte er Rachel nach seiner Wahl zur Sicherheitsbeauftragten. Sie war damit nach Conduleezza Rice, die zweite Frau in der Geschichte der Vereinigten Staaten, die dieses Amt bekleidete. Und nicht wenige waren der Meinung, dass sie hinter Spencer die mächtigste Person im Weißen Haus war. Der Präsident vertraute ihr weiter vorbehaltlos und weihte sie in alle wichtigen Entscheidungen mit ein.
„Also, was wollen Sie, Bob?“, fragte Rachel ihren morgendlichen Anrufer. Bob Roberts war Chefreporter der Washington Post und einer der Presseleute, die Rachel gerne mit Informationen versorgte. Sie wusste, dass er sorgsam damit umging und er hatte in der Vergangenheit bewiesen, fair und unvoreingenommen über die Politik Spencers zu berichten.
„Kommen Sie Rachel, Sie können sich doch sicher denken, warum ich anrufe.“ Rachel setzte sich aufrecht ins Bett und auch wenn sie keine Ahnung hatte, was Roberts damit andeuten wollte, waren ihre Sinne urplötzlich geschärft.
„Sie wollen mich zum Frühstück einladen, Bob.“ Rachel versuchte ihrer Stimme die aufkeimende Nervosität nicht anmerken zu lassen.
„Lassen wir dieses Spielchen, Rachel. Wir wissen doch beide, wie das Geschäft läuft. Bisher haben Sie mich noch nie im Regen stehen lassen. Außerdem wissen Sie, dass ich alle Informationen vertraulich behandle und sorgsam abwäge, bevor ich meine Artikel schreibe.“
„Bob, Sie wissen ganz genau, was ich von Ihnen halte. Nicht umsonst habe ich Sie immer wieder mit Informationen versorgt. Auch in Situationen, in denen ich es nicht gemusst hätte, aber ich weiß im Augenblick wirklich nicht, was Sie von mir wollen.“
Einen Moment war es still in der Leitung und Rachel hörte, wie Bob kräftig durchatmete.
„Ich glaube Ihnen, Rachel. Aber vielleicht haben Sie trotzdem eine Erklärung dafür, warum der Präsident in aller Frühe nach Camp David geflogen ist?“ Rachels Puls beschleunigte sich. Sie war sich sicher, dass der Präsident heute nicht nach Camp David fliegen wollte, schließlich sollte am späten Vormittag ein Treffen mit seinem engsten Stab stattfinden. Der Wahlkampf stand bevor und Spencer wollte sich mit seinen Vertrauten beraten, welche Strategie sie diesmal benutzen wollten.
„Tut mir leid, Bob. Aber ich habe keine Ahnung. Soweit mir bekannt ist, war ein Besuch in Camp David für dieses Wochenende nicht eingeplant. Aber vielleicht möchte er einfach nur ein bisschen relaxen. Die kommenden Monate werden schließlich für uns alle nicht einfach werden.“
„Das nehme ich Ihnen nicht ab, Rachel. Aus einer anderen zuverlässigen Quelle weiß ich, dass der Präsident für heute Vormittag ein Treffen mit seinem Wahlkampfteam angesetzt hat. Dieses Treffen würde er doch nicht riskieren, wenn nicht etwas Wichtiges passiert wäre. Dafür waren die letzten Umfrageergebnisse zu schlecht.“
„Wie gesagt, Bob. Ich kann Ihnen wirklich nicht helfen.“
„Dann wissen Sie auch nicht, warum eine Einheit der Marines heute Nacht auf unseren Stützpunkt nach Narvik verlegt wurde?“ Bobs Stimme hatte deutlich an Schärfe gewonnen.
„Woher wollen Sie das wissen?“
„Sie wissen doch, Rachel, dass ich meine Quellen habe. Aber es gibt noch etwas Merkwürdiges.“ Rachel merkte, wie sie zu frösteln begann, obwohl es in ihrem Schlafzimmer warm war.
„Und das wäre?“, fragte sie, und war sicher, dass die Antwort ihr unruhiges Gefühl nur verstärken wird.
„Nicht nur der Präsident ist in Camp David, sondern auch eine vollgetankte F-14. Haben Sie vielleicht dafür eine Erklärung?“
Spätestens jetzt war Rachel wach. Ihr Gehirn arbeitete fieberhaft und suchte nach einer Erklärung.
„Hören Sie Bob“, sagte Rachel in ihrem unverfänglichsten Plauderton. „Es wird für alles eine ganz einfache Erklärung geben. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich werde mich erkundigen und rufe Sie zurück. Ich bin sicher, dass sich alles als ganz harmlos herausstellt.“
„Okay, Rachel. Ich vertraue Ihnen. Ich warte dann auf Ihren Anruf.“ Ohne eine weitere Antwort abzuwarten, hatte der Reporter das Gespräch beendet.
Rachel saß im Bett und versuchte ihre Gedanken in den Griff zu bekommen. Sicher musste es für alles eine logische Erklärung geben, denn wenn etwas passiert wäre, hätte der Präsident sie doch sicher schon längst informiert.
Rachel schwang sich aus dem Bett und ging unter die Dusche. Doch ein Gedanke ließ sie nicht mehr los. Hatte Nathan Frederik Spencer zum ersten Mal etwas vor ihr verheimlicht?
Kapitel 3
Camp David
Präsident Nathan Frederik Spencer hatte die Nachricht mitten in der Nacht erhalten, auf einem Apparat, dessen Nummer nur wenigen Menschen bekannt war. Zum Glück hatte Caroline nichts davon mitbekommen, denn sie schlief seelenruhig weiter, während er das Schlafzimmer verließ, um mit dem nächtlichen Anrufer alles zu klären.
Eine Stunde später ließ er sich mit dem Helikopter nach Camp David bringen. Seiner Frau hinterließ er eine kurze Nachricht, dass er nach dem Frühstück wieder zurück sei.
Eigentlich hatte er vorgehabt, den Tag ruhig anzugehen und später mit seinem Team den anstehenden Wahlkampf zu planen. Doch die Nachricht, die Spencer erhalten hatte, sorgte dafür, dass sein sonnengebräuntes Gesicht tiefe Furchen zeigte.
Jetzt stand er in seinem Arbeitszimmer von Camp David, das behaglich aber trotzdem modern eingerichtet war und erkennen ließ, dass der Präsident mit beiden Beinen in der heutigen Welt stand. Die schwere Schreibtischplatte war aus Rauchglas und wurde lediglich von einem Laptop modernster Bauart verziert. Er war stolz darauf, dass er im Umgang mit Computern fast mehr verstand, als eine Vielzahl seiner jüngeren Mitarbeiter.
Es klopfte an der Tür und ein kurzhaariger Secret Service Agent hielt den Kopf ins Zimmer.
„Entschuldigung Mr. President. Aber ich wollte Ihnen mitteilen, dass Captain Kinnear sich gemeldet hat. Mister Reilly sitzt im Black Hawk und ist auf dem Weg hierher.“
„Danke, Charlie.“ Zufrieden nickte Spencer dem Agenten zu. „Stellen Sie bitte bis zur Ankunft von Mister Reilly keine Gespräche mehr durch, außer wenn meine Frau anruft. Ich möchte etwas Ruhe haben.“
„Selbstverständlich, Mr. President.“
Gedankenversunken stand Spencer am Fenster und blickte hinaus, auf das großzügige Gelände von Camp David, welches von der grandiosen Morgensonne in verschiedene Farben getaucht wurde. Die letzten Stunden hatte Spencer mit Grübeln verbracht, immer mit dem Druck, eine Entscheidung treffen zu müssen. Und egal, wie er das Blatt auch drehte, die Entscheidung würde schmerzlich ausfallen.
Im Licht der Sonne sah Spencer sein Spiegelbild und stellte fest, dass er in den letzten Jahren doch etwas gealtert war. Auch wenn seine Berater behaupteten, dass ein paar graue Schläfen ihn nur noch seriöser machten. Er war einen Meter neunzig groß und hatte volles, dunkles Haar, das aber nun in einen silbergrauen Ton überging. Dafür sah er immer noch athletisch aus und hatte sich etwas von seiner körperlichen Statur bewahrt, als er der Footballstar in Stanford gewesen war. Seine wachen, blassblauen Augen und sein schmales Gesicht wirkten in einer Unterhaltung einnehmend und waren einer der Gründe, weswegen oft seine charismatische Ausstrahlung gelobt wurde.
Als Spencer vor knapp vier Jahren das Amt des Präsidenten übernahm, hatte er sich selber geschworen, dass ihn dieses Amt nicht kaputt machen würde. Dafür joggte er jeden Tag dreißig Minuten und nutzte den Fitnessraum im Weißen Haus intensiv. Seit dieser Zeit hatte er an Muskeln zugelegt und an Gewicht verloren, was nicht unbedingt einherging mit den Essgewohnheiten, die dieses Amt mit sich brachte.
Nathan Frederik Spencer hatte es nie in die Politik gedrängt. Im Gegenteil. Die Politik hatte ihn gefunden. Er war einer der besten Strafverteidiger der Bezirksstaatsanwaltschaft in Miami gewesen, als die demokratische Partei auf ihn aufmerksam wurde. Mit seiner Frau Caroline und den beiden Söhnen Nathan Jr. und Jim an seiner Seite, begann ein müheloser Aufstieg, der ihn erst zum Justizminister und später zum Vizegouverneur von Florida werden ließ. Es folgte eine Amtsperiode im Senat, ehe er als Gouverneur nach Tallahassee zurückkehrte – eine ideale Ausgangsposition für den Kampf ums Weiße Haus.
In seiner gesamten politischen Laufbahn waren seine Berater stets darum bemüht gewesen, ein bestimmtes Image für Nathan Spencer aufzubauen. Er galt als moderner, aufgeschlossener Mann mit gesundem Menschenverstand, dem man vertrauen konnte. Trotz seines Sunnyboy Aussehens war er ein Mann, der zupacken konnte. Er war genau der Mann, den die Demokraten suchten. Ein moderater Politiker von angenehmer Erscheinung. Nach acht Jahren republikanischer Herrschaft hatte Amerika das Bedürfnis nach einem Wechsel und wählte Spencer.
Jetzt, vier Jahre später, war seine Wiederwahl alles andere als gesichert. Er wandte sich vom Fenster ab und ging zu einem kleinen Beistelltisch. Er goss sich eine Tasse Kaffee ein und versuchte sich nochmals vorzustellen, welche Konsequenzen die Nachricht haben könnte, die er vor ein paar Stunden erhalten hatte. Sollte die ganze Wahrheit ans Licht kommen, wäre er sicherlich politisch erledigt. Aber das, da war sich Spencer sicher, war dann seine geringste Sorge. Aber er hatte Vorkehrungen getroffen, um alles wieder ins rechte Licht zu rücken. Und vielleicht ließ sich daraus auch Kapital schlagen, denn das amerikanische Volk hatte schon immer Präsidenten verehrt, die in Krisensituationen einen kühlen Kopf bewahren und eine, in ihren Augen, richtige Entscheidung treffen konnten.
Schließlich hatte auch der nächtliche Anrufer zum Ausdruck gebracht, dass alles andere als eine Lösung des Problems und eine Wiederwahl nicht zu akzeptieren sei. Man hatte nicht umsonst exorbitante Summen in die Wahlkämpfe und das Image von Nathan Spencer gesteckt, um nach einer Amtszeit wieder aus dem Weißen Haus gejagt zu werden.
Allerdings hatte sich erst vor kurzem ein Großteil der amerikanischen Bevölkerung gegen seine Amtsführung ausgesprochen und ein Teil des Washingtoner Pressekorps, vor vier Jahren noch glühende Verehrer Spencers, begann bereits einen politischen Nachruf zu verfassen. In den meisten Umfragen lag er sechs bis acht Punkte hinter seinem Herausforderer, Senator Joseph Gifford aus North Carolina, zurück. Im Augenblick war die Wahlverteilung so, dass Spencer in New York, New England und in den Staaten des mittleren Westens seine Anhängerschaft hatte. Sein Herausforderer hatte dagegen Kalifornien, Texas und Spencers Heimat Florida auf seiner Seite. Und hier musste sich dringend etwas ändern, wollte Spencer noch eine zweite Amtszeit erleben.
Spencer wusste, dass das Ereignis der vergangenen Nacht eine große Krise heraufbeschwören konnte, dessen Ende nicht nur seinen politischen Tod zur Folge haben könnte.
Er trat mit der Kaffeetasse in der Hand wieder ans Fenster und überlegte. Wollte er wirklich noch eine zweite Amtszeit? Er war sich nicht sicher, ob er das Stehvermögen für einen erneuten Wahlkampf hatte. Die Reisen durchs ganze Land ödeten ihn und Caroline an. Andererseits war Spencer gierig nach Macht geworden. Außerdem würde man ein Aussteigen Spencers nicht akzeptieren. Denn im Gegensatz zu seinem Herausforderer, hatte Spencer einen großen Vorteil. Er musste nicht diese endlose Geldbeschafferei über sich ergehen lassen, um seinen Wahlkampf zu finanzieren. In Spencers Hintergrund stand mit der Suma Corporation eine Organisation, die alle seine Wahlkämpfe nicht nur finanziert hatte, sondern sein gesamtes politisches Leben versorgt hatte – und dort würde niemand ein Aussteigen akzeptieren. Und ihm war klar, dass man der Forderung nachhaltig Ausdruck verleihen würde, denn die Suma Corporation arbeitete nach dem Motto, wer nicht für sie war, war gegen sie. Und dann gab es genügend Mittel, den Gegner zum Schweigen zu bringen.
Spencer erschauderte bei dem Gedanken.
Er leerte seine Tasse und ging zurück, um sich noch einen Kaffee einzugießen. Spencer zog sein Jackett aus und nahm in einem schweren Ledersessel Platz.
Manchmal wunderte er sich, dass bisher niemand von den Pressegeiern hinter die Identität der Suma Corporation gekommen war. Aber die Tarnung dieser Organisation war so perfekt, dass ein Zusammenhang nicht zu erkennen war. Aber auch Spencers näheres Umfeld hatte sich nie gewundert, woher seine schier nie zu versiegenden Quellen stammten. Nicht einmal seine Sicherheitsbeauftragte Rachel Anderson, seine engste Mitarbeiterin, hatte eine Ahnung, wer wirklich die Fäden im Weißen Haus in der Hand hielt. Oft hatte Spencer vorgehabt, Rachel in alles einzuweihen, sich aber dann doch im letzten Augenblick dagegen entschieden. Rachel alles zu erzählen, hätte bedeutet, die junge Frau in Gefahr zu bringen. Denn er war sich sicher, dass Rachel nie akzeptieren würde, was er akzeptierte und was dann mit ihr passieren würde, konnte sich Spencer ausmalen.
Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass der Hubschrauber bald landen würde. Sein Herzschlag erhöhte sich, als er daran dachte, was er gleich würde tun müssen.
Er verabscheute diesen Gedanken, aber er war unumgänglich. Spencer nahm einen weiteren Schluck aus seiner Tasse. Es gab Dinge, die hasste er an diesem Amt, aber sie waren trotzdem nicht zu verhindern. Das folgende Gespräch mit Jack Reilly gehörte eindeutig dazu, aber nochmals sagte er sich, dass es absolut notwendig war.
Nathan Spencer erhob sich und zog sein Jackett wieder an, während er noch einmal die Worte durchging, die er gleich an Jack Reilly richten würde.
Kapitel 4
Luftraum nach Camp David
Jack brauchte nur zehn Minuten, um ein paar Sachen zu packen und an Bord des Pave Hawk zu steigen. Er war noch nicht richtig angeschnallt, da war der Helikopter bereits wieder in der Luft und zog eine enge Kurve, die Jack einen beeindruckenden Blick auf den St. Lorenz Strom erlaubte.
Der Black Hawk jagte durch den Morgenhimmel und erstmals seit drei Jahren spürte Jack, dass sich sein Pulsschlag etwas erhöhte. Seine Gedanken kreisten um den Brief. Die Nachricht war genauso kurz, wie prägnant. Präsident Nathan Spencer bat Jack um ein sofortiges Treffen, in einer äußerst wichtigen Angelegenheit.
Spencer war ein alter Freund von Jacks Vater und kannte ihn schon von Kindesbeinen an. Für Jack stand außer Frage, dass es wirklich wichtig sein musste, wenn der Präsident Jacks freiwillig gewähltes Exil störte.
„He!“, rief er dem Piloten zu. Seine Stimme ging im Rotorenlärm fast unter. „Wo will mich der Präsident denn treffen? Fliegen wir direkt nach Washington?“
Der Pilot schüttelte den Kopf. „Der Präsident befindet sich heute nicht im Weißen Haus. Wir fliegen direkt nach Camp David.“
„Werden noch andere Personen dort sein?“
„Negativ, Sir. Soweit mir bekannt ist, wünscht der Präsident eine private Unterhaltung mit Ihnen.“ Damit war das Thema für den Piloten beendet und er würdigte Jack keines Blickes mehr.
Zwei Stunden später näherte sich der Helikopter seinem Ziel. Als die Maschine tiefer ging, erkannte Jack den geschichtsträchtigen Ort, den er noch nie zuvor besucht hatte.
Camp David diente als Landsitz des amerikanischen Präsidenten und lag etwa fünfundsechzig Kilometer nordwestlich von Washington im Staate Maryland. Immer wieder war der Ort Zeuge zeithistorischer Treffen gewesen. Neunzehnhundertneunundfünfzig fanden hier Gipfelgespräche zwischen Präsident Eisenhower und Nikita Chruschtschow statt, die wesentlich zur Ost-West-Entspannung beitrugen. Einer großen Öffentlichkeit wurde Camp David ein Begriff, als dort der israelische Premierminister Menachem Begin und der ägyptische Staatspräsident Mohammed Anwar as-Sadat unter maßgeblicher Beteiligung von Präsident Carter über einen Frieden im nahen Osten verhandelten.
Jack fragte sich einmal mehr, was der Präsident von ihm wollte. Was war so wichtig, dass er ihn per Helikopter nach Camp David bringen ließ?
Der Pilot überflog eine Zufahrtsstraße, die von Eichen gesäumt wurde und steuerte direkt auf das mehrstöckige Hauptgebäude zu. Jack war etwas überrascht, als er sah, dass hinter den Gebäudetrakten eine F-14 Tomcat stand. Die Sache wurde immer mysteriöser.
Der Pave Hawk setzte unweit des Haupthauses auf. Sofort stoppte der Motor und Jack war für den Augenblick der Ruhe dankbar.
„Mister Reilly?“ Ein Mann vom Secret Service im dunklen Anzug öffnete die Tür. „Der Präsident erwartet Sie bereits.“
Jack folgte dem Mann zu dem imposanten Anwesen, das nur wenige Schritte entfernt war. Sein geschulter Blick verriet ihm, dass noch weitere Secret Service Agenten an strategisch wichtigen Punkten platziert waren.
Er folgte dem Mann und gemeinsam betraten sie das von außen eher schlicht wirkende Hauptgebäude. Sie passierten eine kleine Diele, deren Ausmaße einer kleinen Einzimmerwohnung glichen und traten in ein Konferenzzimmer, dessen Anblick Jack für einen Augenblick den Atem raubte.
Jacks Schritte waren auf dem dicken Teppichboden nicht zu vernehmen. Und die Inneneinrichtung war luxuriös. Ein langer Konferenztisch aus Ahornholz, um den komfortable, lederbezogene Stühle standen, ein von Messinglampen flankiertes Sofa und eine große Mahagonibar mit einer schier unglaublichen Auswahl feinster Spirituosen.
Jack konnte in diesem Augenblick Begin und Sadat vor sich sehen, wie sie mit Carter am Tisch saßen und über weltpolitische Dinge diskutierten.
Dieser Raum strahlte Macht bis in den letzten Winkel aus. Dies wurde durch das überdimensionale Staatswappen unterstrichen, dem Weißkopfseeadler mit dreizehn Pfeilen und einem Ölzweig in den Klauen, das hinter dem Schreibtisch prangte und auch in die Sofakissen eingestickt, in den Eiskübel eingraviert und sogar auf die Glasuntersetzer aufgedruckt war.
„Nehmen Sie bitte Platz, Jack. Der Präsident wird in wenigen Augenblicken hier sein.“ Etwas erschrocken fuhr Jack herum und sah, wie der Secret Service Mann das Zimmer verließ.
Jack ging an die Bar und goss sich zwei fingerbreit Scotch ein. Er nippte an der sicher sündhaft teuren, goldschimmernden Flüssigkeit und fragte sich zum wiederholten Male, was der Präsident der Vereinigten Staaten von ihm wollte?
Kapitel 5
Camp David
„Jack! Was für eine Freude, dich wiederzusehen“, sagte Spencer, während er Jack die Hand schüttelte. Sein Händedruck war fest und warm.
Jack kämpfte einen Augenblick mit den Worten. „Mr. President, es freut mich...“
„Lassen wir doch die Formalitäten, Jack“, fiel Spencer ihm ins Wort und deutete an, sich an den Konferenztisch zu setzten. „Ich kenne dich schließlich schon, seit du ein Baby warst. Warum solltest du mich also jetzt förmlicher behandeln?“ Jack folgte Spencer an den Konferenztisch und nahm neben ihm Platz. Spencer goss sich einen doppelten Wodka ein und fragte Jack, ob er auch noch etwas trinken wollte. Doch dieser deutete auf sein Glas und verneinte.
„Wie geht es deinem Vater? Ich habe lange nichts mehr von ihm gehört?“ Jacks Vater Jefferson war Besitzer einer renommierten Kanzlei gewesen und kannte Nathan Spencer aus seiner Zeit als Strafverteidiger in Miami.
„Er lebt völlig zurückgezogen. Erst Mom`s plötzliche Krankheit und ihr schneller Tod und nur ein paar Monate später der Tod seines jüngsten Sohnes, das war einfach zu viel für ihn. Er igelt sich total ein und verlässt nur noch sehr selten das Haus.“
„Aber du sprichst ihn doch hin und wieder?“
„Selten. Das letzte Mal habe ich vor einem halben Jahr mit ihm telefoniert. Auch wenn er es nie zugeben würde, aber er gibt mir die Hauptschuld an Stephens Tod.“
„Aber das ist doch völliger Unsinn, Jack. Und das weißt du ganz genau.“ Spencers Tonlage hatte sich kurz verschärft, um danach wieder sanfter fortzufahren. „Niemand kann dir einen Vorwurf machen. Du hast nur deinen Job getan.“
„Das ist richtig“, pflichtete ihm Jack bei. „Aber Dad meint wohl, ich hätte besser auf ihn aufpassen, ihn beschützen müssen. Ich hätte wissen müssen, dass er im Gefängnis vor die Hunde geht.“
„Und was wäre die Alternative gewesen, Jack?“, fragte Spencer. „Hättest du die Beweise gegen deinen Bruder einfach unter den Tisch fallen lassen sollen? Ich glaube nicht, dass damit jemandem geholfen gewesen wäre. Außerdem war Stephen alt genug, um die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Gerade dein Vater müsste das als Anwalt doch wohl am besten wissen.“
„Vielleicht ist das seine Art zu trauern und mit dem Verlust fertig zu werden. Im Prinzip hat er ja auch Recht.“