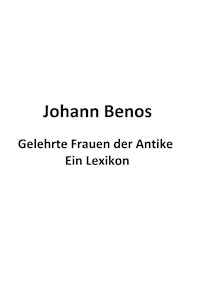
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Gelehrte Frauen der Antike Lexikarisch aufbereitet.
Das E-Book Gelehrte Frauen der Antike - Ein Lexikon wird angeboten von epubli und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
geschichte, Lexikon, Frauen, Antike
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gelehrte Frauen der Antike - Ein Lexikon
1.Einführung 2. Die Frau in den verschiedenen Kulturen 2.1.Die Frau in den verschiedenen Epochen griechischer Kultur 2.1.1. Kykladische Kultur (7000 bis 2000 v. Chr.) 2.1.2. Minoische Zeit (2000 bis 1500 v. Chr.)2.1.3. Mykenische Zeit (1500 bis 1000 v. Chr.)2.1.4. Archaische Zeit (1000-500 v.Chr.) 2.1.4.1. Ionien 2.1.4.2. Griechisches Sizilien 2.1.4.3. Äolien und Lesbos 2.1.5.Klassische Zeit (500 – 323 v. Chr.) 2.1.5.Klassische Zeit (500 – 323 v. Chr.) 2.1.5.1. Athen (6. Jh.) 2.1.5.2. Athen (5. Jh.)2.1.5.3. Athen (4. Jh.) 2.1.5.4.Sparta und Kreta 2.1.5.5. Hetären, die emanzipierten Frauen der klassischen Antike 2.1.5.6. Die Hochschulen und ihre Studentinnen 2.1.5.7. Sport und Frauen 2.1.6. Die Frau in Hellenistischer Zeit (323-201 v.Chr.) 2.1.7. Frühchristliche und Frühbyzantinische Epoche ( 1. Jh. bis 500 n.Chr.) 2.1.7. Mittelbyzantinische Epoche (500 n. Chr. bis 1000) 2.2. Die Römerin 2.2.1. In der Römischen Republik (201 v.Chr. – 1 Jh. n.Chr.) 2.2.2. Im römischen Imperium 2.2.3. Die gelehrte römische Frau 2.3. Die gelehrten germanischen Frauen2.4. Die Frau in Europa außerhalb der griechisch-römisch-germanischen Kultur2.5. Die Hebräerinnen 2.6. Die Inderinnen der Antike 2.7. Die Chinesin in der Antike 3. Fragen zur Gleichberechtigung der Geschlechter4. Die gelehrten Frauen Alphabetisch5. Die philosophischen Schulen und ihre Anhängerinnen 5.1. Diotima´s philosophische Schule5.2. Die Epikureerinnen 5.3. Kleobuline´s philosophische Schule 5.4. Die Kynikerinnen 5.5. Die Kyreneerinnen 5.6. Die Megareerinnen 5.7. Die Neoplatonikerinnen 5.8. Die Neopythagoreerinnen 5.9. Die Peripatetikerinnen 5.10. Die Platonikerinnen 5.11. Pythagoreerinnen 6. Religiöse Philosophinnen 6.1. Gnostikerinnen6.2. Montanistinnen 6.3. Quintilianistinnen 6.4. Christliche Philosophinnen 7. Schlusswort8. Exkurs, gelehrte Frauen des neueren Griechenlands (14. bis 18. Jh.) 9. Literatur1.Einführung
Heutzutage sind die Frauen in fast allen Kulturkreisen der Erde immer noch gegenüber Männern benachteiligt, allerdings nicht überall in gleichem Maße. In manchen sind sie fast gleichberechtigt, in anderen dürfen sie keine eigene Meinung haben und sind fast rechtlos.
Auch früher war dies nicht anders, allerdings gab es von Epoche zu Epoche Schwankungen. Manchmal besaßen die Frauen mehr Rechte und waren den Männern gegenüber fast gleichberechtigt, und manchmal waren sie rechtlos. Manchmal wurden sie wie Sklavinnen gehalten, und manchmal durften sie sogar über Männer regieren. In anderen Kulturen und Epochen lag ihr Schicksal zwischen den zwei Extremen. In Griechenland hatten sie je nach Epoche mehr oder weniger Rechte. Es gab ein Auf und Ab.
Auch heute noch betrachten etliche Männer Frauen als minderwertig, selbst in unserem Kulturkreis. Zwar äußern sie ihre Meinung über Frauen nicht offen, weil so etwas eine Empörung auslösen würde, aber in Kneipengesprächen unter Männern hört man solche Meinungen. Wenn einer Frau etwas misslingt, wird sofort verallgemeinert: „Ach, die Weiber“, oder „Frauen können es halt nicht“, und immer noch gilt bei einigen Männern „cherchè la femme“, hinter einem Unglück oder bei einem Verbrechen wird also schnell eine Frau vermutet.
In der griechischen Enzyklopädie „Ilios“ von 1948/49 in der Biographie von Hypatia aus Alexandria steht, dass sie das einzige Bespiel einer weiblichen Philosophin (sic) in der Weltgeschichte(!) sei. Welcher Irrtum! Allein aus der Antike kennen wir etliche Philosophinnen, die von ihren männlichen Zeitgenossen erwähnt und bewundert wurden.
Es gibt sehr wenig Literatur zu Biographien von gelehrten Frauen der Antike, es sei denn, sie haben eine politische Rolle gespielt, und ihre Biographie gehört zur Geschichte des Landes. Oder sie zeichneten sich durch besondere Tapferkeit oder „Tugend“ aus. Es gab drei Frauen in der griechischen Geschichte, die eine bedeutende geschichtliche Rolle gespielt haben und viel bedeutender waren als die meisten Männer. Sie haben die Weltgeschichte nicht nur beeinflusst, sondern verändert und gestaltet. Es handelt sich hier um die gelehrte Aspasia aus Milet, die Ehefrau des Athener Staatsmannes Perikles, durch deren Initiative das entstand, was man heute an der Athener Demokratie bewundert, außerdem um Kleopatra VII., die Ptolemäerin, Königin von Ägypten, die versuchte hatte, das Reich Alexanders des Großen wieder herzustellen, aber an der Unfähigkeit ihres Liebhabers Marcus Antonius scheiterte und nicht zuletzt um die Kaiserin Theodora aus Zypern, die Ehefrau von Kaiser Justinian, die das Oströmische Reich rettete und die Griechen zu den geistigen und politischen Herrschern des Byzantinischen Reiches machte. Auch zwei geistige Größen kennen wir, die die Literatur und Wissenschaft stark beeinflussten, die Dichterin Sappho aus Lesbos und das Universalgenie Hypatia aus Alexandria. Diese Frauen kann keiner verschweigen, wenngleich manche Historiker versuchen, sie zu diffamieren. Trotz des hervorragenden Beitrags der Frauen – ich habe hier vor allem die alten Griechinnen erwähnt, denn die Nennung der Frauen aller Nationalitäten hätte Bände gefüllt - gibt es Männer, die den Wert der Frauen herabzusetzen versuchen. Es wird sogar behauptet, dass die meisten Werke der antiken Wissenschaftlerinnen und Philosophinnen deshalb verloren gingen, weil sie „minderwertig“ waren!! Mit anderen Worten nur Männer schreiben wertvoll!!
Man versucht den Wert der Hälfte der Menschheit herabzusetzen und zum Untertanen der anderen zu machen. Es wäre das gleiche, würde man bei einem menschlichen Körper die eine Hälfte zum Untertanen der anderen machen wollen. Dies würde zum Untergang des Individuums führen. Trotzdem lässt sich die Menschheit zur Hälfte zu Untertanen der anderen Hälfte machen. Dies ist schon fast als Verbrechen an einem der betroffenen Geschlechter anzusehen, nämlich den Frauen. Ein Kulturkreis, in dem Männer und Frauen nicht gleichgestellt sind, ist ein Körper, dem eine Hälfte fehl und somit eine behinderte Kultur.
Ich habe mich auf die antike Welt beschränkt, vor allem auf Griechenland und Rom, aber auch die bedeutendsten Frauen aus China und Japan und hervorragende weitere Persönlichkeiten aus anderen Ländern erwähnt. Meine Arbeit endet etwa im 10. Jh. n. Chr., da von da an die meisten Staaten und Nationen begannen, sich intensiver mit der Wissenschaft, Literatur und Kunst zu beschäftigen. Die Zahl der gelehrten Frauen nahm stark zu und generell wuchs ihr Beitrag in der geistigen Entwicklung in ihren Heimatländern und international erheblich.
Ich habe mich deswegen auch ausschließlich auf die gelehrten und intelligenten Frauen beschränkt und keine Herrscherinnen genannt, es sei denn sie waren Gelehrte, die sich trotz aller gesellschaftlichen Schwierigkeiten, eine hohe Bildung aneignen konnten, entweder aus eigenen Kräften oder mit Unterstützung ihrer Eltern oder anderer Personen aus ihrem Umfeld. Ich will damit nicht behaupten, dass politisch tätige Frauen weniger intelligent sind, mitunter sind sie sogar hochintelligent, aber sie gehören nicht alle zur Gruppe der Gelehrten. Wenn sie sich nachweislich mit Literatur, Kunst, Wissenschaft und Kultur beschäftigt und Werke geschaffen haben, dann habe ich sie in diese Studie aufgenommen.
Aufgenommen wurden außer Philosophinnen und Wissenschaftlerinnen vor allem Schriftstellerinnen, dann Malerinnen und Bildhauerinnen und andere Künstlerinnen, die ihr Fach erlernt und danach andere darin ausgebildet haben. Allerdings wären Bände nötig, wie gesagt, wollte ich alle hochintelligenten Frauen der Antike erwähnen. Damals gab es nämlich viel mehr hochintelligente gelehrte Frauen als die Erwähnten, aber die männlich geprägte Historiographie der damaligen und späteren Zeit bis heute, wollte und will sie nicht selten verschweigen. Wir kennen nur die, die nicht verschwiegen werden können.
Auffällig ist, dass die meisten gelehrten Frauen der Antike Griechinnen sind. Dies liegt daran, dass wir die meisten Informationen über sie haben und Bildung bei den Griechen sehr früh einen hohen Stellenwert besaß. Außerdem gab es auch sehr viele große und kleine wohlhabende griechische Staaten, die demokratisch regiert wurden, eine der Voraussetzungen für die Entfaltung geistigen Lebens. Sie übten eine große Anziehungskraft auf andere Völker aus, die teilhaben und Griechen sein wollten und dies auch wurden. Die griechischen Städte übten die gleiche Anziehungskraft aus wie heute die U.S.A. So sind heute die meisten Berühmtheiten „Amerikaner und Amerikanerinnen“. In anderen Ländern wie z.B. im pharaonischen Ägypten hatte die Masse trotz der hohen Kultur keinen Anteil an der Bildung und keinen Zugang zu wissenschaftlichen Büchern, abgesehen von der Priesterschaft. Zwei hochintelligente starke Persönlichkeiten wurden aus dieser Zeit bekannt: Hatschepsut und Nofretete, beide Herrscherinnen, aber keine Gelehrte. Erst während der griechischen Herrschaft der Ptolemäer, der Gründung der Universität und Bibliothek von Alexandria sowie der Ansammlung griechischer Gelehrter in Ägypten finden wir eine Zunahme gelehrter Männer und Frauen, allerdings nicht als Ägypter, sondern als Griechen, denn die Menschen identifizierten sich zumeist mit dem herrschenden Volk. In den anderen Völkern des Orients war es ähnlich. Die große Königin Assyriens Semiramis war eine Gelehrte und steht deshalb im Lexikon der gelehrten Frauen. Die arabische Königin Zenobia und die persische Königin Atossa (sie soll die erste Frau Persiens gewesen sein, die Briefe schreiben konnte) waren „nur“ Königinnen und gute Politikerinnen, keine Gelehrte. Allerdings wissen wir von der Hethiterin Puduhera (13. Jh. v. Chr.), der Ehefrau des Königs Hattuschilis III., dass sie schöne Gebete geschrieben hatte, kennen aber nichts aus ihrem Leben. Weitere gelehrte Frauen sind dort nicht überliefert, sondern nur ein paar Männer. Auch sind uns nur wenige gelehrte Römerinnen oder Frauen mit römischem Bürgerrecht aus der Zeit der Republik bekannt bis auf einige berühmte Politikerinnen und starke und intelligente Frauen. Es gab in Rom bestimmt auch in dieser Zeit gelehrte Frauen, aber Quellen darüber fehlen, ebenso wie über italische, gallische, britische und iberische Frauen. Auch die Autoren, die Kurzbiographien berühmter Frauen aus aller Herren Länder geschrieben haben, erwähnen sie nur wegen ihrer Tapferkeit, ihrem Edelmut, ihrer Schlauheit und „Tugend“, nicht wegen ihrer Gelehrsamkeit, weil letzteres nicht gefragt war. Erst in der römischen Kaiserzeit, als die lateinische Bildung fortgeschritten war, fanden wir gelehrte Römerinnen.
In einem Exkurs erschien es mir richtig, auch einige repräsentative gelehrte griechische Frauen zu beschreiben, die im 14. Jh., 15. Jh., 16. und 17. Jh. sowie im 18. Jh. gelebt haben, um zu zeigen, dass es auch in schwierigen Zeiten Frauen gab z. B. während der Besatzung Griechenlands durch das Osmanische Reich, als Bildung schon für junge Männer beinahe unmöglich war, die kaum eine Möglichkeit fanden, ihren Wissensdurst zu stillen und sogar Gelehrte zu werden, so wie einige Theologinnen des 14. und 15. Jh. Laskarina Bouboulina war die erste Admiralin der Weltgeschichte, die diesen militärischen Rang offiziell in einem Staat erlangte oder Manto Mavrogenous, die erste Generalin der griechischen Geschichte und gleichzeitig Gelehrte, außerdem die erste bedeutende Malerin Neugriechenlands Thalia Flora-Karavia, die bedeutendste Philosophin Neugriechenlands Evanthia Kairi, die Ärztin Matio Megdani-Sakellariou, die gleichzeitig, aber unabhängig von dem Briten Edward Jenner (1749-1823) die Polioimpfung erfand, die jedoch heute
2. Die Frau in den verschiedenen Kulturen
2.1.Die Frau in den verschiedenen Epochen griechischer Kultur
Die Lage der griechischen Frau wird in fast allen Abhandlungen über das kulturelle Leben des antiken Griechenlands so behandelt, als entsprächen 1000 Jahre einer Epoche. Die Autoren analysieren die Lage der Frau pauschal vom 7. Jh. v. Chr. bis zum 4. Jh. n. Chr. und benutzen, um ihre Argumente zu untermauern, Autoren wie Homer, Aristoteles und christliche Schriftsteller, als wäre die Zeit stehen geblieben und die Bräuche in dieser Zeitspanne gleich geblieben, ganz so, als würden wir das Leben in Europa vom Mittelalter bis heute wie eine Epoche behandeln und die Frauenrechte des Mittelalters auf die Frau des 19. Jh anwenden. Dabei ändert sich die Welt und damit die Menschen und ihre Einstellung zu einem Thema innerhalb von 20 bis 30 Jahre gewaltig. Die Lage der Frau in 18 Jh war eine andere als im 19. Jh und wiederum eine andere als im 20. Jh. Da wir keine genauen Details über die Änderung der Bräuche und die Lage der Frau in so kurzen Abständen herausfinden können, versuche ich dies jeweils über einen Zeitraum von 200 Jahren, jedoch erst seit 700 v. Chr. und damit der Zeit des Beginns der Geschichtsschreibung. Die früheren Epochen müssen pauschal behandelt werden. Außerdem darf man Hellas nicht als einen Staat mit gleichen Sitten und Bräuchen betrachten, in dem die Frauen überall die gleichen Rechte gehabt hätten. Erst nach Alexander dem Großen dürfen wir die Griechen und Griechinnen des Riesenreiches als zwei Größen behandeln.
2.1.1. Kykladische Kultur (7000 bis 2000 v. Chr.)
Die älteste Kultur auf griechischem Boden nennt man kykladische Kultur, weil die meisten Kulturerzeugnisse dieser Zeit auf den Kykladen gefunden wurden, auch wenn es in Thessalien in der Nähe der heutigen Stadt Volos ein ganzes Wehrdorf gab, das von 7000 bis etwa 1000 v. Chr. existierte, und man dort bei Ausgrabungen viele Tonscherben aus der ältesten Zeit der griechischen Geschichte fand.
Die archäologischen Funde dieser Kultur zeigen die große Bedeutung der Frau. Die Statuen und Statuetten dieser Zeit auf den Kykladen zeigen vorwiegend Frauen mit hohen Hüten, wahrscheinlich Priesterinnen oder Priesterinnen-Königinnen. Sie bezeugen den hohen Stellenwert der Frau dieser Zeit.
2.1.2. Minoische Zeit (2000 bis 1500 v. Chr.)
Die erste Kunde über gelehrte Frauen haben wir aus der sog. minoischen Zeit, und zwar erfahren wir aus der Mythologie, durch Legenden und bildliche Darstellungen, welche große Bedeutung die Frau in dieser Epoche spielte.
In der kretisch-minoischen Zeit spielten die Frauen in Politik und öffentlichem Leben genau die gleiche Rolle wie die Männer. Betrachtet man die Wandmalereien, so sieht man, dass die Frauen an allen Aktivitäten der Männer teilnehmen, und beurteilt man vor allem die griechische Mythologie, die zum größten Teil aus dieser Zeit stammt, waren die Frauen nicht nur Herrscherinnen, sondern auch Kämpferinnen, bedeutende Athletinnen, Jägerinnen und Priesterinnen und übten auch sonst die gleichen Berufe wie die Männer aus.
2.1.3. Mykenische Zeit (1500 bis 1000 v. Chr.)
In der mykenischen Zeit nahm die Bedeutung der Frau in der Politik etwas ab, und ihre Position in der Gesellschaft war nicht mehr unantastbar. Allerdings blieben die vorkommenden hervorragenden Frauengestalten in der Mythologie und in den Legenden genauso zahlreich wie die Gestalten der Männer. Die Göttinnen hielten ursprünglich das Gleichgewicht mit den Männern, nun aber haben wir mehr Götter als Göttinnen und mehr Krieger und kaum Kriegerinnen. Die „Große Mutter“ verlor ihre hervorragende Bedeutung, und aus „Dione“ wurde „Dias“, der mit dem „Zeus“ verschmolz. Nun haben wir auch viele Seher und Priester. Die Frauen konnten noch Könige auf den Thron bringen oder absetzen, Herrscher waren nun meistens Männer. Aber Frauen liebten den, den sie wollten, und wenn sie uneheliche Kinder bekamen, auch wenn sie verheiratet waren, sagten sie einfach, es handele sich um das Kind eines Gottes, was die Väter oder Ehemänner auch akzeptierten. So wurde die autretene Doppelmoral der Gesellschaft, die den Frauen nicht zugestand was den Männern erlaubt war, gesellschaftlich akzeptiert. Antiope, verheiratet mit Enopeus, gebar von Zeus angeblich Zwillinge, Zethos und Amphion, Kalchinia bekam von Poseidon Peratos, den achten König von Sykeon, und seine Urenkelin zeugte mit Apollon Korone. Chthonophyle bekam von Hermes Polybos, den König von Korinth, Io aus Argos bekam von Zeus Epaphos, Amymone zeugte mit Poseidon Nauplieus, und Danae gebar von Zeus den König Perseus. Aithra, die Ehefrau von Ägeus, dem König von Athen, bekam von Poseidon Theseus usw. Sogar Priesterinnen, denen es nicht erlaubt war, mit Männern sexuell zu verkehren, bekamen von den „Göttern“ Kinder, Timandra (gr. die ihren Mann ehrt) betrog ihren Ehemann Echemos, König von Tegea, mit einem Proletarier. Eryphyle spielte eine maßgebende Rolle im Königreich Argos.
Atalanta, die große Heldin und weiblicher Herakles, tötete mit ihren Pfeilen zwei Kentauren, als sie sie zu vergewaltigen versuchten, und sie kämpfte besser als Männer gegen wilde Tiere. Sie ist diejenige, die mit mehreren Männern auf die Jagd ging, um den kaledonischen Eber zu erlegen, einen sehr großen Eber, der die Felder der Bauern verwüstete, und sie war diejenige, die ihn erlegte. Ihrer Forderung entsprechend wollte sie nur denjenigen heiraten, der sie im Rennen besiegen konnte. Melanion besiegte sie und bekam sie. Aber sie hatte auch Kinder von Ares und vom Helden Meleagros. Hippodamea machte etwas Ähnliches. Nur wer sie beim Wagenrennen, das ihr Vater veranstaltete, besiegte sollte ihr Ehemann werden. Die schöne Helena soll, bevor sie Menelaos heiratete, mit Theseus und Achilles geschlafen haben, und ihr Liebesabenteuer als Verheiratete mit Paris ist bekannt. Ihre Rückführung nach Hause durch Menelaos blieb ohne Konsequenzen für sie[1], aber bevor er sie zurückholte, hatte sie nach dem Tode von Paris noch den Troer Deiphobos als Liebhaber. Laut anderen Quellen soll sie weitere Liebhaber gehabt haben. Ihre Tochter Hermione machte es ähnlich. Erst hatte sie ein Verhältnis mit Neoptolemos und dann mit Orestes.
Frauen erscheinen in der Mythologie auch als Gründerinnen von Königreichen. Sparta von Sparta, Messene von Messenia, Kallisto-Arkte von Arkadien usw. Dichter der klassischen Zeit machten aus dem erotischen Leben ihrer Heldinnen nicht selten Schandtaten, und die Frauen wurden zu den verachtenswertesten Frauen Griechenlands. Mancher änderte ihr überliefertes Lebensende und schrieb quasi unter Zuhilfenahme dieses Stoffs eine Kriminalgeschichte.
Die hohe Stellung der Frau dieser Zeit beweist der Mythos, dass Athena, die Göttin der Weisheit und der Wissenschaften, Tochter von Zeus, aus seinem Kopf geboren wurde. Die neun Musen der Wissenschaft, Kunst und Literatur waren ebenfalls Frauen, und die Weissagungen für Apollon, den Sonnengott, taten Frauen kund, nämliche Pythia und Sybillen. Sie blieben auch bei den späteren Griechen in Geltung, „ein weiterer Beweis für die Anerkennung und Würdigung weiblicher Umsicht und Weisheit“.[2]
In archaischer Zeit erfand man die Geschichte von Epipole, Tochter des Trachion aus Karystos in Euböa, die in Troja in Männerkleidung tapfer mit den Achäern gegen die Trojaner gekämpft hatte. Als man ihre Verkleidung erkannte, töteten sie die Achäer zur Strafe, weil sie ein männliches Territorium, Krieg und Schlacht, entweihte. Die Frau muss existiert haben, aber ihr Lebensende ist lediglich eine phantastische Legende. In dieser Zeit gab es genug Frauen als Kriegerinnen, die Amazonen. Sie waren kein eigenes Volk, sondern Frauen von Stämmen im heutigen Russland und Kleinasien, die mit den Männern zusammen kämpften oder sogar eigene weibliche Abteilungen unterhielten.
Über Literatur, Künste und Wissenschaft wissen wir leider kaum etwas. Die Dichter Homer und Hesiod lebten an der Grenze zur archaischen Zeit (9. oder 8. Jh. v. Chr.) und vermischten in ihren Werken die Realität mit der Mythologie. Sie nutzten zwar Quellen aus mykenischer Zeit, aber sagten nicht die volle Wahrheit über die Frauen ihrer Vorzeit. Homer soll sogar ganze Passagen von Gedichten und Überlieferungen aus mykenischer Zeit in seine „Ilias“ übernommen und eventuell verändert haben.
Am Ende der mykenischen Zeit im 12.-11. Jh., dem „heroischen“ Zeitalter der „Helden“, der Krieger und Gewalttäter, gab es für gelehrte Frauen und Männer keinen Platz. Aber es gab viele selbstbewusste und starke Persönlichkeiten, Herrscherinnen und Prinzessinnen wie Medea, Klytemnestra, Antigone, Elektra, Iphigenie u.a., die noch Jahrhunderte später die Männer fasziniert haben, entweder bewundernd oder verteufelnd.
[1] Licht, Sittengeschichte, S. 34.
[2] Gleichen-Russwurm, Kultur und Sitte in Hellas. Bd,1, S. 456.
2.1.4. Archaische Zeit (1000-500 v.Chr.)
2.1.4.1. Ionien
Auf eine unruhige Zeit folgte in Griechenland eine längere Phase relativer Ruhe. Zuvor war als Folge der kulturellen und gesellschaftlichen Umwälzungen wie der dorischen Einwanderung etc. eine völlig neue Kulturepoche entstanden. Neue Städte wurden geegründet und alte verschwanden. Vor den einwandernden Nordwestgriechen wichen die Achäer und Ionen aus und besiedelten die kleinasiatische Küste und ihre Inseln, die zu Ostgriechenland wurden. Im 7. Jh. entstanden im griechischen Osten die ersten philosophischen Schulen Griechenlands, eine Art Universitäten, allerdings nicht nach Fakultäten eingeteilt, sondern die Studenten durchliefen zunächst ein Studium Generale und spezialisierten sich erst später. Wichtigstes Zentrum war die Kulturstadt Milet, die bereits die Kreter vor über tausend Jahren gegründet hatten und der die Ionen zu neuer Blüte verhalfen. Thales von Milet gründete eine naturwissenschaftliche Schule mit wissenschaftlicher Forschung und schuf so die erste Universität der Welt mit vier Fakultäten: Physik, Astronomie, Chemie und Philosophie. Ob bei ihm Frauen studiert haben, wissen wir nicht. Eventuell ja. Die Frauen der Ionen bzw. Achäer müssen von ihrer ftüheren Position nicht viel eingebüßt haben. Auch die Dichtung erlebte einen Aufschwung, vor allem auf den Kykladen-Inseln. Die verschiedenen Dichtungsarten wurden erfunden und erlebten ihren Höhepunkt: die jambische Dichtung mit Archilochos aus Paros, die erotische Dichtung von Hipponax aus Ephesos und die elegische Dichtung von Mimnermos aus Kolophon. Die meisten Dichterinnen widmeten sich der Lyrik. Diese Dichtungsart passte mehr zu den Frauen, weil sie emotional ist, und so traten sie hier besonders hervor. Die berühmteste Lyrikerin war gewiss Sappho aus Lesbos, die „zwölfte Muse“, die sogar alle Männer ihrer Zeit übertroffen hatte.
2.1.4.2. Griechisches Sizilien
Im 6. Jh. v. Chr. verließen viele geistige Größen der Griechen und Griechinnen ihre Heimat Kleinasien, weil dieses erst die Lyder und dann die Perser besetzten und dort Tyrannen einsetzten, die jede freie geistige Aktivität stoppten. Die Gelehrten, die die Tyrannen nicht beweihräuchern wollten, konnten nicht unter einer Diktatur leben, lehren und forschen und fuhren Richtung Westen und Norden. So verbreiteten sich Künste und Wissenschaft auch auf dem griechischen Festland und in Italien, wo Westgriechenland (Unteritalien und Sizilien) entstand, so dass ganz Griechenland an den Kulturereignissen teilhaben konnte. Eine der frühen philosophisch-wissenschaftlichen Schulen war die bereits im 6. Jh. entstandene Hochschule der Pythagoreer, gegründet von Pythagoras aus Samos in der Griechenstadt Unteritaliens Kroton (heute Crotone). Dort wurde Mathematik, Geometrie, Medizin, Musikwissenschaft, Religion, Astronomie und Ethik gelehrt. Pythagoras und seine Frau Theano predigten außer den Wissenschaften nicht nur die Gleichberechtigung, sondern auch die Gleichstellung aller Menschen. Er nahm Frauen nicht nur als Studentinnen auf, sondern bildete sie in seinem engeren Kreis zu Philosophinnen aus. Der britische Althistoriker Michael Grant schreibt, dass „Pythagoras unter seinen Schülern siebzehn Frauen zählte“.[1] Auch im Originaltext von Iamblichos, der die Biographie seines Meisters verfasste, steht, dass sich unter den Schülern 17 Frauen befanden, die aus ganz Griechenland stammten und die allerberühmtesten (epiphanestatai) pythagoreischen Philosophinnen waren, was bedeutet, dass zu seinen Schülerinnen auch nicht bekannte Philosophinnen und einfache Studierende gehörten, die keine Philosophinnen wurden, sondern andere Berufe ergriffen und sich dort lediglich bildeten. Die Anzahl der Studentinnen muss demnach viel höher gewesen sein. Dazu kamen die Studentinnen anderer pythagoreischer Lehrer. Wahrscheinlich belief sich ihre Zahl insgesamt auf mehrere hundert.
In den Staaten, in denen die Pythagoreer herrschten: Kroton, Taras/Tarent und Metapontion war die Frau gegenüber den Männern gleichberechtigt und konnte sich entfalten wie sie wollte. Ehebruch der Männer wurde bestraft und Misshandlungen von Frauen mit Ausschluss aus der Gemeinschaft. Die Mädchen konnten sich frei auf dem Markt bewegen und den Mann ihrer Wahl heiraten. Und es gab viele weitere Vergünstigungen für Frauen. Pythagoreer hatten aber auch strenge Lebensvorschriften. Man duldete keine sexuellen oder andere leibliche Exzesse, auch keine vor- oder außerehelichen Beziehungen. Luxus war nicht erlaubt, und alle sollten ein einfaches Leben führen. Auch Essvorschriften gab es mit einem Verbot von Saubohnen bzw. braunen Bohnen (κύαμος), die eigentlich keine Bohnen sind und bei Menschen, denen ein bestimmtes Ferment im Körper fehlt, schwere Reaktionen hervorrufen können, den Κyamismus, der sogar tödlich verlaufen kann. Pythagoras verbot, nicht alle Bohnen zu essen (Weiße Bohne=φάσηλος oder φασίολος), wie mancher heutige Autor behauptet.
[1] Grant, Von Alexander.., S. 281
2.1.4.3. Äolien und Lesbos 2.1.5.Klassische Zeit (500 – 323 v. Chr.)
Die Äolier, ein alter griechischer Stamm, lebten in Thessalien und in mykenischer Zeit auch in Böotien, bevor sie von den Böotiern vertrieben wurden. Viele von ihnen wanderten nach Lesbos und an die gegenüber liegende Küste (Äolien und Troas) aus. Die Stellung der Frau in archaischer und klassischer Zeit war in Thessalien die gleiche wie in der mykenischen Zeit. Die Frau hatte also viele Rechte wenn auch nicht die vollkommene Gleichberechtigung. Später kamen auch andere griechische Stämme hinzu und veränderten den äolischen Charakter Thessaliens. Lesbos und Äolien blieben bis in die hellenistische Zeit die wichtigste äolische Region. Die Stellung der Frau war hier hoch; nirgendwo sonst gab es so viele Schulen für Mädchen wie auf Lesbos, sämtliche geführt von gelehrten Frauen, die alle literarisch tätig waren (Sappho, Andromeda, Gorgo, Mika). Sie hatten auch die ersten Mädchenschulen für die höhere Bildung der Mädchen gegründet. Die Frauen genossen große Freiheit, was im Athen der klassischen Zeit unvorstellbar gewesen wäre, so dass die Athener der dortigen Frauen die lesbische Liebe andichteten, insbesondere wegen der Mädchenschulen. Sport unter Frauen war wahrscheinlich verbreitet. Eine Statuette, die in Pyrra auf Lesbos gefunden wurde, zeigt eine nackte Frau bei gymnastischen Übungen. Wahrscheinlich beeinflusst von der neuen Zeit, gab es auch bedeutende Dichter, die frauenfeindliche Gedichte schrieben wie Simonides aus Amorgos. Auf Lesbos blieb jedoch die Bedeutung der Frau sehr hoch. Leider brach diese günstige Entwicklung später wieder ab.
2.1.5.Klassische Zeit (500 – 323 v. Chr.)
2.1.5.1. Athen (6. Jh.)
In diesem Jahrhundert herrschten weigehend die Bräuche der archaischen Zeit. Die Frau lebte wie ihre Zeitgenossinnen im kleiasiatischen Ionien. Die Eltern erlaubten ihren Töchtern, sich ihren Ehemann selbst auszusuchen, wie Herodot von einem Vater aus dem Athen dieser Zeit erzählt, Kallias, der beiden Töchtern erlaubte, die Athener zu heiraten, die sie auserwählt hatten.[1] Wahrscheinlich gab es schon Tendenzen, dies zu ändern und wieder die Väter über ihre Töchter bestimmen zu lassen.
[1] Herodot, VI, 122.
2.1.5.2. Athen (5. Jh.)
Die Athener begannen, die Rechte der Frauen einzuschränken. Warum? Durch die Geschichte ist dies nicht zu erklären. Alexander von Gleichen-Russwurm glaubt, die Demokratisierung der ionischen Staaten und das Interesse der Männer an Politik habe zu unterschiedlichen Interessen zwischen Männern und Frauen geführt und zur Zurücksetzung der Frau.[1] Das kann jedoch unmöglich der Grund dafür sein. Gerade der ionische und der athenische Frauenstand zeigen orientalische Züge.[2] Haben die kleinasiatischen Ionen von ihren Nachbarn orientalische Bräuche übernommen und an die Athener weiter gegeben, wenngleich, wie später Aristoteles sagte, bei den Hellenen in „abgeschwächter Form“ im Vergleich zu den Barbaren? Er meint der Stand der Frau war nie gleichgesetzt mit demjenigen von Sklaven!! Wahrscheinlich eher etwas besser!!
[1] Gleichen-Russwurm, Bd. 3, S. 444
[2] Βaumgarten, et al., S. 289
2.1.5.3. Athen (4. Jh.)
Im vielbewundernden Staat der Athener, den „Erfindern“ der Demokratie, hatten die Frauen der klassischen Antike nicht die gleichen Rechte wie die Männer und sogar weniger als die anderen Griechinnen. Der Autor Ermippos aus Smyrna (3. Jh. v.Chr.) schrieb, dass angeblich der Philosoph Thales aus Milet gesagt haben soll „der Mann soll unteranderen den Götter Dank verpflichtet sein dass er Mann und nicht Frau geboren ist.[1] Die Frauen konnten als weiblicher Herkules zwei Wege wählen, den „ehrenhaften“ ewig langweiligen als Hausfrau und Mutter und zu Hause fast eingesperrt[2] oder den „unehrenhaften“ einer emanzipierten Frau, die mit den Männern zwanglos umging, einen Liebhaber haben oder in „wilder Fhe“ leben und sich künstlerisch oder wissenschaftlich betätigten. Diese Frauen wurden etwas abfällig „Hetären“ (Freundinnen) genannt, die fast jeden „nichtmännlichen“ Beruf ergreifen und auch Philosophinnen werden konnten. Beispiele hierfür gibt es genug, obwohl einige moderne Historiker etwas anderes behaupten. Frauenmisshandlungen waren jedoch in Athen verboten und wurden streng bestraft.
Da in Athen Bildung Privatsache war und der Staat lediglich die Aufsicht über Schulen und Lehrer führte, konnte jeder Bürger, wenn er wollte, seine Töchter von Privatlehrerinnen ausbilden lassen und zwar zuhause. Eine umfassende Bildung wie in Lakonien oder Äolien erhielten die Mädchen nicht. Manche Athener Autoren machten deswegen böse Witze über Frauen dort und die weibliche Intelligenz.
Die Ehefrauen und die zur Heirat bestimmten Mädchen der wohlhabenden Bürgerfamilien blieben meistens zuhause eingesperrt, führten den Haushalt mit Hilfe der vielen Sklaven und Sklavinnen und wohnten in einem abgetrennten Teil des Hauses (γυναικών). Sie beschäftigten sich ansonsten mit Weben, Sticken, Stricken, Spinnen u.a., blieben aber vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Der Ehemann besuchte seine Frau meistens nur zwecks Geschlechtsverkehrs bzw. Kinderzeugung und blieb nicht einmal die ganze Nacht bei ihr. Der deutsche Historiker Wilhelm Wägner (Ende des 19. Jh.) findet trotzdem diese Ehe „für beide Teile sehr beglückend.“[3] Wer weiß, was er dabei dachte. Vielleicht war er dafür, dass Derartiges auch in Deutschland eingeführt worden wäre. Gewiss gab es aber auch Liebespaare unter den Eheleuten, wie z.B. Xenophon[4] und Platon[5] berichteten.
Die Mädchen erhielten Unterricht in Tugend, nur Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben, Singen, Tanz und Musik und ausführlichere Unterweisung in den üblichen Frauenarbeiten wie Kochen, Weben u.a. und immer von Lehrerinnen, die gebildete Haussklavinnen waren.[6] An religiösen Festen oder an Opferzeremonien durften vornehme Frauen und Mädchen teilnehmen, allerdings verhüllt und mit Schleier. So kamen sie wenigstens für kurze Zeit aus dem Haus. Hetären und armen Frauen war eine Teilnahme untersagt. Vielleicht durften sie aber zumindest zuschauen. Heiraten durften Athenerinnen nicht entsprechend ihrer persönlichen Wahl, von Ausnahmen aufgeklärter Eltern abgesehen, und im Erbrecht wurden sie benachteiligt. Thukidides postuliert: „der Name der ehrbaren Frau sollte, wie sie selbst, zu Hause verschlossen bleiben“. Unter diesen Bedingungen war es den meisten Frauen, die geistige Werke geschaffen hatten, fast unmöglich, sie bekannt zu machen, es sei denn, dass sie „darauf pfiffen“, als anständig zu gelten. Nur sehr tapfere Frauen wagten dies. Leider gibt es viele Ethnologen und Historiker, die, wenn sie über griechische Frauen schreiben, die Ansicht vertreten, die Athenerin stelle ein Beispiel für alle griechische Frauen dar. So entstand nämlich der Eindruck, alle Griechinnen lebten so wie die Athenerinnen. Das stimmt gewiss nicht. Es gab auch in Athen Männer, die mit dieser Art der Behandlung der Frau nicht einverstanden waren. Der Historiker Plutarchos schreibt – allerdings 400 Jahre später – dass er mit der Meinung Thukidides nicht einverstanden sei, sondern vielmehr wie auch der Sophist Gorgias aus Athen (5. Jh. v. Chr.) glaube, „die körperlichen Vorteile einer Frau sollten den meisten nicht bekannt sein, aber ihr Ruhm“. Plutarchos schreibt weiter, „warum werden Frauen nicht gleichwertig behandelt? Männer wie Frauen haben den gleichen Wert. Ihre Malwerke sind genau so gut wie die von den Männern, ebenso ihre Dichtkunst sowie ihre Weissagungen und auch ihre Tapferkeit“.[7]
[1] Ermippos, Fragmenta Historicorum Graecurum, iii 39
[2] Gleichen-Russwurm, Bd. 3, S. 32-33
[3] Wägner, Hellas, S. 250
[4] Xenophon, Das Gastmahl, 8, 3
[5] Platon, Gastmahl, 179, b-c
[6] Flabellifère, S. 82-85
[7] Plutarchos, Frauentugenden, 243-244, A-D
2.1.5.4.Sparta und Kreta
Die Dorer waren zwar sehr konservativ, was ihre Bräuche anbelangt, und führten ein anderes Leben als die Athener, aber anderseits war bei den Dorern die Stellung der Frau sehr hoch. Nach Fritz Baumgarten et al. war Sparta „das einzige Land des Altertums, wo der Gedanke verwirklicht wurde, den Frauen dieselbe Erziehung zuteil werden zu lassen wie den Männern“.[1] Diese hohe Stellung der Frau im Kerngebiet der Dorier, in Lakonien und Kreta, blieb seit dem 8. Jh. bis mindestens zum 2. Jh. v. Chr. die gleiche. Andere dorische Gebiete wie in Sizilien oder auf Inseln wie Rhodos änderten gewiss ihre Bräuche, denn sie standen unter dem Einfluss unterschiedlicher griechischer und ausländischer Strömungen.
In der alten dorischen Welt hatten die Frauen wie gesagt, die gleichen Rechte wie Männer. Frauen konnten die Männer beraten oder sogar tadeln. Frauen konnten erben und mit ihrem Erbteil machen, was sie wollten. Der Umgang zwischen den Geschlechtern war ungezwungen. Mädchen und Jungen verkehrten zusammen, auch wenn sie inzwischen erwachsen geworden waren. Es änderte sich nichts, unabhängig davon, ob sie verheiratet waren oder nicht. Tänze und Spiele führten sie seit der Kindheit zusammen. Allerdings war die Erziehung der Kinder Staatssache. Schulbildung war Pflicht für beide Geschlechter. In Athen nicht. Der Athener Xenophon, der das spartanische Gesellschaftssystem bewunderte und das der Athener kritisierte „So (wie in Athen) die Mädchen erzogen werden, wie sollen sie etwas Großartiges vollbringen?“[2] Ab dem 7. Lebensjahr wurden die Kinder in Sparta in Lagern untergebracht, wo sie gemeinsam lebten. Die Mädchen schliefen jedoch getrennt von den Jungen. Der Unterricht war aber der gleiche. Die Teilnahme an Sport für Knaben und Mädchen, auch für Jugendliche, war Pflicht. Die Mädchen kämpften in den gleichen Sportarten wie die Knaben, auch in Ringen, Lauf, Diskuswerfen, Speerwerfen u.a., gewiss unter sich und in Altersgruppen aufgeteilt. Auch gab es Wettspiele zu Ehren der Göttin Artemis. Die Mädchen nahmen an den Wettspielen aber leicht angezogen teil, wahrscheinlich weil sich unter den Zuschauern auch Männer befanden. Wie zwei Statuen zeigen, waren sie bekleidet mit einem kurzen Chiton, der die rechte Schulter und Brust frei ließ. Ähnliches geschah auch in anderen dorischen Orten und auch auf der ionischen Insel Chios.
Die Frauen bewegten sich in dorischen Städten ungezwungen, auch auf dem Markt, und diskutierten mit Männern. Da die Arbeit Periöken und Heloten verrichteten, hatten beide spartanische Geschlechter viel Freizeit. Sparta oder Kreta besaßen keine Hochschulen, da für die Männer die beste Kriegsführung das Ideal war und für Frauen, ihre Kinder zu den besten Soldaten zu erziehen. Ihr Gesprächsstoff war deshalb sehr mager. Politisieren war nicht möglich, denn das Land regierten zwei Könige unter der Aufsicht von 5 Ephoren, die zwar gewählt wurden, aber Parteien und politische Richtungen gab es nicht. Spartanische Frauen war es per Gesetz erlaubt, falls ihr Ehemann keine Kinder bekommen konnte, mit einem anderen Mann ihrer Wahl Kinder zu zeugen, die ihr Ehemann akzeptieren musste. Die anderen Griechen, vor allem die Athener, fanden das Benehmen der Spartanerinnen schändlich und sprachen von Sparta als einer „Weiberherrschaft“. Es ist nicht verwunderlich, dass es dorische Frauen waren, die das Frauenverbot der olympischen Spiele brachen. Kalipateira aus Rhodos und Kyniska aus Sparta mit ihrem Wagen. Jedoch gab es auch in Sparta Einschränkungen. Frauen durften nicht zum Militär, nicht für hohe Staatsämter kandidieren oder als Ephoren gewählt werden.
[1] Baumgarten et al, S. 93
[2] Xenophon, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, Ι, 3
2.1.5.5. Hetären, die emanzipierten Frauen der klassischen Antike
Der Terminus Hetäre tauchte erst in dieser Zeit in Attika auf und bedeutet einfach „Freundin“. Genannt wurde so jede Frau, die mit einem Mann lebte, ohne verheiratet zu sein. Man darf sie nicht „Kurtisane“, nennen wie es heute getan wird.[1] Es waren die emanzipierten Frauen dieser Zeit, die sich die Freiheit nahmen, das zu tun, was sie wollten. Sie waren auch die intelligenteren unter den Frauen, die nicht das brave Püppchen spielen wollten. Allerdings gab es Verbote in Berufen und sportlichen Veranstaltungen. Ansonsten waren die gebildeten Hetären geachtet, und die Philosophinnen waren begehrte Diskussionspartner. Hetären konnten heiraten, wenn sie wollten, und das machten auch etliche und gründeten Familien. Sie konnten ihren Beruf weiterhin ausüben, wenn sie wollten, denn sie hatten meistens verständige Männer ausgewählt. Sie wurden von allen Bürgern ihrer Heimatstadt, ja sogar von ganz Griechenland verehrt, wenn sie auf künstlerischem, wissenschaftlichem oder sogar „militärischem“ Gebiet große Taten vollbracht hatten. Nicht wenige Städte haben für berühmte Hetären Statuen aufgestellt und Dichter ihre Errungenschaften besungen. Dies geschah mit einer „ewigen“ Ehefrau nie. Nur und meistens nach dem Tode auf Grabsteinen wurden ihre Treue zu ihrem Ehemann und ihre Tugend gelobt und hervorgehoben. Hetären waren trotz Verleumdungen der Konservativen, der Ewiggestrigen, die es immer schon gab, von der Gesellschaft voll anerkannt. Sie verhielten sich nicht anders als die heutigen jungen Frauen. Trotzdem sind die meisten Frauen Hausfrauen geworden und keine Hetären. Deren Zahl blieb klein, denn die erfolglosen Hetären drifteten langsam in die Prostitution als einzige Lebensmöglichkeit ab. Davor hatten wahrscheinlich die meisten Mädchen Angst, blieben „brav“ zu Hause und ließen den Familiendruck über sich ergehen. Sie heirateten meist einen ungeliebten Mann, nur um Kinder zu zeugen, denn oft sahen sie den Ehemann nicht, da er sich mit Prostituierten vergnügte oder auf der Agora diskutierte. Aber die Angst vor dem unbekannten Leben kann nicht der alleinige Grund dafür sein, weshalb nicht viele Mädchen Hetären wurden. Vielmehr kam der mächtige Druck der Familie hinzu, der ihnen keinen anderen Weg ließ als den der langweiligen Hausfrau. Die Töchter der Reichen lockte das weitere bequeme Leben, aber die Mädchen der Mittelschicht hatten die Wahl und die armen nur einen Weg, den einer Arbeiterin oder den einer Hetäre. In den Reinigungsdienst oder als Dienerinnen konnten sie wegen der vielen billigen Sklavinnen nicht leicht einsteigen. Sie wählten oft den Beruf einer Artistin, Tänzerin, Flötenspielerin, Sängerin, Akrobatin u.a., die ebenfalls den Ruf hatten, Prostitution zu betreiben. Einige wurden Kurtisanen oder offizielle Prostituierte (gr. Porne). In Kleinasien und Korinth gab es auch die „Hierodulen“, die Tempelprostituierten, die, wenn sie nicht mehr „arbeiten“ konnten, als Alterssitz den sicheren Aufenthalt in der Tempelanlage erhielten. Sie darf man nicht Hetären nennen, wie manche es tun.[2] Aristophanes, der als Quelle zitiert wird, nennt die Hierodulen nie Hetären.[3]
Es war kein leichtes Leben, Hetäre zu sein, und trotzdem haben es etliche auf Grund ihrer Intelligenz geschafft, sich zu bilden, gesellschaftlich aufzusteigen und berühmt zu werden.
[1] Paoli, Die Frau, S. 81
[2] Paoli, S. 80
[3] Strabon, Geographika, VIII, 378
2.1.5.6. Die Hochschulen und ihre Studentinnen
In der Klassischen Zeit entstanden mehrere Hochschulen. Berühmt wurden vor allem die Athener platonische Akademie und etwas später die der Peripatetiker von Aristoteles. Die Akademie bildete auch Frauen aus. Bekannt und berühmt sind vier platonische Philosophinnen: Axiothea, Archeanassa, Diotima und Lasthenia, aber alle waren keine Athenerinnen.
Die Epikureer-Hochschule nahm sogar jedes studierwillige Mädchen auf. Ihr Sitz war aber nicht in Athen. Berühmt wurde die Gelehrte Leontion aus Athen. Auch die Kyniker des Diogenes und seiner Nachfolger nahmen Frauen auf. Die bekannteste Vertreterin dieser Philosophenschule war Hipparchia, die von Diogenes Laertios unter den großen Philosophen eingereiht wird. Die Kyrenäer hatten in Phila aus Elis ihre bekannteste Vertreterin.
Allerdings lehnten es die Peripatetiker des großen Aristoteles, der sich selbst ansonsten menschenfreundlich zeigte und allen seinen Sklaven in seinem Testament die Freiheit schenkte und sogar eine Sklavin geheiratet hatte sowie seine Nachfolger ab, Frauen in seine Philosophenschule aufzunehmen, weil sie nach Meinung ihres Meisters „keine begabten Wesen seien“. Die Stoiker des Zeno aus Zypern, wahrscheinlich mit griechisch-phönikischen Vorfahren, verhielten sich ähnlich, weil sie „Frauen für keine gleichberechtigten Menschen“ hielten.
2.1.5.7. Sport und Frauen
Im Gegensatz zur mykenischen Zeit, in der die Mädchen und Frauen sportlich tätig waren und an vielen Wettspielen teilnahmen, wurde die Beteiligung der jungen Frauen an diesen Aktivitäten vom Staat Athen nicht gefördert. An den Panhellenischen Spielen (Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia), an denen ausschließlich Griechen teilnehmen durften, war eine Teilnahme den Frauen verboten, nicht einmal als Zuschauer durften sie dabei sein. In Olympia wurde den Frauen während der Spiele unter Androhung der Todesstrafe sogar das Überschreiten des Flusses Alpheios untersagt, der Grenze zu den Stätten der olympischen Wettkämpfe. Sie sollten gegebenenfalls als Strafe vom hohen Felsen Tympäon in die Tiefe gestürzt werden. Allerdings schreibt Pausanias ist außer Kallipatera, die nicht bestraft wurde, keine Frau erwischt worden. Bedeutet dies, dass keine anderen Frauen gegen das Gesetz verstoßen hatten, oder blieben sie nur unentdeckt, weil man sie einfach nicht entdecken wollte? Jedenfalls wurde nie eine bestraft.[1]
Es gab aber auch in Olympia zu Ehren der Göttin Hera einen uralten Frauensportwettbewerb, Herea genannt, an dem alle jungen Griechinnen teilnehmen konnten und der getrennt von den Männern zu einem anderen Zeitpunkt alle fünf Jahre stattfand. Er wurde in mykenischer Zeit begründet, nach Pausanias von Hippodamea, der Ehefrau des sagenhaften Königs Pelops, des Namengebers der Peloponnes. Die einzige Disziplin war der 150 Meterlauf für drei Mädchengruppen, jeweils in Altersgruppen aufgeteilt. Die Mädchen trugen einen kurzen Chiton bis übers Knie, mit einer freien Schulter und offenes Haar. Die Organisation der Spiele übernahmen 16 Frauen aus den vornehmsten Familien von Elis. Die Siegerinnen durften ihre Abbildung im Tempel der Hera in Olympia aufstellen.
[1]
2.1.6. Die Frau in Hellenistischer Zeit (323-201 v.Chr.)
So nennt man das Zeitalter Alexander des Großen und seiner Diadochen (Nachfolger), als das Griechentum seine größte Ausdehnung fand. In dieser Zeit bekamen oder erreichten die Frauen durch ihre Kämpfe mehr Rechte. Ihre Rechte wurden sogar Gesetz. Es waren die Rechte, die sie praktisch schon längst besaßen, denn „das Gesetz hängt der Realität immer um Jahrhunderte hinterher“.[1] Sie konnten Berufe ausüben, die bis dahin Männern vorbehalten waren. Der Kontakt zwischen Männern und Frauen wurde erleichtert, ohne gleich die Frauen zu verdächtigen oder zu Prostituierten abzustemmpeln.
In hellenistischer Zeit begannen aber einige Prostituierte, sich Hetären zu nennen, um ihr Image aufzubessern. Der Typus der Prostituierten, die sich Hetäre nannte und in Komödien auch als Figur erscheint, stammt aus dieser Zeit (Die Autoren waren Griechen und Römer: Lukianos, Menandros, Terenz, Plautus). Diese „Hetären“ nahmen sich als Beispiel Historiker des frauenfeindlichen 18. und 19. Jh. und prägten das Bild der Hetäre generell als Prostituierte, das auch von heutigen Historikern immer wieder übernommen wird und alle Hetären als Prostituierte brandmarkt.
In dieser Zeit tauchten auch viele Herrscherinnen bzw. Königinnen und sogar Tyranninnen auf, so zahlreich wie noch nie zuvor in der antiken Geschichte. Es gab sogar Königinnen, die wie Göttinnen verehrt wurden z.B. im griechischen Ägypten. Hier wurden die Königinnen, insgesamt vier mit dem Namen Kleopatra und zwei mit dem Namen Arsinoe, zu Göttinnen erhoben.
Sogar an den olympischen und anderen Wettspielen durften sie, wenn auch nicht direkt, teilnehmen, entweder durch die Zurverfügungstellung von Wagen, Wagenlenkern usw., oder sie hielten eigene Wettspiele ab. Kyniska aus Sparta war die erste, die zweite Bostriche von der makedonischen Küste, dann Phyla aus Priene (1. Jh. vor Chr.), die dritte Siegerin [2], die mit dem Olivenzweigkranz geehrt wurde, weil ihr Gespann bei den Spielen gewonnen hatte.
[1] Lefkowitz, S. 49
[2] Pleket, Texts, S. 48.
2.1.7. Frühchristliche und Frühbyzantinische Epoche ( 1. Jh. bis 500 n.Chr.)
Im ersten christlichen Jahrhundert war die Lage der Frau nicht schlecht. Es herrschte der von Jesus propagierte Spruch der Gleichheit der Menschen. Mann und Frau waren gleich. (Jesus hatte mit der orientalischen Tradition gebrochen und die griechische angenommen.) Das Neue Testament zählt zu seinen Jüngerinnen Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, Maria, die Schwester von Lazarus, Johanna, Salome u.a.). Der Bruch mit der jüdischen Tradition glich einer Revolution, da Frauen mit Männern mitzogen und die Lehren Jesu hörten. So verlief es in der ersten Kirche. Was haben ihre nichtchristlichen jüdischen Landsleute gedacht? Sie hielten es für eine Schande, eine schwere Sünde u.a. So waren die Christen den konservativen Hebräern ein Dorn im Auge.
Der Umgang der beiden Geschlechter war bei den Griechen in Kleinasien und Europa ungezwungen wie in hellenistischer Zeit. Die Christen lebten genauso wie die noch in großer Zahl existierenden Anhänger der alten Religion, allerdings ohne Ausschweifungen und rauschende Feste und ohne Opferung von Tieren für ihre Gottesdienste. Die Frauen waren auch in der Kirche und in der Gemeinde als Predigerinnen, Priesterinnen und Bischöfinnen gleichberechtigt.
Ab dem 2. Jh. begann durch die vielen christlichen Sekten, die damals auftauchten die Zerrüttung in der Kirche, und die christlichen Gemeinden spalteten sich. Nicht wenige davon waren von sehr strengen Asketen gegründet, und ihre Anhänger lebten nach den alten orientalischen Bräuchen, bei denen die Frau keine Rolle in der Gesellschaft spielte, sondern fast Sklavin und lediglich Gebärmaschine war. Geschlechtsverkehr war verpönt und in manchen Gemeinden selbst unter Eheleuten verboten. Die Hauptkirche in Ost und West versuchte, die Spaltungen zu vermeiden oder die entstandenen Risse wieder zu kitten. Sie schlossen Kompromisse, und asketische „Kirchenväter“ wurden mehr gehört als die Worte Jesu. Auch das Alte Testament kam zu Hilfe. Die Frau war nicht mehr gleichberechtigt, musste dem Manne gehorchen, hatte zu schweigen und durfte keine eigene Meinung haben. Sie verschwand aus der Verwaltung der Kirche und durfte in der Kirche nur putzen oder beten. Liebe wurde zu einer Sünde abgestempelt, und sogar die Ehe wurde wie bei den asketischen Gemeinden als Verstoß gegen das Keuschheitsgelübde angesehen, das „höchste Gut“ ders Christen! An allen Verstößen gegen die Keuschheit sollte die Frau schuld gewesen sein, die die „keuschen“ Männer verführen wollte. Frauen wurden zu Tieren degradiert oder als Personifikation des Teufels angesehen. Die Männer projizierten gewiss ihre eigenen abnormen sexuellen Wünsche, die sie nicht ausleben dürften, auf die Frau. Für den großen katholischen Kirchenvater Tertullian war „die Frau die Tür des Teufels, sie soll in schwarze Lumpen gekleidet sein“. Der orthodoxe Kirchenvater Gregor von Nyssa war nicht nur gegen die Liebe, sondern auch gegen die Ehe. Die „Sünde“ der Eva lastete vielen Kirchenvätern nach, und die Frau sollte deswegen „ewig Buße tun“. Der berühmte und sonst aufgeklärte orthodoxe Patriarch Johannes Chrysostomos predigte: „Unter allen wilden Raubtieren gibt es kein schädlicheres Tier als die Frau“.[1] Frauen sollten für jedes Übertreten der von der Kirche aufgestellten Regeln bestraft werden, sogar mit Prügeln. Für die Frau gab es keine ausreichende Bildung, und für Leute, die um ihr „Seelenheil“ besorgt waren, las ihr der Mann die rigorosen Regeln des Basilios aus Caesarea vor, betete mit seiner Frau mehrmals am Tag und verbot ihr, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Als „gleichberechtigt“ war die Frau nur angesehen, wenn sie in strenger Askese lebte.[2] Dennoch gab es tapfere Frauen, die sowohl Bildung erhalten hatten als auch die Stufen des öffentlichen oder des geistigen Lebens emporgestiegen waren. Sie waren, was Bildung anbelangt, keine Mädchen aus dem Volke, sondern Kinder aus reichen Familien oder Töchter und Ehefrauen aufgeklärter oder mächtiger Männer, die den Wert ihrer Frau oder Tochter erkannt hatten und sie förderten, ohne auf die Asketen Rücksicht zu nehmen. Deswegen gibt es in dieser Zeit auch schriftstellernde, dichtende und philosophierende Frauenpersönlichkeiten, wenngleich nicht in großer Zahl. Einige Ärztinnen und Naturwissenschaftlerinnen sind bekannt, aber keine Malerinnen, vielleicht deshalb nicht, weil es im sog. Byzantinischen Reich der Griechen und im Westen keine profane Malerei bei den Christen gab, zumindest nicht vor dem 5.-6. Jh.
[1] Kordatos, Geschichte Bd.VIII, S.431
[2] Beck, Erotikon, Fußnote 45
2.1.7. Mittelbyzantinische Epoche (500 n. Chr. bis 1000)
Das Leben der Christen im griechischen Kaiserreich blieb gleich, da fast alle Bewohner Christen waren.
Das 6. Jh. n.Chr. war der Höhepunkt des griechischen Kaiserreiches. Für den Historiker Steven Runciman (1975) erlebte das Reich in diesem Zeitalter eine Gestaltwandlung.[1] Es war die Zeit Justinians I. und seiner genialen Frau Theodora. Das Reich erreichte seine größte Ausdehnung vom Atlantik bis zum Roten Meer und von der Donau und den Alpen bis nach Nubien in Afrika. Hunderte Städte entstanden. Manche wurden wieder aufgebaut und andere neu gegründet. Kunst, Literatur und Wissenschaft blühten. Tausende von großen und kleinen Bauwerken schmückten das Land, mit der unübertroffenen Hagia Sophia in Konstantinopel als Krönung. Neue und alte Gesetze wurden kodifiziert (corpus Justinianus). Dahinter stand Theodora, die geniale und erheblich intelligentere Frau als Justinian. Man versuchte auch, der ausufernden Kriminalität und Prostitution Herr zu werden, denn Tausende von Prostituierte meistens Ausländerinnen, von Zuhältern gekauft, „arbeiteten“ in der Hauptstadt und in anderen Großstädten. Theodora ließ ihren Mann Gesetze zum Schutz der Frauen erlassen und regelte die Beziehungen zwischen Mann Frau, allerdings nach dem christlichen Ideal. Ehebruch von Männern und Frauen wurden nicht geduldet, Misshandlung von Frauen auch nicht. Aber die Frau konnte die Misshandlung nicht als Scheidungsgrund angeben. Für den Mann war eine Scheidung schon dann möglich, wenn seine Ehefrau mit einem anderen Mann ins Theater, ins Bad ging oder mit ihm zusammen aß.[2] Frauen konnten sich nur scheiden lassen, wenn der Ehemann dauerhaft die Ehe brach. Kriminelle und andere straffällig gewordene Frauen durften nicht wie bisher in die feuchten und ungesunden Gefängnisse geworfen werden, sondern wurden in Klöster eingesperrt.





























