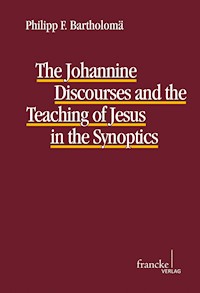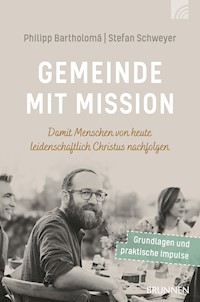
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brunnen Verlag Gießen
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Im neuen Buch von Stefan Schweyer und Philipp F. Bartholomä "Gemeinde mit Mission" dreht sich alles um die großartige Liebesgeschichte, wie Gott und Mensch zusammenkommen. Wie um alles in der Welt kann es gehen, dass Gott und Mensch einander begegnen, miteinander in Beziehung sind, einander lieben? Die Kirche, die "Gemeinde mit Mission", ist dazu berufen, ein Ort zu sein, an dem auch bisher glaubensferne Menschen Gott begegnen und zu leidenschaftlichen Nachfolgern Jesu werden. Aber ist das wirklich so? Im ersten Teil nehmen die Autoren die Realität unserer säkularen Kultur in den Blick, in der viele Menschen den Zugang zu Christentum, Kirche und Gemeinde verloren haben. Im zweiten Teil werden die theologischen Weichen gestellt: Was sind die Grundlagen, was ist das Zielbild von Kirche und Gemeinde? Im Zentrum steht das Evangelium von Jesus aber was bedeutet das z.B. für die Gemeindekultur oder für den sensiblen Umgang mit der Kultur, von der die Gemeinde umgeben ist? Der dritte Teil führt von der Vision zur Praxis: Mit vielen Good-Practice-Beispielen geben die Autoren ganz konkrete Anregungen, wie eine Gemeinde ihren Auftrag erfüllen kann, in einem säkularen Kontext Menschen mit Gott zusammenzuführen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philipp Bartholomä | Stefan Schweyer
GEMEINDE MIT MISSION
Damit Menschen von heute leidenschaftlich Christus nachfolgen
Sofern nicht anders angegeben, sind Bibelzitate der Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, entnommen.
© der deutschen Ausgabe:
2023 Brunnen Verlag GmbH, Gießen
Lektorat: Uwe Bertelmann, Frauke Bielefeldt
Umschlagfoto: Trinette Reed/stocksy.com
Umschlaggestaltung: Jonathan Maul, Brunnen Verlag
Satz: Brunnen Verlag
ISBN Buch: 978-3-7655-2141-6
ISBN E-Book: 978-3-7655-7678-2
www.brunnen-verlag.de
Stimmen zum Buch
Fußball ist einfach: „Das Runde muss ins Eckige“, sagte der legendäre Bundestrainer Sepp Herberger. Die Spielregeln sind klar, die Strategie ist die Herausforderung. So ist es auch mit der Mission der Gemeinde. Menschen, die Gott nicht kennen, sollen ihm begegnen und mit ihm leben lernen. Doch in einer zunehmend säkularisierten Welt wird diese Aufgabe zu einer immer größeren Herausforderung. Philipp Bartholomä und Stefan Schweyer stellen sich der heutigen Situation und haben mit dem vorliegenden Werk eine hervorragende Grundlage für eine missionarische Gemeindearbeit geschaffen. Für missionarische Gemeinden mehr als nur ein nice-to-have. Doch am Ende wird das Buch den Elchtest nur bestehen, wenn Menschen und Gemeinden lernen, das zu leben, was hier gelehrt wird.
Dr. Heinrich Derksen, Studienleiter des Bibelseminars Bonn
In dem Buch ist drin, was draufsteht: Gemeinde mit Mission. Wer heute christliche Gemeinde missionarisch leben will, braucht Liebe, Leidenschaft und Hirnschmalz. Das alles bieten die Autoren an und nehmen die Leserschaft mit auf eine Reise durch die missionarische Gemeindelandschaft. Sie geben einen groben Überblick über die spätmodernen, gesellschaftlichen Besonderheiten. Sie liefern inspirierende Einsichten und wegweisende Impulse aus ihrer Forschungsarbeit und persönlichen Erfahrungen, sie beschreiben Praxisbeispiele, die bis in feinste Details des Gemeindealltags führen. Achtung: Benutzen Sie das Buch nicht als Rezeptbuch. Die Autoren haben es nicht so verstanden, aber ich weiß, dass wir dazu neigen, so zu lesen, denn wir wollen schnelle Erfolge. Lesen Sie es als Meilenstein einer Bildungsreise in Sachen „Gemeinde mit Mission“.
Ansgar Hörsting, Präses Bund Freier evangelischer Gemeinden Deutschland
Ein überfälliges Buch für Praktiker, die für relevante und wirksame Gemeinden in dieser Zeit brennen und auch verstehen, dass dazu Veränderung nötig ist. Die Autoren haben genau hingeschaut, gut gefragt, klug analysiert, dann differenziert reflektiert und hoffnungsvolle Praxiserfahrungen zusammengetragen. Ein starkes Buch zur richtigen Zeit. Voller Anregungen, Herausforderungen und Inspiration.
Lothar Krauss, Pastor in der Viva Kirche Mannheim, Blogger
(der-leiterblog.de) und Mitglied im Vorstand von Willow Creek Deutschland
Wer wie ich den großen Wunsch hat, dass in unseren Gemeinden viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen, der sollte dieses Buch lesen. Es hat meine Sehnsucht nach lebendigen, missionarischen Gemeinden wieder neu befeuert und lässt mich hoffen. Die Autoren schämen sich des Evangeliums nicht und geben ganz normalen Gemeinden praktische Hilfestellungen, um ihren missionarischen Auftrag auch in einem zunehmend säkularen Kontext zu erfüllen.
David Kröker, Leiter des Bereichs „Gemeindegründung“ im Christusforum Deutschland, Gemeindegründer in Euskirchen und Vorsitzender der Deutschen Evangelistenkonferenz
Wow! Endlich mal wieder ein Buch, bei dem es um das Zentrum des auftragsorientierten Gemeindeaufbaus geht. Allein schon das Inhaltsverzeichnis inspiriert und macht Hunger nach mehr. Die richtigen und wichtigen Themen rücken ins Zentrum und laden ein, gründlich und neu über den Kernauftrag der Gemeinde nach- und vorzudenken. Inspiration ist garantiert!
Reto Pelli, Pastor Prisma Kirche Rapperswil, Autor der Gemeindekampagne „42 Tage Leben für meine Freunde“
Man spürt von der ersten bis zur letzten Seite die Liebe der beiden Autoren für die Gemeinde Jesu hier und heute. Zwei praktische Theologen schaffen es, ihre denkerischen Fähigkeiten mit ihrer praktischen Gemeindeerfahrung zu kombinieren.
Für Gemeinden, die den Anschluss an ihre säkulare Kultur nicht verpassen und gleichzeitig dabei ihr missionarisches Profil nicht verlieren wollen, empfehle ich dieses inspirierende Buch als gemeinsame Pflichtlektüre von Leitern und Mitarbeitern. Wer vorher nicht (mehr) motiviert war, wird es danach definitiv wieder sein. Es ist Mut machend und praktisch, aber keinesfalls pragmatisch. Es ist gut lesbar und die konkreten Impulse sind biblisch reflektiert, anschlussfähig und leicht umsetzbar.
Dabei geht es den Autoren nicht um ein bestimmtes Modell oder eine spezielle Gemeindeform. Das Buch fordert heraus, die Schönheit von Gottes Konzept von Kirche für den eigenen Kontext neu zu durchdenken.
Immer wieder hatte ich das Gefühl, mehr von Gottes Idee von Gemeinde und von seiner Liebe zu Menschen, meinen säkularen Freunden, die er durch Gemeinde erreichen möchte, zu verstehen.
Für mich war die Lektüre ein Genuss und die Hoffnung für Gemeinde, die das Buch durch den Fokus auf die Kraft des Evangeliums vermittelt, hat ein Lächeln auf mein Gesicht und neue Begeisterung in mein Herz gebracht.
Steffen Weil, Gemeindegründer & Pastor im Bund der FeG, Coach und Trainer im Bereich Gemeindegründung und Leiter des Netzwerkes City to City in D-A-CH.
Inhaltsverzeichnis
Stimmen zum Buch
Einleitung:Worum es geht und für wen das wichtig ist
Teil IDie Gegenwart verstehen
Gemeinde nach dem Christentum
Kapitel 1Alles eine Frage der Perspektive:
Freikirche zwischen „Wettbewerbsstärke“ und „missionarischer Krise“
Kapitel 2Die Zeiten haben sich geändert:
Freikirchen in einem säkularisierten Kontext
Kapitel 3Auf der Suche nach neuen Wegen:
Quellen der Inspiration, von denen sich lernen lässt
Teil IIDie Zukunft gestalten
Entscheidende Weichenstellungen
Kapitel 4Den Kurs halten:
Mission braucht einen klaren theologischen Kompass
Kapitel 5Zwischen Gesetzlichkeit und billiger Gnade:
Das Evangelium als Kern der Gemeinde-DNA
Kapitel 6Kirche der Zukunft:
Eine klare Vision von Gemeinde
Kapitel 7Eine andere Mentalität entwickeln:
„Umparken im Kopf“
Kapitel 8Zwischen Gleichgültigkeit und Sehnsucht:
Anknüpfungspunkte für den Glauben finden
Kapitel 9Christsein im Exil:
Gemeinde als Kontrastgesellschaft
Kapitel 10Beziehungsweise Gemeinde:
Echte Gemeinschaft in einer individualistischen Zeit
Kapitel 11Realitätscheck:
Merkmale einer Gemeinde, die Bekehrungen fördert
Teil IIIKonkrete Schritte gehen
Impulse für eine Gemeinde mit Mission
Kapitel 12Leidenschaft stärken:
Warum uns unsere Mitmenschen am Herzen liegen
Kapitel 13Kontext verstehen:
Wie unsere Mitmenschen mit dem Glauben in Berührung kommen können
Kapitel 14Kultur prägen:
Was eine gastfreundliche Gemeindepraxis auszeichnet
Kapitel 15Feiern:
Den Gottesdienst als Quelle und Höhepunkt der Mission gestalten
Kapitel 16Befähigen:
Christen auf dem Weg der Mission fördern
Kapitel 17Einladen:
Noch-nicht-Christen auf dem Weg zum Glauben begleiten
Epilog:Plädoyer für einen hoffnungsvollen Realismus
Anmerkungen
Einleitung:Worum es geht und für wen das wichtig ist
Dieses Buch dreht sich um eine Liebesgeschichte; um die eine großartige Liebesgeschichte, wie Gott und Mensch zusammenkommen. Es ist keine simple Story, eher ein Drama. Mit Hoch- und Tiefpunkten. Ziemlich kompliziert, so wie wir Menschen eben sind. Wir haben eine tiefe Sehnsucht nach Liebe – und sind doch so verletzt und verletzend. Wir haben große Hoffnungen und Wünsche – und sind doch so gefangen im Kreisen um das eigene Ich. Wie um alles in der Welt kann es gehen, dass Gott und Mensch einander begegnen, miteinander in Beziehung sind, einander lieben?
Unsere Hauptthese in diesem Buch lautet: „Gemeinde mit Mission“ ist eine Gemeinde mit dem Auftrag, in einem säkularen Kontext Menschen mit Gott zusammenzuführen. Es geht also um Gott (→ a) und um den Menschen in einem spezifischen Kontext (→ b), um die Gemeinde als Ort der Begegnung von Gott und Mensch (→ c) und um deren Mission, die Sendung in die Welt (→ d).
a) Gott
Alles beginnt mit Gott. Er steht am Anfang der Welt, am Anfang unseres Lebens und unseres Glaubens. Ohne Gott wären wir nicht. Ohne ihn gäbe es keine Gemeinde. Gott selbst ist es, der die Initiative ergreift, um mit und unter den Menschen zu leben. Die Beziehung mit ihm lässt sich nicht wie ein Produkt herstellen oder durch gutes Gemeindemanagement herbeiführen. Die Liebesbeziehung mit Gott ist ein Wunder. Wir erbitten und erhoffen sie, aber wir können sie nicht „machen“. Diese Tatsache begleitet uns durch unsere gesamten Überlegungen, auch wenn wir es nicht jedes Mal ausdrücklich dazuschreiben. Gott tut das Entscheidende! Er könnte es auch ohne uns. Aber es scheint ihm zu gefallen, uns einzubeziehen. Durch seinen Geist mischt er sich in unser menschliches Handeln ein und verbindet sich mit unserem Tun.
In der Zunft der Praktischen Theologie, zu der wir beide gehören, gibt es einen treffenden Fachbegriff, um diese Wirklichkeit zu beschreiben: theonome Reziprozität (wörtlich übersetzt: „von Gott gesetzte Wechselwirkung“).1 Das heißt: Es gibt eine Wechselwirkung (Reziprozität) zwischen göttlichem und menschlichem Handeln. Wie diese Wechselwirkung funktioniert, liegt nicht in der Hand des Menschen, sondern wird von Gott bestimmt (theonom). Gott verknüpft sein Handeln mit unserem Handeln, nicht weil unser Handeln so gut ist, sondern weil es Gott gefällt, mit den Menschen als seinen Ebenbildern zusammenzuwirken.
Wenn wir über Gemeindepraxis sprechen, ist uns bewusst, dass wir immer von Gott und dem Wirken seines Geistes abhängig sind. Darum hat Gebet für uns hohe Priorität. Nicht als etwas, das zusätzlich zu unserem Handeln hinzutritt, sondern als Grundhaltung, die unser ganzes Leben trägt. Die Frage lautet nicht: beten oder handeln? Wir handeln betend. Wenn wir uns also Gedanken machen, wie die Gemeindepraxis aussehen könnte, dann erfolgt auch das im Bewusstsein unserer Abhängigkeit von Gott.
b) Mensch
Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Überall – zu allen Zeiten. Das gilt, auch wenn uns in diesem Buch eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen vor Augen stehen, nämlich unsere Mitmenschen, die in einem gesellschaftlich säkularen Klima leben und davon geprägt sind. Diese Bevölkerungsgruppe wächst in unseren Breitengraden enorm.2 Für viele unserer Zeitgenossen ist es ganz normal, so zu leben, als ob es Gott nicht geben würde. In ihrer Geschichte war die Kirche zunächst vor allem mit nichtchristlicher Religiosität konfrontiert. Im christlich geprägten Abendland war man dann stärker mit den Auseinandersetzungen um die richtige Form des Glaubens beschäftigt, was zur Ausdifferenzierung innerhalb des Christentums führte.
Dass es heute im westlichen Kulturkreis so selbstverständlich geworden ist, nicht religiös zu sein, ist ein neueres Phänomen.3 Daher halten wir es für lohnend, spezifisch darauf zu schauen, wie Menschen aus säkularen Kontexten mit Gott zusammenfinden können.
Allerdings leben längst nicht alle Menschen, mit denen wir es in unseren Gemeinden zu tun haben, in einem solchen säkularisierten Umfeld. Migrationsbewegungen haben dazu geführt, dass auch nichtchristliche Religiosität heute vielfältiger und stärker präsent ist als noch vor einem halben Jahrhundert. Das eröffnet neue Chancen und Möglichkeiten der kultur- und religionsübergreifenden Kommunikation des Evangeliums und für interkulturelle Gemeindearbeit.4 Mit der Migration kommen aber auch Christen nach Europa, was mitunter zu „Reverse Mission“5 führt: Europa wird durch Menschen aus ehemaligen Missionsländern neu evangelisiert. Die Landschaft der Migrationsgemeinden in unseren Kontexten wird vielfältig und bunter.6 Wir freuen uns über diese bedeutsame Facette christlichen Lebens in unseren Ländern und verstehen unseren Beitrag mit dem Fokus auf eine säkulare Gesellschaft als eine Ergänzung.
c) Gemeinde
In der Liebesgeschichte von Gott und den Menschen nimmt die Gemeinde eine zentrale Stellung ein. Sie ist ein vorzüglicher Ort, wo Gott und Mensch zusammenkommen. In der Kirche öffnet sich der Raum, um die liebevolle Begegnung mit Gott und untereinander zu erfahren. Christliche Gemeinschaft hat immer auch ihre realen Schattenseiten und Problematiken. Längst nicht alles ist gut. Es gibt Streit und Machtmissbrauch. Doch die hoffnungs- und erwartungsvolle Sicht auf Gemeinde ist größer, denn Jesus selbst hat verheißen, dass er seine Gemeinde baut und selbst die tödlichsten Kräfte sie nicht zerstören können (Mt 16,18). Im Vertrauen auf diese Verheißung ist eine optimistische Sicht auf die Gemeinde angebracht. Ihr wurde von Gott das Potenzial geschenkt, eine von echten Beziehungen geprägte Gemeinschaft zu sein, in der die Erfahrung der Liebesbeziehung mit Gott und untereinander konkrete Gestalt gewinnt.
Wir Autoren sind beide im freikirchlichen Milieu aufgewachsen und haben dort auch als Pastoren gearbeitet. Wir kennen kleine Gemeindegründungsarbeiten und größere Gemeinden und sind mit vielen Kirchen und Gemeinden innerhalb und außerhalb des freikirchlichen Spektrums verbunden. Der Austausch mit vielen Pastoren und Gemeindegründern war für uns wertvoll und lehrreich. Ihre Erfahrungen haben uns inspiriert und wir haben sie als „Good Practices“ hier und da einfließen lassen.
Uns beiden ist es ein Herzensanliegen, Gemeindeleben theologisch reflektiert zu gestalten. Daher ist es kein Zufall, dass sich unsere zentralen wissenschaftlichen Publikationen darum drehen, die freikirchliche Landschaft mit Blick auf den gegenwärtigen gesellschaftlichen Rahmen zu analysieren.7
Dabei sehen wir uns nicht als Vertreter oder Verkäufer des Modells „Freikirche“, auch wenn unsere freikirchliche Prägung in den Texten durchgehend spürbar sein wird. Die Nachteile dieser Kirchenform kennen wir allerdings auch nur allzu gut. Wenn wir in diesem Buch von „Gemeinde“ sprechen, denken wir nicht an eine spezifische institutionelle Form oder eine bestimmte Konfession oder Denomination, sondern in einem ganz allgemeinen Sinn an eine Gemeinschaft von Menschen, die von der Liebe Gottes erfasst wurden und dadurch motiviert ihr gemeinsames Leben entsprechend gestalten wollen. Wir hoffen, dass die Impulse in vielfältigen Kirchengestalten fruchtbar werden können – seien es klassische oder moderne Freikirchen, Hauskirchen, Landeskirchen, landeskirchliche Gemeinschaften oder unabhängige Einzelgemeinden, Kirchen unterschiedlicher Größe im urbanen oder ländlichen Raum. Und manche Impulse führen vielleicht dazu, dass eine Gemeinde oder eine Kirche nicht so bleibt, wie sie ist, sondern ihre Gestalt durch die Orientierung an der Verheißung von Jesus und an seiner Sendung neu justiert wird.
Unserer Wahrnehmung nach verlieren in der Gegenwart denominationelle und konfessionelle Identitäten und Abgrenzungen an Bedeutung. Die Kirchenlandschaft verflüssigt sich, manches fließt ineinander über (und gelegentlich auch auseinander). Deshalb verwenden wir die Begriffe „Kirche“ und „Gemeinde“ austauschbar. Es gab Zeiten, in denen man den Begriff „Kirche“ eher für die Großkirchen verwendet hat und „Gemeinde“ für die Freikirchen, was wir nicht mehr für hilfreich und zukunftsweisend halten.
Kirche/Gemeinde ist ein göttliches Wunder und gleichzeitig eine menschliche Angelegenheit. Eine Gemeinschaft, in der die Liebesbeziehung mit Gott und untereinander Gestalt gewinnt. Diesem Geheimnis wollen wir nachspüren und sind überzeugt, dass dies am besten gelingt, wenn man die Kirche sowohl mit geistlichen als auch mit empirisch-soziologischen Augen wahrnimmt.
d) Mission
Die Gemeinde ist nicht nur dazu bestimmt, die Liebesbeziehung mit Gott zu pflegen, sondern auch andere Menschen in diese Beziehung hineinzuführen. Sie ist von Gott in die Welt gesandt, um seine Liebe zu bezeugen und andere in diese Liebesbeziehung mit Gott einzuladen und auf dem Weg des Glaubens zu begleiten. Das ist Gemeinde mit Mission.
Wenn wir in diesem Buch über Praxisfragen des Gemeindelebens sprechen, gilt unser Augenmerk besonders denjenigen Aspekten, die mit dieser Mission zu tun haben. Viele andere Themen, die für Gemeindeaufbau ebenso wichtig sind (wie z. B. Seelsorge, Gemeindepädagogik, Diakonie, Führungs- und Strukturfragen etc.),8 werden wir nur dann streifen, wenn sie die Mission der Gemeinde direkt berühren. Dieses Buch ist also kein umfassendes Werk zum Gemeindeaufbau, sondern konzentriert sich auf die missionarische Sendung der Gemeinde in einem säkularen Kontext.
Der Begriff „Mission“ kann in einem umfassenden Sinn das gesamte Leben der Kirche beinhalten, denn die Kirche ist als Ganze in die Welt gesandt. Mission gehört daher zum Wesen der Kirche. In einem spezifischen Sinn meint Mission jedoch ihren Auftrag, Jesus in der Welt zu bezeugen (Apg 1,8) und als seine Botschafter zur Versöhnung mit Gott einzuladen (2Kor 5,20). Eine Gemeinde, die ihr Leben nach einer Reich-Gottes-Perspektive gestaltet, wird sich nicht um sich selbst drehen, sondern mit Wort und Tat zum Wohl der Gesellschaft beitragen. Dazu gehört das sozial-diakonische Engagement ebenso sehr wie die Verkündigung des Evangeliums und die Einladung zum Glauben.9 Wenn wir hier das sozial-diakonische Engagement weniger häufig thematisieren, dann also nicht, weil es uns nicht wichtig wäre (im Gegenteil: Es wird immer wichtiger, je „kälter“ das gesellschaftliche Klima wird). Es geht auch nicht darum, Menschen zu helfen, nur damit sie evangelisiert werden können. Diakonie soll Diakonie bleiben. Und damit sie das bleiben kann, braucht es ergänzend dazu Evangelisation. Deshalb halten wir es für besonders wichtig, in einem säkularen Kontext die Sprachfähigkeit des Glaubens zu fördern und Menschen so zu unterstützen und zu begleiten, dass sie zum Glauben finden können.
Die Sendung der Kirche umfasst die ganze Welt. Sie hat daher einen weltweiten, interkulturellen Horizont, der die Grenzen dieses Kontinents übersteigt.10 Die globale, universale Perspektive wird durch die Verortung im lokalen Kontext ergänzt. Wenn wir in diesem Buch über Mission in einem säkularen Kontext sprechen, ist uns wohl bewusst, dass der Säkularismus unserer Breitengrade global gesehen eher die Ausnahme ist. Doch auch der westlich-säkulare Kontext gehört zur Sendung der Kirche und soll nicht übersehen werden.
e) Zu den Autoren und zum Buch
Wir (Philipp und Stefan) haben das Buch gemeinsam verfasst und verantworten seinen Inhalt gemeinsam. Unsere Biografien weisen, wie schon erwähnt, gewisse Überschneidungen auf: Wir kennen beide das Gemeindeleben aus pastoraler Erfahrung, wir sind Professoren für Praktische Theologie an Schwester-Hochschulen11 und wir teilen manche Forschungsinteressen, die zu dieser Zusammenarbeit geführt haben. Dennoch bleiben auch Unterschiede, die bei der Lektüre durchaus erkennbar werden können – die eine oder andere theologische Schwerpunktsetzung und nicht zuletzt die schweizerischen und deutschen Eigenheiten. Das Projekt ist entstanden, weil wir zentrale Überzeugungen teilen und zu dem Schluss kamen, dass sich unsere unterschiedlichen Perspektiven gut ergänzen könnten. So kam es zu einem intensiven Austausch, den wir selbst als große Bereicherung erlebt haben.
Wir danken unseren Hochschulen und unseren Familien, dass sie uns die Freiräume für dieses Projekt gegeben haben. Unser Dank gilt in besonderer Weise unserem Doktoranden Henrik Homrighausen für seine Unterstützung in der Frühphase des Projekts, Frauke Bielefeldt für ihre Unterstützung im Lektorat, dem Brunnen Verlag für die Aufnahme des Buchs in das Verlagsprogramm und Uwe Bertelmann für die kompetente Begleitung der Publikation.
Wir sind zutiefst dankbar für die Erfahrung, dass Gott sich uns liebevoll zuwendet. Das trägt uns. Und es motiviert uns, diese Erfahrung auch anderen zu ermöglichen. Genau deshalb brennt unser Herz für Mission. Wir wünschen uns, dass die Impulse in diesem Buch zu einer Gemeindepraxis anstiften, die auch anderen hilft, in eine Liebesbeziehung mit Gott zu finden.
Zusätzlich zu den konkreten Praxisbeispielen, die im Buch enthalten sind, findet man auf der Homepage www.gemeindemitmission.net ergänzende Materialien. Dort finden sich auch Reflexionsfragen zu den einzelnen Kapiteln, die das Gespräch anregen können. Damit möchten wir vor allem Gemeindeleitungsteams ermutigen, das Buch gemeinsam durchzuarbeiten und konkrete Schritte hin zu einer leidenschaftlichen missionarischen Praxis ins Auge zu fassen und umzusetzen.
Im Dezember 2022, Philipp Bartholomä und Stefan Schweyer
Teil I
Die Gegenwart verstehen
Gemeinde nach dem Christentum
Unser Bild einer „Gemeinde mit Mission“ entfaltet sich in drei Schritten. Zunächst ist es sinnvoll, ein klareres Bild davon zu bekommen, in welchem Kontext missionarischer Gemeindeaufbau heute stattfindet (→ Teil I), bevor wir einige Weichenstellungen bedenken, die wir im Blick auf die Zukunft der Kirche für entscheidend halten (→ Teil II). Schließlich wollen wir bedenken, welche konkreten Schritte sich daraus für die Gemeindepraxis ergeben (→ Teil III).
In der Einleitung haben wir bereits umrissen, warum uns das Thema dieses Buchs persönlich so viel bedeutet, von welchen biografischen Ausgangspunkten her wir schreiben und für wen die Grundlagen und praktischen Impulse dieses Buchs wichtig sein könnten (→ Einleitung). In den weiteren Kapiteln des 1. Teils widmen wir uns Themen, die besonders in freikirchlichen Kontexten bedeutsam sind:
Wie groß ist die
missionarische Wirksamkeit von Freikirchen
eigentlich heute? Wen erreichen Freikirchen wirklich? (→
Kapitel 1
)
Welche
kulturellen Rahmenbedingungen
beeinflussen die Art und Weise, wie wir heute unseren missionarischen Auftrag erfüllen? Inwiefern unterscheidet sich das gegenwärtige säkularisierte Terrain von den gesellschaftlichen Gegebenheiten, unter denen Freikirchen ursprünglich entstanden sind? Und warum ist das wichtig? (→
Kapitel 2
)
Welche
Konzepte des Gemeindeaufbaus
wurden in jüngerer Zeit entwickelt, um speziell den Herausforderungen eines säkularen Zeitalters zu begegnen? Was lässt sich von ihnen lernen und welche Impulse sind für unseren Kontext hilfreich und richtungsweisend? (→
Kapitel 3
)
Nach-christentümlich
In diesem Buch sprechen wir oft von einer „nach-christentümlichen Zeit“. Das Wort „nach-christentümlich“ verwenden wir bewusst, auch wenn es vielleicht für manche Ohren etwas ungewohnt klingt. Wir setzen diese Bezeichnung ein, weil wir damit unsere gegenwärtige Lage präziser beschreiben können als beispielsweise mit dem Begriff „nach-christlich“:
Der Begriff „christlich“ umfasst alles, was zum Glauben an Jesus Christus gehört. Dazu gehören Glaubensinhalte, persönliche Überzeugungen und eigene Glaubenspraxis genauso wie kirchliches Leben und kulturelle Prägungen.
„Nach-christlich“ würde daher eine Zeit beschreiben, in der der christliche Glauben insgesamt verschwindet und durch andere Glaubensformen oder Weltanschauungen ersetzt wird.
„Christentümlich“ meint dagegen nur diejenigen Aspekte des Glaubens, die sich in einer etablierten Kultur niedergeschlagen haben.
„Nach-christentümlich“ bezeichnet also eine Zeit, in der die enge Verbindung von christlichem Glauben und Kultur aufgelöst wird. Der christliche Glaube lebt nach wie vor in unterschiedlichen Gestalten weiter, wird aber kulturell nicht mehr gestützt.
Kapitel 1
Alles eine Frage der Perspektive:
Freikirche zwischen „Wettbewerbsstärke“ und „missionarischer Krise“
Jesus ruft die ganze Welt zu sich und hat seine Leute nachdrücklich dazu aufgefordert, diesen Ruf weiterzugeben (z. B. Mt 28,20). Freikirchen haben dies immer ernst genommen. Mission und Evangelisation waren stets Teil ihrer DNA. So bezeichnen manche die freikirchliche Bewegung auch als „Konversionschristentum“ (von conversio – lateinisch für „Wandlung, Umkehr, Bekehrung“).
Entsprechend hat freikirchlicher Gemeindeaufbau immer auch das Ziel, dass Menschen „konvertieren“, also sich bekehren, zum Glauben kommen und zu Jesus-Nachfolgern werden. Freikirchen sind „Missionskirchen“, Gemeindewachstum ist ein zentrales Anliegen. Deshalb beginnen wir unsere Situationsanalyse in Sachen Gemeindeaufbau mit der Frage: Wie groß ist die missionarische Wirksamkeit von Freikirchen eigentlich heute? Oder anders gefragt: Kommt bei uns eigentlich noch jemand neu zum Glauben? Nach einigen Streiflichtern aus der Forschung (→ a) werfen wir zunächst einen etwas genaueren Blick auf die freikirchlichen Wachstumszahlen (→ b). Daran anknüpfend stellen wir die Frage, wen Freikirchen heute tatsächlich erreichen (→ c), bevor wir schließlich den Ertrag dieses Kapitels kurz zusammenfassen (→ d).
Freikirchliche Verantwortungsträger haben hier jeweils ihre mehr oder weniger „begründete Vermutung“ – mal etwas positiver, mal deutlich negativer gefärbt, je nach persönlichem Erfahrungshorizont und Umfeld. Objektive Zahlen und Analysen gibt es nur wenige und diese werfen ein recht unterschiedliches Licht auf die missionarische Zukunftsfähigkeit von Freikirchen.
a) Streiflichter aus der Freikirchenforschung
Sabine Schröder hat eine Studie zu freikirchlichen Gemeindegründungen in Ostdeutschland durchgeführt.12 Sie geht von folgender These aus: Im weitgehend konfessionslosen, nichtreligiösen Osten entscheidet sich, ob Kirchen und Gemeinden in der zunehmend säkularisierten Gesellschaft Deutschlands (→ Kapitel 2) überhaupt noch missionarische Durchschlagskraft entfalten können. Mit dieser Einschätzung ist sie nicht allein. Man könnte auch sagen: Ostdeutschland ist der Prüfstein für unsere Ansätze und Herangehensweisen im Gemeindeaufbau.
Im Blick auf die Freikirchen kommt Schröder zu einem eher ernüchternden Ergebnis: Selbst überdurchschnittlich missionarisch gesinnte Gemeindegründungen seien kaum in der Lage, die ostdeutsche Bevölkerung mit dem Evangelium zu erreichen. Das habe vor allem damit zu tun, dass die besonderen gesellschaftlichen Bedingungen in Ostdeutschland nach Jahrzehnten des Sozialismus nicht ausreichend bedacht würden und man sich zu wenig mit den spezifisch ostdeutschen Denkvoraussetzungen und Mentalitäten auseinandersetze. Gemeindliche Angebote würden nicht auf die über 70 % Konfessionslosen abgestimmt, sondern auf Menschen, die irgendeine Verbindung zur Kirche oder zum Christentum haben. Dabei hätten viele Ostdeutsche von Kindesbeinen an gelernt, ohne Glauben zu leben. Dadurch sei eine religiöse Sprachlosigkeit entstanden, eine Art „Verständigungsgraben“, der es Freikirchen erschwere, Menschen plausibel zu vermitteln, wie der christliche Glaube im Alltag erfahren und gelebt werden kann. Schröders Fazit: Freikirchen ist es bisher nicht ausreichend gelungen, die weitverbreitete Gleichgültigkeit gegenüber Religion und Kirche zu überwinden und missionarisch in ihr säkularisiertes Umfeld zu wirken.
Deutlich positiver stimmen da zunächst die Ergebnisse einer Forschergruppe aus der Schweiz, die sich detailliert mit dem evangelikal-freikirchlichen Milieu beschäftigt hat.13 Hier wird die freikirchliche Bewegung auf dem religiösen Sektor als innovative und dynamische Kraft wahrgenommen, die eine „erstaunliche Resistenz“ gegen den Trend der Säkularisierung an den Tag legt. Diese Resistenz erklären sich die Schweizer Religionssoziologen mit einer Kombination aus „sozialer Abschottung“ (also einer bewussten Abgrenzung) und „hoher Wettbewerbsstärke“. Einerseits grenzten sich Freikirchen von der ethischen Gleichgültigkeit der Postmoderne klar ab. Auf der anderen Seite würden sie ihr Profil durch gemeinsame Glaubensüberzeugungen, Praktiken, Werte und Normen gewinnen. Dadurch bleibe die freikirchliche Identität auch in einer zunehmend säkularen Gesellschaft stabil. Man bekennt sich zur Bibel als unangefochtener Autorität nicht nur in Glaubensdingen, sondern gerade auch in Sachen Moral und Verhalten. Das sorgt für eine fortdauernde Stabilität freikirchlicher Gruppierungen.
Gleichzeitig agieren Freikirchen ihrer Studie nach „wettbewerbsstark“, das heißt, sie könnten sich auf dem Markt religiöser Möglichkeiten ganz gut behaupten. Demnach gelingt es ihnen, angemessene Antworten auf die unterschiedlichen spirituellen, sozialen und psychologischen Bedürfnisse moderner Menschen anzubieten. Freikirchen, so die Schweizer Forscher, passen ihre Angebote immer wieder an die heutigen gesellschaftlichen Entwicklungen an. Sie bemühten sich vielfach um größtmögliche kulturelle Relevanz. Dazu gehören neben einer verständlichen Sprache und zeitgemäßen Gestaltungsformen auch der Einsatz moderner Musik und ein Gespür für zeitgenössische Ästhetik. Darüber hinaus heben die Autoren der Studie hervor, dass es im freikirchlichen Milieu (zumindest im Vergleich zu anderen religiösen Anbietern und den traditionellen Großkirchen) besser gelinge, die nachwachsende Generation an den christlichen Glauben zu binden. Das habe mit einer starken Einbindung in ein tragfähiges soziales Umfeld zu tun, in dem Gemeinschaft und freundschaftliche Beziehungen über die kirchlichen Veranstaltungen hinaus im Alltag intensiv gelebt werden könnten. Auch die weiterhin vorhandene, häufig leidenschaftlich ausgeübte Praxis der Evangelisation wird als wesentlicher Aspekt freikirchlicher Wettbewerbsstärke benannt.
Insgesamt scheint die Schweizer Studie also Argumente für die missionarische Wirksamkeit und Zukunftsfähigkeit von Freikirchen zu liefern. Doch wir sollten genauer hinschauen. Denn ein konstantes und zum Teil sogar markantes Wachstum ist nicht bei allen Freikirchen zu beobachten, sondern vor allem bei charismatischen Gemeinden. Und auch dieses Wachstum lässt sich nicht immer ihrer nachhaltigen Wettbewerbsstärke zuschreiben, sondern ist teilweise dem Zusammenschluss bisher unabhängiger Gemeinden geschuldet. Außerdem profitieren gerade charismatische Freikirchen besonders stark von der Einwanderung ausländischer Christen z. B. aus Afrika, Asien oder Lateinamerika. Gleichzeitig verdankt sich der Erfolg neuer bzw. charismatischer Freikirchen zu einem großen Teil auch dem Gemeindewechsel von Christen aus anderen Freikirchen (Transferwachstum). Außerdem ist das Wachstum von Freikirchen Folge eines stärkeren „biologischen Wachstums“ bzw. einer gelungenen christlichen Sozialisation: Kinder von Freikirchen-Mitgliedern bleiben häufig auch im Erwachsenenalter mit freikirchlichen Gemeinden verbunden. Das Wachstum der Freikirchen ist also neben Bekehrungen von Menschen aus nichtchristlichem Hintergrund auf einige andere Faktoren zurückzuführen.
Es ist also eine Frage der Perspektive: Einerseits scheinen Freikirchen weiterhin das Potenzial zu haben, der Säkularisierungswelle zu widerstehen und sich im „religiösen Wettbewerb“ zumindest im Vergleich zu den Großkirchen tendenziell besser zu behaupten. („Das Glas ist halb voll!“) Andererseits kann man offensichtlich nur sehr eingeschränkt von einem missionarischen Wachstum sprechen, das sich aus Bekehrungen von Menschen speist, die bisher vom christlichen Glauben noch nicht berührt waren. Ist das Glas also doch eher halb leer? Echter „missionarischer Erfolg“ ist demnach auch in Freikirchen definitiv kein Selbstläufer.
Andererseits war in den letzten Jahren immer wieder auch von einem freikirchlichen „Wachsen gegen den Trend“ zu hören. Lässt sich dies belegen? Und wie sieht dieses Wachstum genau aus? Ein Blick auf einige „nackte Zahlen“ verhilft uns zu einer realistischen Einschätzung der Lage.
b) Der freikirchliche Status quo in Zahlen
Wer in Sachen Gemeindeaufbau auf Zahlen verweist, wird leicht kritisiert. Wir glauben nicht, dass man die missionarische Wirksamkeit einer Gemeinde allein am zahlenmäßigen Wachstum ablesen kann. Aber ein am Neuen Testament orientierter Gemeindeaufbau kann auch nicht gänzlich auf zahlenmäßige Kriterien verzichten (vgl. Apg 2,41.47; 5.12 u. a.). Auch unbequeme Fakten sind unsere Freunde. Wer sie ignoriert, verliert einen wichtigen Impulsgeber für Veränderungen. Das gilt auch für freikirchliche Wachstumszahlen.
Werfen wir einen kurzen Blick auf die deutsche Statistik:14 Während die Evangelische Kirche in Deutschland seit 2003 mehr als 20 % ihrer Mitglieder verloren hat, ist die Entwicklung in den klassischen Freikirchen uneinheitlich. Die Evangelisch-methodistische Kirche (EmK) und der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) verzeichnen einen Mitgliederrückgang, der im Fall der EmK sogar erheblich ist. Der Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP) und der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) sind dagegen mehr oder weniger stark gewachsen.
Im Blick auf das starke Wachstum der Pfingstgemeinden im BFP ist zu beachten, dass im genannten Zeitraum 92 internationale Gemeinden hinzugekommen sind. Diese „Gemeinden anderer Sprache und Herkunft“ (so die offizielle Bezeichnung) spiegeln die wachsenden Einwanderungszahlen in Deutschland wider. Die Zunahme an Mitgliedern des BFP speist sich also zu einem großen Teil aus dem Migrationsmilieu. Der „missionarische Erfolg“ in der heimischen Bevölkerung fällt entsprechend deutlich geringer aus. Das deckt sich mit den Ergebnissen einer internen Erhebung des BFP über das Jahr 2006, aus der hervorgeht, dass knapp ein Viertel der neuen Mitglieder Bekehrte waren. Drei Viertel der neuen Mitglieder waren also bereits vorher gläubige Christen. Außerdem betrifft dieses Wachstum nur rund ein Sechstel der Gemeinden des BFP, andere stagnieren oder schrumpfen. Vor diesem Hintergrund kann man gegenwärtig auch bei den Pfingstgemeinden nur sehr bedingt von „missionarischen Erfolgen“ sprechen, auch wenn insgesamt immerhin ein beachtliches Wachstum zu verzeichnen ist.
Für die Gemeinden im BFeG liegen genaue Angaben vor, wie viele Personen in den jeweiligen Einzelgemeinden zum Glauben gekommen sind, ohne in der Gemeinde aufgewachsen zu sein. Zwischen 2012 und 2019 haben sich pro Jahr 347 Menschen „von außerhalb“ bekehrt, durchschnittlich 0,7 Bekehrte pro Gemeinde. Das entspricht einem jährlichen Bekehrungswachstum von 0,8 %. Rechnet man die entsprechenden Kinder und Jugendlichen aus Gemeindefamilien dazu, ergibt sich eine durchschnittliche Zahl von 1,2 Bekehrten pro Gemeinde und Jahr bzw. ein jährliches Bekehrungswachstum von 1,7 %.
Bedeutsam auch hier: Die große Mehrheit der Hinwendungen zum christlichen Glauben wird von einer überschaubaren Zahl von Gemeinden erzielt. Für die Jahre 2018 und 2019 sieht das so aus: Über 50 % der Gemeinden weisen keine Bekehrungen auf. Der Anteil der Gemeinden mit sechs oder mehr Bekehrungen in diesen Jahren liegt bei unter 20 %. Oder anders gesagt: In weniger als 50 % der Gemeinden finden überhaupt Bekehrungen statt; 80 % davon in nur 20 % der Gemeinden.
Diese Zahlen sind nicht nur auf den ersten Blick ernüchternd. Es lässt sich nicht leugnen: Auch im freikirchlichen Bereich befinden wir uns in einer Krise der Mission und Evangelisation. Auch Freikirchen gelingt es nur begrenzt, Menschen außerhalb der Gemeinden zu erreichen. Es gibt einige Gemeinden, die wachsen, doch auch hier spielen biologischer Nachwuchs, Migration und Gemeindewechsel eine maßgebliche Rolle.
Halten wir fest: Freikirchen haben eine relative Wettbewerbsstärke, aber kein ausgesprochenes missionarisches Wachstum. Doch dies muss kein Grund zur Hoffnungslosigkeit oder Resignation sein, wie wir noch sehen werden.
c) Wen erreichen Freikirchen?
In den letzten zehn Jahren haben die beiden Großkirchen in Deutschland durch Austritt fast vier Millionen Mitglieder verloren. Dieser Mitgliederschwund wird nur zu einem sehr geringen Teil von den Freikirchen aufgefangen. Deren bestenfalls moderates Wachstum zeigt: Selbst aus dem Milieu, das bisher noch nominell kirchlich gebunden war, sich aber von der Kirche und vom Glauben immer mehr entfremdet hat, haben insgesamt nur wenige den Weg in Freikirchen gefunden. Wen erreichen Freikirchen dann eigentlich?
Dieser Frage bin ich (Philipp) in einer umfangreichen Studie zur persönlichen Glaubensgeschichte von Freikirchen-Mitgliedern nachgegangen, mit folgenden interessanten Ergebnissen:15 Die überwältigende Mehrheit der Mitglieder deutscher Freikirchen hat in ihrem Lebenslauf eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Kirchenbindung vorzuweisen (Taufe, Konfirmation, Gottesdienstbesuche usw.). Knapp 16 % derer, die heute zu einer Freikirche gehören, geben an, vorher mindestens 5 Jahre keinerlei Verbindung zu irgendeiner Kirche gehabt zu haben. Das heißt: Nur sehr wenige Menschen, die von Freikirchen erreicht und integriert werden konnten, hatten in ihrer Glaubensbiografie vorher keine prägenden kirchlichen Kontakte.
Im Detail ergibt sich folgendes Bild: 33 % der Befragten sind in Freikirchen aufgewachsen und haben dort einigermaßen regelmäßig den Gottesdienst besucht. Insgesamt 59 % zählen zur Gruppe der „Freikirchenfernen“. Diese gehörten zwar früher nicht zu einer Freikirche, hatten aber dennoch einen Bezug zum christlichen Glauben bzw. zu einer der großen Kirchen. Der Anteil derer, die vor ihrem Eintritt in eine Freikirche „unkirchlich“ waren, also nie etwas mit einer Kirche zu tun hatten und bestenfalls punktuell mit kirchlichen Handlungen in Berührung gekommen sind, liegt bei ca. 8 %.
Schließlich ist eine weitere Frage für den Gemeindeaufbau von großer Relevanz: Wie stark religiös sozialisiert bzw. kirchlich vorgeprägt sind speziell diejenigen, die in Freikirchen zum Glauben kommen? Zur Beantwortung dieser Frage lassen sich drei Typen von Bekehrungen unterscheiden:
der
Vergewisserungstyp
, der bereits vor der Glaubensveränderung mit der Kirche verbunden war und im Elternhaus eine religiöse Sozialisation erfahren hat;
der
Entdeckungstyp
, der zwar eine religiöse Sozialisation im Elternhaus erlebt hat, aber kaum oder gar nicht mit der Kirche verbunden war;
der
Lebenswendetyp
, der vor der Bekehrung keine religiöse Sozialisation durchlaufen hat.
16
Die Daten zeigen also: Bei gut 80 % der Personen, die im Rahmen einer Freikirche zum Glauben gekommen sind, ist ihre Bekehrung eine Fortführung oder Erneuerung bisheriger Glaubenserfahrung bzw. ein Anknüpfen an ein bereits vorher vorhandenes christliches Erbe. Offensichtlich wecken Freikirchen in der Regel ein bereits schlummerndes Glaubenspotenzial auf und greifen (mehr oder weniger bewusst) auf die entsprechende christlich-kirchliche Vorprägung zurück. Was das für den freikirchlichen Gemeindeaufbau bedeutet, werden wir später noch sehen (→ Kapitel 7). Andersherum betrachtet bedeutet dies immerhin: Beinahe jeder fünfte Befragte, der in einer Freikirche zum Glauben gekommen ist, weist keinen christlichen Hintergrund auf. Lebenswenden hin zum Glauben sind in Freikirchen für säkularisierte Menschen ohne vorhandene religiöse Sozialisation also durchaus möglich.
d) Zusammenfassung
Freikirchen haben sich – vor allem im Vergleich zu den traditionellen Großkirchen – eine gewisse „Wettbewerbsstärke“ erhalten. Aus missionarischer Sicht geben die teilweise sogar recht erfreulichen Wachstumszahlen allerdings kaum Anlass zu großer Euphorie: Erstens handelt es sich beim mäßigen freikirchlichen Zuwachs zu einem gewissen Teil um (evangelikal geprägte) protestantische Christen, die ihrer evangelischen Landeskirche enttäuscht den Rücken kehren. Zweitens ist der Erfolg wachsender Freikirchen in der Regel immer auch Resultat von Wechselbewegungen aus weniger „attraktiven“ Freikirchen. Und drittens sind die Einwanderung ausländischer Christen und die Aufnahme bereits bestehender Gemeinden weitere wichtige Faktoren für die Mitgliederzunahme in freikirchlichen Bünden. Der Anteil derer, die sich in Freikirchen tatsächlich neu dem christlichen Glauben zuwenden, bleibt überschaubar. Gerade Menschen aus den wachsenden säkularisierten Gesellschaftsschichten, die gänzlich ohne christlich-kirchliche Prägung aufwachsen, werden von Freikirchen kaum erreicht.
Kapitel 2
Die Zeiten haben sich geändert:
Freikirchen in einem säkularisierten Kontext
In den vergangenen Jahrzehnten hat Religion in Europa massiv an Bedeutung verloren. Die Religionssoziologen sprechen von „Säkularisierung“. Gesellschaftspolitisch ist von einer „neuen Normalität“ die Rede. Vieles ist nicht mehr, wie es war. Tiefgreifende Umwälzungen sind für alle spürbar. Die Zeiten haben sich geändert. Diese „neue, säkulare Normalität“ betrifft auch den Gemeindeaufbau und stellt uns vor eine wichtige Aufgabe: Um entscheidende Weichen für die Zukunft richtig stellen zu können, hilft es, zunächst den gegenwärtigen gesellschaftlichen Kontext zu durchdenken. Schauen wir uns also die kulturellen Rahmenbedingungen etwas genauer an, die unseren Auftrag heute beeinflussen. Vor dem Hintergrund der ursprünglichen Entstehungssituation von Freikirchen (→ a) befassen wir uns mit den Hauptmerkmalen unseres nach-christentümlichen (→ b und → c) und postmodernen Zeitalters (→ d). Mit den Konsequenzen, die sich daraus für die Gemeindearbeit ergeben, beschäftigen wir uns in → Teil II.
a) Wie uns die Geschichte hilft, die Gegenwart zu verstehen
Will man die besonderen Herausforderungen für Freikirchen speziell im deutschsprachigen Europa verstehen und ihnen weise begegnen, ist zunächst ein kurzer Blick auf ihre Entstehungsgeschichte sinnvoll.17 Denn die klassischen Freikirchen (und damit auch ihre neueren Ableger) haben ihre Wurzeln in einer noch zutiefst vom christlichen Glauben und kirchlichen Leben geprägten Kultur und Gesellschaft. In einem solchen Kontext haben sich Freikirchen historisch betrachtet bewusst als Opposition zur Volks- bzw. Landeskirche gebildet und als Alternativmodell in Abgrenzung zur Großkirche verstanden. Als missionarisch orientierte Bewegung lehnten Freikirchen ausdrücklich die gängige Überzeugung ab, wonach Deutschland eine christliche Nation sei, die keiner Evangelisierung mehr bedürfe. Letztlich lebten freikirchliche Gemeinden damit aber trotz vielfältiger Ablehnungs- und Abgrenzungstendenzen in einer Art paradoxen Symbiose mit der kirchlichen Mehrheit: Man ging zwar bewusst auf Distanz zum vielfach kritisierten kirchlichen Feindbild, profitierte aber gleichzeitig vom volkskirchlichen Wirken. So konnten Freikirchen auf die gesellschaftlich etablierten kirchlich-christentümlichen Strukturen aufbauen, bei der Glaubensweitergabe an die von der Kirche vermittelten Gottes- und Moralvorstellungen anknüpfen und ein allgemeines Grundverständnis des christlichen Glaubens in der Bevölkerung voraussetzen.
In diesem Zusammenhang wurde Freikirchen immer wieder vorgeworfen, „in fremden Teichen zu fischen“ bzw. der Volkskirche „Schafe abzujagen“. Über die Berechtigung dieses Einwandes lässt sich streiten. Die vorhandenen volkskirchlichen Gegebenheiten ab dem 19. Jahrhundert waren jedenfalls für die Entstehung und Verbreitung der Freikirchen enorm förderlich – besonders dort, wo es gelang, die bereits existierenden „erwecklichen“ Impulse (als Folge verschiedenster Erweckungsbewegungen) freikirchlich zu kanalisieren.
Ohne Zweifel ging es Freikirchen in erster Linie darum, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, die dem christlichen Glauben fernstanden. Doch die zunehmende innere Distanzierung vieler Kirchenchristen vom volkskirchlichen Leben und die Entstehung erwecklicher Gruppen begünstigte die freikirchlichen Gemeindegründungen: Hier fanden Freikirchen den entsprechenden Nährboden für die Entwicklung ihrer eigenen Gemeinschaften. Eine süffisante Bemerkung des sonst um Sachlichkeit bemühten Freikirchenkritikers J. Jüngst zu Anfang des 20. Jahrhunderts spricht Bände: