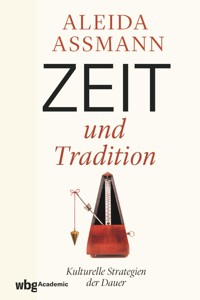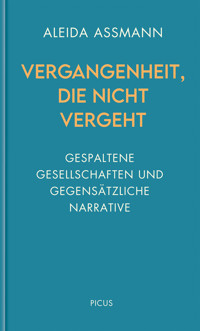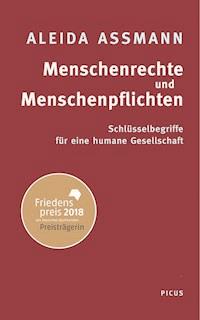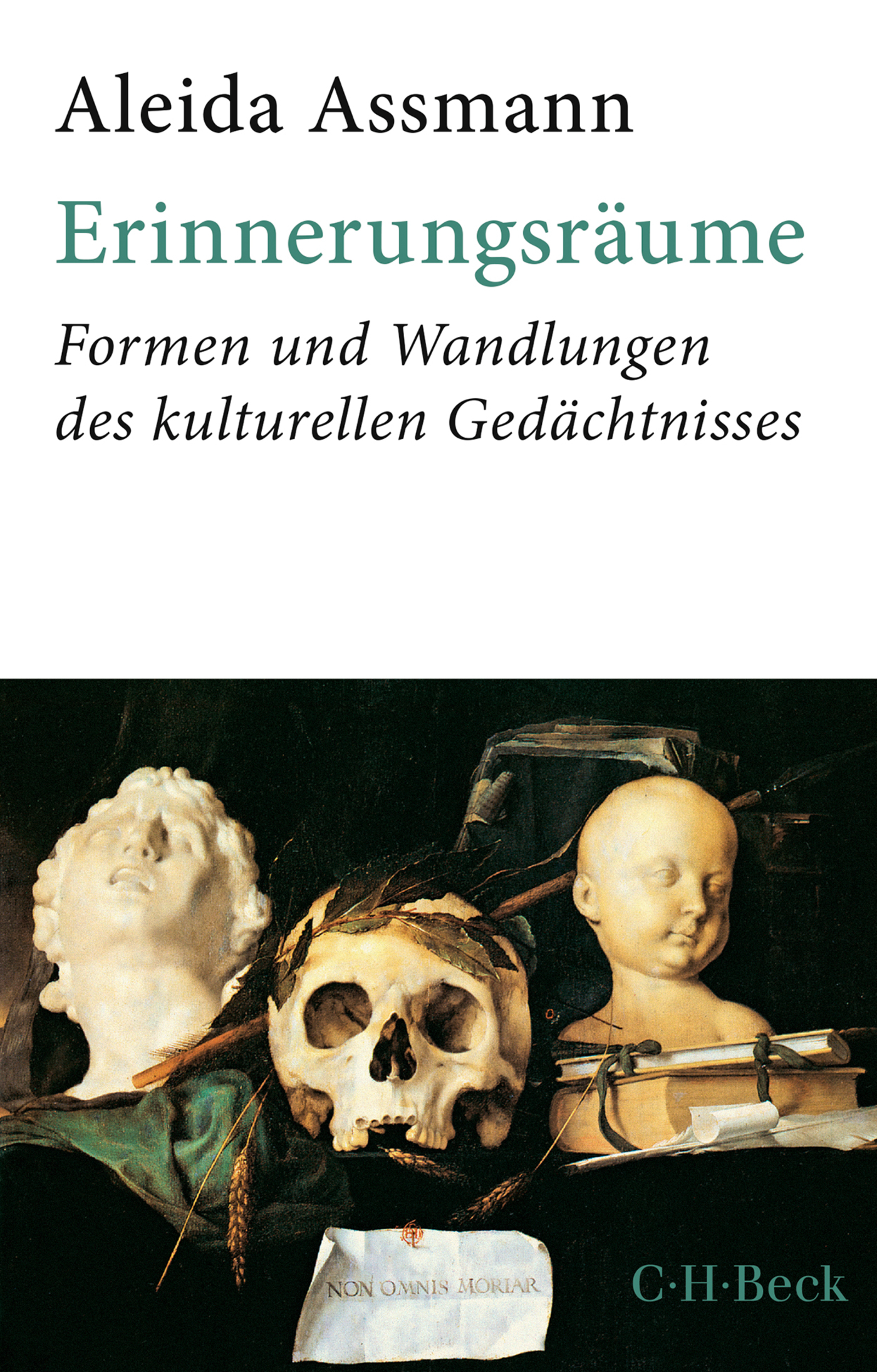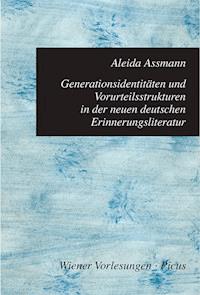18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Die resiliente Demokratie braucht kein Feindbild, aber einen starken Sinn für das, was Menschen miteinander verbindet und zusammenhält." Dass Menschen mitfühlend und solidarisch sein können, bestätigen uns inzwischen die Neurowissenschaften. Dieser sechste, soziale Sinn braucht allerdings auch die Stütze einer entsprechenden «politischen Kultur». In ihrem glänzend geschriebenen Buch zeigen Aleida und Jan Assmann kulturelle Rahmenbedingungen für Gemeinsinn auf und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung unserer Demokratie. Die gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Debatten sind von schroffen Alternativen geprägt: Brauchen wir universale Werte, oder müssen die Eigenarten unterschiedlicher Nationen und Kulturen anerkannt werden? Ist die Linderung von Not eine Sache des zivilgesellschaftlichen Engagements, oder befestigt man damit ungerechte Strukturen, die nur der Staat ändern kann? Aleida und Jan Assmann zeigen, dass solche Fragen falsch gestellt sind. Denn wir brauchen beides: universale Werte und den Respekt vor kollektiven Identitäten. Und zivilgesellschaftliches Engagement ist sehr wohl in der Lage, Strukturen zu verändern. Auf der Spur von Schlüsselbegriffen wie Solidarität, Brüderlichkeit, Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe, Empathie und Respekt und in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Menschenbildern und Beziehungsstrukturen innerhalb und außerhalb Europas bestimmen sie neu, was Gemeinsinn sein kann. Sie fragen nach den Grundlagen einer demokratischen politischen Kultur und zeigen die Wirkungskraft von Gemeinsinn konkret an ermutigenden Beispielen von Schwimmbädern und Stolpersteinen bis hin zu Aufräumaktionen und Tafeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Aleida Assmann Jan Assmann
GEMEINSINN DER SECHSTE, SOZIALE SINN
C.H.Beck
Übersicht
Cover
INHALT
Textbeginn
INHALT
Titel
INHALT
Widmung
VORWORT
EINLEITUNG
Gemeinsinn und Demokratie
Die Fragestellung
Zur Forschungsdiskussion
1. GEMEINSINN: ZUR SPRACH- UND BEGRIFFSGESCHICHTE
Sensus communis
Gemein, Gemeinwohl und Gemeinsinn
Gemeinschaft und Gesellschaft
Christian Thomasius, der deutsche Erfinder des Gemeinsinns
2. SOLIDARITÄT
Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Gemeinsinn, Solidarität
Neue Impulse für Solidarität
Empirische Perspektiven
Zwei Solidaritätskritiker
«Solidarität-mit» und «Solidarität-gegen»
«Sprechen-für»: Ein anderer Begriff des Politischen
«Sprechen-als»: Identitätspolitische Einsprüche
3. BRÜDERLICHKEIT
Die dritte Farbe der Trikolore
Zwischen Rechtsbruch und Bürgerpflicht: Der Fall Cédric Herrou
Die Rolle der politischen Kultur
4. MENSCHENBILDER ZWISCHEN PARTIKULARISMUS UND UNIVERSALISMUS
Ist der Mensch gut oder böse? Anthropologische Perspektiven
Mann und Frau, Erziehung und Gleichstellung
Staatstheorien und ihre anthropologischen Grundlagen
Carl Schmitts Kampf gegen die «jüdische Demokratie»
Die Entstehung des Individuums
Kant: Gemeinsinn und kategorischer Imperativ
Karl Löwith: Der Mensch in der Rolle des Mitmenschen
5. BEZIEHUNGSGRAMMATIKEN: FEINDBILDER UND FREUNDBILDER
Bedrohungsbewusstsein durch Freund-Feind-Denken
Populismus um 1900 und um 2000
Karl Lueger, der Antisemit
Arthur J. Finkelstein, der Vergifter
Praktischer Universalismus: Grenzüberwindende Nächstenliebe
Wer ist mein Nächster? Das jüdische und christliche Liebesgebot
Unser Schwert ist Liebe: Die feministische Revolte im Iran
Ta’ayush: Ein aktuelles Beispiel aus dem Westjordanland
Izzeldin Abuelaish: Ich werde nicht hassen
Neue Perspektiven der Empathieforschung
René Rhinow: Mitfühlender Liberalismus
Joachim Bauer: Von der Psychosomatik zur Soziosomatik
Michèle Lamont: Würdigung und Stigmatisierung
Der Osten schreibt zurück: Zu einer innenpolitischen Schieflage
6. GRUNDSÄTZE DEMOKRATISCHER POLITISCHER KULTUR
Schnelles und langsames Denken
Vier Formen von Respekt
Statusrespekt
Leistungsrespekt
Sozialer Respekt
Kultureller Respekt
Möglichkeiten und Grenzen des Respekts
Identitätspolitiken zwischen Universalismus und Partikularismus
Religio duplex: Universalismus und Kosmopolitismus
Moral und Menschheit
Nietzsches Absage an die christliche Moral
Die Neugründung der Moral
Gleiche Rechte für Ungleiche
Menschenrechte und Menschenpflichten
7. HELDEN UND HELDINNEN DES GEMEINSINNS
Japanische Fußballfans in Qatar
Versehrte Städte
Zweitzeugen und Stolpersteine
Ein Denkmal für Flucht und Migration in Kassel
Tafeln in Deutschland
Miteinander reden in Ostritz
Menschenrechtsstädte
Ein Menschenrecht auf Zukunft: «Black Quantum Futurism»
Althengstett und Ostelsheim
EPILOG ODER: WAS WIR VON DEN FINNEN LERNEN KÖNNEN
ANHANG
ANMERKUNGEN
Vorwort
Einleitung
1. Gemeinsinn: Zur Sprach- und Begriffsgeschichte
2. Solidarität
3. Brüderlichkeit
4. Menschenbilder zwischen Partikularismus und Universalismus
5. Beziehungsgrammatiken: Feindbilder und Freundbilder
6. Grundsätze demokratischer politischer Kultur
7. Helden und Heldinnen des Gemeinsinns
Epilog oder: Was wir von den Finnen lernen können
LITERATUR
Internetquellen (sofern nicht bei den Autoren angegeben)
BILDNACHWEIS
PERSONENREGISTER
Zum Buch
Vita
Impressum
Unseren Kindern Vincent, David, Marlene, Valerie, Corinna
VORWORT
1957 wurde in Bonn ein unabhängiger und überparteilicher Bürgerverein namens «Aktion Gemeinsinn e.V.» gegründet. Er setzte «auf die Bereitschaft der Menschen zum Engagement für den Zusammenhalt der Gesellschaft» und griff Probleme auf, die «im Interesse aller gelöst werden müssen, die aber Staat, Länder und Gemeinden nicht oder nicht alleine lösen können. Denn was der Staat nicht tun kann, was aber dennoch für die Gemeinschaft getan werden muss, das muss der Bürger tun.»[1] Der Verein verzichtete bewusst auf institutionelle Förderung durch den Staat und finanzierte seine Arbeit ausschließlich über Beiträge, Spenden und Zuwendungen für Projekte. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter leisteten inhaltliche und organisatorische Hilfe. 2015 stellte der Verein seine Arbeit ein. Der letzte Vorsitzende war Henning von Vieregge, Autor des Buches Wo Vertrauen ist, ist Heimat. Auf dem Weg in eine engagierte Bürgergesellschaft.
Davon wussten wir nichts, als wir uns vornahmen, den Begriff «Gemeinsinn» wieder aufzunehmen und neue Zugänge zu ihm zu sondieren. Als produktiver Kontext für diese Aufgabe bot sich ein von der Dr. K. H. Eberle Stiftung an der Universität Konstanz von 2020 bis 2023 gefördertes Projekt an mit dem Titel: «Gemeinsinn. Was ihn bedroht und was wir für ihn tun können». Dass die Hälfte dieser Laufzeit in die Coronazeit fiel, hat die Arbeit an dem Thema nicht behindert, sondern eher noch angetrieben. Denn erstens stand menschliches Zusammenleben plötzlich unter dem Vorzeichen «Gemeinsinn» und war von gegenseitiger Rücksicht bestimmt, deren erste Regel lautete: «Deine Maske schützt mich, meine Maske schützt dich.» Und zweitens, nicht weniger wichtig, erschloss die digitale Technologie der Videokonferenz ganz neue Foren und Formen distanzierter Zusammenarbeit. Davon konnte die Arbeitsgruppe, für die wir an der Universität Konstanz ein ideales Milieu fanden, sehr profitieren.[2] Wir sind der Stiftung und der Universität, vor allem aber den Mitgliedern der Gemeinsinn-Gruppe und ihren Gästen für reichhaltige Anregungen, spannende Diskussionsrunden und Kooperationen zu großem Dank verpflichtet.
Innerhalb dieser größeren Gruppe hat sich noch eine engere Kooperation entwickelt. Dass wir als Ehepaar zusammenarbeiteten, war für uns selbstverständlich, aber dass diese Zusammenarbeit unter der Hand die Form einer Ko-Autorschaft angenommen hat, war für uns beide neu und überraschend. Es ist schmerzlich, dass einer von uns das Erscheinen dieses Buches nicht mehr erlebt. Aber es war ein großes Glück, dass wir es noch gemeinsam zu Ende schreiben konnten.
Ich danke Ulrich Nolte und Jonathan Beck vom Verlag C.H.Beck dafür, dass sie dieses Buchmanuskript so wohlwollend angenommen haben. Ulrich Nolte hat den Editionsprozess mit großem persönlichem Einsatz beraten und begleitet; Sabine Walther hat ihn mit Kompetenz und Sorgfalt unterstützt und David Assmann hat sich wie gewohnt als kritischer Mitleser bewährt. Allen sei für diese so effektive Kooperation herzlich gedankt.
Konstanz, im Frühjahr 2024 Aleida Assmann
EINLEITUNG
Gemeinsinn und Demokratie
In den letzten zehn Jahren ist die Demokratie verstärkt ins Zentrum wissenschaftlicher Aufmerksamkeit gerückt. Viele Institute zu diesem Thema wurden neu gegründet, der Begriff tauchte immer öfter in wissenschaftlichen Großprojekten und Forschungsverbünden auf, die Zahl aktueller Publikationen ist rasant angestiegen. Der Grund ist offensichtlich: Demokratien befanden sich nicht mehr im Aufwind, sondern erfuhren erstmals in der Geschichte des Westens starken Gegenwind. Das war nach 1989 noch ganz anders. Nach dem Sturz der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges bekannten sich viele Staaten zu dieser Regierungsform und strebten eine Mitgliedschaft in der EU an. Auch außerhalb der EU formierten sich in autoritären Staaten zivilgesellschaftliche Bewegungen, die trotz repressiver Gewalt mit ihren Großdemonstrationen zeigten, wie attraktiv und ansteckend demokratische Grundwerte sind. Charles Taylor konstatierte damals: «Demokratie ist zu einer Norm geworden, der sich niemand mehr verweigern kann. Es gibt eine Art Demokratisierungsdruck, der für alle Gesellschaften gilt.» Er sah in dieser Entwicklung einen historischen Wandel der «politischen Legitimation» der Demokratie und sprach von einem internationalen Konsens, denn er beobachtete, dass sich in den 1990er Jahren selbst autoritäre Regime als Demokratien «tarnen» mussten.[1]
Doch die Hoffnung, dass mit dem Ende des Staatssozialismus auch der Anfang eines neuen Zeitalters der Demokratisierung beginnen würde, wurde bald getrübt. Gewiss gab es 2013/2014 den Maidan in Kyjiv, auf dem sich die Ukrainer zur EU bekannten und über hundert von ihnen als Märtyrer der Freiheit ermordet wurden. 2020 gingen in Belarus Hunderttausende aus Protest nach einer gefälschten Wahl auf die Straße, darunter weiß gekleidete Frauen mit Blumen in der Hand. Im Iran erleben wir gegenwärtig eine feministische Revolution unter dem Motto: «Frau, Leben, Freiheit!», getragen von ungeheurem Mut und großer Solidarität. Das sind nach wie vor beeindruckende Manifestationen von Zivilgesellschaften. Es gibt aber auch massive Gegenbewegungen, die sich formieren und strategisch aufstellen. Dazu gehören radikale nationalistische Parteien, die in demokratischen Ländern wie Polen, Italien, Ungarn und auch Deutschland mit fremdenfeindlichen Parolen mobilisieren. Auch in anderen EU-Staaten gewinnen rechte Parteien an Zulauf, die offen gegen Pluralismus und Menschenrechte polemisieren. In einigen Mitgliedstaaten wenden sich die Regierungen inzwischen offen gegen den demokratischen Wertekonsens der EU und bauen ihren Staatsapparat um. In Polen wurde das System unabhängiger Richter unterlaufen, Ungarn verwandelte sich unter Präsident Orbán von einer Demokratie in eine «hybride Wahlautokratie». Eine ähnliche Entwicklung war in Israel zu beobachten.
Kein Wunder, dass in dieser Zeit der politischen Krisen und Kriege das wissenschaftliche Interesse an Demokratie deutlich zugenommen hat. Warum hat die Demokratie an Überzeugungskraft verloren? Es gibt gute Gründe, genauer wissen zu wollen, wodurch diese Regierungsform gefährdet ist und wie sie gestärkt werden kann. Lange Zeit galt der Streit als das belebende Elixier der Demokratie. Wir erinnern uns an diese verbreitete Empfehlung: Kontroverse Diskussionen sollten innovative Lösungen hervorbringen und auf diese Weise einen permanenten Fortschritt in Gang setzen. Man war sich einig: Widerspruch und Gegenpositionen zwingen zum Nachdenken und Nachbessern, sie fördern geistige Beweglichkeit und halten die Gesellschaft in Bewegung, um auf immer neue Herausforderungen konstruktive Lösungen zu finden.
So weit, so gut. Es kommt dabei aber letztlich auf die Qualität des Arguments und seine Überzeugungskraft an. Verantwortliche Politiker waren immer in der Lage, für ihre Ziele und Werte auch Unterstützung im anderen Lager zu finden. Differenz und Dissens zwischen den Parteien ist selbstverständlich und gewollt, schloss aber Übereinstimmungen in den Werten und der Einschätzung des Gesamtbilds nicht aus. Diese Form des kommunikativen Streits unterscheidet sich klar von der Form des unkommunikativen Streits, mit dem wir es heute in politischen Auseinandersetzungen zu tun haben.
Die neue Form von Streit schließt Konsens nämlich prinzipiell aus. Der Blick auf ein wie immer geartetes Gemeinwohl ist der Gesellschaft abhanden gekommen. Sie ist ideologisch gespalten. Die AfD hat kompromisslose Umgangsformen eingeführt und neue Maßstäbe gesetzt, und viele Politiker haben sich an dieses populistische Klima angepasst. «Nachhaltig ist das neue Profitabel», verkündet die Werbung einer großen Unternehmensberatung im Intercity. Doch solche Formen des Kompromisses und des Interessensausgleichs sind eher selten. Wer an die Wirtschaft denkt, lehnt den Klimaschutz ab, wer an die Umwelt denkt, lehnt die Wirtschaft ab. Viele erregte Diskussionen (man denke an Gendersternchen) dienen heute nichts anderem als einer kategorischen Veränderungsverhinderung. Die Bremse des Status Quo wird dabei immer fester angezogen. Der Streit hat die Grundwerte der Demokratie erfasst. Der Graben zwischen Demokraten und Antidemokraten wird immer tiefer. Während die Konsenslosigkeit dazu führt, dass wir auf der Stelle treten und sich nichts mehr bewegt, führt die Politik der Antidemokraten zur Selbstabschaffung der Demokratie.
Die Selbstabschaffung der Demokratie ist ein Thema, das die Soziologin Eva Illouz näher untersucht hat.[2] Ihre Fragestellung geht auf die Kritische Theorie der Frankfurter Schule zurück, die gezeigt hat, dass die Demokratie gefährliche Möglichkeiten besitzt, ihre eigenen Grundlagen zu untergraben. Aber anders als Erich Fromm, Horkheimer, Adorno und andere geht Illouz nicht von einem «autoritären Charakter» aus, sondern von bestimmten problematischen Gefühlen, die in einer digitalisierten Gesellschaft inzwischen strategisch massenhaft produziert und eingesetzt werden, um die Wahrheit zu untergraben, Rationalität auszuhebeln und das soziale Mitgefühl zu vergiften.
Mit diesen Fragen beschäftigt sich auch das vorliegende Buch. In diesem Fall sind die Autoren jedoch weder Politologen, Philosophen, Soziologen, Historiker oder Rechtstheoretiker, sondern hoffen, als Kulturwissenschaftler einen Beitrag zu diesem Thema zu leisten. Mit der Thematisierung von Gefühlen sind wir bereits mitten in der Kultur der untersuchten Gesellschaften angekommen. Gefühlskulturen existieren nicht nur in der Gegenwart, sondern überdauern auch und speisen sich aus den Quellen der eigenen Geschichte und den Profilen früherer Identitätskonstruktionen. Denn die politische Frage: Wie wollen wir leben? ist nur schwer zu trennen von der Frage: Wer wollen wir sein? Und diese Frage ist noch schwerer zu trennen von der Geschichte, die man gemeinsam durchlebt hat. Im Zentrum der Frage nach der Zukunft der Demokratie stehen somit auch Fragen nach der Zugehörigkeit, nach Kriterien des Einschließens und Ausschließens und nach Menschenbildern und sozialen Beziehungsgrammatiken. Mit diesen Stichworten sind bereits einige zentrale Begriffe benannt, mit denen wir arbeiten werden. Sie werden in den Kapiteln dieses Buches entwickelt in der Hoffnung, damit der Demokratieforschung weitere relevante Perspektiven zu eröffnen.
Die Fragestellung
Was heißt und zu welchem Ende studieren wir den Gemeinsinn? Bevor wir uns der Geschichte, Bedeutung und Aktualität des Wortes zuwenden, müssen wir zunächst den Kontext, die Problemlage und vor allem die Stoßrichtung dieser Frage klären. Einen ersten Impuls für die grundsätzliche Frage nach der Funktion von Gemeinsinn hat der Staatsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde in seinem berühmt gewordenen Diktum gegeben: «Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Als freiheitlicher Staat kann er (…) nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert.»[3]
Seine Leser und Kritiker wollten damals natürlich genauer wissen, was denn mit der «moralischen Substanz des einzelnen» und der «Homogenität der Gesellschaft» gemeint sei. In einer Antwort auf diese Fragen hat Böckenförde nachgeliefert und präzisiert: «Vom Staat her gedacht, braucht die freiheitliche Ordnung ein verbindendes Ethos, eine Art ‹Gemeinsinn› bei denen, die in diesem Staat leben. Die Frage ist dann: Woraus speist sich dieses Ethos, das vom Staat weder erzwungen noch hoheitlich durchgesetzt werden kann? Man kann sagen: zunächst von der gelebten Kultur. Aber was sind die Faktoren und Elemente dieser Kultur? Da sind wir dann in der Tat bei Quellen wie Christentum, Aufklärung und Humanismus.»[4]
Mit dieser Erläuterung zu seinem Diktum hat der Rechtswissenschaftler Böckenförde einen ganzen Strauß von Fragen an die Kulturwissenschaftler weitergereicht. Fragen wir zuerst einmal: Wie ist dieses berühmte Diktum entstanden? Es lohnt sich, die Sätze, die wie ein Mantra immer wieder zitiert werden, genauer in ihrer Entstehungsgeschichte zu beleuchten. Böckenförde hat seinen wichtigen Gedanken zu einer möglichen Lücke in der Verfassung zuerst 1964 in Anwesenheit von Carl Schmitt auf einem Sommerseminar in Ebrach vorgetragen, das der Heidelberger Staatsrechtler Ernst Forsthoff regelmäßig für seinen akademischen Lehrer organisierte. Weil dieser aufgrund seiner NS-Vergangenheit von jeder akademischen Lehrtätigkeit ausgeschlossenen war, gab ihm sein Schüler Forsthoff die Gelegenheit, regelmäßig mit einer handverlesenen Auswahl seiner eigenen Studenten zu diskutieren.
Im Mittelpunkt dieses Seminars stand die Frage nach der Autonomie der demokratischen Gesellschaft innerhalb eines säkularen Staats, der auf jegliche Weihen der Religion verzichtet. Böckenförde wies damit auf eine Leerstelle in der westdeutschen Demokratie hin, die durch Säkularisierung und die Privatisierung der Religion entstanden ist. Das Rechtssystem kann sich in der Demokratie nicht selbst autorisieren, es braucht einen Schutz durch «Einbettung» in eine bestimmte politische Kultur. Auf die Frage, wie diese Leerstelle kompensiert werden könne, gab Böckenförde eine tentative Antwort: durch die moralische Substanz der individuellen Bürger und die Homogenität der Gesellschaft. Mitte der 1960er Jahre konnte sich Böckenförde noch auf eine homogene, christlich geprägte Gesellschaft verlassen. Das verbindende Ethos suchte er in «einer Art Gemeinsinn» derer, die in diesem Staat leben, und verstand darunter im Wesentlichen das, was diese Menschen bereits gemein haben, nämlich ihre gelebte Kultur.
Böckenfördes Diktum ist in den 1960er Jahren entstanden. Die Welt hat sich seither stark verändert. In Deutschland gab es viele Einwanderungswellen, nicht nur unmittelbar nach 1945, sondern auch ab den 1960er Jahren mit dem Anwerbeabkommen u.a. türkischer «Gastarbeiter», deren Enkel inzwischen in der dritten Generation in Deutschland leben. Die Voraussetzungen, von denen Böckenförde ausging, gibt es heute in der diversen Gesellschaft so nicht mehr. Was er noch als Lösung des Problems ansah, erweist sich heute als eine offene Frage. Seine Lösung erinnert an die verschiedenen Vorschläge einer deutschen «Leitkultur». Dieses Konzept griff im Jahr 2000 Friedrich Merz auf, als es galt, auf das neue Staatsbürgergesetz zu reagieren.[5] Die Leitkultur sollte Inhalte der Mehrheitskultur zusammenfassen und sie zu einer verbindlichen Voraussetzung für den Integrationsprozess von Zuwanderern machen. In einem Papier vom Mai 2001 erklärte der CDU-Bundesvorstand, was er sich unter den «Faktoren und Elementen» der «gelebten Kultur» vorstellte: «Grundlage des Zusammenlebens in Deutschland ist nicht multikulturelle Beliebigkeit, sondern die Werteordnung der christlich-abendländischen Kultur, die von Christentum, Judentum, antiker Philosophie, Humanismus, römischem Recht und Aufklärung geprägt wurde. Integration setzt voraus, dass diese Werteordnung akzeptiert wird.»[6]
Bei dem Versuch, den Einwanderern ein kollektives Selbstporträt der Mehrheitsgesellschaft vorzustellen, haben die hier zusammengefassten Werte und Traditionen durchaus Bedeutung, handelt es sich dabei doch um das Angebot eines europäischen Erbes, das hoch geschätzt und deshalb aktiv zu pflegen und zu nutzen ist. Es ist aber nicht unproblematisch, bei der Präsentation des kollektiven Selbstbildes der deutschen Gesellschaft einen exklusiven Kulturstolz zu entwickeln, der sich nur die positiven Traditionen heraussucht und die dunklen Kapitel der eigenen Geschichte mit Schweigen übergeht. Die deutsche und die europäische Kultur sind bekanntlich auch von Traditionen gewalttätiger Expansion, von Kolonialisierung, Sklaverei, Rassismus, Antisemitismus und übersteigertem Nationalismus geprägt, der sich in zwei Weltkriegen entladen hat; von der forcierten Zerstörung der Umwelt durch ungezügelte Modernisierung ganz zu schweigen. Es wäre keine Schande für die Bewohner eines Landes, wenn sie ihre Geschichte etwas vollständiger erzählen und sich mit den Zugewanderten auch darüber austauschen würden.
Seit dem Antritt der neuen Regierung der Ampelkoalition 2021 ist es still um das auf Assimilation ausgerichtete Konzept der Leitkultur geworden.[7] Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass durch demographischen Wandel die Heterogenität der Gesellschaft deutlich zugenommen hat. Folglich hat das von Böckenförde angesprochene Desiderat – «ein verbindendes Ethos, eine Art Gemeinsinn» als Stütze des demokratischen Rechtsstaats und seiner freiheitlichen Grundordnung – nichts von seiner Dringlichkeit verloren, sondern ist im Gegenteil in der heterogenen Gesellschaft noch wichtiger geworden.
Wir können uns hier Rat bei der Soziologin Eva Illouz holen, die 2023 ein Buch über Undemokratische Emotionen veröffentlicht hat. In diesem Buch, das auf die von Populisten mit Vorliebe geschürten und ausgebeuteten Gefühle eingeht, kommen im Epilog auch noch «die Gefühle einer anständigen Gesellschaft» zu Wort.[8] Hier mahnt die Autorin etwas an, was in der soziologischen und politischen Literatur bislang erstaunlich unterbelichtet geblieben ist: «Leider hat Habermas es versäumt, die Rolle von Gefühlen in einer (…) Zivilgesellschaft explizit zu erörtern.» Jürgen Habermas wie auch Niklas Luhmann haben Gesellschaft bekanntlich als eine Form von «Kommunikation» definiert. Habermas strebte einen «herrschaftsfreien Diskurs» an; auf die Regeln dieser Kommunikation sind beide jedoch nicht weiter eingegangen. Nach bald zwei Jahrzehnten Erfahrung mit sozialen Netzwerken und einem Jahrzehnt Erfahrung mit populistischen Parteien erweist sich diese Leerstelle inzwischen als problematisch.
Nachdem Eva Illouz undemokratische Gefühle wie Angst, Abscheu, Ressentiment und blinden Patriotismus ausführlich beschrieben und analysiert hat, kommt sie zu dem Schluss: «Ich möchte geltend machen, dass die Zivilgesellschaft einen minimalen Respekt einschließen muss und dass ein solcher Respekt nicht möglich ist ohne bestimmte Emotionen, die es uns erlauben, einander in geeigneter Weise als Bürgerinnen und Mitmenschen anzusprechen.» (215) Ähnlich wie Böckenförde ist auch Eva Illouz davon überzeugt, dass eine gute Zivilgesellschaft nicht ohne bestimmte emotionale Dispositionen oder Habitus auskommen kann bzw. sich vor negativen und entwürdigenden Emotionen wie Hass hüten muss. Im Gegensatz zu dem populistischen und rassistischen Wunsch, «alle Unterschiede im Rahmen einer imaginierten Gemeinschaft ähnlicher Menschen zu beseitigen», schlägt sie Emotionen wie «Mitgefühl und Brüderlichkeit» als konstitutiv für eine Zivilgesellschaft vor, «weil beide Emotionen die radikale Fremdheit und Unterschiedlichkeit derer voraussetzen, denen sie gelten» (215).
Niemand konnte sich vor dem 7. Oktober 2023 die Steigerung des Hasses vorstellen, den die Hamas bei ihrem Angriff auf den Kibbuz Be’eri mit ihrem Massaker umsetzte und sadistisch zur Schau stellte. Dieses traumatische Ereignis zeigt, dass heute im Krieg nicht nur militärische Gewalt eingesetzt wird, sondern auch Bilder und Gefühle zu Waffen mit größtem Verbreitungsradius geworden sind. Das Buch, in dem Eva Illouz negative politische Emotionen zu ihrem Thema gemacht hat, ist von diesen bis dahin undenkbaren Ereignissen regelrecht überrollt worden. Von Liebe und Empathie ist nicht mehr die Rede, aber umso mehr von Hass.
Zur Forschungsdiskussion
Mit diesem Buch tragen wir zu einer Wiederbelebung der Begriffe «Gemeinsinn» und «Gemeinwohl» bei, die bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten im Gange ist. Unter dem Thema «Gemeinwohl und Gemeinsinn» konstituierte sich 1998 unter der Leitung von Herfried Münkler eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften mit dem Ziel, Grundlagenforschung im Themenfeld von Demokratie, Recht und Integration zu betreiben. Man wollte prüfen, ob diese beiden altmodischen Begriffe in der modernen Transformationsgesellschaft ausgedient oder im aktuellen Wissenschaftsdiskurs noch eine Gegenwart und sogar Zukunft haben.[9]
Während Gemeinwohl ein Anliegen ist, das alle in einer kleineren oder größeren Gruppe betrifft, handelt es sich bei Gemeinsinn um eine Fähigkeit, die einzelnen Menschen zugesprochen wird. Beide Begriffe haben sich in der politikwissenschaftlichen Forschung als ein komplementäres Paar etabliert. Das Team um Herfried Münkler aus Sozialwissenschaftlern, Politologen, Philosophen und Ethikern hat hier entscheidende Grundlagen gelegt.
Einen wichtigen soziologischen Beitrag hat auch der Habermas-Schüler Claus Offe zu diesem Thema geleistet.[10] Er untersuchte den rhetorisch-performativen Gehalt der Gemeinwohl-Formeln und fragte nach der Passfähigkeit der moralischen Gemeinwohlsemantik innerhalb einer modernen säkularen Gesellschaft, die vorwiegend von Einzelinteressen gesteuert ist. In einer liberalen Gesellschaft, in der man gewohnt ist, in ökonomischen Kategorien wie «Kosten» oder «Anreize» zu denken, seien Begriffe wie «Tugenden» oder «Pflichten» nur schwer unterzubringen. Diese Begriffe hätten daher, so Offe, oft einen appellativen Charakter: «Wenn politische Tugenden nicht bei den Akteuren als normative Ressourcen oder Dispositionen bereits angelegt sind, kann kein institutionelles Verfahren sie evozieren.» Da wir Offe in diesem Punkt zustimmen, konzentrieren wir uns auf den Begriff «Gemeinsinn» und fragen nicht nach Durchsetzungsmechanismen von oben oder von unten, sondern eben nach den «normativen Ressourcen oder Dispositionen, die in den Akteuren bereits angelegt sind», bzw. nach den Rahmenbedingungen einer Gesellschaft, die solche Dispositionen unterdrücken und marginalisieren oder schätzen und begünstigen. Dass Offe für diese Dimension humaner Tugenden offen ist, zeigt sein Umgang mit Begriffen wie Vertrauen, Solidarität, Achtung und Anerkennung, die in den letzten beiden Jahrzehnten eine starke diskursive Aufwertung erfahren haben.
In seinem aktuellen Buch über Gemeinwohl und Weltverantwortung fragt der Politikwissenschaftler Peter Graf von Kielmannsegg nach den Grenzen des Gemeinwohls in einer Zeit globaler Verflechtungen und fortgeschrittener ökologischer Zerstörung. In einem Interview hat er diese Thematik folgendermaßen umrissen: «Die Idee des Gemeinwohls ist immer auf ein begrenztes Gemeinwesen bezogen gewesen: die Stadt, den Staat. Inzwischen leben wir in einem Zeitalter, in dem die Staaten weltweit eng miteinander verflochten sind, aufeinander einwirken, voneinander abhängen. Mehr noch – es gibt heute so etwas wie ein Menschheitsschicksal. Die Frage gewinnt deshalb Schlüsselbedeutung, wie sich die Verantwortung eines partikularen Gemeinwesens für sich selbst und seine Verantwortung für das Menschheitsschicksal zueinander verhalten. Oder wie sie miteinander vereinbar gemacht werden können.»[11]
Die aktuelle Krise der Demokratie hängt direkt mit einem Verlust des Gemeinwohlgedankens zusammen. Die regulative Idee des Gemeinwohls ist gegenwärtig in einigen Demokratien durch das oberste Ziel des Machterhalts der eigenen Partei und einen rücksichtslosen Wettbewerb um die Gunst der Wähler ersetzt worden. Populistische Politik ist aber das Gegenteil einer am Gemeinwohl des Staates und der Gesellschaft orientierten Politik. Wer es sich zum Ziel gesetzt hat, die Emotionen der Wähler zu manipulieren und ihre kurzfristigen Wünsche zu bedienen, hat das Gemeinwohl längst aus den Augen verloren.
Dem Gemeinsinn ist ein Buch von Ulrich Schnabel gewidmet: Zusammen. Wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen (2022). Schnabel ist Wissenschaftsredakteur und Autor erfolgreicher Sachbücher. Auch unser Gemeinsinn-Projekt wird in seinem Buch erwähnt. Es enthält eine reichhaltige Bestandsaufnahme gemeinsinniger Praktiken aus unterschiedlichen Bereichen. In der Kunst zum Beispiel konstatiert er einen neuen Trend vom einsamen Genie hin zum künstlerischen Kollektiv und zur Wertschätzung schöpferischer Zusammenarbeit. Sein aufklärender Journalismus korrigiert Klischees und zeigt, dass in Katastrophensituationen Menschen nicht nur an sich denken, sondern meist freiwillig Hilfe leisten. Er berichtet auch von einfallsreichen Experimenten aus der Wissenschaft, die erklären, unter welchen Umständen in unterschiedlichen Kulturen die Einstellung der Menschen eher auf Egoismus oder auf Altruismus ausgerichtet ist. Zudem wird an vielen alltäglichen Beispielen anschaulich beschrieben, wie «sich aus der beschränkten Energie vieler schwacher Einzelner die große Kraft der Gemeinschaft entwickeln kann». Es kann nämlich von Vorteil sein, eine «kritische Masse» zu bilden, wenn zum Beispiel laut einer neuen Verkehrsregel mehr als fünfzehn «Radfahrende einen ‹geschlossenen Verband› bilden, der über eine Kreuzung fahren darf, selbst wenn die Ampel zwischenzeitlich auf Rot umschaltet».[12]
Das Buch ist aber auch ein Lernbuch, das auf generationsübergreifender biographischer Erfahrung beruht und darstellt, wie sich indivdueller Mut durch Aktionen vervielfachen lässt und man sich dem Anpassungsdruck an die Masse entziehen kann. Die nachwirkende Erfahrung der Diktatur des Nationalsozialismus in der eigenen Familie ist der Hintergrund, vor dem die Werte des Gemeinsinns und der Individualität neu vermessen werden.
Kulturwissenschaftler und Ideenhistoriker haben sich bislang an dieser Diskussion um Gemeinwohl und Gemeinsinn deutlich weniger beteiligt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Anfälligkeit der Demokratie und der Notwendigkeit ihrer Stärkung haben diese Begriffe jedoch eine neue Aktualität gewonnen, weil sie unmittelbare Fragen nach gesellschaftlicher Partizipation, politischer Kultur und der ethischen Unterfütterung des Rechtsstaats aufwerfen. Mit diesem Buch erweitern wir deshalb den politikwissenschaftlichen, sozialtechnischen und rechtlichen Diskurs um historische, religiöse, philosophische und literarische Perspektiven, und wir tun das in der Überzeugung, dass diese Grundfragen unserer sozialen und politischen Existenz keine festen disziplinären Grenzen haben.