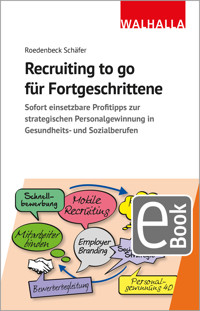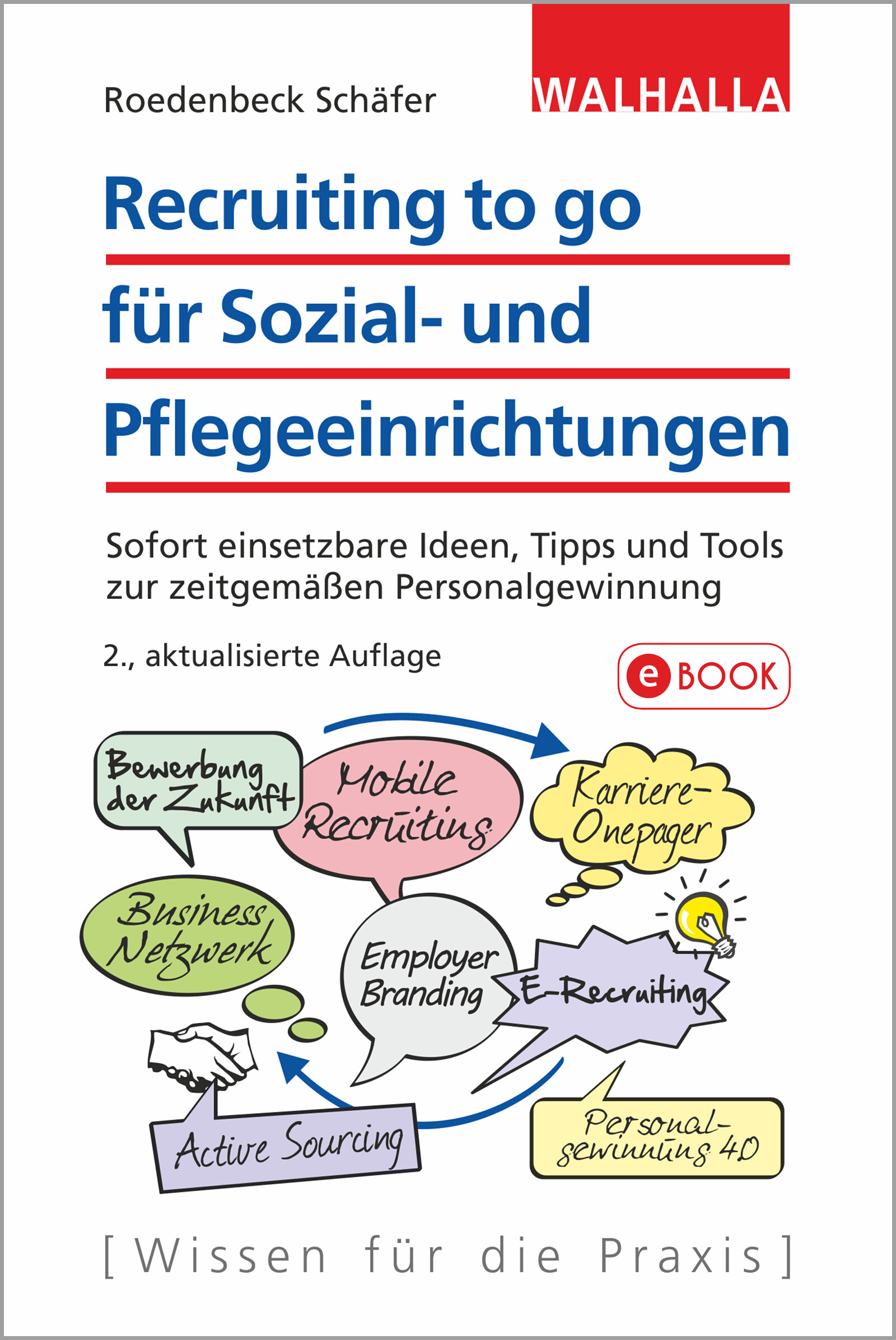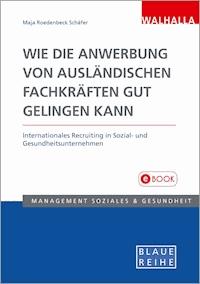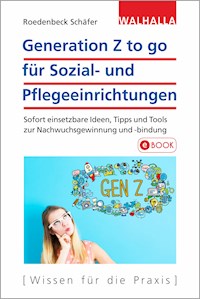
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Walhalla Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Erfolgreiche Nachwuchsgewinnung erfordert neue Maßnahmen
Die Generation Z, die aktuell den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt entert, stellt Sozial- und Gesundheitsunternehmen und ihre Recruiting-Strategien vor neue Herausforderungen. Wie können sie die jungen Leute erreichen, die komplett digital leben und denken, gleichzeitig ungeduldig-zielstrebig und wankelmütig-durchhalteschwach wirken, trotzdem hohe Ansprüche stellen – und es sich leisten können:
- In welchen Kanälen lässt sich erfolgreiches Azubi-Marketing gestalten?
- Welche Methoden eignen sich, welche nicht?
- Welche Unternehmenskultur trägt dazu bei, dass sich die Generation Z wohlfühlt?
Wie sein erfolgreicher Vorgänger Recruiting to go für Sozial- und Pflegeeinrichtungen befähigt der neue Ratgeber Generation Z to go für Sozial- und Pflegeeinrichtungen Unternehmen, sich der Generation Z zu öffnen, ohne ihre Traditionen komplett aufzugeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
1. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected] Web
Kurzbeschreibung
Erfolgreiche Nachwuchsgewinnung erfordert neue Maßnahmen
Die Generation Z, die aktuell den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt entert, stellt Sozial- und Gesundheitsunternehmen und ihre Recruiting-Strategien vor neue Herausforderungen. Wie können sie die jungen Leute erreichen, die komplett digital leben und denken, gleichzeitig ungeduldig-zielstrebig und wankelmütig-durchhalteschwach wirken, trotzdem hohe Ansprüche stellen – und es sich leisten können:
In welchen Kanälen lässt sich erfolgreiches Azubi-Marketing gestalten?Welche Methoden eignen sich, welche nicht? Welche Unternehmenskultur trägt dazu bei, dass sich die Generation Z wohlfühlt?Wie sein erfolgreicher Vorgänger Recruiting to go für Sozial- und Pflegeeinrichtungen befähigt der neue Ratgeber Generation Z to go für Sozial- und Pflegeeinrichtungen Unternehmen, sich der Generation Z zu öffnen, ohne ihre Traditionen komplett aufzugeben.
Autor
Maja Roedenbeck Schäfer ist seit 2020 als Leitung Strategisches Recruitment bei den DRK Kliniken Berlin tätig. Von 2011 bis 2019 verantwortete sie als Projektleiterin das mehrfach ausgezeichnete Personalmarketing und Recruiting der Diakonie Deutschland.
Nebenberuflich schreibt sie Sach- und Fachbücher. Bei Walhalla erhältlich: "Generation Z to go für Sozial- und Pflegeeinrichtungen" (2020), „Wie die Anwerbung von ausländischen Fachkräften gut gelingen kann“ (2018) und „Recruiting to go für Sozial- und Pflegeeinrichtungen (2017). Über ihr Spezialgebiet bloggt sie unter: www.recruiting2go.de.
Seit 2014 ist sie Dozentin und Vertretungsprofessorin für die Quadriga Hochschule, das Fortbildungsprogramm des WALHALLA Fachverlags und die TH Brandenburg. Als Speakerin referierte sie auf den Social Recruiting Days, der Zukunft Personal Europe, dem Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit und dem Personalmanagementkongress.
Schnellübersicht
Einführung zum Buch
1. Hintergründe aus Wirtschaftswissenschaft und Marktforschung
2. Von Google Jobs bis zur Recruiting-App: Kanäle für die Gewinnung der Generation Z
3. Vom Influencer-Personalmarketing bis zur Gamification: Methoden und Formate zur Gewinnung der Generation Z
4. Von den Helikopter-Eltern zum Helikopter-Arbeitgeber? Eine Unternehmenskultur, in der sich die Generation Z wohlfühlt
5. New Work, agiles Arbeiten oder Arbeit 4.0: Die neue Weltsicht, Beispielmethoden, Vorteile und Grenzen
6. Die Generation Alpha
7. Quellen und weiterführende Informationen
Einführung zum Buch
Warum eine Strategie zur Nachwuchsgewinnung nie „fertig“ ist
Wichtige Adressen im Netz: Nutzen Sie die Service-Seite
Wichtige behandelte Begriffe
Warum eine Strategie zur Nachwuchsgewinnung nie „fertig“ ist
Wer „Nachwuchs“ sagt und dabei noch an die „Millennials“ – die Jugend des neuen Jahrtausends – denkt, hat ein paar Jahre verschlafen, ebenso, wer mit den „Digital Natives“ – den Ureinwohnern der digitalen Welt – hadert und sich dabei schlacksige, mit ihren Smartphones verwachsene Teenager vorstellt. Denn die Begriffe Millennials und Digital Natives, auch wenn sie derzeit etwas verschwimmen, wurden für die sogenannte Generation Y geprägt, die zum Jahrtausendwechsel bereits im Teenageralter war. Inzwischen ist sie Anfang bis Mitte 30 und läuft längst nicht mehr unter Jugendkultur. Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens müssen sich auf die nachfolgende Generation, die Generation Z, einstellen. Einiges können sie dabei, wenn vorhanden, aus ihren Strategien für die Vorgängergeneration herleiten – aber längst nicht alles.
Die Generation Y hat den Berufseinstieg geschafft und erste Aufstiegschancen genutzt, vielleicht sogar schon eine Familie gegründet oder außerhalb einer Ehe oder Partnerschaft Kinder gezeugt. Ihre Bedürfnisse sind flächendeckend in der Erwachsenenrealität angekommen. Sie beeinflusst die Arbeitswelt von heute bis in die Führungsebenen hinein. Denn die Generation Y hat beeindruckende Lebensläufe hervorgebracht. So gibt es in Sozial- und Pflegeeinrichtungen viele junge Menschen, die direkt nach der Ausbildung oder dem Studium per Trainee-Programm oder Weiterbildungsmarathon in zügigem Tempo einen, zwei oder drei Karriereschritte gegangen sind und schon in jungen Jahren viel erreicht haben. Das hat einerseits mit dem Nachwuchs-, Fach- und Führungskräftemangel im Sozial- und Gesundheitswesen zu tun, der die Branche dazu zwingt, jungen Talenten früh Verantwortung zu übertragen. Andererseits liegt es aber auch am Selbstbewusstsein der Millennials, die sehr leistungsbereit sind, wenn sie in ihrer Tätigkeit Sinn sehen und die gewünschten Rahmenbedingungen geboten bekommen: Wertschätzung, einen großen Handlungsspielraum, Möglichkeiten des Work-Life-Blendings (die Arbeit zwischen Familienaufgaben und Freizeitaktivitäten einplanen, wie es individuell am besten passt) und vieles mehr. Für den Wirtschaftswissenschaftler und Generationenexperten Prof. Christian Scholz von der Universität des Saarlandes sind die Karrieren der Generation Y keine Überraschung, sind ihr doch – im Gegensatz zur Generation Z! – Beruf, Karriere und Wettbewerb sehr wichtig.
Ann-Kathrin K. (27): Von der Hauptschülerin zur Heimleiterin (https://bit.ly/2vOLRMi)
Karina W. (28): Führungskarriere per Trainee-Programm (https://bit.ly/2VUmMhQ)
Sabine G. (28): Von der Praktikantin zur Kitaleiterin (https://bit.ly/2PZH2JE)
Lars B. (30): Vom Zivildienstleistenden zum Geschäftsführer (https://bit.ly/2wCRMnk)
Petra K. (34): Von der Islamwissenschaftlerin zur Einrichtungsleiterin (https://bit.ly/2JvWa03)
Die Generation Z auf dem Vormarsch
Doch nun rückt die Generation Z nach. Es handelt sich um je nach Quelle ab 1995 bzw. ab 1999 bis etwa 2010 geborene junge Menschen. Internationale Quellen fassen den Zeitraum auch von 1998 bis 2016. Im Jahr 2020 und darüber hinaus stecken die Zler gerade in der Phase des Schülerpraktikums, der Berufsorientierung oder Bewerbung, sind in die Ausbildung oder ins Studium eingestiegen oder haben ihre erste feste Stelle angetreten – und machen Arbeitgebern im Sozial- und Gesundheitswesen das Leben schwer. Die US-amerikanische Psychologin Jean Twenge nennt sie auch die iGeneration. Einerseits, weil sie mit der digitalen Welt und technischen Geräten wie iPhone und iPad groß geworden sind. Das i (= ich) steht aber gleichzeitig auch für den Egozentrismus und Opportunismus des Nachwuchses, der seine eigenen Bedürfnisse und Forderungen in den Mittelpunkt stellt, schon bevor er es sich durch Leistung verdient hat. So wie in der Vorgängergeneration das Y auch für „why“, also für die wiederkehrende Frage nach dem „Warum müssen wir es so machen, wie es schon immer gemacht wurde?“ stand.
Man braucht bloß einmal in einer Personalerrunde das Schlagwort „Generation Z“ in den Raum zu werfen, schon beginnt das große Klagelied. Laut des azubi.reports 2018 der Ausbildungsplattform ausbildung.de (dahinter steckt die Employer Branding-Agentur Territory Embrace) bescheinigen ausbildende Unternehmen dem Nachwuchs gleichzeitig ein überbordendes Selbstbewusstsein und einen Mangel an Ausbildungsreife bzw. eine enorme Unselbstständigkeit. Schwierig für Arbeitgeber ist dabei vor allem, dass mit der neuen Generation scheinbar widersprüchliche Entwicklungen in die Arbeitswelt einziehen. Einerseits manifestieren und potenzieren sich Trends, die in der Vorgängergeneration begonnen haben. Andererseits kehren sich manche Bedürfnisse bereits wieder ins Gegenteil um. Wirtschaftswissenschaftler Scholz spricht in seinem Buch Generation Z – Wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns alle ansteckt (Wiley-VCH Verlag, 2014) von Pendel- versus Trendbewegungen. Demnach wechseln sich Werte wie Kollektivismus (Babyboomer, Generation Y) und Individualismus (Generation X und Z) zwischen den Generationen ab, genauso wie die Fokussierung auf eine globale Perspektive mit der Fokussierung auf die lokale Gemeinschaft. Zu den Trends, die sich im Laufe der Generationen in eine Richtung fortentwickeln und verstärken, zählt Scholz dagegen den permanenten Anstieg des Medienkonsums und die immer weiter zunehmende Bedeutung von Freizeit für die Lebensqualität.
Ein Beispiel für einen fortschreitenden Trend, der uns als Arbeitgeber besonders interessiert, ist die Digitalisierung: Während die Generation Y sich an eine Welt ohne Notebooks, Tablets und Smartphones, ohne Facebook, Instagram und WhatsApp schon kaum noch erinnern kann, übernehmen mit der Generation Z nun endgültig die neuen Technologien das Zepter. In immer jüngerem Alter besitzen Kinder eigene mobile Endgeräte und erschließen sich damit die Welt. Arbeitgeber kommen um Recruiting-Apps und Bewerberberatung per Messenger nicht mehr herum. Auch das Thema „Helikopter-Eltern“ bleibt erhalten: Genau wie die Generation Y wird die Generation Z von überbehütenden Müttern und Vätern geprägt, die kleine Prinzen und Prinzessinnen großziehen. Eigene Bedürfnisse zu benennen und deren Befriedigung einzufordern, ist für sie genauso normal wie sich noch bis weit ins Erwachsenenalter hinein von den Eltern oder anderen Erwachsenen unterstützen zu lassen. Soziologen sprechen auch von einer „verlängerten Jugend“.
Ein Beispiel für einen Trend, der sich umkehrt, ist dagegen das wiederauflebende Sicherheitsbedürfnis (vor dem Hintergrund der vom Terrorismus gepeinigten Welt) der ganz Jungen, zu dem eine durch Streamingdienste wie Netflix geförderte neue Häuslichkeit gehört. Beides steht der weltumfassend-optimistischen Flexibilität der Generation Y gegenüber (vgl. die Studie „A generation without borders“ der Unternehmensberatung OC&C Strategy Consultants). Dazu kommt die Abkehr vom sogenannten Work-Life-Blending, der Vermischung von Arbeit und Privatleben. Gerade haben sich Unternehmen und Organisationen an den Gedanken gewöhnt, dass Kickertische im Pausenraum, Angebote zum mobilen Arbeiten und Betriebskindertagesstätten gute Argumente für die Nachwuchsgewinnung seien. Da kommt der Generation Z-Experte Prof. Christian Scholz daher und sagt, dass die ganz jungen Leute gar keine Lust mehr hätten, Arbeit und Privatleben zu vermischen, wie es beim Homeoffice als Regelarbeitsplatz, der Kinderbetreuung am Arbeitsplatz und einer ausgeprägten Feierkultur in Start-ups häufig üblich ist. Auch Führungsverantwortung zu übernehmen, so wie Ann-Kathrin, Lars oder Petra (siehe oben) es beeindruckend früh getan haben, sei unattraktiv geworden. Die Jungen von heute wünschen sich zwar flache Hierarchien mit Mentoren statt chefiger Chefs und totale Freiheit in der Gestaltung ihres Arbeitsauftrags. Aber Konsequenzen tragen, sich eigenverantwortlich dem beruflichen Ernst des Lebens stellen, der auch das fröhlichste Start-up früher oder später ereilt – das möchten sie nicht. Sie wissen, was ein Burnout ist und dass sich großspurige Arbeitgeberversprechen oft sowieso nicht erfüllen. Darum achten sie lieber von Anfang an auf Freizeit, Freunde und Fun, anstatt ihr Leben allein am Beruf auszurichten. Demnach haben sich die Argumente, mit denen Arbeitgeber den Nachwuchs erreichen können, in den vergangenen Jahren geändert.
Wie soll man da als Arbeitgeber hinterherkommen? Mein Rat, bevor wir ins Detail gehen: Begreifen Sie die Veränderungen in der Arbeitswelt allgemein und konkret in Ihrem Unternehmen nicht als Zugeständnis an die Generation Z. Wenn Sie sich nur um ihretwillen anpassen und ständig den Generationen-Fähnlein im Wind hinterher schwingen, führt das nur zu Unruhe im Unternehmen und Unzufriedenheit in der Bestandsbelegschaft. Gehen Sie den Modernisierungs- und Innovationsprozess jedoch strategisch, flexibel, aber gelassen und aus eigenem Antrieb an, lassen sich von den Ideen des Nachwuchses inspirieren, aber nicht unter Druck setzen, dann machen Sie Ihr Unternehmen zukunftsfähig – und stellen die Generation Z beinahe als Nebeneffekt zufrieden. Eine sinnvolle Strategie zur Nachwuchsgewinnung besteht dabei aus dreierlei Zutaten: den passenden Kanälen, den passenden Methoden und Formaten sowie der passenden Unternehmenskultur.
Verhaltensbeispiele aus der Praxis
Zum Schluss dieses Vorworts als Diskussionsgrundlage noch einige Verhaltensbeispiele aus der Praxis, anhand derer Sie im Team überlegen können, wo charakterlich die Generation Y aufhört und die Generation Z anfängt, wo im Detail möglicherweise die Unterschiede liegen, welche Trends fortgeschrieben werden und welche nicht. Einige Beispiele stammen aus dem Fachbuch Das Krankenhaus im demografischen Wandel: Theoretische und praktische Grundlagen zur Zukunftssicherung von Wolfgang Hellmann und Hans-W. Hoefert (medhochzwei Verlag, 2012). Andere wurden mir von Seminarteilnehmern im Rahmen meiner Dozententätigkeit berichtet oder ich habe sie selbst erlebt.
Ein Werkstudent erklärt der Leitung Unternehmenskommunikation eines sozialen Komplexträgers unverblümt, was sie auf dem Facebook-Unternehmensprofil alles falsch macht und warum die gerade neu designten Flyer trotz größter Bemühungen immer noch nicht modernen Ansprüchen genügen. Das Verhältnis zwischen den beiden ist seither stark unterkühlt. Weder gelingt es der Führungskraft, das wertvolle Feedback des jungen Mannes anzunehmen und dabei über seine jugendlich-selbstüberschätzende Attitüde hinwegzusehen, noch gibt sie ihm eine konstruktive Kritik dazu. Genauso wenig gelingt es dem jungen Mann, seine Verbesserungsvorschläge angemessen zu formulieren und Verständnis dafür zu entwickeln, dass die Modernisierung der Unternehmenskommunikation ein längerer, intensiver Prozess mit vielen Beteiligten ist, bei dem auch Zwischenschritte gewürdigt werden sollten.
Eine junge Mitarbeiterin lädt den Chefarzt ganz selbstverständlich zum gemeinsamen Mountainbike-Fahren ein, nachdem man beim Small Talk festgestellt hat, dass man dieses Hobby teilt. Die früher übliche Zurückhaltung gegenüber höheren Hierarchieebenen oder das ungeschriebene Gesetz, nach dem man sich im Unternehmen unter seinesgleichen zu bewegen hat, ist ihr völlig fremd.
Praktikanten in der stationären Jugendhilfe, die bislang recht unselbstständig waren und eher eine Belastung als eine Hilfe für das Team dargestellt haben, zeigen ab dem Tag Engagement, ab dem sie namentlich im Dienstplan erwähnt werden. Leistung sind sie nur bereit, im Austausch gegen Wertschätzung zu geben.
Die Mutter eines Bewerbers ruft in der Personalabteilung des Arbeitgebers an und fordert, dass ihr Sohn nicht für Wochenendschichten eingeteilt werden möge, damit er an den sonntäglichen Familientreffen teilnehmen kann. Dem Nachwuchs scheint ein solches überbehütendes Verhalten nicht einmal peinlich zu sein. Es wird klar, wo die Jungen gelernt haben, egoistische und nahezu absurde Rahmenbedingungen für sich einzufordern.
Passend dazu fordert ein angehender Assistenzarzt schon im Bewerbungsgespräch spontane Urlaubstage bei gutem Wetter, um surfen gehen zu können, schafft es dann allerdings auch, sich mit den Kollegen so gut zu stellen, dass er für seine Ausflüge immer eine willige Vertretung benennen kann.
Eine Berufseinsteigerin bekommt nach der Erzieher-Ausbildung einen Zweijahresvertrag angeboten und zerreißt ihn vor den Augen des Personalers, weil sie damit nicht zufrieden ist. Die Jungen wissen, dass sie begehrt und nicht auf den erstbesten Arbeitgeber angewiesen sind.
Während der Vorlesung in einer Hochschule bestellen die Studierenden Klamotten bei Amazon oder spielen digitalen Fußball am Smartphone. Gleichzeitig nehmen sie aber motiviert an der Diskussion mit der Professorin teil. Das Nebeneinander der realen und der digitalen Welt ist eingeübt. Die reale Zeit wird durch das Füllen von Erlebnislücken und Wartephasen mit digitalen Beschäftigungen maximal ausgenutzt.
Eine junge Mitarbeiterin sagt zur Einrichtungsleitung „Sie stören“, als diese in die Übergabe platzt. Auch hier zeigt sich das Bedürfnis nach Begegnung auf Augenhöhe mit höheren Hierarchieebenen.
Ein Assistenzarzt äußert nach einem Jahr Berufserfahrung im Mitarbeitergespräch, er wolle nun endlich zum Oberarzt befördert werden. Verschiedene „typische“ Eigenschaften des Nachwuchses versammeln sich hier, allen voran das beeindruckende Selbstbewusstsein und die geringe Frustrationstoleranz bei einem Entwicklungsstillstand.
Ein Nachwuchsteam in der Verwaltung einer Pflegeeinrichtung schlägt der Geschäftsführung vor, die Büros zu tauschen, sodass das Nachwuchsteam im schicken, geräumigen Geschäftsführungsbüro arbeiten kann, während die Geschäftsführung in die kleine Sekretariatskammer umziehen soll, in der die jungen Leute im Moment dicht gedrängt sitzen. Auch hier zeigt sich der Wunsch nach Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. Dass ein großes Büro mit Führungsverantwortung und Status einhergeht, leuchtet nicht länger ein.
Ein Assistenzarzt droht mit Kündigung, wenn er keinen Zugang zu den Patientendaten von unterwegs erhält, um administrative Tätigkeiten im Café erledigen zu können.
Bewerber bringen zum Vorstellungsgespräch einen Fragenkatalog mit und nehmen den Arbeitgeber ins Kreuzverhör, anstatt umgekehrt.
Nach zehn Minuten Vorstellungsgespräch, die er mehr schlecht als recht hinter sich gebracht hat, fragt ein junger Bewerber, wie kurzfristig nach Arbeitsantritt er denn damit rechnen könne, einmal drei Monate in der Unternehmenszweigstelle in Barcelona eingesetzt zu werden.
Ein Berufseinsteiger, gerade erst wenige Jahre an Bord, möchte im Alter von 22 Jahren bereits ein Sabbatical (ein Jahr unbezahlten Urlaub mit Rückkehrgarantie) beantragen.
Ein Jugendlicher hat die Hauptschule abgebrochen und schlägt doch jedes Beschäftigungsangebot aus. „Eine dreijährige Ausbildung sollte es schon sein“, die man ihm bitte anbieten möge. Dass er dazu einen Schulabschluss benötigt, leuchtet ihm nicht ein, wo doch der Nachwuchsmangel in allen Medien beschworen wird.
Noch ein letzter Hinweis, bevor wir starten: Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet, ohne damit jedoch eine Diskriminierung zum Ausdruck bringen zu wollen. Selbstverständlich sind jederzeit alle Geschlechter angesprochen.
Maja Roedenbeck Schäfer
Wichtige Adressen im Netz: Nutzen Sie die Service-Seite
Dieses Buch beschäftigt sich ausführlich mit Anwendungen, Apps und Inhalten, die im Netz zu finden sind. Um den Lesefluss nicht zu stören, sind die Internetadressen meist verkürzt angegeben:
Das übliche www. (für World Wide Web) wurde im Textfluss weggelassen. Moderne Browser setzen dies automatisch dazu, wenn man die „Hauptadresse“ angibt.
Sehr lange Internetadressen – URLs – dieser Websites werden meist „verkürzt“ wiedergegeben. Zur Erstellung wurde ein URL-Shortener verwendet, der aus langen Webadressen eine „Abkürzung“ macht.
Aus https://bit.ly/2VFrFLH wird ungekürzt:
https://karriere.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/Karriereportal/PDFs/Unterrichtsmaterial_SOZIALE_BERUFE_Sek_1.pdf
Digitaler Werkzeugkasten auf WALHALLA.de/recruiting
Wir stellen Ihnen die im Buch behandelten Internetadressen thematisch geordnet und verlinkt auf www.WALHALLA.de/recruiting zur Verfügung. Speichern Sie diese Seite als Lesezeichen im Browser. So haben Sie stets Ihren digitalen Werkzeugkasten in Sachen „zeitgemäßes Recruiting“ zur Hand.
Wichtige behandelte Begriffe
Advertorialein Text, der aussieht wie ein redaktioneller Inhalt, tatsächlich aber eine als Reportage getarnte Werbeanzeige istAugmented Realityeine durch digitale Hilfsmittel erweiterte Realität. Beispiele: die Google Glass-Datenbrille, die weiterführende Informationen zum aktuellen Erleben am Rande des menschlichen Sichtfelds einblendet, oder die Pokémon Go-App, die virtuelle Comicfiguren in die reale Umgebung des Spielers einblendetBabyboomerdie Nachkriegsgeneration, Geburtsjahre (je nach Quelle) ca. 1955 bis 1969Big Datahier die Auswertung großer Mengen an Nutzerverhaltensweisen in digitalen KanälenBlogger-Kampagnemehrere Blogger veröffentlichen gleichzeitig bezahlte Beiträge über ein Unternehmen oder ProduktCandidate Journeyder Weg, den ein Bewerber auf zum Weg zur neuen Anstellung in einem Unternehmen nimmt; die digitalen und analogen Kontaktpunkte, die er währenddessen mit dem Unternehmen hatChat BotDialogsystem, bei dem eine Software mittels Textbausteinen und künstlicher Intelligenz Fragen, die ein Kunde oder ein Bewerber per Messaging Dienst stellt, automatisch beantwortetContent-MarketingWerbung, die nicht auf die klassische Anzeige als Medium setzt, sondern mithilfe von Ratgeberstücken, Advertorials und anderen längeren Inhaltsformen auf Produkte und Unternehmen aufmerksam machtCorporate Influencergeschulte Arbeitgebermarkenbotschafter; Mitarbeitende, die bei der Personalgewinnung mithelfenCyberbullyingMobbing über die sozialen NetzwerkeDarknetein hochverschlüsselter Teil des Internets, in dem das Nutzerverhalten nicht so leicht zurückzuverfolgen ist wie auf den normal zugänglichen Seiten; das Darknet wird daher aus Sicherheitsgründen von Menschenrechtsorganisationen, aber auch für illegale Aktivitäten genutztDigital NativesUreinwohner der digitalen Welt; Menschen, die eine Welt ohne Internet und mobile Endgeräte nicht mehr kennengelernt habenDigital ImmigrantsEinwanderer in die digitale Welt; Menschen, die eine Welt ohne Internet und mobile Endgeräte noch kennengelernt und die Geburtsstunden der Digitalisierung miterlebt habenDSGVOAbkürzung für die Datenschutz-Grundverordnung der EU, die 2018 in Kraft getreten istEdutainmentunterhaltsame Aufbereitung von BildungsangebotenEmpfehlungsmarketingein Instrument der Neukundengewinnung, die durch Mundpropaganda, Bewertungen und Referenzen von Kunden erfolgtFacebookweltweit größtes soziales NetzwerkGamificationAnwendung typischer Elemente aus PC-, Spielkonsolen- oder Handyspielen im artfremden Kontext, zum Beispiel in der Berufsorientierung oder in einer Business-SoftwareGap Year12-monatige Pause zwischen Schulabschluss und Ausbildung oder StudiumGeneration AlphaMenschen mit den Geburtsjahren (je nach Quelle) ab ca. 2010Generation XMenschen mit den Geburtsjahren (je nach Quelle) ab ca. 1965 oder 1969 bis 1980Generation YMenschen mit den Geburtsjahren (je nach Quelle) ab ca. 1980 bis 1995Generation ZMenschen mit den Geburtsjahren (je nach Quelle) ab ca. 1995 bis 2010Helikopter-Elternüberbehütende ElternHolokratieOrganisationstheorie, bei der eine Organisation oder ein Unternehmen von den Mitarbeitenden selbst organisiert wird; Weiterentwicklung der SoziokratieInfluencerbekannte Persönlichkeit in den sozialen Netzwerken, Meinungsführer im InternetInfluencer Takeovereine bekannte Internetpersönlichkeit übernimmt und bespielt den Social Media-Kanal eines Unternehmens für einen bestimmten ZeitraumInstagramsoziales Netzwerk zum Teilen von Fotos, Videos und Stories, die mit Filtern bearbeitet werden; gehört zu FacebookInstant Feedbackregelmäßige schnelle, digitale MitarbeitendenbefragungenKanbanagile Methode zur Steuerung von Produktionsprozessen, die aus der Softwareentwicklung stammtKünstliche Intelligenzselbst lernende Maschinen bzw. ComputerLet’s play-Videoein Video, in dem ein Spieler ein PC-Spiel vorführt und seine Aktionen im Spiel live kommentiertLivestreamVideoaufnahme, die in Echtzeit ins Internet übertragen wird (z. B. auf YouTube oder Twitch)MemeInternet-Hype, InternetphänomenMillennialsMenschen, die um die Jahrtausendwende im Jugendalter warenMobile Recruitingdie Bewerbung vom Smartphone oder Tablet aus ermöglichen; mobil optimierte Stellenanzeigen und Online-Bewerbungsformulare sind dazu notwendigNew Workneue Unternehmens- und Organisationsformen, die durch die Einwirkung von Globalisierung und Digitalisierung auf die Arbeitswelt entstehenOnboardingMaßnahmen zur Mitarbeiterbindung neuer Kollegen bereits ab dem Tag der Zusage und in der ProbezeitPeer RecruitingPersonalgewinnung auf Augenhöhe, von Fachkraft zu FachkraftSCRUMagile Projektmanagement-Methode, die aus der Softwareentwicklung stammtServant LeadershipFührungsstil, bei dem sich die Führungskraft als Coach oder Unterstützer anstatt als Beherrscher ihrer Mitarbeitenden verstehtSharentingWenn Eltern ungefragt Videos und Fotos von ihren Kindern in den sozialen Netzwerken postenSocial Media-ManagerPosition in der Unternehmenskommunikation mit der Zuständigkeit für die Bespielung eines oder mehrerer Social Media-KanäleSocial Recruitingpassive Bewerber über soziale Netzwerke zur Bewerbung zu bewegenSoziokratieOrganisationstheorie, nach der eine Organisation oder ein Unternehmen von den Mitarbeitenden selbst organisiert wirdSuchmaschinenoptimierung (SEO)technische und inhaltliche Überarbeitung einer Webseite nach den Gütekriterien von Google, die dazu führt, dass die Webseite auf Google weiter oben gelistet wirdTik Tok (ehe. Musical.ly)Videoplattform für Playback-VideosVirtual Realityeine computergenerierte zweite Realität, in der sich der Nutzer mittels einer Datenbrille interaktiv und in Echtzeit bewegen und verhalten kannWhatsApp2009 gegründeter Instant Messenger-Dienst, der seit 2014 zu Facebook gehörtWorking Out LoudSelbstlernprogramm, in dem eine interdisziplinäre Kleingruppe sich mittels vorgegebener Übungen in einem 12-wöchigen Zyklus mit einem Thema auseinandersetztWork-Life-BalanceVereinbarkeit von Arbeits- und PrivatlebenWork-Life-BlendingVermischung von Arbeits- und Privatleben1. Hintergründe aus Wirtschaftswissenschaft und Marktforschung
Die Generation Z in Zahlen
Der typische Azubi und was wir von ihm lernen können
Geschichten von der Quarterlife Crisis
Online zu Hause: Die Generation Z tickt digital
Die Generation Z in Zahlen
Wir wollen uns nicht allzu lange in der Vergangenheit und im theoretischen Überbau der Generationenforschung aufhalten, denn allein darüber kann man ganze Bücher und Studien schreiben, was andere auch bereits getan haben. Zum Teil etwas verfrüht, muss man kritisch sagen, denn seit es mit der Generation X in Mode gekommen ist, demografische Kohorten zu analysieren, und seit das Online-Marketing ständig aktuelles quantitatives Wissen über Zielgruppen verlangt, scheinen sich die Medien, Marketingberater und Soziologen in der Disziplin gegenseitig zu überbieten. Es wird kaum mehr beobachtet und abgewartet, bis eine Generation eine Lebensphase tatsächlich durchlaufen hat, um dann rückblickend einzuordnen, sondern synchron gelebt und beschrieben – was dann auch mal zu vorschnellen Schlüssen führen kann. Oder dazu, dass die Digitalisierung dem Nachwuchs einfach vorschreibt, was ihm zu gefallen hat: Der Algorithmus rechnet aus, was er aufgrund von Big Data-Analysen [hier: Auswertung großer Mengen an Nutzerverhaltensweisen in digitalen Kanälen] für den nächsten großen Trend hält und befeuert die jungen Leute über die digitalen Kanäle derart penetrant mit entsprechenden Inhalten, dass sich der Trend tatsächlich realisiert. Generation Z-Experte Prof. Christian Scholz, der eine Beschäftigung mit der Generation Z seit 2008 in den USA, seit 2010 in Australien und seit 2014 in Europa beobachtet, formuliert es so:
„Spricht man […] jemandem wegen seines Geburtsdatums die Fähigkeit zur Eigeninitiative ab, so kann man mit dieser Beurteilung nicht nur falsch liegen […], man kann letztlich sogar eine etwaig vorhandene Eigeninitiative im Keim ersticken und damit die Wirklichkeit schaffen, die man selber (fälschlicherweise) ‚gesehen‘ hat.“
Es handelt sich um eine neue, beängstigende Form der sich selbsterfüllenden Prophezeiung.
Ich wage einmal die These, dass aufgrund der Digitalisierung Journalismus, Soziologie, Marktforschung und Marketing als Disziplinen verschwimmen. Die Journalistin muss nicht mehr abwarten, bis der Soziologe seine Kohortenanalyse sorgfältig ausgewertet hat, bevor sie darüber berichten kann, sondern kann sich mit digitalen Marktforschungstools wie civey.com oder Online-Umfragedienstleistern wie surveymonkey.de selbst schnell mal zu einem Thema umhören. Das ist in manchen Fällen (civey.com) laut Anbieter sogar repräsentativ und ergibt allemal genug Futter für einen schönen Online-Bericht. Auch kann die Journalistin in Rekordzeit Studienergebnisse aus der ganzen Welt online zusammensuchen. Marktforschung übernehmen nicht länger nur erfahrene Institute, sondern Kommunikationsagenturen, die ihre Erkenntnisse praktischerweise gleich in der Beratung an ihre Kunden verkaufen können. Der Soziologe gerät unter Druck, seinerseits immer früher Ergebnisse anzubieten. Der Marketingexperte – ich sage es mal überspitzt – fühlt sich dank allwissendem Google- oder Facebook-Algorithmus ohnehin dem Journalismus, der Marktforschung und der Soziologie überlegen, was die Beschreibung von Zielgruppen angeht. Und dann kommt noch eine große Gruppe mehr oder weniger professioneller Blogger und selbsternannter Generation Z-Experten hinzu, die ihre eigenen Erkenntnisse beisteuern, bis das Ganze ziemlich verwässert. Prof. Scholz warnt gar vor falschen Stereotypen über die Generation Z, die nicht dadurch wahr würden, dass sie in seriösen wie unseriösen Kanälen permanent kolportiert werden: So schwächt er das Argument der angeblichen Übermacht der Generation Z auf dem Arbeitsmarkt, die durch den demografischen Wandel entsteht, durchaus ab. Nur in wenigen Ausnahmen wie – ausgerechnet – den Pflegeberufen hätte die Generation Z aufgrund ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit eine wirklich gute Verhandlungsposition. In anderen Berufen kämen ausländische Arbeitskräfte oder die Möglichkeit für Unternehmen hinzu, Dienstleistungen digital aus einem weltweiten Netzwerk einzukaufen, die den Demografie-Effekt ausglichen. In Ländern wie den USA, Australien oder England, so Scholz, habe es sich schon herumgesprochen, dass die gegenwärtige Jugend sogar teilweise erstaunlich schlechte Karten auf dem Arbeitsmarkt habe. Egal wie klein die Alterskohorte – es sei einfach eine unrealistische Annahme, dass eine ganze Generation ausschließlich aus High Potentials (Leistungsträgern) und Premium-Mitarbeitern bestehen könne.
Generationendefinitionen sollte man also immer kritisch hinterfragen. In einer Session (Arbeitsgruppe) zum Thema Generation Z beim HR Barcamp 2019 in Berlin erlebte ich eine junge Teilnehmerin, die einzige Anwesende im entsprechenden Alter, die sich nach einiger Zeit den schimpfenden Personalern zu sagen traute, sie fände es schon „etwas brutal“, wie man über ihre Generation urteile und alle Gleichaltrigen über einen Kamm schere.
Prof. Christian Scholz betont die Grenzen der Generationenforschung: Nicht jeder Vertreter einer Alterskohorte benehme sich wie der Durchschnitt, die Grenze zwischen den Generationen verlaufe ohnehin fließend. Im Laufe seines Lebens und mit mehr Erfahrung in der Arbeitswelt ändere der junge Mensch durchaus seine Einstellungen und ohnehin schimpfe man schon seit Sokrates auf die schlechten Manieren der Jugend. Trotzdem gebe es klare Unterschiede zwischen den Mittelwerten der verschiedenen Generationen. Und darum habe die Generationenforschung ihren Sinn. Sie zwinge uns zu einer differenzierteren Zielgruppenbetrachtung und helfe bei der Erklärung von Spannungen wie auch Innovationen.
Ich sehe das genauso: Generationendefinitionen können uns als Arbeitgeber dabei unterstützen, mehr Reichweite für unsere Personalmarketing-Maßnahmen zu erzielen oder Konflikte in Teams zu durchschauen. Zahlen, Daten und Fakten machen es uns auch leichter, Vorstände für ein Thema wie den Umgang mit der Generation Z und notwendige Veränderungen im Unternehmen zu sensibilisieren. Und eine kritisch-strategische Herangehensweise, basierend auf erhobenem Zielgruppenwissen, ist allemal besser als ein Herumstochern im Dunkeln nach Bauchgefühl. Verzichten können wir auf die Generationenforschung also nicht.
Babyboomer (je nach Quelle geboren in den 1950ern und 1960ern, teils wird bereits ab 1946 gerechnet)
Nachkriegsgeneration, zahlenmäßig dominant. Lebt, um zu arbeiten. Definiert sich über beruflichen Erfolg und Statussymbole wie Haus und Auto. Ist leistungsorientiert und unflexibel. Hat eine hohe Arbeitgeberbindung, bleibt also häufig das ganze Arbeitsleben beim selben Unternehmen. Ist wenig technikaffin, was digitale Endgeräte und Kanäle angeht, oder hat zumindest Mühe, sich in die rasanten technologischen Entwicklungen hineinzudenken.
Generation X (je nach Quelle geboren zwischen den späten 1960ern und frühen 1980ern)
Arbeitet, um zu leben. Beschreibt erstmals eine Work-Life-Balance, also die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, als Bedürfnis. Versteht sich im Berufsleben vorwiegend als Einzelkämpfer. Ist strebsam und hat hohe Ansprüche an sich selbst. Will Selbstverwirklichung statt Statussymbole erreichen. Kennt die Welt noch ohne Internet und digitale Endgeräte. Passt sich zwar an die technologischen Veränderungen an, bleibt ihnen gegenüber aber kritisch („Digital Immigrants“, also „Einwanderer in die digitale Welt“). Auch Generation Golf oder Generation Praktikum genannt.
Generation Y (je nach Quelle geboren in den 1980ern und 1990ern, Teenager um die Jahrtausendwende)
Andere Bezeichnungen: „Millennials“ (etwa: „Die Kinder des neuen Jahrtausends“), „Digital Natives“ („Ureinwohner der digitalen Welt“). Formuliert erstmals das Bedürfnis nach Spaß bei der Arbeit, ist aber gleichzeitig karrierebewusst. Versteht sich als Teamworker, wünscht die Begegnung auf Augenhöhe statt Hierarchien. Möchte keine Trennung mehr zwischen Arbeit und Freizeit, sondern nach individuellem Stundenplan zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten oder Freunde treffen (Work-Life-Blending). Ist optimistisch, selbstbewusst und stellt alles infrage (daher auch „Generation Why“). Kam sehr früh mit dem Internet und digitalen Endgeräten in Berührung. Versteht die virtuelle Welt als zweite, gleichberechtigte Welt neben der Realität.
Generation Z (je nach Quelle geboren ab Mitte/Ende der 1990er-Jahre bis 2010, manche Quellen rechnen bis 2016)
Kleine Alterskohorte, auf dem Arbeitsmarkt stark umworben. Andere Bezeichnung: iGeneration. Kennt eine Welt ohne Internet und digitale Endgeräte nicht mehr, benutzt und besitzt sehr früh eigene Smartphones und Tablets. Denkt und lebt in virtuellen Kanälen, deren Grenzen zur Realität verschwimmen („Virtual Reality“, „Augmented Reality“, „Künstliche Intelligenz“). Hat eine niedrige Frustrationstoleranz und eine kurze Konzentrationsspanne. Keine ausgeprägte Bindung und Loyalität gegenüber Arbeitgebern. Lernt audiovisuell und interaktiv. Geht intuitiv mit großen Informationsmengen um. Ähnelt in manchen Charakterzügen der Generation Y, entwickelt sich in anderen Bereichen jedoch wieder zurück zu eher traditionellen Werten.
Generation Alpha (je nach Quelle geboren ab etwa 2010)
Die erste Generation, die komplett im 21. Jahrhundert aufwächst. Wird in Cartoons gern mit einem Smartphone an der Nabelschnur dargestellt. Die erste Generation, die mit technologieaffinen Eltern aufwächst, die einerseits über die Risiken und Gefahren der virtuellen Realität Bescheid wissen, andererseits Lebensentwürfe jenseits der „always on“-Mentalität („immer online“) kaum noch vermitteln können.
Der typische Azubi und was wir von ihm lernen können
Um aus einer allgemeinen Generationendefinition konkrete Erkenntnisse für die Gewinnung und Bindung des Nachwuchses in der Arbeitswelt abzuleiten, gehen wir nun mehr ins Detail und versetzen uns in unseren typischen Azubi, Studi oder Berufseinsteiger.
Der azubi.report 2018 von ausbildung.de, der hier nur als beispielhafte Auswertung vielerlei ähnlicher Studien dienen soll, charakterisiert den deutschen Durchschnitts-Azubi wie folgt: Er verdient 651 bis 850 Euro im Monat und wird von seiner Familie finanziell unterstützt (26 Prozent) oder hat einen Nebenjob (11 Prozent). Er hat 21 Bewerbungen geschrieben, war bei vier Vorstellungsgesprächen und hat zehn Absagen sowie fünf Zusagen erhalten. Seinen Ausbildungsplatz hat er nach einem mittleren Schulabschluss online gefunden. Ansonsten fand er das Schülerpraktikum zur Berufsorientierung hilfreich (52 Prozent).
Wie können Arbeitgeber aus solchen Zahlen lernen? Nun, wenn der Azubi fünf Zusagen bekommen hat, leuchtet es ein, dass er nicht vor Glück und Dankbarkeit auf die Knie fällt, wenn wir ihm einen sechsten Ausbildungsplatz anbieten. Jeder von uns wäre genauso selbstbewusst, wenn er merkte, dass er auf dem Arbeitsmarkt gefragt ist. Wenn wir lesen, dass der Azubi aber auch zehn Absagen bekommen hat, sollten wir uns fragen: Welches Unternehmen konnte es sich erlauben, in Zeiten des Nachwuchs- und Fachkräftemangels Absagen zu erteilen? Es ist erfahrungsgemäß nicht davon auszugehen, dass diese Absagen an junge Menschen gingen, die von den Qualifikationen oder ihrem Charakter her wirklich absolut gar nicht auf den Ausbildungsplatz gepasst haben. Viel wahrscheinlicher basierten die Absagen auf veralteten Auswahlkriterien, die irgendwann einmal festgehalten und seither nicht mehr hinterfragt wurden. Schreibt unser eigenes Unternehmen vielleicht ebenfalls zu viele Absagen, einfach weil wir mit unserem Bewerbungsprozess noch nicht in der Gegenwart angekommen sind?
Im azubi.report merken 46 Prozent der jungen Leute an, dass sie die Anforderungen der Unternehmen an ihre Schulnoten zu hoch finden. Sind gute Schulnoten wirklich so furchtbar aussagekräftig bezüglich der Motivation eines zukünftigen Azubis? Gerade in einer Zeit, in der Bildungsexperten Land auf, Land ab kritisieren, dass die Lehrpläne an deutschen Schulen dringend überarbeitungsbedürftig sind? Lässt der Hinweis in der Stellenanzeige, dass gute Schulnoten von Vorteil sind, junge Leute mit soliden Dreier-Abschlüssen womöglich davor zurückschrecken, sich bei uns zu bewerben? Wäre es vielleicht besser, den Hinweis zu streichen? Ein Fazit der Autoren des azubi.reports lautet: „Schreiben Sie in die Stellenanzeigen nur die unbedingt notwendigen Voraussetzungen. Geben Sie auch Bewerbern mit schlechteren Schulnoten oder weniger Skills eine Chance, Sie im Gespräch zu überzeugen.“
Wenn 58 Prozent der Schüler angeben, in der Schule das Bewerbungsschreiben per Post zu üben, und sich deshalb 47 Prozent der Schüler auch per Post bewerben, obwohl 66 Prozent der Personaler die Online-Bewerbung und 31 Prozent die E-Mail-Bewerbung bevorzugen würden, müssen wir wohl einmal mit den Lehrern der örtlichen weiterführenden Schulen sprechen. Wir sollten ihnen erklären, dass es hilfreich wäre, wenn sie mit ihren Schülern Karriereportale und Online-Bewerbungsformulare durchgingen statt Bewerbungsmappen aus Papier zu basteln. „Es gibt an meiner Schule Berufskundeunterricht“, erzählt Justus (16), der mich 2019 einige Tage als Praktikant begleitet hat. „Dort haben wir einen kleinen Kurs in PowerPoint bekommen und reden über unsere Praktika. Manchmal schauen wir uns Berufeportale im Internet an. Das leitet unser Tutor an, der – wie er selber sagt – eigentlich auch keine Ahnung von Berufskunde hat. Deshalb bin ich mir bei der Effektivität dieses Fachs nicht so sicher.“ Bestimmt wäre der Tutor dankbar für ein paar Tipps, was Unternehmen wirklich hilft. Oder noch besser: interaktives, multimediales Unterrichtsmaterial, das Sie ihm kostenlos zur Verfügung stellen. Ein Beispiel finden Sie hier: https://bit.ly/2VFrFLH
Eine weitere wichtige Quelle für die Berufsorientierung sind für junge Menschen ihre Eltern (kein Wunder, wenn wir uns das Stichwort Helikopter-Eltern ins Gedächtnis rufen). Auf die Frage, wer oder was ihnen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz geholfen hat, nannten im azubi.report 68 Prozent Freunde und Familie (meistgenannte Quelle). 53 Prozent nannten das Schülerpraktikum, 41 Prozent Karriereseiten von Unternehmen, 34 Prozent Jobmessen und 28 Prozent den Berufskundeunterricht in der Schule. Auch mein Praktikant Justus (16) bestätigt: „Ich spreche mit meiner Familie und Freunden über meine Berufswünsche – mit Lehrern eher nur oberflächlich. Auch den Kontakt zu meinen Praktikumsstellen habe ich durch Verwandte und Bekannte bekommen.“ Die wenigsten Jugendlichen sind so selbstbewusst wie ein weiterer Praktikant von mir, Frederik (14). Der sagt: „Wenn ich eine gute Idee habe, welchen Beruf ich machen kann, würde ich mich auch gegen den Rat meiner Eltern dafür entscheiden.“
Es ist ein Trend, der auch für die Generation Y bereits beschrieben wurde und sich in der Generation Z offenbar fortsetzt: Den allermeisten jungen Menschen ist es wichtig, dass ihre Eltern ihren Berufswunsch unterstützen. Während frühere Generationen eher dafür bekannt waren, genau das Gegenteil von dem zu werden (Künstler), was Mutter und Vater vorgeschlagen hatten (Lehrer), vertraut die Jugend von heute bereitwillig auf ihre Helikopter-Eltern. Für uns als Arbeitgeber folgen daraus zwei Dinge:
Lasst uns die Eltern mit einbeziehen. Mit dem Ausbildungsmarketing per Instagram erreichen wir zwar die Jugendlichen direkt, aber eine zusätzliche Stellenanzeige in der Onlineausgabe der Regionalzeitung oder bei Facebook, wo ihre Mütter und Väter unterwegs sind, kann rund um die Bewerbungsphase für die Ausbildung genauso wichtig sein.
2.Lasst uns auf den Schneeballeffekt setzen. Wenn Familienangehörige sich untereinander Berufe und Arbeitgeber empfehlen, sind Personalmarketing-Aktionen, bei denen Mitarbeitende animiert werden, Arbeitgeberbeiträge in ihren persönlichen Netzwerken zu teilen, oder Prämien für die Empfehlung von Azubis wesentlich sinnvoller als Plakatkampagnen nach dem Gießkannenprinzip.
Und weiter geht’s: Wenn laut azubi.report Auszubildende im Durchschnitt erst nach drei Monaten die endgültige Zusage für ihren Ausbildungsplatz erhalten, 34 Prozent die Bewerbung laut eigener Aussage zwischenzeitlich zurückziehen oder innerlich abschreiben, weil es ihnen zu lange dauert, bzw. sogar 64 Prozent der Personaler Abbrüche im laufenden Verfahren beklagen, sollte man sich doch schnellstens einmal mit der Beschleunigung des Bewerbungsprozesses befassen. „Lassen Sie den Bewerber nicht zu lange warten und digitalisieren Sie Ihr Auswahlverfahren. Lernen Sie Ihre Bewerber so früh wie möglich persönlich kennen“, empfehlen die Autoren des azubi.reports. Zwar rühmen sich die in der Studie befragten Unternehmen, in weniger als zwei Wochen eine erste Rückmeldung zur Bewerbung zu geben. Aber wenn es sich dabei bloß um eine sachliche, standardisierte Eingangsbestätigung handelt, ist damit nichts, aber auch wirklich gar nichts gewonnen. Innerhalb von zwei Wochen sollte mindestens ein persönlicher Kontakt (telefonisch oder eine individuell formulierte E-Mail oder WhatsApp-Nachricht) stattgefunden haben und ein Vorstellungsgespräch vereinbart sein. Im Rahmen eines Recruiting-Tool-Tests hat einer unserer diakonischen Träger sogar einmal einen kompletten Bewerbungsprozess mit Sichtung der Unterlagen, Vorstellungsgespräch, Hospitation und Zusage innerhalb von fünf Tagen durchgeführt. Mehr zum Thema „Beschleunigung des Bewerbungsprozesses“ später.
Umfangreiches Wissen über aktuelle Ereignisse durch Internet und Social Media
Stark orientiert an Meinungsführern und (Arbeitgeber-)Marken im Internet
Hohe Ansprüche an Unternehmen, die ihnen Produkte (oder Arbeitsplätze) schmackhaft machen wollen
Bedürfnis nach Individualität in der Masse
Sehnsucht nach Abenteuern und Erlebnissen, auch mit Arbeitgebern und Unternehmen
Interesse an gesellschaftlicher Verantwortung
Junge Menschen dieser Generation ähneln sich weltweit mehr als jede andere Generation zuvor.
Auch das Trendence Institut beschäftigt sich umfangreich mit der Lebenswelt von Schülern in Deutschland. Über zehntausend von ihnen werden jährlich zu den beliebtesten Arbeitgebern Deutschlands befragt und die Antworten zu einem Ranking (Bestenliste) zusammengefasst. Dazu gibt es inhaltliche Ergebnisse wie den Trend Report „Das fordern Schüler_innen“ von 2019. Demnach ist die allerwichtigste Anforderung von Schülern (insbesondere von denen, die eine Berufsausbildung anstreben) an den zukünftigen Arbeitgeber, dass es dort nette Kollegen gibt. Das sagen 60 Prozent. Themen wie ein hohes Ausbildungsgehalt (24 Prozent) oder ein attraktiver Standort (24 Prozent) sind viel weniger wichtig. Für uns als Arbeitgeber heißt das, dass es gar nicht genug Mitarbeitendenportraits auf unseren Karrierewebseiten und in unseren Social Media-Kanälen geben kann. Und zwar echte, authentische Portraits, in denen Mitarbeitenden keine gestelzten Lobeshymnen auf das Unternehmen in den Mund gelegt werden, sondern in denen sie ausführlich und frei von der Seele sprechen dürfen, was sie bewegt – innerhalb, aber auch außerhalb ihres Berufs.
58 Prozent der Schüler ist ein fairer Bewerbungsprozess wichtig (zweitwichtigster Faktor). Das deckt sich mit den Ergebnissen des azubi.reports weiter oben. Wenn jemand das Gefühl hat, er werde nur wegen einer schlechteren Note in Mathe gleich aussortiert, kann das nach hinten losgehen. Die Generation Z ist in diesem Punkt sehr sensibel und Arbeitgeber sollten das ernst nehmen. Denn wenn der Eindruck entsteht, ob zu Recht oder nicht, dass nach oberflächlichen oder sinnfreien Kriterien bewertet wird oder dass Menschen wegen einer ausländischen Herkunft oder einer bunten Frisur diskriminiert werden, spricht sich das herum. Und der digital orientierte Nachwuchs vertraut auf nichts so sehr wie eine positive Empfehlung oder eine negative Bewertung aus der Online-Community.
Bringt aufgrund gescheiterter Bildungsexperimente Bildungsdefizite mit, sieht aber darin kein eigenes Problem, sondern eines der Gesellschaft oder der Führungsebenen. Schämt sich nicht zu sagen, dass sie etwas nicht kann oder schafft, sondern delegiert die Aufgabe zurück an die Führungsebene.
Möchte nichts zu einem guten Betriebsklima beitragen, weil sie glaubt, es einfordern zu dürfen. Verschlechtert das Betriebsklima sogar, indem sie sich als „Kuschelkohorte“ gegenüber anderen Generationen abgrenzt.
Scheut sich davor, Verantwortung zu übernehmen. Damit ist Führungsverantwortung gemeint, aber auch die Verantwortung für die Auswirkung des eigenen egoistischen und opportunistischen Handelns auf die Kollegen.
Fühlt keine Loyalität zum Arbeitgeber. Die Karriere besteht aus einer Aneinanderreihung von Kurzzeitbindungen. Ist bereit, aufgrund eines kritischen Feedbacks der Chefin, eines etwas langweiligen Auftrags oder einer fachlichen Überforderung sofort zu kündigen. Lässt sich auch durch Benefits und Führungsstiloptimierungen nicht daran hindern.
Kennt sich zwar geradezu im Schlaf mit modernen, leicht zu bedienenden digitalen Anwendungen (schlichten, selbsterklärenden, sich selbst aktualisierenden Apps) aus, fühlt sich aber mit komplexerer Software wie den klassischen Multimodul-Lösungen schnell überfordert.
Präferiert konservative Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle, abgesehen von dem gelegentlichen, selbstbestimmten Homeoffice-Tag, wenn die Handwerker kommen.
Sucht Kontakt zu Betriebsrat und Gewerkschaften, um sich über ihre Rechte zu informieren und sie durchzusetzen.