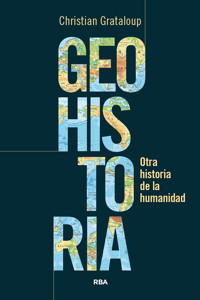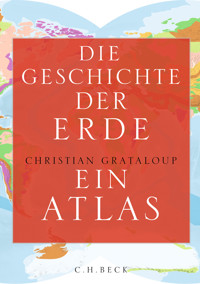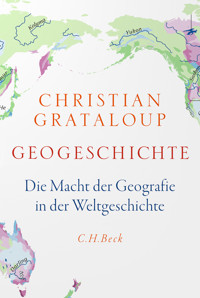
32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Christian Grataloup hat sich auch in Deutschland einen Namen gemacht. In seinen Bestsellern "Die Geschichte der Welt" und "Die Geschichte der Erde" werden Karten auf eine ganz neue und moderne Weise mit erläuternden historischen Texten verbunden. Nun legt der Meister der historischen Kartografie die Summe seines Denkens vor: Geogeschichte ist eine Expedition voller Überraschungen, bei der Grataloup einer einzigen Frage auf der Spur ist: Welchen Einfluss hat die Geografie auf den Verlauf der Weltgeschichte?
Geologie, Anthropologie, Klimatologie, Demografie, Genetik, Epidemiologie und Ökonomie – sie alle werden in diesem Buch mobilisiert, um die Weltgeschichte von den frühesten Anfängen bis zur Gegenwart auf eine andere Weise zu erzählen: als Geschichte von geografischen Räumen und ihren Bedingungen. Dabei geht es Christian Grataloup nicht um eine klassische historische Erzählung, sondern um die Analyse der Faktoren, die das Entstehen und Verschwinden von Zivilisationen begünstigt haben, um die geografischen Bedingungen von Erfolg und Misserfolg und um den Weg der Menschheit in eine globalisierte Welt, in der Umweltfaktoren, ob wir es wollen oder nicht, immer stärker den Gang der Geschichte bestimmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Christian Grataloup
GEOGESCHICHTE
Die Macht der Geografie in der Weltgeschichte
Aus dem Französischen von Stefan Lorenzer
C.H.BECK
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Widmung
ATLAS
VORBEMERKUNG: Eine Geogeschichte der Menschen auf dieser Erde
EINLEITUNG: Die Frage des Anderen. Ein pluraler Singular, ein singulärer Plural
KAPITEL 1: Geschichte geografisch lesen
Die ganze Erde einnehmen. Eine erste Antwort auf den Bevölkerungsdruck
Feuer, Nadel, Haus
Wie wir zu hypersozialen Primaten wurden
Die Geschichte der Menschheit – zwischen Nähe und Mobilität
Eine Frage der Nachbarschaften
KAPITEL 2: Verbreitung und Zerstreuung der Menschen über die Erde
Ein Umkehrspiegel der Gegenwart
Auszug aus der Baumsavanne in höchst unterschiedliche Umwelten
Homo sapiens, am Ende allein auf weiter Flur
Niedrigwasser und frühe Seefahrt
Australisches Inseldasein
America, America!
Was, wenn es schon früher zur Aufspaltung in kontaktlose Gesellschaften gekommen wäre?
KAPITEL 3: Das Lebendige zähmen: aber nur ein paar Arten
Synchronie und Polygenese von Gesellschaften
Neolithische Revolutionen
Sesshaftigkeit ist keine Tochter der Landwirtschaft mehr
Notwendige Bedingungen für den Anbruch des Neolithikums
Eine neuartige Nutzung der Erde
Das Meer steigt …
Konkurrenz von Baum und Mensch
Domestizierungen: Heterogene Gleichzeitigkeit
Wenige domestizierbare Arten
Koevolution von Mensch und Wolf
War das Neolithikum eine Katastrophe?
Was, wenn das Lama eine Kuh gewesen wäre?
KAPITEL 4: Anderswo, früher: andere Geschichten
Eufrasien und die Anderen: Die Letzten waren die Ersten
Die Welten der letzten Verbreitungen
Im Westen Neues (oder vielleicht im Osten?)
Ein allzu bipolares Wissen.
Die Great Plains und Amazonien.
Ozeanische Merkwürdigkeiten
Australische Isolation.
Die papuanischen Berggesellschaften.
Die Besiedlung des pazifischen Raums.
Im dünn besiedelten hohen Norden
Subsahara-Afrika, eine sehr alte Peripherie
Afrika, ein europäisches Toponym.
Subsahara-Afrika, ein eigenständiger Raum.
Die zwei Ränder Subsahara-Afrikas.
Im Herzen Subsahara-Afrikas.
Jenseits der Peripherie
Eine negative und provisorische Geografie
Anarchistische Völker?
Was, wenn die globale Welt woanders entstanden wäre?
KAPITEL 5: Die Geburt der globalen Welt aus der eufrasischen Achse
Verbundene Welten
Ein Hindernisparcours
Offenes Land und Barrieren.
Die Grenzen der eufrasischen Achse.
Geisterwälder.
Von einer «Zivilisation» zur anderen
Untergründige Beziehungen zwischen den Welten
Verbreitung domestizierter Lebewesen
Gemeinsame Kulturpflanzen.
Gemeinsame Haustiere.
Wie Welten sich verbinden
Kenne den Weg.
Der Malaiische Archipel, Heimat der Gewürze.
Der Raum der Edelmetalle
Als Geld noch kein Geld war.
Die Erfindung des Münzgeldes.
Der monetäre Rohstoff wird knapp.
Ein Raum, aber keine «Zeit»
Osten, Zentrum, Westen
Von Abendländern und Morgenländern
Ausgediente Orientalismen.
Zwei gegensätzliche Religionsräume.
Reisfelder und Berge.
Frühreife Mitte, träge Peripherien
Knotenpunkt Fruchtbarer Halbmond.
An den Enden der Achse.
Japanische Autonomie.
Der mediterrane Westen.
Fernab der Wirren im Zentrum.
Gesellschaften mit Wurzeln und Gesellschaften auf Hufen
Landwirte und Reiter
Reitkünste
Sesshafte Reiche, von Steppenreitern regiert
Iran öffnet sich auf Zentralasien.
Nordindien am Fuß des Khaiberpasses.
Türkischer Vorstoß in die Mittelmeerwelt.
Steppenreiche
Im Angesicht der Steppengesellschaften.
Nomadenreiche.
Die mongolische Geschichte.
Der Schwarze Tod, eine Folge des Austauschs.
Das mongolische Reich, Opfer seiner enormen Größe.
Reiche und Wirtschaftswelten
Große Flüsse und Getreide: Eine imperiale Ökologie?
Imperiale Milde.
Die «Getreidedominanz».
Gefährliche Nachbarschaften: Eine imperiale Grundsituation?
Das geeinte Reich.
Dezentrale Reichshauptstädte.
Jenseits der Reiche. Wirtschaftswelten
Woher kommt die Königin?
Indien. Halb Reich, halb polyzentrische Welt.
Als es mehr als ein China gab.
Polyzentrischer Malaiischer Archipel.
Japan ist kein Reich.
Dauerhaft polyzentrisch: Europa.
Erbschaft alter Konfigurationen
Was, wenn Zheng He Afrika umschifft hätte?
Die sieben Reisen des Zheng He
Hat es die Großen Entdeckungen der Chinesen wirklich gegeben?
KAPITEL 6: Die Bifurkation der Welt
Out of Eufrasia:
Die unvermeidlichen «Entdeckungen»
War Amerika so isoliert?
Alle haben Amerika entdeckt … außer Kolumbus.
Die Wikingerroute (8. bis 13. Jahrhundert).
Weiterziehen, wenn die Erde erschöpft ist
Die Tiefendynamik der Achse.
Wachsende Edelmetallverknappung.
Europa: Zufälle und Begehrlichkeiten
Gegen den Westwind
Ein erster Schritt in Richtung Übersee?
Erste europäische Expansion nach Südwesten.
Die ersten Zuckerinseln.
Zwischenstationen.
Auf der Suche nach dem winterlosen Land
Die portugiesische Umsegelung Afrikas.
Portugiesisch-Indien.
Was in Eurasien als Marginalie begann
Dreißig Jahre, die Amerika zusammenbrechen ließen
Warum zurück nach Übersee?
Spanische Beharrlichkeit.
Männermangel.
Warum gerieten die anderen Gesellschaften der Achse nicht in Versuchung?
An den zwei Enden der (europäischen) Weltkarte.
Sollten die Türken erwogen haben, nach Amerika zu fahren?
Eine koloniale Wirtschaftswelt
Fluch der «Entdeckungen»
Der größte Bevölkerungseinbruch der Geschichte
Ein bakteriologischer Vorteil für die Kolonisatoren
Was, wenn Europa auf Übersee verzichtet hätte?
War es für Europa die Mühe wert?
Was, wenn der ungleiche Mikrobenaustausch sich umgekehrt hätte?
Was, wenn Europa teilweise tropisch gewesen wäre?
KAPITEL 7: Eine globale Welt, vorübergehend europäisch
Columbian exchange:
Die Globalisierung der Ökosysteme
Zeitmaßstäbe
Absichtliche Transfers
Das neolithische Erbe wird global
Tiere von Ost nach West.
Wechselseitige Migration von Pflanzen.
Die Westindischen Inseln
Die Plünderung Amerikas
Wettstreit europäischer Mächte
Erste englische und französische Vorstöße im 16. Jahrhundert.
Die Niederländer betreten die Bühne.
Neue Akteure im 17.
Alle großen europäischen Staaten wollen ihre kleinen Antillen.
Der Wettbewerb nützt den Freibeutern.
Von Potosí über Amsterdam nach Beijing
Anhaltend grassierende Inflation.
Inflation auf der Achse der Alten Welt.
Die Erschaffung des Südens
Lange Zeit marginalisierte gemäßigte und kalte Zonen
Transatlantischer Sklavenhandel: Demografischer Aderlass und geopolitische Desorganisation in Subsahara-Afrika
Lange gefährdete europäische Stützpunkte.
Das Ausbluten Subsahara-Afrikas durch den Sklavenhandel.
Langsames Vordringen des europäischen Handels nach Ostasien
Das portugiesische 16. Jahrhundert.
Die Zeit der Ostindienkompanien.
Vormacht der Niederländischen Ostindienkompanie (VOC) im 17. Jahrhundert.
Vormacht der Britischen Ostindienkompanie (BEIC) im 18. Jahrhundert.
Europäischer Konsum – Nutznießer und Motor der Erfindung des Südens
Tee, Kaffee, Schokolade, Tabak.
Baumwolle, von Indien nach England.
Von den Tropen zur Unterentwicklung
Vernetzung und Ungleichheit.
Europäische Vielfalt wird auf die Welt übertragen.
Substitution und Industrialisierung.
Haiti. Von der Peripherie zur Randständigkeit.
Was, wenn der Süden den Norden erschaffen hätte?
KAPITEL 8: Der Menschen Erde
Europa, einen Schritt voraus (18. Jahrhundert bis 1914)
Eine mehrdimensionale Revolution
Der grundlegende Wandel: die Zahl der Menschen
Die Revolution der nicht-agrarischen Produktion
Das Paradigma der Moderne
Puzzle und Kapitalismus
Die zweite Kolonisierung
Europa konnte sich die Welt leisten.
Hüben Demokratie, drüben Imperialismus.
Die Waffe der Schuld.
Gefahren einer Wirtschaftswelt
Die Weltkarte: Langfristige Folgen der Großen Transformation (20. und beginnendes 21. Jahrhundert)
Weltpuzzle
Schrumpfung der Welt, Inflation der Menschenzahl
Die Erfindung des Westens
Kann man den Westen kartografieren?
Folgen europäischer Auswanderung.
Weltfluchtversuche
Der «Süden»: Immer noch unterjochte Gesellschaften
Das Zeitalter fossiler Kohlenstoffe (18. bis 21. Jahrhundert)
Geologisches Erbe, leichtfertig verschleudert
Gemeinsame Biosphäre
Immer der einfachste Weg
Systemische, aber nicht ausweglose Bedrohung
SCHLUSSWORT: Erdgebunden, global, universal
Danksagung
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
Für Anne-Marie Mitschöpferin dieses Buchs Ohne unsere vierzig Jahre fruchtbaren Dialogs wäre nichts davon möglich gewesen.
ATLAS
Übersicht der Karten im Atlas
Verbreitung und Vermischung von Homo sapiens
Die Menschen werden sesshaft und vermehren sich
Bevölkerungsaufschwung und -krise
Die Bevölkerungsexplosion
Verbreitung des Menschen: Passagen und Hindernisse
Geisterwälder
Die Veränderung der Ökoregionen nach der letzten Eiszeit
Die Domestizierung der Pflanzen
Die Domestizierung der Tiere
Jäger und Sammler an den Rändern der Welt
Die Seefahrer auf dem Pazifik
Der Einfluss des Klimas
Die Vielfalt der Sprachen im 15. Jahrhundert
Die indigenen Gesellschaften (21. Jahrhundert)
Die Achse der Alten Welt zu Beginn unserer Zeitrechnung
Die Globalisierung im 15. Jahrhundert
Die Verbreitung des Buddhismus und Konfuzianismus
Die Nutzung der Erde im 15. Jahrhundert
Die Reisen Zheng Hes (1405–1433)
Asiatischer Reisanbau
Wie Europa die Welt kolonisiert hat
Das maritime Netz der Welt
Tordesillas: Die erste Aufteilung der Welt
Die demografische Katastrophe und die Wiederaufforstung Amerikas
Der Kolumbianische Austausch
Die Globalisierung der Verwendung von Edelmetallen
Die Einteilung der Welt in Nord und Süd
Fossile Rohstoffe
Kohlenstoff
Das Meer und der Permafrost
Umweltverschmutzung
Karten aus den Atlanten «Die Geschichte der Welt» (20238) und «Die Geschichte der Erde» (2024) unter der Leitung von Christian Grataloup und realisiert von Légendes Cartographie. © L’Histoire – Les Arènes, 2019, 2022 und 2023
VORBEMERKUNG
Eine Geogeschichte der Menschen auf dieser Erde
Die historische Erzählung, die Sie lesen werden, wurde von einem Geografen geschrieben. Sie knüpft an meine zunächst in den Éditions Les Arènes und der Zeitschrift L’Histoire veröffentlichten Atlanten an, den Atlas der Welt (2022) und den Atlas der Erde (2024), deren Thematik sie entfaltet. Wie die Atlanten verfolgt sie ein anspruchsvolleres Vorhaben als das einer bloßen Lokalisierung von Ereignissen. Sie möchte deutlich machen, was die Geschichte von Gesellschaften ihrem Raum verdankt. Geografen beschäftigen sich für gewöhnlich damit, den Raum der heutigen Gesellschaften zu erforschen und zu interpretieren, während es hier letztlich darum geht, die Werkzeuge der Geografie für das Verständnis der Vergangenheit fruchtbar zu machen. Das bedarf vielleicht der Erläuterung.
Obgleich die Menschen Mittel gefunden haben, um die Distanzen zwischen sich zu verringern, ob durch immer leistungsfähigere Transport- und Kommunikationsmittel oder jene Konzentration möglichst vieler Aktivitäten auf kleinstmöglichem Raum, die man Stadt nennt, gibt es doch für jede Gesellschaft manches, das ihr nah, und anderes, das ihr fern ist. Was bei ihren Nachbarn geschieht, hat zwangsläufig Auswirkungen auf sie selbst, ganz gleich, wie diese aussehen, ob sie zum Frieden oder zum Krieg, zur Öffnung oder Schließung der Grenzen führen. Die Geschichte der Nachbarn ist stets Teil der eigenen Geschichte. Das gilt insbesondere dann, wenn diese Nachbarn viele und wenn sie bevölkerungsreich sind. Nachbarschaften dieser Art tragen zu rascheren und tiefgreifenderen historischen Veränderungen bei. Dagegen stellen Gesellschaften, die zumindest zeitweise isoliert waren, autonomere Welten dar, in denen die Erhaltung tendenziell über den Wandel siegt. Wie intensiv ihre Beziehungen und wie stark sie vernetzt sind, wirkt sich erheblich auf die Dynamik von Gesellschaften aus. Geschichte ist geografisch.
Zudem ist die Menschheit nicht allein auf der Erde. Sie ist Teil der dünnen Schicht des Lebens, die man Biosphäre nennt. Ein paar Dutzend Meter unter die Erdkruste, ein paar Kilometer hinunter in den Ozean und hinauf in die Atmosphäre: Leben gibt es nur in einem winzigen Teil des Planeten. Aber die Menschen partizipieren aktiv an der Biosphäre. Wir haben unsere irdische Verfasstheit allzu oft vergessen, aber die gegenwärtige Umweltkrise ruft sie uns mit wachsendem Nachdruck in Erinnerung. Die historische Erzählung spielt nicht im erdentrückten Raum.
Dem vorliegenden Buch geht es um eine Synthese dieser beiden Perspektiven. Die erste, horizontale, ist die der Beziehungen zwischen Gesellschaften auf der Erdoberfläche, die der Grenzen und Konflikte, der Verbreitungen und Eroberungen. Die zweite, vertikale, ist die der Domestizierungen, des Bergbaus, der Reisfelder, der Verschmutzungen. Unsere Erzählung verknüpft beide, um mit den Füßen fest auf der Erde zu bleiben. Wir werden Meeresströmungen und Seefahrer kennenlernen, Berge, Wüsten und Eroberer, Bauern und zu kalte Winter …
Dieses Buch möchte also zu einer historischen Reise ebenso wie zu einer geografischen Lesart des Vergangenen einladen. Das ist es, was der von Fernand Braudel geprägte Begriff der «Geogeschichte» meint. Natürlich ist die Geschichte der Menschen auf der Erde für ein paar hundert Seiten ein sehr weites Feld. Aber es geht nicht darum, die Weltgeschichte zusammenzufassen. Es soll nur das zur Sprache kommen, was in den Lichtkegel der geohistorischen Doppelperspektive tritt. Wenn ein Gesprächspartner sich überrascht zeigte, dass ich mich als Geohistoriker verstehe, habe ich häufig erwidert, ich hätte mich für die Geografie entschieden, um die Art Geschichte zu treiben, die mir vorschwebt: ohne mich auf eine Epoche zu beschränken und ohne den Beitrag der Naturwissenschaften zu vernachlässigen. Die Vorliebe für die großen illustrierten Erzählungen des Menschheitsabenteuers verdanke ich vielleicht meinen Kindheitslektüren, C. W. Cerams Götter, Gräber und Gelehrte (1949) zum Beispiel oder den Atlanten, in denen ich zu ungezählten Reisen aufbrach, ohne mich vom Fleck zu rühren. Man könnte mir entgegenhalten, der zeitliche und räumliche Umfang meines Forschungsgegenstandes (von der Urgeschichte bis heute und einmal rund um die Welt) verleite zu Vereinfachungen, ja Ungenauigkeiten. Aber damit ist auch ein Kohärenzgewinn verbunden, den ein Überblick aus vielen Händen nicht bieten kann. Tatsächlich ließe sich meine Aufgabe mit der eines Allgemeinmediziners vergleichen: Die Kenntnisse der Spezialisten sind für ihn unverzichtbar, aber der Patient ist ein und derselbe Mensch, dessen Gesundheit sich nur ganzheitlich verstehen lässt, und die Aufgabe des Generalisten besteht darin, jede Krankheit in ein Gesamtbild einzuordnen und die Therapien aufeinander abzustimmen. Die folgende Geschichte ist also keine vornehmlich umweltbezogene, ökonomische, geopolitische, demografische, kulturwissenschaftliche … Sie ist etwas von alledem in einer geohistorischen Synthese.
Das Buch unternimmt auch den einen oder anderen Ausflug in die kontrafaktische Geschichtsschreibung. Mitunter ist es fruchtbar, sich in eine histoire des possibles, eine «Geschichte des Möglichen» hinauszuwagen, um den schönen Titel von Quentin Deluermoz und Pierre Singaravélou (2016) aufzugreifen. Wenn es den einen Hasard, das Schicksal und die Fügung nicht gibt, so gibt es doch die vielen hasards, die Zufälle, Abzweigungen und Weggabelungen, die Augenblicke der Bifurkation: Was wäre gewesen und geworden, hätten 1492 nicht Europäer, sondern Chinesen den ersten Kontakt zwischen den Gesellschaften Amerikas und den Bewohnern der Alten Welt hergestellt? Solche Hypothesen zu skizzieren, kann uns manches über die Dynamik der Welt lehren, immer vorausgesetzt, dass sie nicht absurd sind und dem historischen Kontext Rechnung tragen.
Die weite Öffnung des Fokus, der von der Ur- und Frühgeschichte bis heute und morgen reicht und die ganze Erde in den Blick nimmt, richtet sich an ein breites Publikum. Ich habe mich außerdem entschlossen, ganz auf Fußnoten zu verzichten. Hätte ich jede Quelle ausweisen wollen, wäre das Buch sehr viel dicker geworden und würde sich weniger flüssig lesen lassen. Die gleiche Entscheidung gilt für die Bibliografie.
Diese Arbeit richtet sich nicht in erster Linie an meine akademischen Kollegen, sondern an alle Leser, die neugierig auf unsere Vergangenheiten und beunruhigt über unsere Zukunft sind. Möge ihnen das Buch ein ebenso großes Lesevergnügen bereiten wie das bis heute nicht nachlassende, das mir meine Kindheitslektüren beschert haben.
Gute Reise!
EINLEITUNG
Die Frage des Anderen. Ein pluraler Singular, ein singulärer Plural
Am 9. Juni 1537, sechzehn Jahre nach der Eroberung Mexiko-Tenochtitláns durch Hernán Cortés und vier nach der Cuscos durch Francisco Pizarro, unterzeichnete Papst Paul III. (Alessandro Farnese) die Bulle Sublimis Deus, die den Debatten darüber ein Ende setzte, ob die indigenen Bevölkerungen Amerikas der Menschheit angehören oder nicht. Mit dieser Bulle sollte ihrer zu Recht als unmenschlich gebrandmarkten Behandlung durch die Eroberer und ersten Siedler Einhalt geboten werden. Der päpstliche Beschluss kam der Bitte spanischer Prälaten nach und war keineswegs nur eine humanitäre Maßnahme. Von den afrikanischen Sklaven, deren Verschleppung nach Amerika damals begann, war denn auch gar nicht die Rede. Vielmehr ging es in erster Linie darum, die Kirche und namentlich die Missionsorden in ihrer Bemühung zu unterstützen, Macht über die indigenen Bevölkerungen zu gewinnen. Der Wille des katholischen Klerus trat freilich in Konkurrenz zu der Absicht säkularer Siedler, sich enorme encomiendas zu sichern, Agrar- und Bergbaubetriebe, die auf der brutalen Ausbeutung der indigenen Bevölkerung beruhten. Es ist dieser Kontext der Konkurrenz unter Kolonisatoren, in dem die Kirche einen Schlussstrich unter die Debatte setzt, ob die jenseits des Atlantiks «entdeckten» Gesellschaften dem Menschengeschlecht angehören. Es war also einem hartnäckigen Irrglauben entgegen nicht die Kontroverse von Valladolid, die 1550/1551 zur Anerkennung des Menschenstatus der indigenen Amerikaner führte. Tatsächlich legte sie lediglich die theoretischen Modalitäten der Bekehrung und Ausbeutung der amerikanischen Bevölkerung fest.
Die ersten amerikanischen Indigenen, die 1493 von Christoph Kolumbus nach Europa gebracht worden waren, hatten zwar lebhafte Neugier, aber keine Zweifel an ihrer Zugehörigkeit zur Menschheit geweckt. Denn Kolumbus war überzeugt, es mit Bewohnern der Inseln vor einer der Küsten Ostasiens zu tun zu haben. Man befand sich also noch immer in einem der drei von der Antike und den Kirchenvätern festgeschriebenen Teile der bewohnten Welt. Der Blickwinkel änderte sich zu Beginn des 16. Jahrhunderts, als andere Reisende, so insbesondere Amerigo Vespucci, die gelehrte Welt Europas davon überzeugten, dass die Länder jenseits des Atlantiks nicht zu Asien gehörten und es sich um einen bislang unbekannten Weltteil handeln musste, der 1507 auf den Namen America getauft wurde. Als am 8. September 1522 die achtzehn Überlebenden der Magellan-Expedition von der ersten Weltumsegelung nach Sevilla zurückkehrten, bestätigten sie, dass die Ausdehnung des «Großen Ozeans» (der damals noch nicht «Pazifik» hieß) und mit ihr der Abstand zwischen Amerika und Asien ganz erheblich war. Das erschwerte es, die Amerikaner als Nachfahren Noahs zu betrachten, dessen drei Söhne nach Auskunft der Genesis einst Asien, Europa und Afrika besiedelt hatten. Als Lösung, die nicht an den Buchstaben der Heiligen Schrift rührte, bot es sich an, die Bevölkerung Amerikas nicht als Kinder Gottes, als seelenbegabte Lebewesen zu betrachten. Man rechnete sie also zu den höherstehenden Tieren, nicht aber zu den Menschen. Eroberer und Kolonisatoren waren über diesen Tierstatus alles andere als unglücklich.
Ein anderes, nicht theologisches Argument trug jedoch stark dazu bei, dass immer mehr Intellektuelle und Geistliche zur Annahme des Menschencharakters der Indigenen neigten. Es hatte sich rasch herausgestellt, dass eine indigene Amerikanerin und ein Europäer (so sah die übliche Geschlechterpaarung aus) Kinder zeugen konnten. Die ersten spanischen Siedler in Amerika hatten eine Einheimische zur Frau genommen und eine Familie gegründet. Der zweifellos zu Unrecht als erster «Mestize» geltende Martín Cortés, el Mestizo, war um 1523 der Erstgeborene eines Paars, das aus Hernán Cortés und Malintzin, besser bekannt als «La Malinche», bestand. Kein Europäer, der einige Zeit in Amerika verbracht hatte, konnte ernsthaft daran zweifeln, dass die «Eingeborenen», die selbstverständlich «Barbaren» blieben, Menschen waren. Die Debatte über ihre Abstammung von Adam und Noah war ein Disput unter Intellektuellen, die den Atlantik nie überquert hatten.
So unverständlich, wie europäische und indigene Gesellschaften einander blieben, war die Eroberung Amerikas eine massive Konfrontation mit sozialer Andersartigkeit. Die Interfertilität lieferte den schlagendsten Beweis für die Zugehörigkeit von Europäern und indigenen Amerikanern zu ein und demselben Menschengeschlecht. Aber der Wille der Eroberer zur Herabsetzung der Besiegten und die tiefe Überzeugung, ihnen überlegen zu sein, erschufen sich mit der Erfindung der «Rassen» ein vermeintlich natürliches, trügerisches Fundament. Die kolonisatorische europäische Erfahrung seit dem 16. Jahrhundert war eine Praxis und Theorie der Ungleichheit unter den Menschen. Aber aus ihr erwuchs zugleich das Bewusstsein von der Existenz ein und derselben Menschheit. Es gab Menschen überall auf der Erde.
***
Die Haltlosigkeit des Begriffs der biologischen Rasse, durch die sich Menschen voneinander unterscheiden sollen, ist seit Mitte des 20. Jahrhunderts ein unbestreitbares wissenschaftliches Faktum. Für den Begriff sind nur noch die Sozialwissenschaften zuständig, denn so wenig es Rassen gibt, so sehr gibt es Rassisten und von ihnen rassifizierte Menschen. Aber dies ist eine andere, traurige Geschichte. Bleibt die offenkundige Tatsache der biologischen Einheit der Menschen. Diese Homogenität aber ist selber etwas, das uns in Erstaunen versetzen sollte.
Menschen gibt es tatsächlich gegen Ende des 15. Jahrhunderts, als Kolumbus in See sticht, fast überall. Die Antarktis und ein paar kleine Inseln mitten im Ozean ausgenommen, bilden sich Gesellschaften auf allen Landmassen wie auf den Inseln vor den Küsten. Keine andere Art von Lebewesen, ob Pflanze oder Tier, kennt eine solche Ubiquität, die alles andere als «natürlich» ist. Wo immer bestimmte Pflanzen oder Tiere ohne Zutun des Menschen schon weit verbreitet waren, schlug sich diese Verbreitung in morphologischen Variationen nieder. Die Hauptursache dafür liegt in der Dauer des Vorgangs. Die Elefanten Asiens und Afrikas etwa (und letztere bilden ihrerseits zwei Arten) haben durchaus einen gemeinsamen Ursprung, ganz wie die ausgestorbenen Mammuts, aber die geografische Ausbreitung ihres gemeinsamen Vorfahren ging je nach Weltregion mit divergenten Evolutionen einher. Die Auseinanderentwicklung reicht ganze 60 Millionen Jahre zurück. Anderes Beispiel: Die Familie der Pferde (Equidae) tauchte zweifellos vor 55 Millionen Jahren in Amerika auf, um sich sehr viel später in Europa und Afrika auszubreiten, wo sie sich in Pferde, Esel und Zebras auseinanderentwickelte, während in Amerika diese ganze Säugetierfamilie ausgestorben ist. Diese beiden Beispiele stehen also für Zeiträume, die ungleich länger sind als die 100.000 Jahre, die seit der Verbreitung von Homo sapiens, ja selbst die 1,5 Millionen, die seit der Verbreitung von Homo erectus verstrichen sind. Kein Zweifel, läge die Verbreitung der Menschen mehrere Millionen Jahre zurück und wäre es bis ins 15. Jahrhundert zu keinem Kontakt mehr zwischen den verschiedenen Linien gekommen, gäbe es heute nicht eine einzige, sondern mehrere menschliche Spezies, ganz wie es verschiedene Affenarten gibt: Orang-Utans, Makaken oder Gibbons in Südostasien, Gorillas, Schimpansen und Paviane in Subsahara-Afrika, Seidenäffchen und Kapuzineraffen in Südamerika.
Tiere wie Pflanzen haben sich, wie es die Besonderheit der Fauna und Flora Australiens deutlich belegt, in der biologischen Evolution umso mehr auseinanderentwickelt, je stärker und länger ihre Isolation war. Vor dem 15. Jahrhundert lebte die menschliche Spezies in ganz unterschiedlichen Umwelten in Eurasien, Amerika und Australien. Die Menschen haben weder die gleichen Pflanzen angebaut noch die gleichen Tiere gejagt oder gezüchtet. Und doch waren sie biologisch vergleichbar. Kleine morphologische Variationen und geringfügige Unterschiede der Chromosomenausstattung ändern nichts an einer sehr starken genetischen Homogenität, die weit über die anderer Primatenarten hinausgeht.
***
So eintönig die genetische Geografie der Menschen ist, die historische Vielfalt menschlicher Gruppen scheint nachgerade unendlich. In erster Linie ist dies eine Frage der Zahl. Es gibt heute Gesellschaften, die nur ein paar hunderttausend, ja zehntausend Individuen zählen. Die kleinsten nationalen Bevölkerungen sind häufig die der pazifischen Inselstaaten (Nauru mit 11.000, Tuvalu mit 12.000, Palau mit 18.000 Menschen), aber auch die der Antillen (St. Kitts und Nevis mit 54.000, Dominica mit 72.000), nicht zu vergessen die Kleinstaaten in Europa (San Marino mit 34.000, Liechtenstein mit 38.000, Monaco mit 39.000, ganz zu schweigen von den 825 Bewohnern des Vatikans) oder anderswo (Brunei mit 445.000, Bhutan mit 78.000). Am anderen Ende der Statistik stehen die Milliardenstaaten China und Indien mit jeweils 1,4 Milliarden Menschen. Man kann davon ausgehen, dass diese beiden imperialen demografischen Erbschaften multinationalen Ursprungs sind, aber doch einen festen nationalen Kern haben. So bilden die Han, die «chinesischen Chinesen», wie man sie nennen könnte, die größte ethnische Gruppe der Welt: 90 % der Personen, die einen Pass der Volksrepublik China besitzen.
Die Vergangenheit kennt keine so astronomischen Bevölkerungszahlen. Vor dem 19. Jahrhundert zählte die Menschheit weniger als 1 Milliarde Menschen, achtmal weniger als heute. Trotz der geringeren Menschenzahl gab es aber bereits Regionen von großem demografischen Gewicht. Im Römischen Reich lebten im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung etwa 60 bis 70 Millionen Menschen, was 24 % bis 28 % der Weltbevölkerung entsprach. Etwa gleich groß war der Anteil der chinesischen Han-Dynastie. Gemeinsam stellten beide Reiche gut die Hälfte aller Menschen, während die meisten damaligen Gesellschaften, auch wenn es andere dicht besiedelte Gebiete gab (Indien, Zentralamerika, Südostasien), von vergleichsweise bescheidenem Umfang waren. Die Kluft, die wir heute haben, gab es also schon damals.
Auch wenn man weiter in die Vergangenheit zurückgeht, sind die Abstände nicht zwangsläufig kleiner. Vorherrschend ist der Eindruck, dass die Jäger- und Sammlergruppen des Paläolithikums nur ein paar Dutzend Mitglieder zählten. Eine nicht unumstrittene Hypothese, die sich nur schwer erhärten lässt. Über die Jäger und Sammler vor 30.000 Jahren, um nicht noch weiter, nämlich bis vor das Paläolithikum zurückzugehen, haben wir praktisch keine quantitativen Kenntnisse. Dennoch lässt sich festhalten, dass es Regionen gibt, in denen sie zahlreiche Spuren hinterlassen haben, was auf eine dauerhafte Ansiedlung (also kein ständiges Nomadentum) und zugleich auf eine eher im drei- als zweistelligen Bereich angesiedelte Bevölkerungszahl schließen lässt. Da man die damalige Weltbevölkerung auf 2 bis 3 Millionen schätzen kann, haben einzelne gesellschaftliche Gruppen offenbar einen nicht unerheblichen Teil der damaligen Menschheit ausgemacht. Trotz allem ist aber die Kluft zwischen Mega- und Mikrogesellschaften wahrscheinlich stetig gewachsen.