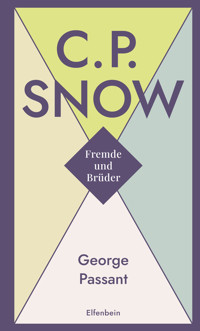
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fremde und Brüder
- Sprache: Deutsch
Nach Anthony Powells »Ein Tanz zur Musik der Zeit« und Simon Ravens »Almosen fürs Vergessen« erscheint endlich auch der dritte große englische Romanzyklus aus dem 20. Jahrhundert erstmals vollständig in deutscher Übersetzung: Die elfbändige Reihe »Strangers and Brothers«, im Original zwischen 1940 und 1970 veröffentlicht, kam hierzulande trotz mehrfacher Versuche in verschiedenen Verlagen nie zum Abschluss. Unsere Ausgabe startet im Frühjahr 2025 auf der Grundlage einer behutsamen Überarbeitung der vorliegenden Übersetzungen von Grete Felten aus den sechziger Jahren. Sie soll bis 2029 mit der Erstveröffentlichung der auf Deutsch bislang fehlenden Teile abgeschlossen werden. Snows Romanwerk, dessen Handlung sich vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis in die Zeit der Studentenunruhen von 1968 erstreckt, zeichnet — in der Rückschau des pensionierten Hochschullehrers Lewis Eliot und dabei autobiografisch getönt — den Lebensweg eines britischen Akademikers aus der Mittelschicht durch die sogenannten »corridors of power« nach: von Eliots Jugend in eher bescheidenen Verhältnissen in einer englischen Provinzstadt über seine Karriere als Anwalt in London, als Beamter, als Dozent in Cambridge. Dabei bieten die Romane eine tiefgründige Untersuchung der britischen Arbeitswelt des 20. Jahrhunderts und deren Institutionen sowie des komplexen Zusammenspiels zwischen dem Privatleben und dem Streben nach Ansehen in Beruf und Öffentlichkeit — entlang all der vielen Fallstricke moralischer Entscheidungen und vor dem Hintergrund sozialer Spannungsgeflechte und weltpolitischer Veränderungen. Dabei erzählt Snow clever und nicht selten amüsant. Seine liebevoll ausgearbeiteten Charaktere binden die einzelnen Romane, die auch separat gut lesbar sind, in geradezu Proust'scher Manier aneinander. Der in der Chronologie an zweiter Stelle stehende Teil »George Passant« erschien bereits 1940 — als erster Band überhaupt und noch unter dem Titel »Strangers and Brothers«, den Snow erst später auf den heranwachsenden Zyklus übertrug. Lewis Eliot, der schüchterne Protagonist der Reihe, tritt in dieser fesselnden Analyse seines Mentors George Passant, eines charismatischen Anwaltsgehilfen, in den Hintergrund. In den Jahren der Wirtschaftskrise zwischen den Kriegen versammelt George — ein radikaler Idealist, der die Welt neu gestalten will — eine Gruppe junger Leute um sich, die, unruhig und ehrgeizig, darauf vertrauen, dass er sie von den Zwängen ihres provinziellen Lebens befreit. Doch als seine hohen Ambitionen durch Geldnot und den Wunsch nach sexueller Freiheit getrübt werden, wird seine Macht über die Gruppe zu einer Gefahr für sie alle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C. P. Snow
George Passant
Roman
Aus dem Englischen übersetztvon Grete Felten
Elfenbein
Die Originalausgabe erschien 1940unter dem Titel
»Strangers and Brothers« bei Macmillan Publishers, London.
Grete Feltens deutsche Übersetzung erschien erstmals 1964bei der Deutschen Verlags-Anstalt, Stuttgart. Für die vorliegende
Neuausgabe wurde sie auf der Grundlage der 1970 von C. P. Snow revidierten Fassung behutsam überarbeitet.
Band 2 des Romanzyklus »Fremde und Brüder«
Copyright © C. P. Snow 1940
Erste Auflage 2025
© 2025 Elfenbein Verlag, Berlin
Benediktinerstraße 57 · 13465 Berlin
Einbandgestaltung: Oda Ruthe
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-96160-121-9 (E-Book)
ISBN 978-3-96160-101-1 (Druckausgabe)
TEIL 1
george passant triumphiert
I
FLAMMENSCHEIN AUF EINEM SILBERNEN ZIGARETTENETUI
Das Kaminfeuer in unserem Stammlokal sprühte aufund sank zusammen. Es war wohltuend in diesen Frühherbsttagen, und ich genoss die Wärme neben mir, ohne mir Gedanken darüber zu machen, dass ich nun schon eine ganze Weile wartete. Schließlich kam Jack herein, eilte an den anderen Tischen vorüber, um sich an dem meinen niederzulassen, und sagte:
»Ich sitze in der Klemme, Lewis.«
Einen Augenblick lang dachte ich, er wolle sich nur wichtig machen, doch als er weitersprach, merkte ich, dass es ernst war.
»Bei Calvert bin ich erledigt«, sagte er. »Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll.«
»Was hast du denn angestellt?«
»Ich – gar nichts«, sagte Jack. »Aber heute früh hab ich etwas geschenkt bekommen …«
»Woher? Von wem?«
»Von Roy.«
Roys Namen hatte ich in den letzten zwei Monaten oft gehört. Er war fünfzehn Jahre alt und der Sohn Calverts, den Jack eben erwähnt hatte und dem die Abendzeitung unserer Stadt gehörte. Jack war in der Redaktion angestellt, und der Junge hatte es während der Schulferien, die noch nicht zu Ende waren, fertiggebracht, mit ihm näher bekannt zu werden. Ohne sich Gedanken zu machen, hatte Jack ihm Bücher geliehen und sich gern und viel mit ihm unterhalten, und erst vor wenigen Tagen war ihm klargeworden, dass der Junge für ihn schwärmte und sich romantischen Vorstellungen hingab.
Mit einem raschen Griff fuhr Jack in seine Rocktasche und hielt ein Zigarettenetui vors Feuer.
»Hier haben wir die Bescherung«, sagte er. Die Flammen beleuchteten das neue, blankpolierte Silber. Ich streckte die Hand aus, nahm das Etui, betrachtete die Initialen J. C. (Jack Cotery) in verschnörkelter Frakturschrift und wog das schwere Silber in der Hand. Wir beide, Jack und ich, waren jeder fünf Jahre älter als der Junge, von dem das Geschenk stammte, aber wir verdienten in der Woche noch nicht einmal ein Drittel der Summe, die es gekostet haben musste.
»Ich frage mich bloß, wie er das hat bezahlen können«, sagte ich.
»Sein Vater hält ihn nicht knapp«, gab Jack zurück. »Aber er muss dafür seinen letzten Groschen ausgegeben haben.«
Er hatte das Etui wieder an sich genommen und sah mit bedrücktem Lächeln zu, wie sich die Flammen in ihm spiegelten. Ich betrachtete ihn; von allen meinen Freunden war immer er derjenige, dem solche Sachen passierten. Oft genug hatte ich beobachtet, wie er die Blicke der Frauen auf sich zog. Freilich zögerte er nicht, dieses Interesse zu erwidern, aber manchmal nahm er es – bei Frauen oder auch hier bei Roy – nur hin, ohne selbst einen Schritt entgegenzukommen. Er war kein schöner Mann, ja, er sah – für Männeraugen – nicht einmal besonders gut aus mit seinem frischen roten Gesicht, dem glatten schwarzen Haar und der eher kleinen athletischen Figur. Sein Gesicht, die Augen und der gesamte Ausdruck veränderten sich quecksilbrig, sobald er sprach.
»Du hast noch nicht alles gesehen«, sagte Jack und drehte das Etui um. Auf dieser Seite war in Email ein leuchtendes Wappen in den Farben Gold, Rot, Blau und Grün eingelegt; das einzige Feld, das ich erkennen konnte, zeigte blaue Wellenlinien.
»Er hat ein Blatt in das Etui gelegt, auf dem er nachweist, dass dies das Wappen der Coterys ist«, fuhr Jack fort und zeigte mir einen Bogen Kanzleipapier, der mit einer sauberen, festen Knabenhandschrift bedeckt war. Ein Absatz legte dar, die blauen Wellenlinien erklärten sich »aus einem Wortspiel, in dem Côte für Cotery« stehe; es stamme »von einer Familie Cotery in Dorset, die im Jahre 1607 von Jakob I. in den Adelsstand erhoben worden« sei. Mich überraschten die Gründlichkeit, mit der jede Einzelheit behandelt war, die genealogischen Hinweise, die Liebe nicht nur zu Jack, sondern auch zur Heraldik, die aus alledem sprach; er musste sich wochenlang darum bemüht haben.
»Gar nicht ausgeschlossen, dass das stimmt«, sagte Jack. »Es ist dann eben abwärtsgegangen mit dieser Familie. Schließlich hat ja mein Vater noch den einen Bruder in Chiswick …«
Ich lachte, und er spann den Einfall nicht weiter aus. Mit einem Blick auf das Papier faltete er es zusammen, rieb eine blinde Stelle auf dem Etui blank und betrachtete sorgenvoll und doch mit einem halben Lächeln das Wappen.
»Du solltest es lieber noch heute Abend zurückschicken«, sagte ich.
»Schon zu spät«, erwiderte Jack. »Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe – für den alten Calvert bin ich erledigt.«
»Weiß er denn, dass Roy dir ein Geschenk gemacht hat?«
»Er weiß noch mehr. Er hat einen Brief erwischt, der das Geschenk begleitete.«
Erst jetzt wurde mir klar, dass Calvert schon mit Jack gesprochen haben musste.
»Und was stand in dem Brief?«
»Das weiß ich nicht. Es war der erste, den er mir geschrieben hat. Aber man kann’s erraten, Lewis, man kann’s erraten. Natürlich hat Calvert sich aufgeregt. Und es scheint, dass ich da überhaupt nichts tun kann.«
»Hast du ihm denn sagen können«, fragte ich, »dass dir das völlig überraschend kam und dass du gar nichts davon gewusst hast?«
»Stell dir das nur nicht zu leicht vor!«, sagte Jack. »Übrigens hat er mir auch kaum Gelegenheit dazu gegeben. In seiner Aufregung war er nicht in der Verfassung, mir zuzuhören. Er sagte einfach, er habe entdeckt, dass sein Sohn mir einen – unbesonnenen Brief geschrieben habe. Und er müsse mich ersuchen, nicht zu antworten und auch nicht mit Roy zu sprechen. Das habe ich ihm gern versprochen. Aber sonst wollte er über Roy nichts von mir hören, sondern ging gleich auf ein anderes Thema über: meine Zukunft in der Firma. Er sagte, er habe immer damit gerechnet, dass für mich einmal eine gute Stelle in der Herstellungsabteilung frei würde. Jetzt habe er festgestellt, dass es mit den Beförderungen zu rasch gegangen sei; zwangsläufig werde er da das Tempo herabsetzen müssen. So könne ich zwar in meiner jetzigen Lehrlingsstelle bleiben, solange ich Lust hätte, aber er rate mir doch in meinem eigenen Interesse, mich nach etwas anderem umzusehen.«
Jack sah niedergeschlagen aus; ein Gefühl der Verlassenheit überkam uns beide, dem gerade junge Menschen so leicht ausgeliefert sind.
»Und damit völlige Klarheit herrscht«, fügte Jack hinzu, »hält er es für seine Pflicht, die Zahlung meines Schulgeldes einzustellen.«
Die »Schule« nannten wir jene Institution in unserer Stadt, die sowohl auf technischem wie auch auf geisteswissenschaftlichem Gebiet damals – im Jahre 1925 – die einzige Möglichkeit einer Weiterbildung bot. Jack war von Calvert dorthin geschickt worden, um das Druckerhandwerk zu erlernen, und ich besuchte jede Woche juristische Vorlesungen – Vorlesungen, die George Passant hielt, der Mann, an den ich gedacht hatte, als mir klar wurde, dass sich Jack tatsächlich in einer üblen Lage befand.
»Im Augenblick hast du nichts zu befürchten«, sagte ich. »Er kann dich nicht einfach ganz hinaussetzen – das würde die Aufmerksamkeit zu sehr auf seinen Sohn lenken.«
»Wer wird sich denn schon meinetwegen aufregen!«, sagte Jack.
»Das kann er nicht machen«, beharrte ich. »Aber was sollen wir unternehmen?«
»Ich habe nicht die leiseste Idee«, sagte Jack.
Jetzt nannte ich den Namen George Passants. Jack sprang sofort auf. »Zu dem hätte ich schon vor ein paar Stunden gehen sollen«, sagte er.
Wir gingen die London Road hinauf, überquerten sie am Bahnhof und bogen in eine Gasse ein, die uns rasch auf die lärmende Hauptstraße führte. Fish-and-chips-Läden verströmten Lichterglanz und Bratküchengeruch; Straßenbahnen rasselten vorüber. Jetzt, wo er ein bestimmtes Ziel vor sich sah, wurde Jack gesprächiger.
»Was soll ich machen, wenn Calvert mich nicht Drucker werden lässt?«, fragte er. »Sonst hatte ich ja allerhand Ideen, ich war doch immer ein fixer Junge. Aber sobald einem jemand die Laufbahn versperren will, kommt es einem vor, als wäre Buchdrucker der einzige mögliche Beruf in der ganzen weiten Welt. Was könnte ich denn sonst noch werden, Lewis?« Er sah einen Polizisten, der gerade mit seiner Lampe in ein dunkles Schaufenster leuchtete. »Ja«, meinte Jack, »Polizist wäre ich auch gern. Aber dafür bin ich ja nicht groß genug. Es heißt, man wird größer, wenn man so läuft …«, dabei hob er die Hände senkrecht über den Kopf wie Moses im Kampf gegen die Amalekiter und wiederholte, während er neben mir die Straße entlangging: »Ich möchte Polizist werden, ich möchte Polizist werden.«
Plötzlich hielt er inne und sah mich mit einem kläglichen, verlegenen Lächeln an. Ich lächelte auch: Dieses Schwanken zwischen Zuversicht und Verzweiflung, die Hoffnung der Zwanzigjährigen, jetzt himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt – ich kannte sie ja viel besser als er. Die Hoffnung war mein tägliches Brot. Ich war ebenso aufgeregt wie er; das Wappen der Coterys auf dem silbernen Zigarettenetui war plötzlich kein Anlass mehr, so bedrückt und traurig zu sein – es stieg mir wie Wein zu Kopf, und was Jack erzählt hatte, schwebte wie Holzrauch durch den Septemberabend. So waren wir voller Erwartung, ja, in gehobener Stimmung, als wir in eine Nebenstraße einbogen und in George Passants Wohnzimmer hinter einem rötlichen Vorhang die Lampen brennen sahen.
George kannte ich schon einige Jahre. Ich hatte ihn zufällig bei einer seiner juristischen Vorlesungen an unserer »Schule« kennengelernt – die er hielt, um sich etwas dazuzuverdienen, da er nur Angestellter bei Eden & Martineau war, nicht etwa Partner in dieser Kanzlei. Das war eine glückliche Begegnung: Er hatte für mich bereits sehr viel mehr getan als sonst jemand aus meiner Bekanntschaft.
Das Haus, vor dem wir jetzt standen, war das einzige in der Stadt, das uns zu jeder Tages- und Nachtzeit offenstand. Jack klopfte, und George kam selbst an die Tür.
»Tut mir leid, dass wir dich stören, George«, sagte Jack. »Aber es ist etwas passiert …«
»Kommt rein«, sagte George, »kommt herein.«
Seine Stimme war laut und eindringlich. Etwas mehr als mittelgroß, überragte er Jack um ein weniges; seine Schultern waren massiv, er fing an, dick zu werden, obwohl er erst sechsundzwanzig Jahre alt war. Doch das Auffallendste an seiner Erscheinung war der Kopf, die mächtige Stirn und die kraftvoll gebaute Kinn- und Backenknochenpartie in dem fleischigen Gesicht.
Er ging voraus in sein Wohnzimmer. »Trinkt ihr eine Tasse Tee? Ich kann schnell eine Kanne Tee kochen. Aber ihr mögt vielleicht lieber ein Glas Bier? Irgendwo habe ich bestimmt auch noch Bier.«
Freundschaftlich und schüchtern brachte er diese Einladung vor. Zuerst redete er uns mit Cotery und Eliot an, verbesserte sich aber dann und nannte uns bei den Vornamen. Schwerfällig tappte er durchs Zimmer, suchte in den Schränken und fuhr sich ratlos durch sein helles Haar, als er nichts fand. Das Zimmer lag voller Papiere, Tisch und Fußboden waren damit bestreut, am Kamin stand eine Aktentasche, neben einem Sessel war ein Stoß Bücher gestapelt. Eine leere Teetasse stand auf einem Bogen Papier auf dem Kaminsims, wo sie feuchte, dunkle Ringe hinterlassen hatte. Doch von diesem Arbeitschaos abgesehen, hatte George das Zimmer so gelassen, wie er es vorgefunden hatte; die Möbel gehörten ausnahmslos seiner Hauswirtin, an einer Wand hing noch ein Spruch: »Der Herr ist mein Hirte«, und über dem Kaminsims ein Bild: »Der Entsatz von Ladysmith«.
Schließlich förderte George mit einem Aufschrei drei Flaschen Bier zutage und stellte sie auf den Tisch.
»Und jetzt«, sagte er, indem er sich’s in einem Sessel bequem machte, »können wir zur Sache kommen. Worum geht’s also?«
Jack erzählte die Geschichte von Roy und dem Geschenk. Wie vorher bei mir, so verschwieg er auch jetzt zunächst die Unterredung, die er am Vormittag mit Calvert gehabt hatte, schilderte aber George gegenüber alles noch lebendiger.
»Der Junge ist der Vetter von Olive, musst du wissen, George. Und anscheinend ist die ganze Familie ein bisschen überspannt.«
»Von Olive möchte ich das doch nur bis zu einem gewissen Grade zugeben«, meinte George. Olive gehörte zu unserer »Gruppe«, den jungen Leuten also, die sich immer wieder mit George trafen.
»Trotzdem muss ich mir Vorwürfe machen«, sagte Jack. »Ich hätte sehen müssen, was vorging. Es ist auch für Roy hart, dass ich nichts gemerkt habe. Ich war regelrecht blind.«
Dann legte Jack das Zigarettenetui auf den Tisch.
George lächelte, untersuchte es aber nicht genauer, ja, er nahm es nicht einmal in die Hand.
»Freilich, der Junge tut mir leid«, sagte er. »Aber er steht außerhalb meines Kreises, und ich kann da nichts unternehmen. Allerdings würde es mir großes Vergnügen machen, seinem Vater zu sagen, dass er sich nicht zu wundern brauche. Schließlich hat er ja seinen Sohn auf eine vornehme Privatschule geschickt – und damit muss man eben rechnen bei diesen komischen Institutionen. Und dann würde ich ihm auch ganz gern noch sagen, dass der Mensch am besten vorankommt, wenn man ihm seine Freiheit lässt – Freiheit vor allem von dem verdammten Zuhause, den verdammten Eltern und dem verdammten Leben.«
Er wurde wieder ruhiger und sprach mit einer Wärme zu Jack, die vollkommen offen und aufrichtig war und dabei merkwürdig schüchtern wirkte.
»Was ich ihm eigentlich klarmachen möchte, muss ich zum größten Teil für mich behalten. Aber niemand kann mir verwehren, ihm ein paar Worte über dich zu sagen.«
»Ich hatte nicht vor, dich in diese Sache zu verwickeln, George«, sagte Jack.
»Ich glaube, daran könntest du mich nicht einmal dann hindern, wenn ein zwingender Grund vorläge. Aber den gibt es doch natürlich nicht.«
Optimistisch und energisch wie immer, erfasste George sofort eine rettende Tatsache, über die auch ich mir schon Gedanken gemacht hatte: Calvert würde ja nur seinen Sohn ins Gerede bringen, wenn er Jack bestrafte.
»Unglücklicherweise scheint er das anders zu sehen«, sagte Jack.
»Wie meinst du das?«
Jack schilderte nun das Gespräch, das er am Vormittag mit Calvert geführt hatte. Zornig und erregt unterbrach ihn George immer wieder mit seinen scharf zustoßenden Anwaltsfragen: »Es ist ganz unwahrscheinlich, dass er so vorgehen sollte. Du musst doch selbst einsehen, dass er das einfach nicht machen kann – er kann doch diesen Brief gar nicht mit deiner Stellung in seiner Firma vermengen.«
Schließlich beschwerte sich Jack:
»Aber ich habe das doch nicht zu meinem Vergnügen erfunden, George.«
»Entschuldige«, sagte George. »Was hat der Bursche dann noch zu dir gesagt?«
Er hielt gerade noch an sich, bis Jack alles aufgezählt hatte – keine Aussicht auf ein Weiterkommen in der Firma, die Erlaubnis, unter stillschweigendem Geduldetwerden den gegenwärtigen Posten beizubehalten, Abbruch des Kurses an der Schule – um dann kräftig zu fluchen. Seine Flüche klangen, als hätte er sie gerade erst neu geprägt und als ständen ihm die Tatsachen in ihrer ganzen Brutalität unmittelbar vor Augen. Bei den meisten Menschen bedarf es eines festen Glaubensgrundes, soll ein Fluch mit dem nötigen Nachdruck herauskommen; anders bei George, wenn er erst einmal in Zorn geriet. Als der Ausbruch vorüber war, sagte er:
»Es ist ungeheuerlich. So ungeheuerlich, dass nicht einmal diese Bosse sich das leisten können. Ich weigere mich einfach zu glauben, dass sie sich einen Spaß daraus machen dürfen, sich ungerecht und auch noch blöd aufzuführen – und das auf deine Kosten.«
»So jemand wie ich ist für sie eben nicht so wichtig«, meinte Jack.
»Aber das wird sich bald ändern. Herrgott im Himmel, in zehn Jahren wirst du ihnen beigebracht haben, dass sie besseren Leuten den Platz weggenommen haben.«
Für eine Weile war es still zwischen uns; George sah Jack an. Schließlich überwand er sich und fragte: »Du hast wahrscheinlich irgendwelche Verwandten, die dir jetzt unter die Arme greifen können? Solltest du etwa nicht an sie herantreten wollen, so frage ich mich …«
»George«, fiel Jack ein, »wenn es um Hilfe im Augenblick geht, so habe ich keine Menschenseele, an die ich mich wenden könnte.«
»Ist das so«, sagte George, »dann möchte ich wissen, ob du wohl etwas dagegen hättest, wenn ich einmal die Sache in die Hand nehme? Ich weiß, ich bin natürlich nicht der richtige Mann in dieser Lage«, fuhr er rasch fort, »ich habe ja keine Verbindungen. Und Arthur Morcom und Lewis hier sagen immer, ich wäre nicht gerade sehr geschickt im Umgang mit diesen Leuten. Nach meiner Meinung übertreiben sie da wohl ein bisschen – und ich würde, wo es die Sache wert ist, jedenfalls versuchen, diesen Fehler zu vermeiden. Aber wenn du irgendjemand anderen finden kannst, der das besser versteht, dann darfst du ruhig mich übergehen und es dem anderen in die Hand geben.«
Jack ging diese verlegen und stockend vorgebrachte Rede zu Herzen, und am Ende sah er bedrückt aus, fast als schäme er sich.
»Ich wollte mir ja nur einen Rat holen, George«, sagte er.
»Es könnte schon sein, dass ich gar nichts ausrichte«, sagte George. »Ich will auch nicht behaupten, dass es leicht sein wird. Aber wenn du nichts dagegen hast, dass ich die Sache in die Hand nehme …«
»Aber nur, wenn es dir nicht zu viel Mühe macht.«
»Wenn ich’s in die Hand nehme«, sagte George nun wieder mit lauter, unbekümmerter Stimme, »dann mach ich’s nach meiner Façon. Alles klar?«
»Ich danke dir, George.«
»Ausgezeichnet«, sagte George, »ausgezeichnet.«
Er schenkte uns noch einmal ein, trank selbst sein Glas aus, machte sich’s wieder in seinem Sessel bequem und sagte:
»Ich freue mich sehr, dass ihr beide heute Abend zu mir gekommen seid.«
»Das war Lewis’ Einfall«, sagte Jack.
»Du hast doch nur darauf gewartet, dass ich’s vorschlage«, sagte ich.
»Nein, nein«, erklärte Jack. »Ich sagte doch schon, für mich selbst fällt mir nie was Gescheites ein. Das ist vielleicht überhaupt mein wunder Punkt. Ich habe kein Ziel. Ihr anderen schafft euch irgendwie alle ein Ziel, und wenn ihr es selbst nicht fertigbringt, dann sorgt schon George dafür. So war es doch auch bei dir, Lewis, mit deinen Prüfungen. Aber ich als Einziger«, er kam jetzt wieder auf sich selbst zu sprechen, und zwar mit einer entwaffnenden Selbstironie, »ich als Einziger, ich stehe im Regen und warte.«
»Darüber müssen wir wohl auch noch einmal sprechen.« George sah Jack schmunzelnd an, dann stieg wieder ein Lachen in ihm auf, weil ihm eine Erinnerung kam. »Ja, ich war noch ein Jahr jünger, als du jetzt bist, und ich hatte auch kein Ziel«, sagte er. »Damals war ich gerade als Lehrling bei meiner ersten Firma eingetreten, in Wickham war das. Und eines Tages ließ sich der Juniorpartner einfallen, mich wegen meiner Lebensweise anzufahren. Er betonte immer wieder: ›Wenn Sie je ein Anwalt werden wollen, dann müssen Sie sich erst einmal entsprechend benehmen.‹ Ich war als junger Mann stets bereit, vernünftige Ratschläge von erfahrenen Leuten anzunehmen, und freute mich, dass er mir ein Ziel gewiesen hatte, das ich anstreben konnte. Freilich war mir nicht so recht klar, wie sich ein Anwalt nun eigentlich benehmen müsse. Jedenfalls hörte ich auf, im Wirtshaus Billard zu spielen, und stellte auch meine Besuche in Ipswich ein, wo ich mich an den Samstagabenden zu amüsieren pflegte. Ich zog meinen besten dunklen Anzug an, kaufte mir einen Bowler-Hut und eine Aktentasche. Da liegt sie«, George deutete auf den Kamin. Vor unterdrücktem Lachen stiegen ihm die Tränen in die Augen; er wischte sie weg und fuhr fort: »Zu meinem Pech ärgerten diese Manöver offenbar nun wieder den Seniorpartner, ohne dass ich freilich gleich etwas davon merkte. Vierzehn Tage lang hielt er an sich, dann ging er eines Tages hinter mir zum Büro. Ich hängte gerade meinen Hut auf, als er loslegte: ›Ich weiß nicht, was Sie da für Späße treiben‹, sagte er. ›Warten Sie doch erst einmal ab, ob Sie es überhaupt zum Anwalt bringen – dann haben Sie noch genug Zeit, sich auch so aufzuführen.‹«
George brüllte vor Lachen. Es war Mitternacht, und bald danach brachen wir auf. Als wir in der Tür standen, sagte George zu Jack, der schon auf die dunkle Straße hinaustrat:
»Morgen Abend sehen wir uns wieder. Bis dahin habe ich über deine Angelegenheiten nachgedacht.«
II
GESPRÄCH AM ABEND
Am nächsten Abend hielt George seine Vorlesung in der Schule. Ich war unter seinen Hörern, und wir gingen zusammen aus dem Saal. Jack wartete auf dem Korridor.
»Wir treffen uns jetzt anschließend mit Olive«, sagte George freundlich und kam gleich zur Sache. »Ich habe ihr gesagt, sie soll uns aus dem Hause Calvert berichten.«
Jacks Gesicht hellte sich auf; er schien sich unbehaglicher zu fühlen als am Vorabend.
Wir gingen in ein Café, das die ganze Nacht geöffnet hatte, hauptsächlich für Lastwagenfahrer auf der Tour zwischen London und dem Norden. Es war von schirmlosen Gaslampen erleuchtet und roch nach Gas, Paraffin und heißem Tee. Das Fenster war vom Dampf beschlagen, und wir konnten Olive von draußen nicht sehen. Aber sie war schon da und saß mit Rachel in der Ecke hinter einem mit Linoleum belegten Tisch.
»Es tut mir leid, dass man dir das Leben schwer macht, Jack«, sagte Olive.
»Ich werde mich schon daran gewöhnen«, erwiderte Jack mit dem mutwilligen, glutvollen Lächeln, das er unwillkürlich aufsetzte, wenn er mit hübschen Frauen sprach.
»Das hoffe ich auch«, sagte Olive.
»Komm zur Sache«, sagte George, »und lass deinen Familienbericht hören.« Er wandte sich an Jack: »Ich möchte dir keine falschen Hoffnungen machen. Ich sehe nur einen einzigen Weg, wie ich dir helfen kann. Und ob der zum Ziel führt, hängt davon ab, ob die Calverts sich schon festgelegt haben.«
Wir saßen eng nebeneinander rund um den Tisch. George am unteren Ende ließ es sich bei aller Konzentration auf den Konflikt gut schmecken, er kaute an einem dicken Sandwich, aus dem eine Scheibe Schinken hing, und rührte mit einem Bleilöffel in einer großen Teetasse, ohne sein Gespräch mit Jack außer Acht zu lassen.
»Nun also«, fragte er Olive, »wie stellt sich dein Onkel zu der Sache?«
Wir sahen sie an; sie lächelte. Ihr leuchtendgrünes Kleid bildete einen scharfen Kontrast zu der Wand, von der die Farbe abblätterte. Ein Außenstehender hätte schon aus ihrer Kleidung schließen können, dass sie als Einzige von uns aus einem soliden, gutbürgerlichen Elternhaus kam. Solid allerdings nur in finanzieller Hinsicht, denn es war allgemein bekannt, dass Olives Vater mit seinem Bruder, Jacks Chef, schlecht stand, und Olive selbst hatte sich halb und halb von ihrer Familie losgelöst.
Sie hatte den Hut abgenommen, und ihr blondes Haar hob sich hell gegen das grüne Kleid ab. Als ich sie so lächeln sah bei Georges Frage, hatte ich einen Augenblick lang die Empfindung, als strahle ihr offenes, hübsches Gesicht Zuversicht aus.
»Wie nehmen sie es auf?«, fragte George.
»Es ist schon herum«, sagte sie. »Das wundert mich nicht. Vater hat es heute Vormittag von einer meiner Tanten erfahren. Inzwischen haben sie alle Onkel Frank schon kräftig bearbeitet.«
»Und was macht er?«, fragte George.
»Er ist unschlüssig«, sagte Olive. »Er weiß nicht, was er als Nächstes tun soll. Die ganze Zeit sagt er, es sei schade, dass die Ferien noch eine Woche dauern – sonst wäre es das Beste, den Jungen sofort in die Schule zurückzuschicken.«
»Himmelherrgott«, sagte George. »Das ist allerdings eine überaus scharfsinnige Feststellung.«
»Jedenfalls«, fuhr Olive fort, »hat die Familie ihn anscheinend fertiggemacht. Er hat sich gerade, bevor ich zu euch ging, zu einer Art Entschluss durchgerungen. Er will an Roys Housemaster telegrafieren und ihn fragen, ob er sich um den Jungen kümmern kann …«
»Ist das Telegramm schon fort?«, unterbrach sie George.
»Das muss inzwischen fort sein«, erwiderte Olive.
»Siehst du denn gar nicht, wie wichtig das ist?«, rief George; er wurde ungeduldig, weil da jemand einen taktisch wichtigen Punkt übersah.
Olive ging gar nicht darauf ein und fuhr fort:
»Zu etwas anderem konnte er sich nicht aufraffen. Die Familie hat es nicht erreicht, dass er strenger vorging. Er versuchte die Sache so darzustellen, als ob Roy nur ein bisschen überarbeitet sei und Luftveränderung brauche. Hätte ich in dem Alter so etwas angestellt, so wäre die größte Tracht Prügel meines Lebens fällig gewesen. Aber Roys Vater könnte ja noch nicht einmal mit einer Tochter fertig werden, geschweige denn mit einem Sohn.«
George war in Gedanken mit Olives Neuigkeiten beschäftigt, ließ diese letzte Bemerkung aber doch nicht hingehen.
»Du weißt, dass du bei uns nicht durchkommst, wenn du so tust, als glaubtest du an diesen sadistischen Blödsinn.«
»Ich habe aber auch nie vorgegeben, an alle deine schönen Träume zu glauben, oder willst du das behaupten?«, sagte sie.
»Du kannst doch nicht zu diesen Deppen halten – gegen mich«, sagte George.
Er hatte die Stimme erhoben. Wir waren daran gewöhnt, dass er seltsame Wörter aus seiner Heimat verwendete, wenn er in Zorn geriet. Olive stieg das Blut zu Kopf, bis auf ein nervöses Zucken ihrer vollen Lippen blieb ihr Gesicht unbewegt. Doch trotz ihres hitzigen Temperaments stritten die beiden nie lange miteinander; sie verstand ihn ganz instinktiv besser als irgendeiner von uns damals. Und George ging mit ihr viel unbefangener um als mit Rachel, die jedes seiner Worte im Herzen verwahrte und eben jetzt sagte:
»Ich denke wie du, oh, ich denke wie du, George. Wir müssen den Menschen helfen, sich selbst zu verwirklichen …«
Sie war die Älteste in diesem Kreise, ein Jahr oder auch mehrere älter als George, während Olive so alt wie ich und Jack war. Es konnte einen aus der Fassung bringen, wenn man sah, wie Rachels Augen bei solchen schwärmerischen Ergüssen scharf und hell aus dem vollen Mondgesicht herausfunkelten.
»Heute Abend ist jedenfalls nicht der rechte Zeitpunkt«, sagte George zu Olive, »ein Thema wieder aufzunehmen, das ich ja längst mit dir erledigt habe. Wir haben Wichtigeres zu tun, und das sähest du auch selbst, wenn du dir über das klar wärest, was du uns da berichtet hast.«
»Was meinst du damit?«
»Du hast uns eine Chance gezeigt«, sagte George. »Verstehst du denn nicht – dein Depp von einem Onkel hat zweierlei gemacht. Einmal hat er Jack büßen lassen, was er nach Lage der Dinge ungestraft tun kann. Zum anderen hat er aber seines Sohnes wegen auch den Housemaster benachrichtigt. Der Umstand, dass diese beiden Schritte zusammenfallen, könnte sich ungünstig für ihn auswirken.«
»Er lässt seinen Zorn an Jack aus«, sagte sie. »Aber wie soll ihm das jemand verwehren?«
»Das ist gar nicht so unmöglich«, sagte George. »Es hat natürlich keinen Sinn, Calvert überzeugen zu wollen; niemand von uns stellt so viel dar, dass er sich direkt bei ihm beschweren könnte. Aber vergesst nicht, dass er unter anderem auch vorhat, Jack das Schulgeld zu streichen.«
George erinnerte uns daran, dass diese Maßnahme routinemäßig vor den Ausschuss kommen musste, der die Angelegenheiten der Studenten an der Schule regelte – ein Ausschuss, in dem auch Calvert saß, und zwar als Begründer des Stipendiensystems. Dieses System sah vor, dass Unternehmer intelligente junge Leute auswählten – wie Calvert etwa Jack – und ihnen die Studiengebühren zur Hälfte bezahlten. Den Rest erließ die Schule dann.
»Ein Glück, dass er in dem verdammten Ausschuss sitzt«, sagte George. »Wir brauchen ihm nur zu Gemüte zu führen, wie sich dieses Zusammentreffen für uns darstellt. Er kann es sich nicht leisten, Jack vor aller Öffentlichkeit zum Sündenbock zu machen. Und die anderen Ausschussmitglieder würden nur höchst ungern ihre Hand dazu reichen.«
»Würden sie sich wirklich alle so sehr an einer Ungerechtigkeit stoßen?«, fragte Rachel.
»Sie würden sich daran stoßen, dass jemand sie für ungerecht halten könnte«, sagte George, »man muss ihnen das nur klarmachen. Jede Gruppe verhält sich so.«
»Man kann es ihnen aber nicht klarmachen«, sagte Jack.
»Doch«, erwiderte George. »Martineau, der Domherr, ist nämlich zufällig auch in dem Ausschuss. Allerdings ist er kein so frommer Mann wie sein Bruder«, hier brach George in ein Lachen aus, »aber ich kann dafür sorgen, dass er die Wahrheit erfährt. Unser Martineau wird sich schon Gehör bei ihm verschaffen. (›Unser Martineau‹ war der Bruder des Domherrn und Teilhaber der Firma Eden & Martineau, in der George beschäftigt war.) Und außerdem …«
»Was außerdem?«, fragte Olive.
»Ich bin vollauf berechtigt, selbst vor dem Ausschuss zu erscheinen. Aufgrund meiner Stellung an der Schule. Es wäre freilich besser, wenn ihnen jemand anders die Wahrheit über Jack sagte, aber wenn es nötig ist, kann ich es übernehmen.«
Wir waren betroffen. Ich wechselte einen Blick mit Olive; wie ich selbst, so fühlte auch sie sich jetzt an der Auseinandersetzung beteiligt; die Erregung hatte uns gepackt, und uns lag daran, dass die Sache ein gutes Ende nehme. Gleichzeitig wusste ich aber, dass sie große Angst um George hatte.
Einen Augenblick herrschte Schweigen.
»Mir gefällt das nicht«, platzte Olive heraus. »Vielleicht könntest du wirklich etwas für Jack herausschlagen. Es klingt überzeugend – aber gegen deine Beweisführung bin ich ja noch nie aufgekommen.«
»Und du bist immer zu optimistisch«, sagte ich. »Ich glaube nicht, dass der Domherr sich unbeliebt macht wegen eines jungen Mannes, den er noch nie in seinem Leben gesehen hat. Selbst wenn du den anderen Martineau auf deine Seite bringst, was ich auch für unwahrscheinlich halte.«
»Da bin ich nicht so sicher«, meinte George. »Aber wie das auch gehen mag, das braucht uns ja gar nicht zu stören. Die Hauptsache bleibt, dass ich selbst vor dem Ausschuss erscheinen kann.«
»Und wie wird das für dich ausgehen?«, rief Olive.
»Bist du sicher, dass das nicht auf dich selbst zurückfällt?«, fragte Jack. Er kehrte Olive den Rücken; dass sie ihn zwang, gegen seine eigenen Interessen zu sprechen, ärgerte ihn.
»Ich sehe nicht, wie mir etwas passieren sollte«, sagte George. Er zog aus seiner Brusttasche einen Bogen Briefpapier und legte ihn vor sich auf den Tisch.
Olive beobachtete ihn sorgenvoll.
»Schau«, sagte sie, »du solltest nun wirklich bald aufhören, immer nur für deine Protegés zu sorgen. Wir sind nicht so wichtig, dass du deine ganze Zeit auf uns verschwenden darfst. Du musst dich jetzt endlich um dich selbst kümmern. Das heißt, du musst Eden & Martineau so weit bringen, dass sie dich zum Partner machen. Und eben das werden sie nicht tun, wenn du dich absichtlich bei wichtigen Leuten in schlechtes Licht setzt. Siehst du denn gar nicht«, sie wurde plötzlich heftig, »dass du dich vielleicht bald schwarzärgern wirst, weil du dich damit begnügt hast, immer nur für uns zu sorgen?«
George hatte angefangen, etwas auf den Bogen zu schreiben. Er blickte auf und sagte:
»Ich bin äußerst zufrieden mit meinem jetzigen Zustand. Versteh doch bitte, dass ich meine Zeit lieber mit Menschen verbringe, die ich schätze, als mit irgendwelchen Bossen hier am Ort im Teetässchen zu rühren.«
»Bloß weil du zu schüchtern bist«, sagte Olive. »Warum? Du gehst nicht einmal mehr zu den Freitagabendgesellschaften bei Martineau.«
»Diesen Freitag habe ich vor hinzugehen.« George hatte einen roten Kopf bekommen. Zum ersten Mal an diesem Abend verlor er die Fassung. »Und übrigens – wenn ich je wünschen sollte, Partner zu werden, so wird es, glaube ich, keine so riesigen Schwierigkeiten geben. In jedem Falle kann ich stets mit Martineaus voller Unterstützung rechnen.« Er wandte sich wieder seinem Briefbogen zu.
»Das stimmt wirklich, ich habe Martineau über George sprechen hören«, sagte Jack.
»Du bist hier Partei«, sagte Olive. »George, ist das ein Brief an den Ausschuss?«
»Noch nichts Endgültiges. Ich teile nur dem Direktor mit, dass ich möglicherweise in einer dienstlichen Angelegenheit an den Ausschuss herantreten werde.«
»Mir gefällt das trotzdem nicht. Du …«
In diesem Augenblick betrat Arthur Morcom das Café und ging auf Olive zu. Er hatte sich vor kurzem als Zahnarzt in der Stadt niedergelassen und kannte unsere Gruppe nur über seine Freundschaft mit Olive. Ich wusste, dass er in sie verliebt war. Diesen Abend war er gekommen, um sie heimzubegleiten; als er sie ansah, spürte er sofort, dass die Stimmung gespannt und erregt war.
Olive fragte George: »Hast du etwas dagegen, wenn wir’s Arthur sagen?«
»Ich für meine Person nicht«, erwiderte George ein wenig unbeholfen.
Die Geschichte von Roys Geschenk kannte Morcom bereits. Ich legte Wert darauf, ihm Georges Plan darzulegen, und tat das auch in groben Zügen. Morcoms scharfe blaue Augen funkelten vor Interesse, und er trieb mich mit »Ja! Ja!« voran, bis ich unsere Erörterungen in der vergangenen Stunde wiedergegeben hatte. Ich beobachtete sein mageres, feingeschnittenes Gesicht, dessen Lächeln durch eine zusätzliche Lachfalte weit außen auf jeder Wange so überaus aufrichtig und sympathisch wirkte. Als ich geendet hatte, sagte er:
»Es tut mir sehr leid, George. Aber ich finde, dass Olive recht hat.«
Er wandte sich zu Jack und entschuldigte sich, dass er auf der Gegenseite stehe. Jack lächelte. Als Olive versucht hatte, George zu überzeugen, war Jack gekränkt und ärgerlich gewesen. Jetzt, wo Morcom nichts anderes tat, sagte Jack ganz spontan:
»Ich nehme Ihnen das nicht übel, Arthur. Höchstwahrscheinlich haben Sie recht.«
Morcom nahm die beiden Argumente auf, die Olive und ich schon vorgebracht hatten: Würde George mit seiner Intervention Jack wirklich helfen, und, was noch viel bedenklicher schien, war es nicht ein unbesonnenes, ja, gefährliches Unternehmen für George selbst? Morcom brachte das mit mehr Nachdruck vor als wir. Er war mit George nicht eng befreundet, keiner von beiden fühlte sich ganz unbefangen dem anderen gegenüber. Aber Morcom war ebenso alt wie George, und George hatte vor seiner Tüchtigkeit und Einsicht Respekt. So hörte er ihn an, nicht ohne gelegentlich aufzubrausen und sich mit seinen ausgeklügelten Vernunftgründen zu verteidigen.
Schließlich sagte Morcom:
»Ich weiß, Sie haben es satt, dass Ihre Freunde unterdrückt werden. Aber Sie werden nichts dagegen machen können, bis Sie nicht selbst ganz festen Boden unter den Füßen haben. Ist es die Sache nicht wert, sich so lange zu gedulden?«
»Nein«, sagte George. »Dieses Abwarten habe ich schon zu oft mitgemacht. Wenn man so lange wartet, vergisst man entweder, dass überhaupt jemand unterdrückt wird, oder man stellt sich auf den Standpunkt, dass er es verdient hat.«
Morcom war nicht nur viel weltläufiger als George, er traf auch meist die klügeren Entscheidungen. Später aber erkannte ich in Georges Äußerung ein Beispiel dafür, dass sich auch die Weltfremden einmal als die Klügeren erweisen konnten.
»Ich glaube allmählich«, sagte Morcom, »dass Sie mit Wonne die Gelegenheit ergreifen, die Bosse zu attackieren, George.«
»Im Gegenteil«, erwiderte George, »ich bin ausgesprochen ängstlich.«
Wir brachen alle in Gelächter aus, aber Olive, die ihn beobachtete, stimmte nicht ein. Kurz darauf sagte sie:
»Er hat seinen Entschluss gefasst.«
»Hat es Sinn, dass ich noch etwas sage?«, fragte Morcom.
»Also«, sagte George mit einem schüchternen Lächeln, »ich glaube immer noch, dass wir diese Leute in eine unmögliche Lage bringen können …«
III
BLICK ÜBER DIE GARTEN
An einem Mittwoch hatten wir uns im Café getroffen, zwei Tage später, am Freitag, rief Olive mich im Büro an.
»Roy hat etwas herausbekommen, durch seinen Vater. George müsste das sofort erfahren, aber ich kann ihn nicht erreichen. Heute ist sein Melton-Tag, nicht wahr?« Die Firma Eden & Martineau hatte Filialen in mehreren Kreisstädten, und George verbrachte regelmäßig einen Tag in der Woche auswärts. »Er muss es wissen, ehe er heute Abend zu Martineau geht …«
Ihre Stimme klang bei aller Sachlichkeit besorgt; sie wollte, dass jemand mit Roy zusammenkomme, um zu untersuchen, was an seinen Neuigkeiten war. Normalerweise wäre Jack der Mann dafür gewesen, aber mit ihm durfte Roy sich ja nicht treffen. So bat sie mich, sobald ich frei wäre, Morcom aufzusuchen, sie werde mit Roy auch dort sein.
Ich ging am späten Nachmittag zu Morcom. Der Weg führte mich aus der Stadtmitte plötzlich zwischen Buchsbaumhecken und fünfstöckige viktorianische Giebelhäuser, deren rote Ziegel im Widerschein der Abendsonne eine grotesk-gemütliche Gotik zur Schau stellten. Doch der Eindruck der Behaglichkeit verschwand, wenn man die dunklen Fenster sah: Früher, als sich die Stadt noch nicht so ausgebreitet hatte, waren das wirklich Wohnhäuser gewesen, aber jetzt gab es hier nur Büros, die am Abend verlassen dalagen. Nur Martineaus Haus am Ende der Promenade hatte sich als stattliches Privathaus erhalten. Das Nachbarhaus, das ihm ebenfalls gehörte, war in Wohnungen aufgeteilt worden, und dort wohnte Morcom im obersten Stockwerk.
Als ich in sein Wohnzimmer trat, waren Olive und Roy eben angekommen. Olive hatte Morcom einen großen Strauß tiefroter Dahlien mitgebracht und ordnete sie gerade auf einem Tisch am Fenster in einer Vase. Das Rot loderte vor dem Hintergrund des Parks, in den die Promenade überging.
Olive stellte eine Blüte gefälliger, trat dann von der Vase zurück und fragte Morcom: »Ist’s so schön?«
Morcom lächelte ihr zu. Und er, der Verschlossene und Zurückhaltende, konnte nicht verhindern, dass ihn dieses Lächeln verriet – viel gründlicher verriet, als ein Lächeln Jacks das je tun würde.
Wie aus einer anderen Welt zurückkehrend wandte Morcom sich zu Roy, der still dabeigestanden und das Zwischenspiel mit den Blumen beobachtet hatte. Morcom zog ihn sofort in ein Gespräch.
Sein Glück mit Olive machte Morcom nur noch behutsamer und rücksichtsvoller. Sie sprachen über Bücher und über Roys Zukunft; er war in der Schule gerade im Begriff, sich zu spezialisieren. Die beiden verstanden sich gut, doch es zeigte sich, dass Morcom gar nicht so behutsam hätte vorzugehen brauchen, denn Roy überraschte uns beide durch seine Beherrschung und kam von selbst auf den eigentlichen Gegenstand.
»Es tut mir leid, dass ich Ihnen allen solche Schwierigkeiten mache, Mr. Morcom«, sagte er. »Aber ich dachte, jemand müsse wissen, was man mit Mr. Passant vorhat.«
Er sprach höflich, formell, mit heller melodischer Stimme; so höflich, dass bisweilen ein wenig Schalkhaftigkeit durchblitzte. Sein Gesicht war gut geschnitten, nervös und sehr traurig für ein Jungengesicht; doch diese Trauer lag, wie mir schien, von Natur darin und kam nicht nur von seinem gegenwärtigen Kummer. Ein- oder zweimal glitt ein frohes, liebenswertes Lächeln über seine Züge.
»Ich habe es Olive schon erzählt – gestern Abend bekam mein Vater unerwartet Besuch. Ich habe Mutter heute Vormittag dazu gebracht, mir zu sagen, was los war. Der Direktor war da – von der ›Schule‹, wie Jack immer sagte. Er war gekommen, um Vater zu sagen, dass ein Mr. Passant möglicherweise versuchen werde, Geschichten zu machen. Mutter hat natürlich nichts weiter gesagt, aber ich habe mir gedacht, dass es sich um Jack handelt. Und alles hing mit einem Ausschuss zusammen. Das habe ich zunächst nicht verstanden, aber Olive hat es mir heute Nachmittag auseinandergesetzt.«
»Ich habe ihm sagen müssen, wozu sich George am Mittwoch entschlossen hat«, erklärte Olive.
»Ich plaudere nichts aus«, versicherte Roy. »Ich hätte auch Olive nicht gesagt, was ich heute Vormittag herausbekommen habe, wenn ich nicht an allen diesen Geschichten schuld wäre.«
Ich versuchte ihm das auszureden, aber er schüttelte den Kopf.
»Es ist mein Fehler«, sagte er. »Wenn ich nicht wäre, hätten die sich gestern Abend nicht über Mr. Passant unterhalten.«
»Weißt du irgendetwas über das Gespräch?«, fragte ich ihn.
»Ich glaube, der Direktor hat vorgeschlagen, er wolle das selbst mit Mr. Passant aushandeln. Er war überzeugt, dass er ihn von weiteren Schritten zurückhalten könne.«
»Wie?«
»Indem er Mr. Eden und Mr. Martineau einen Wink gibt«, sagte Roy.
Ich sah Morcom an: Wir waren beide erschrocken.
»Meinst du, dass er das wirklich tut?«
»Mutter rechnete damit, dass der Direktor heute Vormittag hinginge. Sie müssen wissen«, erklärte Roy, »die ärgern sich anscheinend über Mr. Passant noch mehr als über Jack.«
Er sah, dass wir alle besorgte Gesichter machten.
»Ist das sehr schlimm?«, fragte er.
»Nicht besonders, es kann nur ein bisschen unangenehm werden«, sagte Morcom leichthin, um Roy zu beruhigen. Doch der ließ keinen Blick von uns und sagte:
»Darf ich noch etwas anderes fragen, Mr. Morcom?«
»Aber selbstverständlich.«
»Glauben Sie, dass Jacks Karriere nun endgültig ruiniert ist?«
»Die wird von dieser Geschichte überhaupt nicht berührt«, sagte ich schnell, und Morcom stimmte zu.
»Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Roy«, sagte Olive.
Roys Zweifel begannen zu schwinden; Olives Stimme klang freundlich, sie mochte ihn doch besser leiden, als sie am Mittwochabend hatte zugeben wollen. Aber er war immer noch unruhig, bis sie hinzufügte:
»Wenn du es wissen willst – wir haben uns gerade Gedanken gemacht, ob sie George Passant schaden können.«
Roys Angst ließ nach. Eine kleine Weile war er nicht mehr der frühreife Junge; er neckte Olive, als ob auch wir drei keine Sorgen mehr hätten.
»Du hast Mr. Passant wohl gern, Olive?«, fragte er mit seinem warmen Lächeln.
»In gewisser Weise ja«, erwiderte sie.
»Bist du verliebt in ihn?«
»Absolut nicht«, antwortete sie, um nach einer Pause mit großem Nachdruck hinzuzusetzen: »Aber das eine kann ich dir sagen: Er ist zwanzigmal mehr wert als Jack Cotery.«
Kurze Zeit danach brachen sie auf. Beim Gehen gab Roy uns beiden die Hand, und während Morcom noch mit Olive sprach, sagte er leise zu mir:
»Morgen werde ich abgeschoben. Wahrscheinlich sehe ich Sie nicht so bald wieder, Mr. Eliot. Ob Sie wohl die Zeit finden, mir zu schreiben, wie die Sache ausgegangen ist?«
Vom Fenster aus sahen Morcom und ich die beiden durch den Park gehen.
»Ich möchte wissen, wie es ihm im Leben ergehen wird«, sagte Morcom. Aber seine Gedanken – hoffnungsvolle Gedanken damals – galten Olive und seinem eigenen Schicksal.
Wir blieben am Fenster stehen, aßen Brot und Käse aus Morcoms Speisekammer und behielten die Straße im Auge. Wir mussten George warnen, ehe er das Nachbarhaus betrat und Martineau besuchte.
IV
EINE TASSE KAFFEE WIRD VERSCHÜTTET
Der Laternenanzünder kam die Straße herauf; unter der Lampe neben Martineaus Gartentor trat die Heckenkrone plötzlich hell aus dem Dunkel. Morcom schaute ruhig auf den Park hinaus, ohne das Gespräch fortzusetzen.
Während ich darüber nachdachte, wie sympathisch er mir war, wurde mir im gleichen Augenblick bewusst, dass er es dennoch niemals zustande gebracht hätte, unser aller Leben so auszufüllen und aufzuhellen, wie wir es George verdankten. Wo stünden wir alle, wenn George nicht zu Eden & Martineau gekommen wäre?
Wo stünden wir? Wir waren arm und jung. Nach unserem Herkommen waren wir Krethi und Plethi, Kleinbürger, die später in Büros und Läden landen würden. Wir wohnten in möblierten Zimmern – wie ich zum Beispiel seit dem Tod meiner Mutter – oder zu Haus bei unseren Familien, verstreut in den fünfzigtausend Häusern der Stadt. Die Welt schien im Aufbruch, wir wollten gerne dabei sein, aber wir fühlten uns wie Gefangene.
Ich selbst hätte, wäre George nicht gewesen, noch immer mit zwei Pfund die Woche als Angestellter in der Schulverwaltung gesessen und darüber nachgedacht, was ich mit den dreihundert Pfund anfangen solle, die ich von einer Tante geerbt hatte. Vielleicht hätte ich schließlich etwas unternommen, aber mit neunzehn hat man noch keine klaren Vorstellungen. George jedoch ließ mir keine Ruhe, er tyrannisierte und bearbeitete mich, bis ich endlich anfing zu studieren und auf die juristischen Examina hinzuarbeiten. Einen Monat vor dem Zwischenfall mit Jack hatte ich endlich aufgehört, die Entscheidung hinauszuschieben, und wollte nun Ende September aus dem Büro ausscheiden.
Genauso stand es mit den anderen in Georges Gruppe – ausgenommen Jack, den Pechvogel. George hatte uns in Bewegung gebracht, hatte uns Geld geliehen; es schien, als bereite es ihm nicht das geringste Kopfzerbrechen, wenn er von dem, was er selbst verdiente – zweihundertfünfzig Pfund bei der Firma und zusätzlich dreißig Pfund an der Schule –, die Mittel vorstreckte. Für uns war es das erste Mal, dass wir einem großherzigen Menschen nahekamen.
Wir begeisterten uns an den Büchern, die er uns lesen hieß, und für die Ansichten, die er leidenschaftlich, durchschlagend und unerschütterlich verfocht. Wir wurden mitgerissen von seinem Glauben an den Menschen und an uns selbst. Und wir machten uns zwangsläufig auch unsere Gedanken über George selbst. Olive wusste sicherlich sehr bald, und Jack und ich erkannten wenig später, dass George kein einfacher Charakter war, kein Mensch aus einem Guss. Trotzdem fühlten wir – und darin hätte nichts uns je erschüttern können –, dass er ein Mann war, in dem ein warmes, verständnisvolles, lebendiges Herz schlug; es ging hier nicht um gut oder schlecht, sondern einfach um das Herz; er war ein Mensch aus Fleisch und Blut.
Darüber dachte ich nach, als ich ihn endlich im Laternenschein auftauchen sah, pfeifend, den Stock schwingend, den steifen Hut (den er gewissenhaft trug, wenn er dienstlich unterwegs war) auf den Hinterkopf geschoben.
Ich rief hinunter. George traf uns auf der Treppe, binnen kurzem hatten wir die Neuigkeit berichtet. George fluchte.
Wir gingen miteinander zurück in Morcoms Wohnung, damit er überlegen könne. Minutenlang saß er schweigend in angestrengtem Nachdenken. Dann erklärte er in seinem erstaunlichen, streitbaren Optimismus:
»Ich nehme an, dass Martineau mich noch dabehalten wird, wenn der gesellschaftliche Humbug erledigt ist. Das wird eine großartige Gelegenheit sein, ihm die volle Wahrheit vorzutragen. Wahrscheinlich haben sie uns damit den bestmöglichen Weg eröffnet, um den Domherrn für die Sache zu erwärmen.«
Doch als wir Martineaus Empfangszimmer betraten, war George nervös. Vielleicht nicht mehr als sonst auch, wenn er gezwungen war, den »gesellschaftlichen Humbug« mitzumachen, sogar in der milden Form der Freitagabendempfänge bei Martineau. Er setzte sich dem diesmal auch nur aus, weil Olive ihn herausgefordert hatte, während wir anderen regelmäßig hingingen, uns gut unterhielten und Martineaus traditionelle Einladungsformel zu schätzen wussten – »kommen Sie doch zu einer Tasse Kaffee, oder was es sonst noch gibt, vorbei« –, obwohl wir nach ein paar Besuchen Bescheid wussten, dass es beim Kaffee ohne alles blieb.
»Wie schön, dass Sie alle kommen«, rief Martineau. »Heute Abend sind wir nicht viele.«
Es waren wirklich nur wenige Menschen im Zimmer; er wusste nie, wie viele Besucher zu erwarten waren, und auf dem Tisch am Kamin stand ein ganzes Regiment leerer Tassen und Untertassen aufgereiht, während vor dem Feuer zwei Kannen mit großen Henkeln mehr Kaffee und Milch warmhielten, als wir den Abend über brauchen würden.
Morcom und ich setzten uns. George ging unbeholfen auf die Tassen und Untertassen zu; er hatte das Gefühl irgendetwas tun zu sollen, irgendein geheimnisvolles Zeremoniell beachten zu müssen, das ihm nie beigebracht worden war. Er stand neben dem Tisch und verlegte sein Gewicht bald auf den rechten, bald auf den linken Fuß; seine Wangen waren gerötet.
Da sagte Martineau:
»Sie sind lange nicht dagewesen, George, nicht wahr? Eigentlich hab ich’s doch nicht verdient, dass ich meine Freunde nur im Büro zu sehen bekomme, was meinen Sie? Sie wissen doch, wie gern ich Sie hier habe.«
George lächelte. In Martineaus Gesellschaft konnte er sich nicht lange unbehaglich fühlen. Auch nicht, als Martineau fortfuhr: »Da ich gerade von meinen Freunden im Büro spreche: Ich glaube, dass Harry Eden heute Abend einmal hereinschauen wird.«
Georges Gesicht blieb nur so lange umwölkt, bis Martineau ihn in seiner liebenswürdigen Art versorgte. Die Bemerkung über Eden hatte ihm unsere Warnung wieder zu Bewusstsein gebracht, mehr noch: Sie hatte ihn an einen Menschen erinnert, mit dem er nicht gut stand; aber George reagierte auch prompt, wenn er bei seinem Gegenüber Sympathie spürte. So konnte er, während Martineau sprach, alle unangenehmen Gedanken beiseite schieben und sich in der Gesellschaft eines Menschen, den er mochte, nur einfach wohlfühlen.
Wir alle hörten Martineau gern zu. Sein Geplauder war heiter, ganz unkonventionell und voller Überraschungsmomente. Er hatte eine fast mutwillige Passion für religiöse Kontroversen und liebte es, uns an den Freitagabenden zu berichten, welcher neuen Ketzerei er nun schon wieder beschuldigt würde. Dabei machte es ihm überhaupt nichts aus, dass wir alle miteinander keine religiösen Menschen waren, und zwar nicht einmal im weitesten Sinne. Er war so impulsiv, dass er es irgendjemandem erzählen musste, wenn er wieder einmal in einer »Klemme« saß, wie er sich ausdrückte. Er schilderte also jetzt seinen neuesten Leserbrief an eine obskure theologische Zeitschrift und die gereizten Antworten darauf.
»Sie behaupten, ich sei jetzt dem Manichäismus schon ge- fährlich nahe«, verkündete er uns freudestrahlend.
George kicherte. Er ließ alle Eigenarten Martineaus gelten; und so schien es ganz in Ordnung, dass der Hausherr hier im Cutaway mit der Nelke im Knopfloch vor seinem Kamin stand und uns auseinandersetzte, wie er die Orthodoxen nächstens wieder in Verlegenheit bringen wolle. Keinem von uns kam der Gedanke, dass er schon fünfzig war und dass in diesem kritischen Alter so mancher Mann ruhelos wird. Vor zwei Jahren war seine Frau gestorben; wir merkten nicht, dass er im vergangenen Jahr seinen Überspanntheiten immer mehr nachgegeben hatte.
Mit George erwarteten wir, dass er auch in Zukunft jeden Freitagabend wie heute auf seinem Kaminteppich stehen und seine schwarze Fliege über dem Stehkragen zurechtzupfen würde. Ich überredete ihn, einen Brief vorzulesen, den ihm ein cholerischer Landpfarrer geschrieben hatte; Martineau lächelte über die Schmähungen, mit denen er darin bedacht war und die er fröhlich herausschmetterte, den Kopf auf die Seite geneigt und die lange Nase in die Luft gesteckt.
Dann neckte ihn George, weil Martineau sich Verpflichtungen aufbürdete, die nicht weniger ausgefallen waren als seine Einstellung in Glaubensdingen. Er war schon lange aus der anglikanischen Kirche ausgetreten und stritt sich darüber noch immer mit seinem Bruder, dem Domherrn, herum. Jetzt hatte er ein Amt in der Verwaltung der angesehensten Methodistengemeinde unserer Stadt. Dorthin begab er sich regelmäßig und freudig jeden Sonntag zweimal, gestand aber, lachend und nahezu stolz, dass er von vornherein beabsichtige einzuschlafen, ehe noch die Predigt begann.
»Haben Sie denn am letzten Sonntag schlafen können, Mr. Martineau?«, fragte George.
»Vormittags, ja. Aber abends war ein auswärtiger Prediger da – und der hatte irgendwas Störendes in der Stimme.«
George schüttelte sich vor Lachen; er lehnte sich in seinen Sessel zurück und ließ seinen Blick durch das Zimmer schweifen; es war ein freundlicher, hoher Raum, hell gestrichen und mit einem Farbdruck – »Die Quelle« von Ingres – an der dem Kamin gegenüberliegenden Wand. Ausnahmsweise sehnte er das Ende dieses Abends, den er in respektabler Gesellschaft verbringen musste, nicht herbei.
Und Jack, der für eine halbe Stunde hereinschaute, nahm an, dass alles gut stehe. Olive hatte ihm ihre Befürchtungen mitgeteilt, man werde George möglicherweise unter Druck setzen, doch Jack fand ihn so überraschend wohlgelaunt, dass auch seine Stimmung sich hob. Er ging früh wieder weg, und bald danach leerte sich der Raum, nur George, Morcom und ich blieben noch bei Martineau.
Dann kam Eden. Er ging quer durchs Zimmer auf den Kamin zu.
George hatte sich halb aus seinem Stuhl erhoben, als er Eden erblickte, und stand nun auf dem Sprung, die Hände auf den Sessellehnen, unschlüssig, ob er ihn anbieten solle. Doch Eden, der sich gerade bei Martineau entschuldigte, bemerkte ihn nicht.
»Es tut mir leid, dass ich so spät komme, Howard«, sagte Eden freundlich zu Martineau. »Meine Frau hat ein paar Leute eingeladen, und ich konnte nicht umhin, ein paar Runden mitzuspielen.«
Eden hatte einen kahlen Schädel, ein breites, offenes Gesicht und einen Mund, der sich leicht zu einem liebenswürdigen Lächeln bequemte. Er war ein paar Jahre älter als sein Partner, und man sah ihm seinen Beruf in jeder Hinsicht mehr an – außer in der Kleidung, denn er zog sich moderner und legerer an. An diesem Abend trug er einen bequemen grauen Straßenanzug, der locker um seinen kräftigen Körper hing. Während er mit Martineau sprach, wärmte er sich den breiten Rücken am Kaminfeuer.
George setzte einmal vergeblich an und sagte schließlich:
»Möchten Sie sich nicht setzen, Mr. Eden?«
Jetzt endlich schenkte Mr. Eden ihm Beachtung.
»Ich will Sie doch nicht aus Ihrem Sessel vertreiben, Passant«, sagte er. »Wenn ich ehrlich sein will, gehe ich gar nicht gerne hier vom Feuer weg.« Doch George war schon halb aufgestanden, und Eden fuhr fort: »Na, wenn Sie sich’s unbedingt ungemütlich machen wollen …«
Er ließ sich auf Georges Stuhl nieder. Martineau sagte:
»George, wollen Sie so freundlich sein, Harry Eden eine Tasse Kaffee zu reichen?«
Eifrig machte sich George ans Werk. Er hob die große Kanne und füllte eine Tasse. Die Tasse in der Hand, wandte er sich an Eden:
»Ist es so recht, Mr. Eden?«
»Ach, wissen Sie – ich hätte ihn doch lieber weiß, glaube ich.«
George entschuldigte sich hastig. Er wollte die Tasse auf dem Tisch abstellen, da streckte Eden in der Meinung, George wolle sie ihm reichen, die Hand aus, George konnte nicht mehr ausweichen, und der Kaffee ergoss sich über Edens Rock und den oberen Teil der Hose.
Eine Sekunde stand George wie angewurzelt. Er errötete von der Stirn bis zum Hals herunter.
Als er sich so weit gefasst hatte, dass er sich entschuldigen konnte, sagte Eden ärgerlich:
»Die Schuld lag ganz und gar bei mir.« Er rieb sich heftig mit dem Taschentuch ab. George erwachte aus seiner Betäubung und wollte helfen, aber Eden wehrte ab: »Ich werde schon damit fertig, Passant, ich werde sehr gut damit fertig.«
George kniete nieder und versuchte, die Kaffeepfütze auf dem Teppich aufzuwischen, da brachte ihn Martineau dazu, sich hinzusetzen, und gab ihm eine Zigarette.
Wenn überhaupt jemand Schuld hatte, so war es tatsächlich Eden. Aber ich wusste, dass George das nicht glauben konnte.
Martineau brachte die Unterhaltung wieder in Gang, auch Eden beteiligte sich. Nach ein paar Minuten bemerkte ich jedoch, dass die beiden sich mit einem Blick verständigten; dann sagte Martineau zu George:
»Ich habe mich gefreut, Ihren Freund Cotery heute hier zu sehen. Wie macht er sich denn eigentlich, George?«
George hatte kein Wort gesprochen, seit er Eden zu Hilfe kommen wollte. Er zögerte und sagte dann:
»Im Großen und Ganzen kommt er recht gut voran. Er hat nur eben jetzt eine Menge Ärger in seiner Firma. Aber …«
Eden sah Martineau an und sagte: »Wissen Sie, Passant, gerade über diese Angelegenheit wollte ich heute Abend ein Wort mit Howard reden. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass Sie hier wären, aber vielleicht kann ich es jetzt doch anschneiden. Schließlich sind wir alle Freunde, wie wir hier beisammensitzen, nicht wahr? Die Sache ist nämlich die – Howard und mir ist zu Ohren gekommen, Sie hätten die Absicht, diesem jungen Mann durch gewisse Schwierigkeiten hindurchzuhelfen.«
Eden bemühte sich, das alles freundlich und beiläufig vorzubringen; es war immerhin ein Risiko, in Morcoms und meiner Gegenwart über die Sache zu sprechen, denn wir waren ursprünglich als Freunde Georges zu den Freitagabenden eingeladen worden. Doch aus Georges Antwort klang unüberhörbarer Argwohn, und mir war klar, dass der verschüttete Kaffee daran schuld war, wenn er sich jetzt besonders misstrauisch und gereizt zeigte.
»Ich wüsste gerne, wer Ihnen das gesagt hat, Mr. Eden.«
»Das müssen wir, glaube ich, jetzt aus dem Spiel lassen«, antwortete Eden.
»Wenn das so ist«, sagte George, »so möchte ich doch wenigstens sichergehen, dass Ihnen nichts Falsches erzählt worden ist.«
»Reden Sie, George, berichten Sie uns«, warf Martineau ein. Eden nickte zustimmend. Leidenschaftlich, aber knapp und klar referierte George, was ich nun schon verschiedene Male gehört hatte: wie es zu dem Geschenk gekommen, wie Jack zum Sündenbock gemacht worden war.
Martineau schien die Fassung zu verlieren, als er hörte, in was der Junge sich verrannt hatte, doch Eden lehnte sich mit einem nachsichtigen Lächeln in seinem Sessel zurück.
»Solche Sachen kommen vor«, sagte er. »Solche Sachen kommen vor.«
George schloss mit einer Schilderung der Strafen, die Jack treffen sollten.
»Das ist zu hart – irgendjemand muss doch da protestieren«, sagte er.
»Und das wollen Sie also für ihn übernehmen, ja?«
»Ja«, sagte George.
»Die Sache ist die – wir haben gehört, Sie wollen die Angelegenheit über einen Ausschuss an der Schule verfolgen, stimmt das?«
»Allerdings.«
»Ich will mich da nicht einmischen, Passant.« Eden lächelte kurz und legte die Fingerspitzen aneinander. »Aber glauben Sie, dass dies die vernünftigste Art ist, die Sache anzupacken? Meinen Sie nicht, dass man hinter den Kulissen immer noch einiges zum Guten wenden könnte?«
»Da ist keine Aussicht, fürchte ich. Man muss sich unbedingt klarmachen, Mr. Eden, dass Cotery absolut keine Verbindungen hat«, sagte George. »Nicht etwa nur unzureichende Verbindungen – es gibt überhaupt keinen einzigen Menschen auf der ganzen Welt, der für ihn eintritt.«
»Das ist völlig richtig«, sagte Morcom in ruhigem, sachlichem Ton und ohne jede Erregung zu Eden. »Und Passant ist gar nicht glücklich, wenn er selbst die Sache anpackt. Aber er ist in einer schwierigen Lage: Wenn er nichts unternimmt, tut überhaupt niemand etwas.«
»Das ist natürlich ein großes Pech für Cotery«, sagte Eden. »Ich verstehe das gut. Aber Sie meinen doch gewiss nicht, Morcom, dass Passant den richtigen Weg einschlägt? Man reizt die Leute nur zum Widerstand, wenn man sie überrumpeln will.«
»Ich finde das auch«, antwortete Morcom. »Und ich habe Passant tatsächlich vor ein paar Tagen schon meine Meinung gesagt. Sie deckt sich mit Ihrer.«
»Das freut mich«, sagte Eden. »Ich weiß nämlich, dass Passant glaubt, mit zunehmendem Alter gingen wir alle den Weg des geringsten Widerstandes. Bis zu einem gewissen Grade stimmt das wirklich, fürchte ich. Aber Ihnen kann er das nun nicht vorwerfen. Sie sehen also, Passant«, fuhr er fort, »wir sind alle der Ansicht, dass Cotery ein Pechvogel ist. Aber das bedeutet noch nicht, dass wir meinen, Sie sollten sich in eine überstürzte Unternehmung einlassen. Es ist doch noch eine Menge Zeit. Mag ihn diese Geschichte ein bisschen zurückwerfen – schließlich ist er ein heller junger Mann. Mit Geduld und Ausdauer muss er es am Ende doch zu etwas bringen.«
»Er ist zwanzig«, sagte George. »Das ist gerade das Alter, in dem man es absolut nicht erträgt, kein Ziel vor Augen zu haben. Man kann einem Menschen in dem Alter nicht sagen, dass er noch Jahre warten muss.«
»Das ist alles schön und gut«, meinte Eden.
»Ich bringe es nicht fertig, Geduld zu predigen, wenn ein anderer sie praktizieren muss«, sagte George.
Er bemühte sich, seinen Zorn zu unterdrücken, und Eden lächelte nur noch mechanisch.
»Was Sie vorhaben, soll also eine Demonstration sein«, sagte Eden. »Ich hatte immer das Gefühl, dass man davon im Allgemeinen mehr Schaden als Nutzen hat.«
»Ich kann das leider nicht als eine Demonstration ansehen«, sagte George.
Eden runzelte die Stirn, schwieg eine Weile und sagte dann:
»Die Sache hat noch einen anderen Haken, Passant. Ich wäre lieber nicht darauf zu sprechen gekommen, und ich will es auch nicht aufbauschen. Aber wenn Sie aktiv werden, machen Sie möglicherweise uns persönlich Schwierigkeiten, denn schließlich stehen ja Howard und ich in einer gewissen Verbindung mit Ihnen.«
»Man hat also vermutlich heute Vormittag Ihnen die Verantwortung in die Schuhe schieben wollen«, rief George.
»Ganz so möchte ich es nun nicht gerade ausdrücken; was meinen Sie, Howard?«, sagte Eden.
»Auf jeden Fall hat man sich offenbar unglaublich unfair benommen, als man an Sie herantrat«, sagte George.
»So kann man das vielleicht sagen«, erwiderte Eden, »ja, so kann man das wohl sagen. Aber das ändert nichts an der Tatsache.«
»Wenn wir uns immer alle ganz fair verhielten, George«, sagte Martineau, »dann erführe keiner viel vom anderen, wie?«
George fragte Eden: »Haben Sie den Herrschaften klargemacht, dass ich als Privatmann vorgehe?«
»Mein lieber Passant, Sie müssten doch wissen, dass man diese Grenze nicht ziehen kann. Wenn Sie – um es einmal etwas grob zu sagen – sich vor einflussreichen Leuten zum Narren machen wollen, dann kommen auch Howard und ich nicht ungerupft davon.«
»Ich kann diese Grenze allerdings ziehen«, sagte George, »und wenn Sie mich dazu ermächtigen, so kann ich das auch diesen … dieser ihrer Informationsquelle sehr klarmachen.«
»Das würde die Sache nur noch verschlimmern«, sagte Eden.
Eine kleine Weile herrschte Schweigen. Dann sagte George:
»Ich muss Ihnen nun eine definitive Frage stellen, Mr. Eden. Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass mein Vorgehen meinen Verpflichtungen der Firma gegenüber zuwiderläuft?«
»Es ist nicht meine Absicht, die Sache so formell aufzuziehen«, erklärte Eden. »Ich habe hier einfach als Freund zu Freunden gesprochen. Meiner Meinung nach täten Sie uns allen einen Gefallen, Passant, wenn Sie noch einmal darüber schliefen. Weiter möchte ich jetzt nichts dazu sagen. Und jetzt müssen Sie mich entschuldigen, Howard, aber ich muss jetzt leider gehen, ich möchte nicht zu spät ins Bett kommen.«
Wir hörten ihn noch den Gartenweg entlanggehen und das Tor einklinken. George starrte auf den Teppich. Ohne aufzublicken sagte er zu Martineau:
»Es tut mir leid, dass ich Ihnen den Abend verdorben habe.«
»Seien Sie nicht albern, George. Harry Eden ist immer so ungeschickt mit dem Porzellan.« Martineau war Georges Blick auf den Teppich gefolgt und sprach, als ob er wisse, dass der verschüttete Kaffee jenem mehr zusetze als der Streit. Er fuhr fort: »Und diese kleine Meinungsverschiedenheit – da wissen Sie doch, dass Harry die Sache nur beilegen wollte.«
George antwortete zunächst nicht, aber dann brach es aus ihm heraus:
»Ich möchte Ihnen das gern begreiflich machen, Mr. Martineau. Ich weiß, Sie meinen, ich müsse mich davor hüten, der Firma zu schaden. Ich habe mir das so gründlich wie nur möglich überlegt; freilich mache ich mir selbst gelegentlich etwas vor, aber dieses Mal ist das, glaube ich, wirklich nicht der Fall. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Geschichte vielleicht zu allerlei Redereien Anlass geben wird – natürlich, das muss ich zugeben –, dass wir aber nicht einen einzigen Mandanten dadurch verlieren werden. Sie hätten sich genauso entschieden, allerdings ohne so lange zu überlegen.«





























