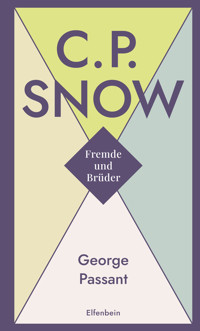Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elfenbein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fremde und Brüder
- Sprache: Deutsch
Nach Anthony Powells »Ein Tanz zur Musik der Zeit« und Simon Ravens »Almosen fürs Vergessen« erscheint endlich auch der dritte große englische Romanzyklus aus dem 20. Jahrhundert erstmals vollständig in deutscher Übersetzung: Die elfbändige Reihe »Strangers and Brothers«, im Original zwischen 1940 und 1970 veröffentlicht, kam hierzulande trotz mehrfacher Versuche in verschiedenen Verlagen nie zum Abschluss. Unsere Ausgabe startet im Frühjahr 2025 auf der Grundlage einer behutsamen Überarbeitung der vorliegenden Übersetzungen von Grete Felten aus den sechziger Jahren. Sie soll bis 2029 mit der Erstveröffentlichung der auf Deutsch bislang fehlenden Teile abgeschlossen werden. Snows Romanwerk, dessen Handlung sich vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis in die Zeit der Studentenunruhen von 1968 erstreckt, zeichnet — in der Rückschau des pensionierten Hochschullehrers Lewis Eliot und dabei autobiografisch getönt — den Lebensweg eines britischen Akademikers aus der Mittelschicht durch die sogenannten »corridors of power« nach: von Eliots Jugend in eher bescheidenen Verhältnissen in einer englischen Provinzstadt über seine Karriere als Anwalt in London, als Beamter, als Dozent in Cambridge. Dabei bieten die Romane eine tiefgründige Untersuchung der britischen Arbeitswelt des 20. Jahrhunderts und deren Institutionen sowie des komplexen Zusammenspiels zwischen dem Privatleben und dem Streben nach Ansehen in Beruf und Öffentlichkeit — entlang all der vielen Fallstricke moralischer Entscheidungen und vor dem Hintergrund sozialer Spannungsgeflechte und weltpolitischer Veränderungen. Dabei erzählt Snow clever und nicht selten amüsant. Seine liebevoll ausgearbeiteten Charaktere binden die einzelnen Romane, die auch separat gut lesbar sind, in geradezu Proust'scher Manier aneinander. »Zeit der Hoffnung« erschien 1949 als dritter Band; in der erzählerischen Reihenfolge jedoch steht er an erster Stelle, da er die Jahre 1914 bis 1933 behandelt, in denen Lewis Eliot von einem neugierigen Jungen zu einem etablierten Anwalt heranreift. Grüblerisch, aus verarmtem Elternhaus, ambitioniert, gesellig und beflügelt von jugendlicher Leidenschaft, setzt er sich allen Widrigkeiten zum Trotz durch und schafft den Sprung heraus aus der kleinstädtischen Ödnis nach London. Dabei lernt er, wie verlockend und tückisch zugleich das Streben nach Erfolg und Liebe sein kann: Während seine Karriere — gefördert durch die mürrische Tante Milly und den brillanten George Passant — an Auftrieb gewinnt, verliebt sich Lewis in die einnehmende Sheila Knight, eine schöne, aber psychisch labile Frau, die ihn nicht liebt. Und alles gerät ins Wanken ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C. P. Snow
Zeit der Hoffnung
Roman
Aus dem Englischen übersetztvon Grete Felten
Mit einem Nachwort von Johanna Marthe Israel
Elfenbein
Die Originalausgabe erschien 1949unter dem Titel
»Time of Hope« bei Faber & Faber, London.
Grete Feltens deutsche Übersetzung erschien erstmals 1960bei der Deutschen Verlags-Anstalt, Stuttgart. Für die vorliegende Neuausgabe wurde sie von Johanna Marthe Israel auf der Grundlage der 1970 von C. P. Snow revidierten Fassung behutsam überarbeitet.
Band 1 des Romanzyklus »Fremde und Brüder«
Copyright © C. P. Snow 1949
Erste Auflage 2025
© 2025 Elfenbein Verlag, Berlin
Benediktinerstraße 57 · 13465 Berlin
Einbandgestaltung: Oda Ruthe
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-96160-120-2 (E-Book)
ISBN 978-3-96160-100-4 (Druckausgabe)
TEILI
SOHN UND MUTTER
I
EIN STUNDENSCHLAG
Die Mücken tanzten über dem Wasser. Das Schilf standzum Greifen nahe, hochaufstrebend und üppig, und auf der anderen Seite stieg das Flussufer so steil an, dass wir von der Welt ganz abgeschlossen waren, allein an dem heißen, stillen Sommernachmittag, der kein Ende nahm. Wir waren seit dem Morgen hier, die ganze Bande; der Boden zeigte rings die Spuren unserer Mahlzeit. Jetzt, da die Sonne sank, dämpften sich selbst unsere kindlichen Stimmen. Träge lagen wir da und blickten durch das Röhricht auf den spiegelnden Fluss. Ich streckte mich, um einen Grashalm abzupflücken, und fühlte die Erde rau und warm unter meinen Knien.
Es war ein langer, langer Tag gewesen – so lang, wie man ihn nur in der Kindheit erlebt. Ich war noch nicht neun Jahre alt, damals, im Juni 1914, und hätte diesen Tag gewiss vergessen, wäre nicht das Erlebnis auf dem Heimweg gewesen.
Es fing schon an zu dämmern, als wir aufbrachen, das Ufer erklommen und uns wieder in der Vorstadt fanden, dicht neben den Straßenbahnschienen. Drunten im Schilf konnten wir uns einbilden, wir hätten unser Lager in einsamer Wildnis aufgeschlagen, in Wirklichkeit liefen die Schienen noch eine ganze Meile neben dem Fluss her. Ich ging allein nach Hause, müde und glücklich nach dem Tag in der Sonne. Nichts trieb mich, ich hatte Zeit und genoss den warmen Sommerabend. Der Duft blühender Linden lag über der Vorstadtstraße, und in manchen Häusern gingen schon die Lichter an. Die Ziegel der neuen Kirche glühten rosenfarben im Schein der sinkenden Sonne.
An der Kirche teilte sich die Straße. Rechts ging es zum Fleischer und zu einer Reihe von Häuschen, die unmittelbar am Bürgersteig standen, links an der Bibliothek vorbei den vertrauten Weg entlang heimwärts. Hier lagen vor den Häusern kleine, gepflegte Gärten, sie besaßen alle einen zweiten Zugang, der zur Hintertür führte. Hier stand auch das Haus meiner Tante – mit dem Schild »Bauunternehmer« über dem Hofeingang –, und dann kam das unsere. Es war mit seinem Nachbarn das älteste in der Straße, hatte ein Stockwerk mehr und war wie die Kirche aus Ziegeln gebaut. Ein bisschen schäbig sah es aus, und das Holzwerk hätte eines neuen Anstrichs bedurft. Als ich bei der Bibliothek einbog, leuchteten mir die Jasminbüsche in der Dämmerung entgegen. Ich konnte es schon sehen, mein Zuhause – und da geschah es. Aus heiterem Himmel und ohne jeden Grund überfiel mich die Angst, die Furcht vor einem Unheil, das dort auf mich lauerte. Von einer Sekunde zur anderen hatte mich der Schrecken aus dem Dunkel angesprungen. Ich war zu jung, um mich wehren zu können. Für ein Kind ist jeder Jammer ewig, und ich war noch ein Kind, unfähig mir vorzustellen, dass diese Angst ein Ende nehmen könnte.
Trotz meiner Müdigkeit stürmte ich wie toll auf unser Haus zu. Ich musste sofort wissen, was diese böse Ahnung zu bedeuten hatte. Sie schien mich aus dem Nichts überfallen zu haben. Ich konnte ja noch nicht durchschauen, dass daheim etwas in der Luft gelegen und sich auf mich übertragen haben mochte, dass ich vielleicht das eine oder andere gehört, aber aus meinem Bewusstsein verdrängt hatte. So trieb mich nichts als Furcht und Schrecken an den Nachbargärten vorbei, und ich hörte kaum das »Gute Nacht«, das man mir von den Blumenbeeten aus nachrief. Die Mutter ist gestorben – das war mein einziger Gedanke.
Doch ich fand alles wie sonst. Von der Straße aus sah ich, dass im Vorderzimmer noch kein Licht brannte; aber das war nicht ungewöhnlich, es wurde immer erst angezündet, wenn ich heimkam. Ich lief durch die Hintertür ins Haus. An der Rückseite waren die Jalousien schon heruntergelassen, ein Lichtstreifen fiel in den Garten. In der Küche glomm der Gasstrumpf, ich brauchte die Lampe nur aufzudrehen. Auf dem Tisch stand mein Abendbrot. Aber ich musste erst meine Mutter finden; ich hastete durch den Korridor und platzte in das erleuchtete Wohnzimmer. Da saß sie – ich schrie auf vor Glück und Erleichterung.
Sie wurde verlegen, als ich so plötzlich auftauchte. Ihr hübsches Gesicht, immer stolz und selbstbewusst, aber nie entspannt, kam mir verändert vor: Ihre Wangen waren gerötet, die Augen glänzten, ihr Blick war nicht durchdringend, kühn und unruhig wie sonst. Sie saß mit zwei Freundinnen, die bei uns ein und aus gingen, an einem Tisch, auf dem ein Spiel Karten in drei Reihen ausgebreitet war. Eine der Frauen zeigte gerade auf den Pikkönig. Doch ich wusste, sie spielten nicht – sie legten Karten.
Solche Séancen veranstaltete meine Mutter, sooft sie ihrer Freundinnen habhaft werden konnte. Kamen Maud und Cissie zum Tee, so wurde eifrig gewispert und geflüstert, und vielsagende Blicke gingen hin und her. Dann gab mir Mutter ein paar Pennys für Bonbons oder eine Illustrierte, und die drei Frauen zogen sich in das Hinterzimmer zurück. Was sie dort trieben, erfuhr ich nicht. Ihr Stolz gestattete meiner Mutter nicht, mich merken zu lassen, dass sie über die Maßen abergläubisch war.
»Hast du schon gegessen, mein Junge?«, fragte sie mich jetzt. »Es steht alles auf dem Tisch.«
»Ich zeige deiner Mutter gerade ein paar Kartenkunststückchen«, erklärte die rundliche, gutmütige Maud.
»Geh nur und iss dein Abendbrot«, sagte meine Mutter rasch. »Und dann ist’s Zeit für dich, schlafen zu gehen, ja?«
In Wirklichkeit wurde ich sehr unregelmäßig ins Bett geschickt. Meine Mutter war zwar tüchtig, hatte aber häufig anderes im Kopf, und mein Vater, für den sie eine unangefochtene Autorität war, tat nur hin und wieder zum Spaß so, als wolle er sich am häuslichen Regiment beteiligen. Beide liebten mich zärtlich. Sie setzten große, noch ganz unbestimmte Hoffnungen in mich, ließen mich aber von klein auf meist tun, was ich wollte. So ging ich auch an diesem Abend, nachdem ich gegessen hatte, wieder über den Korridor zu dem leeren, dunklen Vorderzimmer. Über die Schwelle sickerte das Licht von nebenan, und ich hörte meine Mutter mit ihren Freundinnen eifrig flüstern – beim Kartenlegen senkten sie ihre Stimmen.
Ich suchte mir Streichhölzer, stieg auf den Tisch, zündete die Gaslampe an und machte mir’s zum Lesen bequem. Seit ich das Haus betreten, alles friedlich gefunden und meine Mutter gesehen hatte, war ich wieder ruhig, eingehüllt in die Geborgenheit, die man nur als Kind empfindet. Wie vorher das Unglück, so schien mir jetzt dieser Frieden immer und ewig währen zu müssen. Die Furcht war verschwunden, die schrecklichen Augenblicke, die ich mein ganzes Leben lang im Gedächtnis behalten sollte, waren mir an jenem Abend schon aus dem Sinn gekommen. Ich rollte mich auf dem Sofa zusammen und verlor mich im Magazin »The Captain«.
Ich hatte schon eine Weile gelesen, und die Augen wollten mir zufallen. Die Sonne hatte mir tagsüber doch sehr zugesetzt, und ich hätte gleich ins Bett gehen sollen. Da schreckte mich durch das offene Fenster eine wohlbekannte Stimme auf.
»Lewis! Was treibst du denn da noch so spät?«
Es war meine Tante Milly, die nur zwei Häuser von uns entfernt wohnte. Ihre Stimme war laut und selbstbewusst, leicht füllte sie jeden Raum und übertönte alle anderen.
»So etwas ist mir doch wirklich noch nicht vorgekommen«, rief sie, immer noch von draußen. »Nun, wenn du noch auf bist, anstatt schon längst im Bett zu liegen«, fuhr sie ärgerlich fort, »kannst du mir auch die Haustür aufmachen.«
Sie trat hinter mir ins Zimmer und blickte, rot vor Ärger und Entrüstung, auf mich herab.
»Jungen in deinem Alter sollten um acht Uhr im Bett liegen. Kein Wunder, wenn du früh nicht raus magst.«
Ich wollte das bestreiten, aber Tante Milly hörte gar nicht zu.
»Kein Wunder, dass du nur Haut und Knochen bist«, fuhr sie fort. »Jungen in deinem Alter brauchen ihre zwölf Stunden Schlaf. Auch darüber werde ich mit deiner Mutter noch sprechen müssen.«
Tante Milly war die Schwester meines Vaters, eine robuste Person, so groß wie meine Mutter, aber viel massiger, mit einer dicken, knolligen Nase und hellblauen vorstehenden Augen, die immer ein wenig verwundert um sich blickten. Das Haar trug sie in einem Knoten hoch am Hinterkopf aufgesteckt, was ihr eine entfernte Ähnlichkeit mit der Britannia verlieh. Über alles hatte sie ihre feste Meinung, und einer ihrer Grundsätze war, dass man immer die Wahrheit sagen müsse, und zwar erst recht, wenn sie für den andern unangenehm war. Nach ihrer Ansicht wurde ich zugleich verwöhnt und vernachlässigt, und sie war der einzige Mensch, der mir Vorschriften zu machen versuchte. Sie selbst hatte keine Kinder.
»Wo ist deine Mutter? Ihretwegen bin ich hergekommen; ich dachte, sie wüsste vielleicht was Neues«, sagte sie anklagend, was ich nicht recht verstand.
Ich erwiderte, Mutter sei mit Maud und Cissie nebenan, »sie spielen Karten«, fügte ich hinzu. Ich war mir meiner kleinen Schwindelei wohl bewusst.
»So, sie spielen Karten!«, rief sie entrüstet. »Da will ich doch gleich mal nachsehen, wie lange das noch dauern soll.«
Tante Millys Stimme drang selbst durch zwei geschlossene Türen. Offensichtlich war sie sehr aufgebracht. Sie fragte laut, wie nur erwachsene Menschen an solchen Unsinn glauben könnten – darauf war es still, wohl weil meine Mutter ihr nur leise widersprach –, dann ergriff wieder Tante Milly das Wort. Schließlich schlugen die Türen, und die Tante trat wieder zu mir ins Zimmer.
»Kartenspielen!«, rief sie aus. »Ich halte ja nicht viel davon, aber darüber wollte ich noch kein Wort verlieren. Wenn sich’s nur darum handelte!«
»Tante Milly, du hast aber …«, holte ich zur Verteidigung meiner Mutter aus. Mir war eingefallen, dass Tante Milly Mutter im letzten Jahr heftige Vorwürfe gemacht hatte, als diese am zweiten Weihnachtstag eine Partie Whist angeregt hatte.
»Kartenlegen und Wahrsagen!«, höhnte Tante Milly, ohne meinen Einwand zu beachten. »Ein Jammer, dass sie nichts Besseres zu tun findet. Und kein Wunder, wenn’s hier nicht vorangeht. Wahrscheinlich sollte ich dir ja nichts sagen, aber schließlich – wer soll sich denn sonst darum kümmern, was aus euch wird. Dein Vater und deine Mutter tun’s jedenfalls nicht, da kann ich predigen, was ich will, sie hören nicht auf mich.«
Draußen in der Diele verabschiedete sich meine Mutter von Maud und Cissie, dann öffnete sich die Tür langsam, und sie trat entschlossen, mit hocherhobenem Kopf und stolzem Schritt ins Zimmer – die Füße setzte sie betont nach außen, wie stets, wenn sie majestätisch wirken wollte. Sie besaß in der Tat viel Würde, wenn auch ihre Art, sie zu zeigen, etwas sonderbar sein mochte.
Mutter schwieg, bis sie in der Mitte des Zimmers vor Tante Milly stand. Sie blickte ihr ins Gesicht und sagte:
»Bitte gedulde dich, bis wir allein sind, Milly. Solltest du mir wieder einmal Vorschriften machen wollen, dann wäre ich dir dankbar, wenn du warten würdest, bis meine Gäste das Haus verlassen haben.«
Beide Frauen waren groß und stattlich, beide hatten einen starken Willen. Aber sonst waren sie in jeder Hinsicht verschieden. Die schmale, gebogene Nase meiner Mutter ließ sich mit Tante Millys Knollennase überhaupt nicht vergleichen, und Mutters schöne Augen blickten kühn, hell und gescheit aus tiefen, gewölbten Höhlen, während Tante Millys Knopfaugen trüb wirkten. Meine Mutter war eine Romantikerin, sensibel, maßlos stolz und ein Snob, Tante Milly völlig naiv, immer betriebsam, immer für irgendeine »gute Sache« tätig, ohne jedes Einfühlungsvermögen, aber sehr überrascht und verletzt, wenn man nicht auf ihre Vorschläge einging, dennoch nie erlahmend in ihrer Aktivität. Sie besaß nicht das geringste Fingerspitzengefühl und war durch nichts zu entmutigen. Auch Humor hatte sie nicht die Spur, sehr im Gegensatz zu meiner Mutter, bei der man jetzt allerdings auch nichts davon spürte, während sie Tante Milly vor dem Kaminsims gegenüberstand.
Seit der Heirat meiner Eltern waren die beiden Frauen viel beisammen. Sie trieben sich gegenseitig zur Verzweiflung und lebten in einem Zustand dauernden Missverstehens, schienen aber einander doch nie lange entbehren zu können.
»Ich möchte dich bitten, meine Gäste in Frieden zu lassen«, sagte meine Mutter.
»Gäste!«, spottete Tante Milly, »Maud Taylor kenne ich schon länger als du. Ein Jammer, dass sie sich nicht geheiratet hat, als wir es taten. Kein Wunder, dass sie jetzt aus den Karten lesen möchte, dass sie noch einen Mann kriegt.«
»Wenn sie in meinem Hause ist, ist sie mein Gast, und ich wäre dir dankbar, wenn du ihr nicht deine Ansichten aufzwingen wolltest.«
»Es handelt sich doch nicht um meine Ansichten«, rief Tante Milly noch lauter als sonst. »Es handelt sich um den gesunden Menschenverstand. Du solltest dich wirklich schämen, Lena.«
»Ich denke nicht daran, mich zu schämen«, erwiderte meine Mutter hochfahrend, man merkte aber doch, dass ihr das Thema unangenehm war.
»Kartenlegen und dieses alberne Handlesen und …«, hier pausierte Tante Milly eindrucksvoll, »… und ein paar schmierige Teeblätter anstarren – dafür kann ich beim besten Willen kein Verständnis aufbringen.«
»Niemand hat dich darum gebeten«, erwiderte meine Mutter kühl. »Solange ich dich nicht auffordere mitzuhalten, hast du gar keinen Grund, uns Szenen zu machen. Schließlich hat jedermann das Recht zu einer eigenen Meinung.«
»Aber nur, wenn sie dem gesunden Menschenverstand entspricht«, beharrte Tante Milly. »Teeblätter – im zwanzigsten Jahrhundert!« Offenbar empfand sie das als einen besonders durchschlagenden Trumpf.
Meine Mutter zögerte und meinte schließlich:
»Es gibt allerlei, worüber wir nicht Bescheid wissen.«
»Über Teeblätter wissen wir ganz gut Bescheid«, gab Tante Milly zurück und lachte polternd. So war eben ihr Humor. Bedeutungsvoll fuhr sie fort: »Freilich gibt es noch allerlei, worüber wir nicht Bescheid wissen. Gerade deshalb kann ich ja nicht verstehen, dass du für solchen Unfug Zeit hast. Zum Beispiel wissen wir noch nicht darüber Bescheid, wovon du und Bertie und dieser Junge in Zukunft leben sollen. Es gibt allerlei, worüber wir nicht Bescheid wissen, und ich sagte dem Jungen eben …«
»Was hast du dem Jungen gesagt?«, begehrte meine Mutter zornig auf und ging nun ihrerseits zum Angriff über. Es war ihr sehr peinlich gewesen, als Tante Milly das Gespräch geschickt von den Fragen des guten Tones auf ihren Aberglauben gelenkt und sie gezwungen hatte, sich zu rechtfertigen. Nun stand sie wieder auf sicherem Grund, und ihr Zorn war echt und überzeugend.
»Ich habe ihm bloß gesagt, dass ihr nun lange genug alles habt gehen lassen, wie es gerade ging. Kein Wunder, wenn es immer schlimmer mit euch wird. Niemals hättest du es zulassen sollen …«
»Milly, du sollst davon nicht vor Lewis sprechen!«
»Das schadet ihm gar nichts. Früher oder später muss er’s ja doch erfahren.«
»Trotzdem will ich nicht, dass du in seiner Gegenwart davon sprichst.«
Ich spürte, dass es hier nicht um Kleinigkeiten ging, und so fragte ich:
»Bitte, was ist los?«
»Hab keine Angst«, sagte meine Mutter und blickte mich liebevoll und zärtlich an, als wolle sie mich vor jedem Kummer schützen. »Vielleicht wird noch alles gut.«
»Dein Vater macht dummes Zeug«, sagte Tante Milly.
Aber meine Mutter unterbrach sie rasch:
»Ich bitte dich, darüber nicht vor dem Kind zu sprechen.«
Ihre Stimme war fest und so zornig, dass sie selbst Tante Milly einschüchterte. Beide verstummten; man hörte die Uhr auf dem Kaminsims ticken. Ich hatte keine Ahnung, worüber sie sich so aufregten, doch Angst würgte mich. Noch einmal fragen durfte ich nicht, das war mir klar. Jetzt war es ernst geworden, diesmal konnte ich nicht nach Hause laufen und dort Ruhe und Sicherheit wiederfinden.
Plötzlich drehte sich draußen der Schlüssel im Schloss, und mein Vater trat ins Haus. Wir alle wussten, woher er kam: Als begeisterter Sänger leitete er einen Männerchor in unserer Gemeinde; diese Leidenschaft kostete ihn viele Abende. Er trat ein und zwinkerte mit seinen kurzsichtigen Augen, weil ihn das Licht blendete.
»Wir haben gerade von dir gesprochen, Bertie«, fing Tante Milly an.
»Das überrascht mich nicht«, meinte mein Vater leichthin. »Ich hab wohl wieder was falsch gemacht?«
Er spielte den reuigen Sünder, da es ihm Spaß machte, seine Sanftheit und Nachgiebigkeit, die bei ihm schon drollig genug wirkten, noch zu übertreiben. Wenn sich eine Gelegenheit bot, den Clown zu spielen, konnte er schwer widerstehen. Er war sehr klein, ein ganzes Stück kürzer als Frau und Schwester, dazu besaß er einen unverhältnismäßig großen Schädel, der dem von Tante Milly glich, nur seine Züge waren feiner. Auch Vaters Augen standen vor, doch wenn er nicht gerade den Hanswurst machte, waren sie still, besinnlich und vergnügt. Wie seine Schwester hatte auch er hellbraunes Haar (das meiner Mutter war sehr dunkel), dazu trug er einen großen rötlichen Seehundsbart. Die Brille hing gewöhnlich schief auf seiner Nase, sein eines Auge schaute leicht darüber, das andere darunter hervor. Er legte den Hut auf dem Büfett ab und schaute seine Schwester verschmitzt an.
»Ich wünschte, ich träfe dich auch mal bei einer nützlichen Beschäftigung«, sagte Tante Milly.
»Fahr doch nicht gleich auf deinen Bruder los, kaum dass er zur Tür hereinkommt«, unterbrach sie meine Mutter.
»Ich bin’s doch gewöhnt, Lena, ich bin das längst gewöhnt«, schmunzelte mein Vater. »Sie schiebt die Schuld immer auf mich, damit habe ich mich schon abgefunden.«
»Wenn du dich bloß mal deiner Haut wehren würdest«, rief meine Mutter gereizt.
Mein Vater war ziemlich blass; schon das ganze letzte Jahr hatte er nicht gut ausgesehen. Trotzdem wirkte er gelassener als meine Mutter, und er musste auch jetzt sagen, was er immer sagte, wenn die Uhr die volle Stunde schlug. Ihr Gehäuse war aus Marmor; der Chor hatte sie ihm für zehnjährige treue Dienste geschenkt. Das Zifferblatt flankierten rechts und links kleine dorische Säulen; das Schlagwerk tönte voll durchs Haus. Jedes Mal, wenn mein Vater sie hörte, machte er dieselbe Bemerkung. Jetzt schlug sie elf.
»Ein schöner, voller Ton«, sagte mein Vater anerkennend. »Wirklich, ein schöner, voller Ton.«
»Zum Kuckuck mit der Uhr!«, rief meine Mutter gequält.
Schließlich lag ich in meiner Dachkammer und presste das heiße Gesicht in die Kissen. Heiß vom Sonnenbrand, heiß aber auch von Angst und Kummer. Ich hatte länger gebetet als sonst, aber das Herz war mir nicht leichter davon geworden. Ich konnte und konnte nicht verstehen, was Schlimmes geschehen war.
II
MR. ELIOTS ERSTES SPIEL
Die nächsten vierzehn Tage brachten nichts Neues.Meine Mutter hatte ihre Sorgen und kümmerte sich wenig um mich, aber wenn ich sie und Vater im Gespräch überraschte, verstummten sie sofort, und mir wurde unbehaglich zumute. Tante Milly ließ sich öfter bei uns sehen als je zuvor, fast jeden Abend nach dem Essen hörten wir ihre kräftige Stimme schon von der Straße her. Trat sie dann ein, so wurde ich unweigerlich nach draußen geschickt. Allmählich gewöhnte ich mich an den Druck, der uns alle beschwerte, und konnte ihn sogar vergessen. Ich saß gern mit einem Buch im Garten, der etwas tiefer lag als der Hof. Das Gras stand hoch in dem kleinen Viereck, das eine Blumenrabatte, ein Steingarten und ein paar Himbeersträucher säumten. Am liebsten waren mir unsere Baume – drei Birnbäume an der Mauer und zwei Apfelbäume auf dem Rasen. Meist nahm ich mir einen Liegestuhl, setzte mich unter einen der Apfelbäume und las, bis es dämmerte und die Buchstaben auf den weiß schimmernden Seiten kaum mehr zu erkennen waren.
Dann schaute ich hinauf zum Haus. Das Wohnzimmerfenster leuchtete jetzt als helles Rechteck zu mir herunter, und ich fragte mich oft beklommen, was wohl dahinter verhandelt wurde.
Abgesehen von diesen abendlichen Besprechungen änderte sich aber unser Tageslauf nicht.
Ich ging wie immer in die Schule, und wenn ich mittags heimkam, fand ich die Mutter schweigsam und zerstreut. Auch mein Vater machte sich jeden Morgen in sein Geschäft auf. Eine regelmäßige Tätigkeit entsprach seinem gefügigen, heiteren Temperament, und nicht einmal Tante Milly konnte ihm vorwerfen, dass er seine Arbeit schleifen ließ. Er stand – wie unser etwa sechzehnjähriges Dienstmädchen – früh auf und war schon längst fort, wenn ich zum Frühstück erschien. Erst am Abend gegen halb sieben oder sieben Uhr kam er zu seinem High Tea wieder nach Hause.
Vor drei Jahren hatte mein Vater sich selbständig gemacht, nachdem er lange in einer kleinen Stiefelfabrik mitunter die Buchhaltung betrieben hatte und die rechte Hand des Direktors gewesen war. Dort hatte er zweihundertfünfzig Pfund im Jahr verdient, und davon hatten wir recht gut leben und uns sogar eine Hilfe halten können. Aber Vater kannte das Gewerbe und den Umsatz und erzählte zu Haus, dass Mr. Stapleton, sein Chef, im Jahr zwölfhundert Pfund aus dem Geschäft zog. Meinen Eltern sowie Tante Milly und deren Mann erschien dieses Einkommen ungeheuer – sie konnten sich einen solchen Reichtum kaum vorstellen. Und Vater malte sich aus, wie schön es wäre, selbst Fabrikbesitzer zu sein. Mutter bestärkte ihn, während Tante Milly prophezeite, das bestimmt alles schiefginge, ihm aber gleichzeitig vorwarf, es fehle ihm an Unternehmungsgeist, den Versuch zu wagen.
Meine Mutter war es, die ihn schließlich dazu trieb. Sie selbst haderte mit den Einschränkungen, die mit ihrem Geschlecht einhergingen. Wäre sie ein Mann gewesen – sie hätte sich durch nichts zurückhalten lassen, und ihrem Erfolg hätte nichts im Wege gestanden. So lieh sie meinem Vater ihre Ersparnisse, an die hundertfünfzig Pfund, und trieb für ihn ein Darlehen auf. Den Rest steuerte Tante Milly bei, deren Mann, ohne viel Aufhebens zu machen, sein Bauunternehmen gut im Schwung hatte und beträchtlich wohlhabender war als wir. Mein Vater besaß nun plötzlich eine Fabrik, die zwar klein war – er beschäftigte nie mehr als ein Dutzend Leute –, ihm aber eben doch die Selbständigkeit verschaffte. In dieser Fabrik hatte er in den vergangenen drei Jahren gewissenhaft jeden Tag zugebracht.
Auch Mutter hatte abends oft über den Büchern gesessen, hatte mancherlei vorgeschlagen, Unterlassungen gerügt, auch etwa zur Einstellung eines neuen Reisenden geraten. In der letzten Zeit war das in meiner Gegenwart nicht mehr geschehen, aber Vater war nach wie vor den ganzen Tag in seinem Betrieb. Er sagte übrigens niemals »mein Unternehmen« oder »meine Fabrik«, sondern zog die anspruchslose Ortsbezeichnung »Myrtle Road« vor.
An einem Freitagabend Anfang Juli hatten meine Eltern ein langes Gespräch miteinander, und als ich aus dem Garten kam, spürte ich, dass mein Vater sehr erregt war.
»Lena hat Kopfweh, sie ist schon zu Bett gegangen«, sagte er. Dabei sah er mich kläglich an, und ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Umso überraschter war ich, als er vorschlug, wir beide sollten am nächsten Tag zum Cricketspiel unseres Bezirks gehen. Ich hatte Schlimmes erwartet und wusste nun überhaupt nicht mehr, woran ich war.
Ich selbst ging regelmäßig, wenn ich einen Sixpence auftreiben konnte, zu diesen Spielen, aber mein Vater hatte in seinem ganzen Leben noch keins besucht. Er wollte mich um halb zwölf vor dem Sportplatz treffen, also vorzeitig von Myrtle Road weggehen. Das verblüffte mich, denn nicht einmal um einer Singstunde oder eines spannenden Buches willen hatte Vater bisher jemals die Fabrik vor Arbeitsschluss verlassen. Samstags kam er sonst immer um halb zwei nach Hause.
»Wir bleiben den ganzen Tag dort, ja? Schließlich wollen wir auch etwas für unser Geld haben, oder?«
Seine Stimme klang gedrückt, und seine Späße wollten nicht recht gelingen.
Am nächsten Morgen jedoch war er schon fast wieder der Alte. Er war immer für Neues zu haben, und es störte ihn nicht, wenn er sich nicht auskannte.
»Sieh mal an«, sagte er, als er unser Eintrittsgeld bezahlt hatte und wir uns durch die Drehtür zwängten, »hier spielen sie also, ja?« Dabei schaute er aber zu den Übungsnetzen hinüber. Er geriet keineswegs in Verlegenheit, als ich ihn zu unseren billigen Sitzen führte, die unmittelbar neben der weißen Bretterwand lagen.
Gleich darauf konnte ich mich nicht mehr um meinen Vater kümmern, denn der atemraubende Schwung der ersten Spielminuten riss mich völlig hin. Die Wicketstäbe leuchteten in der Sonne, der Ball flog wie ein Blitz durch die Luft, die Schlagmänner begannen ihr überlegtes Spiel, und ich schluckte vor Aufregung bei jedem Ball. Natürlich ergriff ich leidenschaftlich Partei. Leicestershire spielte gegen Sussex. Jahrelang war ich davon überzeugt, mich an jedes Detail dieses Tages genau zu erinnern. Ich hätte schwören können, dass mein Vater und ich die ersten Bälle des Innings von Leicestershire sahen. Aber meine Erinnerung muss mir einen Streich gespielt haben. Viel später erst habe ich mir den Punktestand angesehen. Das Spiel hatte bereits am Donnerstag begonnen, und Sussex hatte ohne große Einbußen über zweihundert Punkte gemacht und an jenem Abend zwei unserer Wickets geholt. Der Freitag war völlig verregnet, und tatsächlich sahen wir (entgegen meiner mich trügenden Erinnerung) Leicesterhire sein Innings fortsetzen.
Ich wünschte Leicestershire von ganzem Herzen eine gute Punktzahl gegen Sussex. Und auch innerhalb der Mannschaft hatte ich noch meinen Favoriten, denn einen Helden musste ich haben. Die Auswahl war jedoch nicht groß; wir besaßen keine überragenden Spieler. Ich begeisterte mich für C. J. B. Wood, musste allerdings gelegentlich gegen meinen Willen zugeben, dass er nicht so glänzend war wie Jessop oder Tyldesley. Aber ich tröstete mich damit, dass er umso zuverlässiger spielte. Tatsächlich enttäuschte mich mein Held nur selten, doch wenn er versagte, musste ich mich beherrschen, um nicht loszuheulen.
An diesem Morgen sorgte er dafür, dass mir kurz die Haare zu Berge standen. Er schlug die Bälle – ich glaube, Albert Relf war der Werfer – immer wieder unbeholfen und plump und taumelnd so, dass sie meist brav im Mid-off landeten. Einmal jedoch sprang ihm der Ball dabei schräg über die Schlägerkante und flog kniehoch zwischen dem ersten und dem zweiten Slip hindurch. Vier Runs auf einen Schlag! Die Leute ringsum klatschten und sagten albern: »Hübsch gemacht!« Ich verachtete sie, und ich war um meinen Helden besorgt, der mit der Rückseite seines Schlägers nachdenklich auf die Pitch klopfte.
Nach der ersten Viertelstunde ließ meine Anspannung ein wenig nach. Mein Vater saß da und staunte alles mit seinen großen blauen Augen an. Als er merkte, dass ich nicht mehr so völlig selbstvergessen auf meinem Sitz klebte, wollte er vielerlei von mir wissen.
»Lewis«, fragte er, »muss man eigentlich sehr viel Kraft haben zum Cricketspielen?«
Ich hatte eine Menge »gescheite« Bücher gelesen und antwortete darum selbstbewusst: »Manche Schlagmänner schaffen alle Runs aus dem Handgelenk.« Ich erklärte ihm das Prinzip des »leg glance«.
»Sie drehen einfach das Handgelenk, wie?« Er betrachtete die Männer und forschte weiter: »Aber die meisten sind doch recht stattliche Burschen, was? Muss man unbedingt so groß sein?«
»Quaife ist ein ganz kleiner Kerl, Quaife aus Warwickshire.«
»Wie klein – kleiner als ich?«
»Ja, sicher.«
Ob das stimmte, wusste ich nicht genau, aber ich fühlte, dass Vater diese Antwort Freude machte. Er ließ sich auch seine Genugtuung deutlich anmerken und spann dann seine Überlegung weiter:
»Bis zu welchem Alter kann man dabeibleiben?«
»Sehr lange«, erwiderte ich.
»Gibt es Spieler, die älter sind als ich?«
Mein Vater war kaum vierzig, und dennoch erschien er mir alt. Ich versicherte ihm, dass W. G. Grace noch mit achtundfünfzig Jahren Cricket gespielt hatte, und mein Vater lächelte nachdenklich.
»In welchem Alter kann man denn spätestens anfangen? Wer ist der älteste Neuling hier?«
Damit war ich überfragt. Das Höchstalter eines Anfängers in einem erstklassigen Spiel war mir nicht bekannt. Ich konnte meinen Vater nur ganz allgemein ermutigen.
Er baute gern Luftschlösser, und auch an jenem Tage hing er Phantasiegespinsten nach. Er sah sich plötzlich als hervorragenden Cricketspieler: Man stellte ihn an den entscheidenden Platz, jedermann bewunderte ihn, mit einem Schlage war er berühmt. Bei solchen Träumereien entfernte er sich aber nie allzu weit von der Wirklichkeit. Er blieb nach Alter und Statur der Mann, der er war, wurde also nicht etwa plötzlich zum starken, großen, strahlenden Jüngling – nein, er fand sich mit den Tatsachen ab, schmunzelte sogar über seine Unzulänglichkeit und malte sich aus, was ihm dennoch alles widerfahren könnte.
Das war auch der Grund, weshalb er Reisebeschreibungen in solchen Mengen verschlang. Er ging über die Straße zur Bibliothek und suchte sich etwa ein neues Buch über die Quellen des Amazonas aus, um sich dann zu Hause in dem Traum zu wiegen, dass er, der leider so kurz geratene Mann mittleren Alters, durch den Regenwald paddelte, den vor ihm noch kein Weißer betreten hatte.
Damals und auch später noch redete ich mir ein, er lese diese Bücher, um seine Kenntnisse zu erweitern, und machte mir vor, er wisse ausgezeichnet über tropische Länder Bescheid. Aber im Grunde war mir klar, dass das nicht stimmte. Doch die Erkenntnis tat mir weh, und ich empfand es als bittere Kränkung, wenn ich Tante Milly sagen hörte, mein Vater tauge nichts und meine Mutter sei abergläubisch und hochnäsig. Eine blinde, wilde, tränenschwangere Liebe stieg dann in mir auf, und erst Jahre später ruhte ich so in mir selber, dass ich solche Bemerkungen von ihr hinnehmen konnte. Dabei dachte ich selbst oft genug das Gleiche – doch meine Einsicht kränkte mich nicht im Geringsten.
In der Mittagspause spendierte mein Vater mir eine Ingwerlimonade und eine Fleischpastete, und später tranken wir noch Tee miteinander. Die romantischen Phantasien waren jetzt verblasst und sein Interesse am Spiel infolgedessen auch nur noch gering; er hockte geduldig da und sah ohne jedes Verständnis, ja fast ohne den Ball wahrzunehmen, zu. Er wollte mich nicht spüren lassen, dass er gewissermaßen nur noch aus Pflichtgefühl blieb.
Als nach den letzten Würfen die Zuschauer rund um uns dem Ausgang zuströmten, sagte er:
»Wir wollen warten, bis das Gedränge ein bisschen nachlässt.«
So saßen wir da, während der Platz sich allmählich leerte. Die Fenster des Pavillons leuchteten in der Abendsonne, und der Schatten der Anzeigetafel reichte halbwegs bis zum Wicket hinüber.
»Lena meint, ich soll dir’s sagen«, begann mein Vater zögernd.
Erschreckt starrte ich zu ihm auf.
»Ich wollte nicht eher damit anfangen – ich wollte dir nicht den Spaß hier verderben.« Er sah mich an und fügte hinzu: »Es ist nämlich nichts Gutes, Lewis.«
»Oh«, rief ich aus.
Mein Vater rückte seine Brille gerade.
»In Myrtle Road laufen die Dinge nicht sehr gut. Das ist das Problem«, sagte er. »Ich kann nicht sagen, dass die Dinge laufen, wie wir es wollen.«
»Wieso?«, fragte ich.
»Milly meint, es sei meine Schuld«, gab Vater gelassen zu. »Aber ich weiß nicht recht …« Dann redete er von »größeren Firmen«, die »billigere Modelle« herausbrächten, und schloss, als er sah, dass ich nichts verstand, mit: »Ich fürchte, wir sind erledigt. Möglicherweise muss ich Konkurs anmelden.«
Das klang unheimlich und beängstigend, obwohl ich mir bei dem Wort nichts vorstellen konnte.
»Das bedeutet«, sagte mein Vater, »dass wir wahrscheinlich nun nicht mehr viel Geld haben werden. Es tut mir weh, wenn ich daran denke, Lewis, dass ich nicht mehr hie und da einen Souvereign für dich zur Seite legen kann. Ich hätte dir so gern ein paar Souvereigns zugesteckt, wenn du nun größer wirst.«
Diese Erklärung beunruhigte mich eine Zeitlang. Mein Vater aber rührte sich nicht und fügte auch kein Wort mehr hinzu. Rings um uns hatten sich die Bänke geleert, wir waren allein auf unserer Seite übriggeblieben. Der Wind fegte Papierfetzen über den Rasen. Schließlich drückte sich mein Vater den steifen Hut in die Stirn und meinte zögernd:
»Ich schätze, wir müssen wohl irgendwann mal nach Hause zurück.«
Die Tore zum Cricketgelände standen weit offen, und wir schlenderten nun die von Kastanien beschattete Straße entlang. Eine Straßenbahn nach der anderen überholte uns, aber mein Vater hatte keine Lust, mit einer zu fahren. Er blieb schweigsam und bemerkte nur einmal:
»Alles wäre halb so schlimm, wenn Lena sich’s nicht so zu Herzen nähme.«
Das klang fast, als erwarte er von mir Beistand.
Kaum war er ins Haus getreten und hatte Mutter begrüßt, rief er munter:
»Nun hab ich also mein erstes Cricketspiel gesehen! Das gibt’s nicht oft – ein Mann in meinem Alter, der das zum ersten Mal erlebt …«
»Bertie!«, sagte meine Mutter mit kalter, ärgerlicher Stimme; sie konnte an jenem Abend nicht ertragen, was sie sonst hinnahm: dass er den Einfältigen spielte und sich naiver gab, als er in Wirklichkeit war. »Kommt zum Essen«, fuhr sie fort. »Lewis wird Hunger haben.«
»Sicherlich«, sagte mein Vater. An einem gewöhnlichen Tage hätte er gewiss geantwortet: »Und ich etwa nicht?«, denn er liebte seine festen Redensarten und ließ sie nicht gern ungesagt. Doch heute spürte er, dass meine Mutter litt und dass Späße nicht am Platze waren.
Wir setzten uns um den Küchentisch, auf dem kaltes Fleisch, Käse, eine Schüssel Birnenkompott, Marmeladentörtchen und ein Krug Sahne standen.
»Ihr habt doch wahrscheinlich den ganzen Tag kaum etwas gegessen«, sagte meine Mutter. »Ihr müsst jetzt ordentlich hungrig sein.«
Mein Vater ließ es sich schmecken. Ich konnte erst nicht recht zulangen, denn meine Mutter sah so anders aus als sonst, dann stopfte ich aber doch in mich hinein, wonach mein Magen verlangte. Mutter behauptete, sie habe schon gegessen, wahrscheinlich stand ihr der Sinn nicht danach. In einem Winkel der Küche – das Haus war völlig verbaut – sang der Wasserkessel auf dem Herd.
»Ich trinke eine Tasse Tee mit euch«, sagte meine Mutter. Während der Mahlzeit hatten weder sie noch Vater ein Wort gesprochen. Jetzt strich sich mein Vater den Schnurrbart, trank den ersten Schluck Tee und meinte so beiläufig wie möglich:
»Ich habe getan, was du mir gesagt hast, Lena.«
»Was denn, Bertie?«
»Ich habe Lewis gesagt, dass Myrtle Road uns Sorgen macht.«
»Sorgen«, sagte meine Mutter, »ich hoffe, du hast ihm mehr gesagt als das.«
»Ich habe getan, was du mir gesagt hast.«
»Ich hätte es dir gern erspart«, meine Mutter wandte sich mir zu, »aber ich wollte doch nicht, dass du es als Erstes von Tante Milly oder sonst jemandem hörst. Ich könnte nicht ertragen, dass du von Fremden erfährst, was du nun einmal wissen musst. Du musst es von uns erfahren.«
Sie sagte das sehr zärtlich und liebevoll, aber bittere Scham und verletzter Stolz färbten den Ton ihrer Stimme.
Doch sie hatte noch nicht alle Hoffnung aufgegeben, dagegen sträubte sich ihre kraftvolle Natur. Sie saß halb im Schatten und halb in der Lichtbahn, die die Abendsonne quer durch die Küche legte, und ihre Teetasse warf einen hellen, zitternden Kreis auf die Wand. Während sie mit ungewöhnlich hoher, gepresster, aber doch fester Stimme zu sprechen versuchte, blickte sie nur selten zu meinem Vater hinüber.
Ich verstand nicht viel von dem, was sie sagte, und fing nur auf, dass uns dreien Unglück, Kummer, Not und Schande drohten. Das widerwärtige Wort »Bankrott« kehrte immer wieder, und dann war von einem »Konkursverwalter« die Rede, der eingesetzt werden sollte.
»Wie lange können wir das noch hinausschieben?«, fragte sie eindringlich – doch mein Vater wusste es nicht, er war nicht kämpferisch wie sie und vermochte nicht auf ihre Pläne einzugehen.
Denn Pläne, wie man Geld beschaffen könne, machte sie immer noch; sie wollte unseren Arzt um ein Darlehen bitten, ihr »bisschen Schmuck« verkaufen, zu einem Geldverleiher gehen. Aber sie kannte sich zu wenig aus. Freilich war sie gescheit und hätte den rechten Sinn dafür gehabt, doch hatte es ihr an Gelegenheit gemangelt, sich das nötige Wissen anzueignen. So war sie trotz ihrer Energie hilflos und musste tatenlos dem Gang der Dinge zusehen.
Anscheinend hatte Tante Milly ihre Hilfe angeboten und wollte als Einzige von unseren Verwandten einspringen.
»Immer wieder ist sie diejenige, der wir zu Dank verpflichtet sind«, sagte meine Mutter – zu meiner Verblüffung, denn bisher hatte für mich festgestanden, dass Tante Milly unsere Erzfeindin war.
Mein Vater schüttelte den Kopf. Er sah bedrückt und elend aus, bewahrte aber seine Ruhe.
»Es hat keinen Sinn, Lena. Das würde die ganze Sache nur noch schlimmer machen.«
»Du wirfst immer gleich die Flinte ins Korn«, rief meine Mutter. »So warst du schon immer.«
»Es hat wirklich keinen Sinn weiterzumachen«, wiederholte mein Vater fast hartnäckig.
»Du hast gut reden«, erwiderte sie verächtlich. »Wovon glaubst du eigentlich, dass ich in Zukunft leben soll?«
»Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Lena«, versuchte mein Vater sie behutsam zu trösten. »Ich werde doch schließlich eine Stellung finden, wenn ich ein bisschen Zeit zum Suchen habe. So viel verdiene ich immer, dass ich dich und Lewis ernähren kann.«
»Denkst du etwa, dass ich mir deswegen Sorgen mache?«, schrie meine Mutter auf.
»Ich sorge mich jedenfalls darum«, erwiderte mein Vater.
»Irgendwie durchkommen werden wir natürlich, da habe ich gar keine Angst«, gab meine Mutter zu. »Aber ich muss mich vor den Leuten auf der Straße schämen. Ich kann ja niemandem mehr ins Gesicht sehen.«
Die Qual, die aus diesen Worten klang, schüchterte meinen Vater so ein, dass er in sich zusammensank und kein Wort des Trostes mehr wagte.
Wie ich die Eltern so sitzen sah in der nun schon düsteren Küche, sehnte ich mich beinahe schmerzhaft nach einem Leid, das dem meiner Mutter die Waage hielte, und es fehlte nicht viel, so hätte ich einen Kummer erfunden und das gespielt, was sie wirklich fühlte, nur um zu erreichen, dass sie sich um mich kümmern musste und darüber ihre eigenen Sorgen vergaß.
III
EIN KIRCHGANG
Als ich an jenem Abend schlafen ging, nahm ich unserKonversationslexikon mit auf mein Zimmer. Ich hatte es erst kurz zuvor entdeckt und empfand es seither als sehr angenehm, nicht mehr dauernd meiner Umgebung mit Fragen lästig fallen zu müssen. Jetzt aber hatte ich wirklich einen ernsthaften Grund zum Nachschlagen, denn meiner Mutter wollte ich mit dieser Sache nicht kommen, hier hieß es selbständig handeln. Als ich ins Zimmer trat, schimmerte mir ein bleicher Himmel durch das winzige Mansardenfenster entgegen, und da es eine klare Nacht war, konnte ich auch schon ein paar blasse Sterne erkennen. Eine Kerze stand neben meinem Bett. Ich zündete sie an, stellte mich, noch ehe ich mich auszog, mit dem Lexikon dicht daneben, schlug das Stichwort »Konkurs« auf und bemühte mich zu verstehen, was da stand.
Ein Luftzug ließ die Kerze tropfen, und ich knetete das weiche Wachs zwischen den Fingern. Wieder und wieder las ich die Erläuterungen des Lexikons und verglich sie mit dem, was ich von meines Vaters Reden im Gedächtnis behalten hatte, aber meine Verwirrung wurde nur größer.
Noch im Juli wurde mir klar, dass das Unheil nun seinen Lauf genommen hatte. Mein Vater ging nicht mehr regelmäßig zur Fabrik, manchmal blieb er vormittags zu Haus, manchmal wieder waren er und Mutter den ganzen Tag fort. Bei einer solchen Gelegenheit fand mich einmal Tante Milly allein im Garten.
»Ich wollte doch mal sehen, ob sie dich nicht ganz vergessen«, sagte sie.
Ich hatte vorher mit ein paar Nachbarskindern French Cricket gespielt und saß nun im Liegestuhl unter meinem Lieblingsbaum. Meine Tante blickte forschend auf mich herab.
»Sie haben dir doch hoffentlich etwas zu essen dagelassen?«, fragte sie.
»Ja«, erwiderte ich und ärgerte mich über ihre Fürsorge. Trotzdem bot ich ihr meinen Stuhl an. Was gute Manieren betraf, so hatte meine Mutter strenge – zum Teil selbst erfundene – Regeln und Grundsätze. Tante Milly lehnte unfreundlich ab.
»Ich bin alt genug, um stehen zu können«, sagte sie und fixierte mich so merkwürdig, dass mir unbehaglich zumute wurde. »Haben sie dir gesagt, was passiert ist?«, fragte sie endlich.
Zunächst wollte ich um die Sache herumreden, aber sie nahm mich ins Kreuzverhör. Ich fühlte mich ganz elend und brachte schließlich heraus, ich wisse, dass mit Vaters Fabrik nicht alles in Ordnung sei.
»Ich glaube nicht, dass du Bescheid weißt. Kein Wunder, wenn bei euch alles schiefgeht«, erklärte Tante Milly. »Wahrscheinlich sollte ich dir ja nichts sagen, aber es ist besser für dich, wenn du die ganze Wahrheit erfährst.«
Am liebsten hätte ich sie angefleht zu schweigen; voll Furcht und Hass blickte ich zu ihr auf.
Tante Milly sagte mit Nachdruck:
»Dein Vater hat Bankrott gemacht.«
Ich schwieg. Groß, laut, drohend stand sie in der Mitte des Gartens, die Sonne färbte ihr Haar mit einem rötlichen Schein. In den Blumen summte eine Biene.
»Ja, Tante Milly«, sagte ich, »ich habe von diesem – Bankrott gehört.«
Unerbittlich fuhr Tante Milly fort:
»Das heißt, dein Vater kann seine Schulden nicht bezahlen. Sechshundert Pfund sind es – wahrscheinlich sollst du’s nicht wissen –, aber mehr als zweihundert wird er niemals aufbringen können.«
Mir schienen das Riesensummen zu sein.
»Wenn du groß bist«, sagte Tante Milly, »musst du alles bis auf den letzten Penny zurückzahlen, hörst du! Am besten machst du dich jetzt schon mit dem Gedanken vertraut. Du darfst dir keine Ruhe gönnen, bis die Schuld getilgt und deine Familie wieder zu Ehren gekommen ist. Dein Vater schafft das nicht mehr. Er wird genug zu tun haben, um für euer tägliches Brot zu sorgen.«
Vielleicht erwartete sie, dass ich kleiner Kerl blindlings alles verspräche, was sie von mir verlangte. Aber ich sagte kein Wort.
»Es wird auch kein Geld da sein, um dich auf die höhere Schule zu schicken. Dein Vater kann das Schulgeld niemals aufbringen. Aber ich habe deiner Mutter schon versprochen, dass wir uns drum kümmern werden.«
Es kam mir gar nicht in den Sinn, dass es Tante Milly gut mit mir meinte, und ich wusste es auch nicht zu schätzen, dass sie sich schon jetzt um Dinge sorgte, die noch drei Jahre Zeit hatten. Ich hasste sie und war tief gekränkt; unter dem Schmerz wallte der Zorn in mir auf. Trotzdem stotterte ich, der mütterlichen Erziehung eingedenk, ein paar Dankesworte heraus.
»Mache dir auch klar«, fügte Tante Milly noch hinzu, »dass du’s auf der höheren Schule nicht so leicht haben wirst. In der altmodischen Penne, in die deine Mutter dich gesteckt hat, ist es keine Kunst, ein guter Schüler zu sein. Kein Wunder, dass du da der Beste bist. Du wirst sehen, in einer großen Schule weht ein schärferer Wind, und mich würde nicht wundern, wenn du’s dort nur bis zum Durchschnitt brächtest. Aber du musst dich natürlich trotzdem anstrengen.«
»Ich werde meine Sache schon machen, Tante Milly«, platzte ich heraus, obwohl mir jämmerlich zumute war. Ich versuchte höflich, zuversichtlich, selbstbewusst zu sein, aber es klang wahrscheinlich trotzig und ungezogen.
In diesem Augenblick trat meine Mutter zu uns in den Garten.
»Da bist du ja wieder, Lena«, sagte Tante Milly.
»Ja, ich bin wieder zurück«, erwiderte meine Mutter leise. Sie war blass und erschöpft, aller Mut schien sie verlassen zu haben. Sie fragte Tante Milly, ob sie eine Tasse Tee im Garten trinken wolle.
Tante Milly erklärte ihr, sie habe mir gesagt, dass sie für meine Ausbildung aufkommen werde.
»Das ist wirklich sehr lieb von dir, Milly«, sagte meine Mutter ohne eine Spur ihres sonstigen Stolzes. »Es täte mir so leid, wenn Lewis auf seine Ausbildung verzichten müsste.«
»Tante Milly meint, ich käme auf der höheren Schule nicht recht mit«, warf ich ein. »Ich habe ihr aber gesagt, dass ich meine Sache schon machen werde.«
Ein belustigtes, wenn auch nur mattes Lächeln huschte über das Gesicht meiner Mutter. Wahrscheinlich konnte sie sich mein Gespräch mit der Tante nur zu gut vorstellen, und gerade an diesem schlimmen Nachmittag tat ihr mein Auftrumpfen wohl.
Tante Milly hatte diesmal an Mutter nichts auszusetzen und verschonte sie auch mit ihren Binsenwahrheiten. Sie machte sogar den außergewöhnlichen Versuch, meine Mutter auf andere Gedanken zu bringen, lenkte das Gespräch auf die Politik und erklärte, die Nachrichten seien zwar schlecht, aber sie glaube deshalb doch nicht, dass es zum Kriege kommen werde.
»Schließlich leben wir doch im zwanzigsten Jahrhundert!«
Meine Mutter schlürfte langsam ihren Tee. Sie war zu abgespannt, um sich auf eine Debatte einzulassen. Sonst stritten sich die beiden auch über dieses Thema, denn Tante Milly war eine begeisterte Liberale, meine patriotische Mutter dagegen konservativ und eine eingefleischte Chauvinistin.
Tante Milly wollte sie weiter aufheitern und berichtete, dass alle möglichen Leute sich nach Mutter erkundigten.
»Das kann ich mir denken«, gab meine Mutter bitter zurück.
»Deine Freundinnen aus der Kirchgemeinde möchten dich gerne besuchen«, beharrte Tante Milly.
»Ich will niemanden sehen«, sagte meine Mutter. »Man soll mich in Ruhe lassen, Milly. Bitte halte sie mir vom Halse.«
Mehrere Tage lang verließ meine Mutter das Haus überhaupt nicht und brütete stumm und hilflos vor sich hin. Es ging über ihre Kraft, den Nachbarn unter die Augen zu treten, denn sie kannte das Geschwätz in solchen Fällen nur zu gut, und je lebhafter sie sich ausmalte, was man über uns klatschte, umso größer wurde ihre Qual. Sie wusste, man hielt sie für eitel und hochmütig und glaubte, sie dünke sich etwas Besseres. Jetzt war sie allen auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert. Sogar die wöchentliche Sitzung mit ihren kartenschlagenden Freundinnen sagte sie ab – sie fühlte sich so tief im Unglück, dass auch hier kein Hoffnungsschimmer mehr winkte.
Ich schlich auf Zehenspitzen durchs Haus, als ob Mutter krank wäre. Sie war es tatsächlich oft, denn trotz ihrer Willensstärke, trotz der Energie, mit der sie alles anpackte, und der stolzen Gewissheit, dass ihre reichen Anlagen ihr allenthalben Überlegenheit sicherten – trotz dieser Kraft ihrer Persönlichkeit konnte sie sich doch nie auf ihre Nerven verlassen. Sie war überaus zäh und hielt nicht nur psychisch, sondern auch physisch durch, wenn es darauf ankam; aber zu meinen frühesten Erinnerungen gehört doch auch ihr verdunkeltes Schlafzimmer, ihre matte Stimme, die Tasse Tee auf einem Serviertischchen im Halbdunkel und die leicht von Brandy geschwängerte Luft.
Meine Mutter trank nie außer in diesen Zeiten nervöser Erschöpfung, doch der Geruch ist mir haften geblieben – sicher, weil Tante Milly ihre spitzen Bemerkungen nicht unterdrücken konnte.
Nach dem Bankrott trachtete meine Mutter vor allem, sich dem Gerede der Leute zu entziehen. Sie war nicht eigentlich krank, nur verzagt und gebrochen. Es dauerte eine Woche, dann hatte sie sich wieder in der Gewalt.
Am ersten Sonntag im August (es war tatsächlich Sonntag, der 2. August 1914) kam sie erhobenen Hauptes und mit entschlossenem Blick zum Frühstück herunter.
»Bertie«, sagte sie zu meinem Vater, »ich gehe heute in die Kirche.«
»Tatsächlich?«, staunte mein Vater.
»Und du wirst mich begleiten, mein Junge?«, sagte sie zu mir. Dass mein Vater nicht mitkam, stand für sie ohnehin fest.
Es war ein brütend heißer Vormittag, und ich bettelte, daheim bleiben zu dürfen.
»Nein, Lewis«, sagte Mutter in einem Ton, der jeden Widerspruch erstickte, »ich möchte, dass du mitkommst. Ich will ihnen zeigen, dass sie meinetwegen schwätzen können, was sie wollen. Es wäre unter meiner Würde, wenn ich davor Angst hätte.«
»Du könntest aber doch noch ein oder zwei Wochen zuwarten, Lena«, schlug mein Vater behutsam vor.
»Wenn ich heute nicht gehe, könnten die Leute denken, wir hätten einen Grund, uns zu schämen«, sagte meine Mutter nicht sehr logisch, aber mit einer Großartigkeit, die ihr gut stand.
Sie hatte ihren Entschluss erst auf dem Weg zum Frühstückstisch gefasst, und schon hatten Unternehmungslust und Trotz sie so gestärkt, dass sie völlig verwandelt war. Fast heiter ging sie ins Schlafzimmer zurück, um sich anzuziehen, und als sie wieder herunterkam, drehte und wendete sie sich eitel, aber doch auch würdevoll und majestätisch vor mir und fragte:
»Sieht deine Mutter nicht gut aus? Bist du stolz auf mich? Bin ich hübsch genug?«
Sie trug ihr bestes elfenbeinfarbenes Kleid mit Keulenärmeln und Wespentaille. Bei jeder Wendung raffte sie den Rock, denn sie war stolz auf ihre zierlichen Fesseln. Als die Kirchenglocke zu dröhnen begann, setzte sie gerade den großen Strohhut auf und warf einen letzten befriedigten Blick in den Spiegel über der Kommode.
»Wir kommen schon«, sagte sie in das mahnende Geläut hinein, »uns braucht man nicht herbeizuzwingen.«
Sie war erregt und sah reizend aus mit ihren geröteten Wangen. Ich musste die Gesangbücher tragen, sie spannte ihren weißen Sonnenschirm auf und trat hinaus auf die sonnenhelle Straße. Sie ging langsam und geziert, wie immer, wenn sie ihre Würde unterstreichen wollte. Mich nahm sie an die Hand – ihre Finger bebten.
Vor der Kirche trafen wir mehrere Nachbarn, die »Guten Morgen, Mrs. Eliot« sagten. Meine Mutter erwiderte laut und fast ein wenig arrogant: »Guten Morgen, Mrs…« (Corby oder Berry oder Goodman, Namen, die in unserem Stadtteil häufig waren). Zum Stehenbleiben und Schwatzen war jetzt keine Zeit, denn die Glocke läutete schon schneller – ein Zeichen, dass sie bald verstummen würde.
Ohne mich von ihrer Hand zu lassen, rauschte meine Mutter das Kirchenschiff entlang und strebte ihrem angestammten Platz zu. Die Kirche stand noch nicht lange. Sie war hell getäfelt und hatte knallgelb gestrichene Stühle anstatt der festen Bankreihen, aber die prominenten Gemeindemitglieder hatten sich im Kielwasser des Doktors und seiner Schwester bereits wieder ihre Plätze ausgewählt, die ihnen auch reserviert blieben, wenn sie den Gottesdienst nicht besuchten. Meine Mutter hatte natürlich nicht gezögert, sich gleichfalls drei Plätze zu sichern, die sich unmittelbar hinter denen des Kirchenvorstandes befanden. Einer blieb stets leer, da mein Vater sich hartnäckig weigerte, uns zu begleiten.
Rechts vom Altar stand eine kleine Orgel mit leuchtend blauen Pfeifen. Die Schlussakkorde des Vorspiels waren noch nicht verklungen, als meine Mutter auf dem Polster vor ihrem Stuhl niedersank. Durch die neuen bunten Glasfenster drang das helle Morgenlicht gedämpft und wunderlich verfärbt ins Innere der Kirche.
Der Gottesdienst begann. Gewöhnlich folgte meine Mutter mit großem, vielleicht allzu kritischem Interesse, denn der Pfarrer war ein entschiedener Anhänger der Hochkirche, und sie war jedes Mal von neuem gespannt, wie »hoch« er sich mit seiner Predigt trauen werde. »Er ist tatsächlich ›höher‹, als ich’s für möglich gehalten hätte«, sagte sie dann wohl, wobei sie das Wort ›höher‹ so geheimnisvoll auszusprechen verstand, dass sowohl ihre Missbilligung wie auch die Spannung deutlich wurden. Meine Mutter war nicht nur abergläubisch, sondern auch fromm, nicht nur ein Snob, sondern auch romantisch und sentimental; sie liebte und verehrte die alte Kirche, in der sie als Kind gebetet hatte, sie liebte deren graue Gotik und den wohltuend ruhigen Gang des Gottesdienstes. Das neue Gebäude hatte sie enttäuscht, und ihre Kritik, wenn der Pfarrer von dem abwich, was ihr lieb und teuer gewesen, war im Grunde Ausdruck ihrer Anhänglichkeit und Pietät dem Alten gegenüber.
An jenem Sonntagmorgen jedoch war sie viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt, als dass sie sich um den Pfarrer hätte kümmern können. Sie meinte, alle Leute blickten nur auf sie, das machte sie befangen, und wenn sie überhaupt betete, so wohl nur um die Kraft, durchhalten zu können, denn noch stand ihr ja die Begegnung mit der Gemeinde beim Verlassen der Kirche bevor. Bei dieser Gelegenheit pflegte meine Mutter sonst Sonntag für Sonntag mit unsern Bekannten zu plaudern. Man schlenderte über den Kirchhof und teilte einander das Neueste mit, fast als ob man sich auf dem Marktplatz träfe. Das war die Probe heute, die meine Mutter bestehen musste. Dieser versammelten Menge musste sie gegenübertreten und sie bezwingen.
Sie stimmte in die Responsorien und Psalmen ein und sang die Choräle laut mit, dass ihre Nachbarn sie hören mussten. Während der Predigt, in der uns der Pfarrer in einer Randbemerkung mahnte, wir sollten daran denken, dass schwere Zeiten kommen könnten, saß sie mit stolz erhobenem Haupte da. Kaum einer nahm das ernst, denn wie für meine Mutter war auch für die meisten anderen Kirchgänger ein drohender Krieg nicht im Entferntesten so interessant wie Mr. Eliots Versagen. Unser Land hatte ja so lange Frieden gehabt – selbst wenn man die Möglichkeit eines Krieges in Erwägung zog, konnte man sich kein rechtes Bild davon machen, wie sehr er das Leben jedes Einzelnen verändern sollte.
Der Pfarrer endete mit dem Anruf der Heiligen Dreifaltigkeit, die Gemeinde schmetterte den Schlusschoral, in den auch meine Mutter mit heller Stimme einfiel, dann gingen die Kollektensammler mit den Beuteln durch die Reihen. Als sie zu uns kamen, drückte mir Mutter ein Sixpence-Stück in die Hand, während sie selbst eine halbe Krone einwarf, nicht ohne den Beutel einen Augenblick festzuhalten und die Münze so hineinfallen zu lassen, dass ihre Nachbarn sehen konnten, was sie gegeben hatte. Natürlich war das eine wohlüberlegte Verschwendung, normalerweise gab Mutter einen Schilling, und nach Tante Millys Ansicht war das schon mehr, als sie sich leisten konnte.
Schließlich kam der Segen. Mutter erhob sich von den Knien, zog ihre langen weißen Handschuhe an und nahm meine Hand fest in die ihre. Dann ging sie entschlossen am Taufbecken vorbei zur Tür und trat in den blendenden Sonnenschein auf den Kirchhof hinaus, wo sich auf den kiesbestreuten Pfaden bereits kleine Gruppen gebildet hatten. Nicht eine einzige Wolke stand am Himmel.
Als Erste trat die Frau eines Kaufmanns, der sein Geschäft in unserer Nähe hatte, auf meine Mutter zu und sagte freundlich:
»Es tut mir so leid, dass Sie Sorgen haben. Nehmen Sie’s nur nicht zu tragisch – es gibt schlimmere Dinge im Leben.«
Ich spürte das Wohlwollen, aber um Mutters Mund zuckte es – diese Güte machte sie wehrlos, und sie konnte nur ein paar Dankesworte stammeln.
Eine andere Frau steuerte auf uns zu; meine Mutter versteifte sich, presste die Lippen aufeinander und rief offensichtlich all ihren Stolz und ihre Willenskraft auf, ja, sie grüßte sogar lächelnd, allerdings mit einem recht spöttischen Lächeln.
»Ach, Mrs. Eliot, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob es Ihnen dieses Jahr wohl möglich ist, wieder eine Zusammenkunft in Ihrem Haus zu übernehmen.«
»Ich hoffe doch, Mrs. Lewin«, antwortete meine Mutter herablassend. »Ich möchte Ihr Programm auf gar keinen Fall über den Haufen werfen.«
»Ich weiß, dass Sie Schwierigkeiten haben …«
»Hat das etwas mit unserer Versammlung zu tun? Ich habe doch, soviel ich weiß, fest zugesagt. Bitte versichern Sie Mrs. Hughes (das war die Frau des Pfarrers), dass man sich nicht um einen Ersatz zu bemühen braucht.«
Die Augen meiner Mutter blitzten unternehmungslustig. Die erste Runde war überstanden, sie war nun in der richtigen Verfassung für ihre schwere Aufgabe. Sie schritt majestätisch über den Kiespfad, die Füße bedächtig nach auswärts gesetzt, und gab ihrem Sonnenschirm einen eleganten Schwung; jetzt hatte sie die Initiative ergriffen und richtete nun von sich aus das Wort an ihre Freunde, nicht ohne sich des besonders gepflegten Verkehrstons zu bedienen, über den sie bei solchen »Staatsaffären« verfügte.
Noch immer zitterte ihre Hand, die heiß in der meinen lag, aber sie gab sich keine Blöße. Niemand wagte eine Anspielung auf den Bankrott, wenn auch eine Bekannte, offensichtlich mehr aus Neugier als aus Bosheit, fragte, wie es meinem Vater gehe.
»Mr. Eliot hat sich Gott sei Dank immer einer guten Gesundheit erfreut«, erwiderte meine Mutter.
»Ist er zu Hause?«
»Natürlich«, sagte meine Mutter. »Er liest und genießt den schönen Sonntagmorgen.«
»Was will er denn nun anfangen – ich meine, was wird er nun tun?«
Meine Mutter blickte kalt auf die neugierige Fragerin hinab.
»Er hat noch keinen Entschluss gefasst«, antwortete sie so überlegen, dass die andere die Augen abwandte. »Er hat verschiedene Eisen im Feuer und will sich natürlich nicht zu billig verkaufen.«
IV
DIE HOFFNUNGEN MEINER MUTTER
Zu Hause freilich fand meine Mutter keine Ruhe, bis meinVater endlich wieder eine Stellung hatte. Sie verfolgte mit angespannter Aufmerksamkeit die Anzeigenspalten unserer Zeitung und demütigte sich sogar so weit, den Pfarrer und den Doktor um Rat anzugehen. Trotzdem dauerte es mehrere Wochen, ehe Vater etwas fand. Er kannte zwar Unternehmer in seiner Branche, die ihm in normalen Zeiten wohl geholfen hätten, aber wegen der Kriegsgefahr war keiner willens, neue Leute einzustellen. So gingen die Stunden und Tage dieses heißen Sommers dahin. Meine Mutter brachte es aber trotzdem fertig, mir samstags meinen Sixpence für den Sportplatz zuzustecken. Dort gingen die Spiele weiter wie eh und je, und die Zuschauer füllten nach wie vor die Tribünen, obwohl draußen grelle Anschlage hingen, die ich nicht recht verstand. Fettgedruckt sprang mir das Wort »Mobilmachung« in die Augen – das war am Morgen nach dem Konkurs meines Vaters; es verwirrte und verblüffte mich genauso wie das Wort »Bankrott« und jagte mir einen tieferen Schrecken ein als vielen, die älter waren als ich.
Der August neigte sich schon dem Ende zu, als meines Vaters Angelegenheit in der Zeitung erschien. Seine Schulden betrugen sechshundert Pfund; die Hauptgläubiger waren verschiedene Lederfabrikanten und Tante Millys Ehemann. Man verglich sich mit acht Schilling pro Pfund. Doch die Mitteilung verschwand neben den Meldungen vom Kriegsschauplatz. Die britischen Truppen befanden sich bei Mons noch immer auf dem Rückzug, und bei all ihrem Patriotismus wünschte meine Mutter, die schlimme Qualen ausstand in ihrem Stolz und Ungestüm, wir alle möchten von der Katastrophe verschlungen werden – die Nachbarn, unsere Stadt, das ganze Land –, damit in dieser Flut von Unheil, Not und Untergang auch ihre Schande weggeschwemmt würde.
Es wurde Oktober, und die Stecknadeln, mit denen meine Mutter auf der von der Zeitung gelieferten Karte die Fronten absteckte, kamen allmählich zum Stillstand – doch mein Vater hatte noch immer keine Arbeit. Da kam er eines Abends heim und sprach leise auf Mutter ein. Er war sehr gedrückt, und Mutter sah ich zum ersten Mal in meinem Leben weinen. Nicht etwa aus Dankbarkeit oder Erleichterung – der Kummer presste ihr diese Tränen ab, und mir fuhr aufs neue die Angst in alle Glieder. Ich hatte die ganze Zeit heimlich gefürchtet, man könne meinen Vater ins Gefängnis sperren. Der Anlass zu dieser Angst war wohl ein Gespräch mit meiner Mutter, die mir eines Abends, als wir allein beim Essen saßen, erklärte, Vater dürfe auf keinen Fall Schulden machen. Wir müssten darauf bedacht sein, von jetzt an unsere Einkäufe immer sofort bar zu bezahlen. Als ich nun Bitterkeit in Mutters Zügen und Tränen in ihren Augen sah, packte mich der Schrecken, Vater könne dieses Gebot vergessen haben. Es überraschte mich deshalb, als ich meine Mutter leise und traurig sagen hörte:
»Kommende Woche fängt Vater wieder zu arbeiten an, mein Junge.«
Die Einzelheiten erfuhr ich von Tante Milly, als sie das nächste Mal zu uns kam.
»Dein Vater hat nun also endlich wieder eine Beschäftigung.«
»Ja, Tante Milly.«
»Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass er einen guten Vertreter abgeben wird. Wenn jemand nein sagt, wird er ihn freundlich anlächeln und seines Weges gehen. Kein Wunder, wenn sie ihm nur so viel zahlen, dass ihr das Nötigste zum Leben habt.«
Der frühere Chef meines Vaters – bei uns hieß er immer nur Mr. Stapleton – hatte bei einem Lederhändler ein gutes Wort für ihn eingelegt. Mein Vater war also Reisender und musste nun seine früheren Konkurrenten besuchen.
»Wahrscheinlich sollte ich dir’s ja nicht sagen«, fuhr Tante Milly fort, »aber sie geben ihm drei Pfund die Woche. Wie ihr damit auskommen sollt, weiß ich nicht, aber es ist natürlich besser als gar nichts. Anderswo würde er wahrscheinlich auch nicht mehr bekommen.«
Um diese Zeit muss meine Mutter gemerkt haben, dass sie wieder ein Kind erwartete. Ich erfuhr nichts davon. Zwar sah ich, dass sie sich nicht wohlfühlte und dass ihre Bewegungen schwerfällig wurden, aber dass sie kränkelte, war ja nichts Neues für mich. So war ich den ganzen Winter über, auch noch im Frühling, ahnungslos und spürte nur, dass sie unablässig das Bedürfnis hatte, sich mir mitzuteilen.
Wenn ich in diesem Herbst nachmittags aus der Schule heimkam, saß sie gewöhnlich im Zimmer nach der Straße am Kamin. Draußen fiel sacht und melancholisch der Regen, es wurde schon dunkel, und die Flammen spiegelten sich, wenn sie sprunghaft aufloderten, in den Fensterscheiben. Meine Abendmahlzeit stand bereit, eine recht gute, denn wir aßen kaum schlechter als früher. Es gab zwar nicht mehr so oft Fleisch, und an Festtagen fehlte »der Vogel« auf dem Tisch – wie viel Freude hatte meiner Mutter dieses Zeichen gehobener Lebenshaltung gemacht! –, aber noch immer hätte es meine Mutter für unter ihrer Würde gehalten, mir etwa Margarine statt Butter vorzusetzen. So machte ich mich also über mein Ei her, aß meine Butter- und Marmeladenbrote und beschloss die Mahlzeit mit einem Stück selbstgebackenen Kuchens. Wir hatten keine Vera mehr, die den Tisch abräumte, aber wir ließen die Sachen stehen, denn Tante Milly schickte ihr Mädchen morgens und abends eine Stunde herüber.
Meine Mutter ließ es gern ganz dunkel werden, ehe sie das Gaslicht anzündete und die Vorhänge zuzog. Wir saßen und schauten in das gierige Feuer, Mutter konnte jauchzen vor Vergnügen, wenn die Glut unvermutet weitab von der brennenden Mitte aus schwarzen Kohlenbrocken hell aufzüngelte, und ich musste dann die gleichen flüchtigen Bilder in den zuckenden Flammen erkennen wie sie selbst.
Wenn wir an jenen Nachmittagen so im Dunkeln saßen und das Feuer seinen flatternden Schein an die Decke warf, erzählte mir meine Mutter von ihrer Familie, den Hoffnungen ihrer Jugend und ihren hochfliegenden Plänen, von ihren Empfindungen für meinen Vater, und wie wichtig es sei, dass ich einmal alles in Ordnung brächte, was ihr im Leben misslungen war.