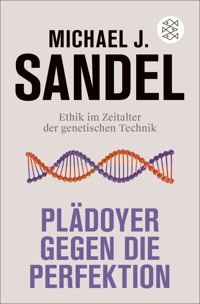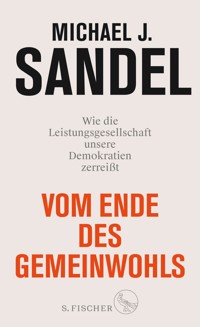16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Sandel erklärt die Theorien der Gerechtigkeit mit Klarheit und Dringlichkeit.« New York Times Seit ihren Anfängen gehört Gerechtigkeit zu den Kernthemen der Philosophie. Wie können wir die Erkenntnisse, die sie im Laufe der Jahrhunderte gewonnen hat, für unseren Alltag nutzen? Anhand konkreter Beispiele von Abtreibung und Leihmutterschaft über Preisfindung in Krisenzeiten bis hin zu Kriegsrecht und Umweltschutz macht Bestseller-Autor und Star-Philosoph Michael J. Sandel die Theorien von Aristoteles, Kant oder John Rawls für unsere Zeit fruchtbar. Welchen Wert haben moralische Normen? Gibt es Kriterien für das richtige Handeln? »Gerechtigkeit« stellt unsere Überzeugungen auf den Prüfstand und plädiert für ein moralisches Engagement der Gesellschaft, das das Gemeinwohl ins Zentrum rückt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 778
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Michael J. Sandel
Gerechtigkeit
Wie wir das Richtige tun
Über dieses Buch
»Sandel erklärt die Theorien der Gerechtigkeit mit Klarheit und Dringlichkeit.« New York Times
Seit ihren Anfängen gehört Gerechtigkeit zu den Kernthemen der Philosophie. Wie können wir die Erkenntnisse, die sie im Laufe der Jahrhunderte gewonnen hat, für unseren Alltag nutzen? Anhand konkreter Beispiele von Abtreibung und Leihmutterschaft über Preisfindung in Krisenzeiten bis hin zu Kriegsrecht und Umweltschutz macht Bestseller-Autor und Star-Philosoph Michael J. Sandel die Theorien von Aristoteles, Kant oder John Rawls für unsere Zeit fruchtbar. Welchen Wert haben moralische Normen? Gibt es Kriterien für das richtige Handeln? »Gerechtigkeit« stellt unsere Überzeugungen auf den Prüfstand und plädiert für ein moralisches Engagement der Gesellschaft, das das Gemeinwohl ins Zentrum rückt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Michael J. Sandel, geboren 1953, ist politischer Philosoph. Er studierte in Oxford und lehrt seit 1980 in Harvard. Seine Vorlesungsreihe über Gerechtigkeit begeisterte online Millionen von Zuschauern und machte ihn zum weltweit populärsten Moralphilosophen. »Was man für Geld nicht kaufen kann« wurde zum internationalen Bestseller. Seine Bücher beschäftigen sich mit Ethik, Gerechtigkeit, Demokratie und Kapitalismus und wurden in 27 Sprachen übersetzt. Bei S. FISCHER erschien zuletzt sein Klassiker »Das Unbehagen in der Demokratie. Was die ungezügelten Märkte aus unserer Gesellschaft gemacht haben«.
Helmut Reuter, geboren 1946, arbeitet seit 1995 als freier Übersetzer aus dem Englischen und Französischen. Neben den Werken Michael J. Sandels hat er u.a. Bücher von John Hands, Lawrence M. Krauss oder Niall Ferguson übersetzt. Er lebt in der Nähe von München.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
© 2009 by Michael J. Sandel
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2013 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Erschienen im Ullstein Verlag
Covergestaltung: Kosmos
Coverabbildung: iStock Photo
ISBN 978-3-10-491894-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
1 Das Richtige tun
Gemeinwohl, Freiheit und Tugend
Womit verdient man sich ein Purple Heart?
Die Bankenrettung
Drei mögliche Annäherungen an die Gerechtigkeit
Die Rangierlok ohne Bremsen
Die afghanischen Ziegenhirten
Moralische Zwickmühlen
2 Das Prinzip des größten Glücks
Jeremy Benthams Utilitarismus
Bettler zusammentreiben
Einwand 1: Die Rechte des Einzelnen
Christen den Löwen vorwerfen
Ist Folter je gerechtfertigt?
Die Stadt des Glücks
Einwand 2: Eine allgemeingültige Währung für Werte
Der Nutzen von Lungenkrebs
Explodierende Benzintanks
Preisabschlag für Senioren
Schmerz gegen Bezahlung
Die Mädels von St.Anne’s
John Stuart Mill
Das Plädoyer für die Freiheit
Höhere Freuden
Shakespeare versus Die Simpsons
3 Besitzen wir uns selbst?
Der minimale Staat
Die Philosophie des freien Marktes
Michael Jordans Geld
Besitzen wir uns selbst?
Nieren verkaufen
Beihilfe zum Suizid
Einvernehmlicher Kannibalismus
4 Bezahlte Helfer
Wehrpflicht oder Berufsarmee?
Die Argumentation zugunsten der Freiwilligenarmee
Einwand 1: Fairness und Freiheit
Einwand 2:Staatsbürgerliche Tugend und das Gemeinwohl
Schwanger gegen Bezahlung
Leihmutterverträge und Gerechtigkeit
Einwand 1:Fehlerhafte Einwilligung
Einwand 2: Abwertung und höhere Werte
Schwangerschaft auslagern
5 Es kommt auf den Beweggrund an
Kants Begründung der Rechte
Die Schwierigkeiten mit der Glücksmaximierung
Was ist Freiheit?
Personen und Sachen
Was ist Moral?
Der berechnende Krämer und das Better Business Bureau
Am Leben bleiben
Der moralische Menschenfeind
Der Held des Buchstabierwettbewerbs
Was ist der oberste Grundsatz der Sittlichkeit?
Kategorische versus hypothetische Imperative
Kategorischer Imperativ I: Eine Maxime verallgemeinern
Kategorischer Imperativ II: Personen als Zwecke behandeln
Moral und Freiheit
Fragen an Kant
Sex, Lügen und Politik
Kants Argumentation gegen Gelegenheitssex
Ist es falsch, einen Mörder zu belügen?
Hätte Kant Bill Clinton verteidigt?
Kant und Gerechtigkeit
6 Plädoyer zugunsten der Gleichheit
Verträge und ihre moralischen Grenzen
Grenzen der Übereinkunft: Baseballbilder und Toiletten
Humes Haus und die Windschutzscheibe
Sams mobiler Autodienst
Der vollkommene Vertrag
Zwei Grundsätze der Gerechtigkeit
Moralische Willkür – und was daraus folgt
Ein egalitärer Alptraum
Einwand 1: Anreize
Einwand 2:Anstrengung
Was uns zusteht – und was nicht
Ist das Leben ungerecht?
7 Eine Frage der Vielfalt
Korrektur der Prüfungsverzerrungen
Ausgleich für frühere Benachteiligungen
Förderung der Vielfalt
Affirmative Action und die Rechte des Einzelnen
Rassentrennung und antijüdische Quoten
Positive Diskriminierung für Weiße?
Gerechtigkeit und Verdienst
Warum sollten Studienplätze nichtversteigert werden?
8 Wem steht was zu?
Gerechtigkeit, Telos und Ehre
Teleologisches Denken: Tennisplätze und Pu der Bär
Was ist das Telos einer Universität?
Was ist der Zweck von Politik?
Tugend und Politik
Learning by Doing
Das gute Leben
Aristoteles’ Verteidigung der Sklaverei
Casey Martins Golfkarren
9 Was sind wir einander schuldig?
Entschuldigungen und Reparationen
Müssen wir für die Sünden unserer Vorfahren büßen?
Moralischer Individualismus
Soll der Staat moralisch neutral sein?
Gerechtigkeit und Freiheit
Die Anforderungen der Gemeinschaft
Der Mensch als Geschichtenerzähler
Verpflichtungen jenseits von Vereinbarungen
Solidarität und Zugehörigkeit
Familiäre Verpflichtungen
Französische Widerstandsbewegung
Die Rettung äthiopischer Juden
Ist Patriotismus eine Tugend?
Grenzpatrouillen
Buy American!
Solidarität und Verantwortung
Kann Loyalität stärker sein als universelle moralische Prinzipien?
Robert E. Lee
Meines Bruders Hüter I: Die Bulger-Brüder
Meines Bruders Hüter II: Der Unabomber
Gerechtigkeit und das gute Leben
10 Gerechtigkeit und Gemeinwohl
Das Streben nach Neutralität
Abtreibung und Stammzellen
Die gleichgeschlechtliche Ehe
Gerechtigkeit und das gute Leben
Eine Politik des Gemeinwohls
1. Bürgerschaft, Opfer und Dienst an der Gemeinschaft
2. Die moralischen Grenzen der Märkte
3. Ungleichheit, Solidarität und staatsbürgerliche Tugend
4. Eine Politik des moralischen Engagements
Danksagung
Sachregister
Für Kiku in Liebe
1Das Richtige tun
Im Sommer 2004 tobte der Hurrikan Charley aus dem Golf von Mexiko über Florida hinweg Richtung Atlantik. Der Sturm forderte 22 Menschenleben und verursachte Schäden in Höhe von elf Milliarden Dollar.[1] Außerdem zog er eine Debatte über Preistreiberei nach sich.
Eine Tankstelle in Orlando verkaufte Zwei-Dollar-Eispakete für zehn Dollar. Es war Mitte August, und ohne Strom für Kühlschränke und Klimaanlagen hatten viele Leute keine andere Wahl, als den Aufpreis zu bezahlen. Umgestürzte Bäume führten zu einer erhöhten Nachfrage nach Kettensägen und Dachreparaturen. Unternehmen boten an, zwei Bäume vom Dach eines Hausbesitzers abzuräumen – für 23000 Dollar. Läden, die kleine Stromgeneratoren normalerweise für 250 Dollar anboten, verlangten dafür nun 2000 Dollar. Einer 77-Jährigen, die zusammen mit ihrem noch älteren Gatten und ihrer behinderten Tochter vor dem Hurrikan floh, nahm man 160 Dollar pro Nacht für ein Motelzimmer ab, das sonst 40 Dollar kostet.[2]
Viele Einwohner Floridas waren wegen der überhöhten Preise verärgert. Eine Schlagzeile der USA Today lautete: »Nach dem Sturm kommen die Geier.« Ein Bewohner, dem man erklärte, es koste 10500 Dollar, einen umgestürzten Baum von seinem Dach zu entfernen, brachte das Unbehagen der Menschen auf den Punkt: Es sei einfach nicht inOrdnung, wenn Leute versuchten, »aus Not und Elend anderer Menschen Kapital zu schlagen«. Charlie Crist, der Justizminister von Florida, schloss sich dieser Meinung an: »Es erstaunt mich, wie viel Gier in der Seele mancher Leute wohnen muss, dass sie bereit sind, von Menschen zu profitieren, die unter den Folgen eines Hurrikans leiden.«[3]
In Florida gibt es ein Gesetz gegen Preiswucher, und im Gefolge des Hurrikans gingen bei den Behörden mehr als 2000 Beschwerden ein. Einige davon führten zu erfolgreichen Gerichtsverfahren. Ein Hotel in West Palm Beach musste 70000 Dollar an Strafen und Entschädigungen bezahlen, weil es seinen Kunden zu viel abgenommen hatte.[4]
Als Crist sich anschickte, dem Gesetz gegen Preiswucher tatsächlich Geltung zu verschaffen, brachten einige Ökonomen vor, dieses Gesetz – und die öffentliche Aufregung – beruhten auf einer falschen Annahme. Während im Mittelalter die Philosophen und Theologen glaubten, dass der Austausch von Gütern durch einen »gerechten Preis« geregelt sein solle, der den Dingen aufgrund von Tradition oder einem ihnen innewohnenden Wert zukomme, würden in Marktgesellschaften die Preise durch Angebot und Nachfrage festgelegt. So etwas wie einen »gerechten Preis«, so die Ökonomen, gebe es einfach nicht.
Thomas Sowell, ein Vertreter des freien Marktes, bezeichnete Preiswucher als »emotionsmächtigen, aber ökonomisch bedeutungslosen Begriff. Die meisten Ökonomen schenken ihm keine Beachtung, weil er zu wirr erscheint, als dass man sich mit ihm befassen müsste.« In der Zeitung Tampa Tribune versuchte Sowell sogar zu erklären, »wie Preiswucher den Menschen in Florida hilft«. Die Menschen sprächen von Wucher, »wenn die Preise erheblich höher sind als gewohnt«, schrieb Sowell. Doch das Preisniveau, »an das wir gewöhnt sind, ist in moralischer Hinsicht nicht besser oder fairer als die Preise, die der Hurrikan nach sich zieht«.[5]
Höhere Preise für Eis, Mineralwasser, Dachreparaturen, Notstromaggregate und Motelzimmer hätten, so Sowell, den Vorteil, dass sie die Nutzung dieser Dinge durch Verbraucher begrenzten und die Anreize für weit entfernte Anbieter erhöhten, die nach dem Hurrikan am dringendsten benötigten Güter und Dienstleistungen bereitzustellen. Wenn die Bewohner Floridas in der Augusthitze mit Stromausfällen konfrontiert seien und ein Sack Eis zehn Dollar bringe, würden Eisfabriken es lohnendfinden, mehr davon zu produzieren und nach Florida zu verfrachten. Nichts an den Preisen sei ungerecht – sie gäben einfach den Wert wieder, den Käufer und Verkäufer den Dingen beimäßen, die sie tauschten.[6]
Mit ähnlichen Argumenten wandte sich der Marktliberale Jeff Jacoby in einem für den Boston Globe verfassten Kommentar gegen Gesetze zur Einschränkung von Preiswucher: »Es ist kein Wucher, wenn man verlangt, was der Markt hergibt. Das ist weder gierig noch unverfroren. Es ist die Art, in der Güter und Dienstleistungen in einer freien Gesellschaft verteilt werden.« Wie Jacoby einräumte, seien »die Preisspitzen empörend, besonders für jemanden, dessen Leben soeben durch einen todbringenden Sturm aus der Bahn geworfen wurde«. Doch die Empörung rechtfertige keinen Eingriff in die Mechanismen des freien Marktes. Dadurch, dass die scheinbar exorbitanten PreiseAnreize für Anbieter schüfen, mehr dieser notwendigen Güter herzustellen, »bringen sie mehr Nutzen als Schaden«. Seine Folgerung: »Floridas Wiederaufbau wird nicht beschleunigt, indem man die Verkäufer verteufelt, sondern indem man ihnen freie Hand lässt.«[7]
In einem Gastkommentar der Zeitung in Tampa verteidigte Justizminister Crist (ein Republikaner, der 2006 zum Gouverneur Floridas gewählt wurde) hingegen das Gesetz gegen Preiswucher: »In Notzeiten darf die Regierungnichtzulassen, dass Menschen, die mit ihrer Familie vor einem Hurrikan fliehen, für grundlegende Versorgungsgüter unzumutbare Preise abverlangt werden.«[8] Crist wies die Vorstellung zurück, diese »unzumutbaren« Preise stünden für einen wirklich freien Tausch:
Hier liegt keine normale freie Marktsituation vor, in der sich Käufer und Verkäufer freiwillig auf einen Preis einigen, der auf Angebot und Nachfrage beruht. In einer Notlage stehen die Käufer unter Zwang. Sie sind unfrei. Was sie an Notwendigem beschaffen – etwa sichere Unterkünfte – kaufen sie notgedrungen.[9]
Die Debatte über Preiswucher, die nach dem Hurrikan Charley aufkam, wirft schwierige Fragen zur Moral und zum Recht auf: Ist es falsch, wenn Verkäufer von Waren und Dienstleistungen eine Naturkatastrophe ausnutzen und verlangen, was der Markt hergibt? Und wenn ja, was sollte der Gesetzgeber dagegen unternehmen? Sollte der Staat Preiswucher verbieten, selbst wenn er damit in die Freiheit der Käufer und Verkäufer eingreift, untereinander nach Belieben Geschäfte abzuschließen?
Gemeinwohl, Freiheit und Tugend
Bei diesen Fragen geht es nicht nur darum, wie wir miteinander umgehen sollten. Es geht auch darum, wie das Recht lauten und wie die Gesellschaft organisiert werden sollte. Es geht um Fragen der Gerechtigkeit. Um sie beantworten zu können, müssen wir herausfinden, was Gerechtigkeit bedeutet. Eigentlich haben wir damit schon begonnen. Sieht man sich die Diskussion über Preiswucher genauer an, wird man bemerken, dass die Argumente für und gegenGesetze zum Preiswucher sich um drei Leitgedanken drehen: die Mehrung des Gemeinwohls, die Achtung vor der Freiheit und die Förderung der menschlichen Tugenden. Jede dieser Vorstellungen verweist auf einen jeweils anderen Ansatz, über Gerechtigkeit nachzudenken.
Das Standardargument für freie Märkte beruht auf zwei Behauptungen – eine betrifft das Gemeinwohl, die andere die Freiheit. Die erste Behauptung lautet: Märkte fördern das Wohl einer Gesellschaft insgesamt, weil sie Menschen Anreize bieten, hart zu arbeiten und damit die Güter bereitzustellen, die andere Menschen sich wünschen. Märkte mehren den Wohlstand und dienen damit dem Gemeinwohl. Die zweite Behauptung: Märkte respektieren die Freiheit des Einzelnen; anstatt Gütern und Leistungen einen bestimmten Wert aufzuzwingen, lassen Märkte die Menschen selbst entscheiden, welchen Wert sie den Dingen beimessen wollen, die sie tauschen.
Und wie halten es die Befürworter der Gesetze gegen Preiswucher? Erstens bringen sie vor, dem Gemeinwohl der Gesellschaft sei durch die in schwierigen Zeiten überhöhten Preise nicht wirklich gedient. Selbst wenn höhere Preise für eine größere Gütermenge sorgten, müsse das gegen die Last abgewogen werden, die man den Armen aufbürde. Für Begüterte mag es so gesehen ärgerlich sein, die aufgrund des Sturms aufgeblähten Preise für den Liter Benzin oder das Hotelzimmer zu bezahlen. Für Menschen mit bescheidenen Mitteln stellen diese Preise jedoch eine wirkliche Härte dar, die sie sogar dazu bringen könnte, lieber inmitten der Katastrophe auszuharren, als sich in Sicherheit zu bringen. Jede Bewertung des Gemeinwohls müsse den Schmerz und das Leid jener einbeziehen, die in einem Notfall ihre Grundbedürfnisse nichtmehr befriedigen könnten, weil das zu viel kostet.
Zweitens, so behaupten die Befürworter der Gesetzegegen Preiswucher, sei der freie Markt unter bestimmten Umständen nicht wirklich frei. Wenn jemand mit seiner Familie vor einem Hurrikan flieht, so argumentiert Crist, dann ist der überhöhte Preis für Benzin oder Unterkunft nicht wirklich Ausdruck eines freien Austauschs. Es handelt sich eher um Erpressung. Um entscheiden zu können, ob Gesetze gegen Preiswucher gerechtfertigt sind, müssen wir also diese unterschiedlichen Vorstellungen von Gemeinwohl und Freiheit gegeneinander abwägen.
Doch es gibt noch ein weiteres Argument. Ein großer Teil der öffentlichen Unterstützung für Gesetze gegen Preiswucher speist sich aus einer tiefer liegenden Quelle. Die Menschen empören sich über »Geier«, die die verzweifelte Lage anderer ausnutzen; sie wollen sie bestraftsehen, nicht belohnt. Derlei Empfindungen werden oft als atavistische Gefühle abgetan, die in der Politik oder in den Gesetzen nichts zu suchen hätten. In Jacobis Worten: »Floridas Wiederaufbau wird nicht beschleunigt, indem man die Verkäufer verteufelt.«[1]
Doch die Empörung über Preistreiber ist mehr als unbedachter Ärger. Sie verweist auf eine durchaus ernstzunehmende Argumentation. Empörung ist jener besondere Zorn, den man empfindet, wenn man glaubt, jemand bekomme etwas, was ihm nicht zustehe. Empörung dieser Art ist Zorn über Ungerechtigkeit.
Als Crist davon sprach, welche »Gier in der Seele mancher Leute wohnen muss, dass sie bereit sind, von Menschen zu profitieren, die unter den Folgen eines Hurrikans leiden«, rührte er an die moralische Quelle dieser Empörung. Zumindest implizit gab er seinen Lesern zu verstehen: Gier ist ein Laster, eine schlechte Lebensart, besonders dann, wenn die Menschen dadurch blind für die Leiden anderer werden. Und sie ist mehr als ein individuelles Laster – sie widerspricht den Werten der Zivilgesellschaft. In stürmischen Zeiten rückt eine gute Gesellschaft zusammen. Anstatt nach maximalen Vorteilen zu streben, geben die Menschen aufeinander acht. Eine Gesellschaft, in der Menschen während einer Krise ihre Nachbarn ausbeuten, ist keine gute Gesellschaft. Deshalb ist exzessive Gier ein Laster, das es zu bekämpfen gilt. Gesetze gegen Preiswucher können die Gier zwar nicht verhindern, aber zumindest ihre unverfrorensten Auswüchse eindämmen und zeigen, dass die Gesellschaft sie missbilligt. Eine Gesellschaft, die gieriges Verhalten eher bestraft als belohnt, fördert die Tugend, miteinander zu teilen und Opfer für das Gemeinwohl gemeinsam zu tragen.
Obwohl dieses Argument einleuchtet, heißt das natürlich nicht automatisch, dass es stets Vorrang vor konkurrierenden Überlegungen haben muss. In manchen Fällen könnte man auch zu dem Schluss kommen, eine vom Hurrikan getroffene Gemeinschaft sollte einen Pakt mit dem Teufel schließen – also Wucherpreise gestatten, weil man hofft, damit eine Armee von Dachdeckern und anderen Aufbauspezialisten auf den Plan zu rufen, sogar um den Preis, dass man damit Gier billigt. Erst werden also die Dächer repariert, um das soziale Gefüge kümmern wir uns später. Trotzdem ist festzuhalten, dass die Debatte über Gesetze gegen Preiswucher – neben Fragen des Gemeinwohls und der Freiheit – tuch immer die von uns geteilten Werte thematisiert. Es geht um die Frage, wie man die Einstellungen, Voraussetzungen und Charaktereigenschaften kultiviert, die in einer guten Gesellschaft wünschenswert sind.
Manche Menschen, darunter auch viele, die Gesetze gegen Preiswucher befürworten, empfinden beim Tugend Argument Unbehagen. Der Grund: Es scheint stärker wertend vorzugehen als Argumente, die sich auf das Allgemeinwohl und die Freiheit berufen. Die Frage, ob eine bestimmte Politik die wirtschaftliche Erholung beschleunigt oder wirtschaftliches Wachstum befeuert, lässt sich weitgehend wertfrei klären. Denn man geht davon aus, dass alle lieber mehr als weniger verdienen. Dabei ist es ganz egal, wie die Menschen ihr Geld ausgeben. Ähnlich verhält es sich mit der Frage, ob Menschen in einer Notlage wirklich frei entscheiden können – sie erfordert nicht, diese Entscheidungen zu bewerten. Die Frage ist lediglich, ob oder in welchem Ausmaß Menschen frei oder eben notgedrungen handeln.
Dagegen beruht das Tugend-Argument auf dem Werturteil, dass Gier ein Laster sei, das der Staat nicht auch noch ermutigen sollte. Doch wer entscheidet darüber, was Tugend und was Laster ist? Lässt sich darüber in pluralistischen Gesellschaften nichttrefflich streiten? Und ist es nicht gefährlich, Werturteile per Gesetz durchzusetzen? Angesichts dieser Problematik halten viele Menschen daran fest, dass die Regierung in Fragen der Tugenden und der Laster neutral zu sein hat und nicht versuchen sollte, gute Einstellungen zu fördern und schlechten entgegenzuwirken.
Wenn wir also unseren Reaktionen auf Preiswucher nachspüren, sehen wir uns in verschiedene Richtungen gezogen: Wir sind empört, wenn Menschen etwas bekommen, was ihnen nichtzusteht; Gier, die menschliches Elend ausnutzt, denken wir, sollte bestraft und nicht belohnt werden. Und doch sind wir besorgt, wenn Werturteile Eingang in die Gesetzgebung finden.
Dieser Zwiespalt verweist auf eine der großen Fragen der politischen Philosophie: Soll eine gerechte Gesellschaft danach streben, die Tugend ihrer Bürger zu fördern? Oder sollte das Gesetz gegenüber konkurrierenden Entwürfen neutral sein, damit die Bürger selbst frei entscheiden können, wie sie am besten leben?
Folgt man den Erklärungen aus den Lehrbüchern, scheidet sich an dieser Frage das politische Denken des Altertums von dem der Neuzeit. Das ist nicht ganz falsch. Wie Aristoteles lehrt, bedeutet Gerechtigkeit, den Menschen zu geben, was ihnen zusteht. Und um festzustellen, wem was zusteht, müssen wir bestimmen, welche Tugenden es wert sind, belohnt zu werden. Aristoteles besteht darauf, dass wir nicht herausfinden können, was eine gerechte Verfassung ist, ohne zuerst zu entscheiden, wie wir leben wollen. Für ihn kann das Gesetz gegenüber Fragen des richtigen Lebens nicht neutral sein.
Moderne politische Philosophen – von Immanuel Kant im 18. bis John Rawls im 20. Jahrhundert – bringen hingegen vor, die Grundsätze der Gerechtigkeit sollten nicht auf irgendwelchen spezifischen Wertvorstellungen beruhen. Eine gerechte Gesellschaft achte vielmehr die Freiheit des Einzelnen, die eigene Vorstellung vom guten Leben selbst zu wählen.
Man könnte also sagen, dass die alten Theorien zur Gerechtigkeit mit der Tugend beginnen, die modernen dagegen mit der Freiheit. In den folgenden Kapiteln erkunden wir Stärken und Schwächen beider Ansätze. Es lohnt sich jedoch, gleich zu Beginn darauf hinzuweisen, dass uns dieser historische Gegensatz in die Irre führen kann.
Denn wenn wir unseren Blick auf jene Argumente richten, die in den aktuellen politischen Diskussionen eine Rolle spielen – nicht unter Philosophen, sondern unter gewöhnlichen Leuten – sehen wir ein komplizierteres Bild. Zwar herrschen die Argumente vor, in denen es um unseren Wohlstand oder die Freiheit des Einzelnen geht, aber hinter diesen Argumenten (und manchmal im Widerstreit mit ihnen) können wir oft die Werturteile und Überzeugungen der Diskutanten ausmachen. Implizit geht es auch immer um die Frage, welche Tugenden belohnt und welche Lebensweise von einer guten Gesellschaft gefördert werden sollten.
Wie wir es auch drehen und wenden: Den auf Werturteilen beruhenden Wesenszug der Gerechtigkeit können wir nicht ganz abschütteln. Die Überzeugung, dass Gerechtigkeit sicher ohne Freiheit, aber eben auch ohne Tugend nicht zu haben sei, reicht tief. Wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken, scheinen wir dadurch unausweichlich gezwungen zu sein, über die beste Lebensführung nachzudenken.
Womit verdient man sich ein Purple Heart?
Bei manchen Themen ist nur allzu offensichtlich, dass es um Fragen von Tugend und Ehre geht. Nehmen wir die jüngste Debatte darüber, wer das Purple Heart verdient. Seit 1932 hat das Militär der USA diesen Orden an Soldaten verliehen, die im Kampfdurch Feindeinwirkung verwundet oder getötet wurden. Neben der Ehrung erhalten die Geehrten auch spezielle Vorrechte in Kliniken für Veteranen.
Seit Beginn der aktuellen Kriege im Irak und in Afghanistan wurde bei einer zunehmenden Zahl von Soldaten eine Posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Zu den Symptomen zählen wiederkehrende Alpträume, schwere Depressionen und Suizidgefahr. Wie es heißt, leiden derzeit mindestens 300000 Veteranen an posttraumatischem Stress oder schweren Depressionen. Fürsprecher dieser Veteranen haben vorgeschlagen, auch sie sollten für den Purple Heart-Orden in Frage kommen, da psychische Verletzungen mindestens ebenso quälend sein können wie körperliche Wunden.[1]
Nachdem eine Beraterkommission die Frage untersucht hatte, verkündete das Pentagon 2009, das Purple Heart bleibe den Soldaten mit körperlichen Wunden vorbehalten. Veteranen, die an psychischen Störungen und Traumata litten, kämen nicht in Frage, auch wenn ihnen seitens der Regierung eine medizinische Behandlung und Behindertenrenten zustünden. Das Pentagon lieferte zwei Begründungen für diese Entscheidung: Posttraumatische Belastungsstörungen seien erstens nicht durch absichtliche Feindeinwirkung verursacht, zweitens seien sie objektiv nur schwer zu diagnostizieren.[2]
Hat das Pentagon die richtige Entscheidung getroffen? Selbst nach seinen eigenen Maßstäben sind die Begründungen nicht überzeugend. Auch wenn posttraumatische Störungen schwerer zu diagnostizieren sein dürften als ein Beinbruch, kann die dadurch ausgelöste Verletzung schwerer sein und länger anhalten. Eine der am häufigsten mit dem Purple Heart anerkannten Verletzungen aus dem Irakkrieg war ein perforiertes Trommelfell – es wurde durch nahe Explosionen verursacht.[3] Doch im Gegensatz zu Geschossen und Granaten sind solche Explosionsgeräusche nicht einer vorsätzlichen feindlichen Taktik zuzurechnen. Wie traumatisierender Stress sind sie ein zerstörerischer Nebeneffekt von Gefechtshandlungen.
Wie sich in der anschließenden Debatte schnell gezeigt hat, drehte sich die Auseinandersetzung eigentlich um die Bedeutung des Ordens und die Tugenden, die durch ihn ausgezeichnet werden. Auf welche Tugenden kommt es nun an? Im Gegensatz zu anderen militärischen Auszeichnungen wird mit dem Purple Heart nicht Tapferkeit honoriert, sondern das Opfer, das jemand gebracht hat. Dazu ist kein heroischer Akt erforderlich, nur eine durch den Feind zugefügte Verwundung. Die Frage ist, welche Art von Verletzung zählen soll.
Eine Veteranenvereinigung namens Military Order of the Purple Heart war dagegen, den Orden für psychische Wunden zu verleihen – man behauptete, damit würde der Ehrung »die Basis entzogen«. Ein Sprecher der Vereinigung stellte fest, zentrales Eignungskriterium solle »vergossenes Blut« sein.[4] Er verzichtete jedoch darauf, zu erklären, warum nicht blutende Verletzungen nicht zählen sollten. Doch Tyler E. Boudreau, ein ehemaliger Captain der Marine, der die Einbeziehung psychischer Verletzungen befürwortet, bietet eine überzeugende Analyse des Disputs an. Er führt den Widerstand auf eine tiefsitzende Einstellung innerhalb des Militärs zurück, wonach posttraumatischer Stress eine Art Schwäche sei. »Die gleiche Kultur, die Härte verlangt, bestärkt auch die Skepsis gegenüber der Ansicht, die Gewalttätigkeit des Krieges könne auch die robustesten Gemüter verletzen … Solange unsere Militärkultur zumindest von einer stillen Verachtung gegenüber den psychischen Verletzungen durch den Krieg geprägt ist, ist es leider unwahrscheinlich, dass diese Veteranen jemals ein Purple Heart bekommen werden.«[5]
Die Debatte über das Purple Heart ist weniger ein medizinischer oder klinischer Streit darüber, wie man feststellen kann, ob wirklich eine Verletzung vorliegt, als viel mehr ein Streit über moralische Eigenschaften und militärische Werte. Jene, die darauf beharren, dass nur blutende Wunden zählen sollten, sind überzeugt, dass posttraumatischer Stress eine Charakterschwäche widerspiegele. Jene, die glauben, psychische Verletzungen sollten zu der Auszeichnung berechtigen, bringen vor, dass Veteranen mit anhaltenden Traumata und schweren Depressionen ebenso große und ehrenhafte Opfer für ihr Land gebracht hätten wie Soldaten, die zum Beispiel ein Glied verloren haben.
Der Streit um diese Auszeichnung illustriert damit die moralische Logik der aristotelischen Theorie der Gerechtigkeit. Wir können nicht bestimmen, wer eine militärische Auszeichnung verdient, ohne zu fragen, welche Tugenden der Orden eigentlich honoriert. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir konkurrierende Vorstellungen davon bewerten, was einen guten Charakter oder ein zu honorierendes Opfer ausmacht.
Man könnte vorbringen, militärische Auszeichnungen seien ein Sonderfall, ein Rückfall in eine altertümliche Ethik von Ehre und Tugend. Heutzutage denken wir beim Thema Gerechtigkeit eher daran, wie die Früchte des Wohlstands oder die Lasten der Wirtschaftskrise zu verteilen sind und wie man die Grundrechte der Bürger bestimmen soll. Auf diesen Gebieten dominieren meist Erwägungen zum Gemeinwohl und der individuellen Freiheit. Und doch führt uns gerade die Erörterung ökonomischer Zusammenhänge zu der von Aristoteles in den Raum gestellten Frage, was Menschen moralisch zusteht und warum.
Die Bankenrettung
Sehen wir uns beispielsweise die öffentliche Wut anlässlich der Finanzkrise 2008/09 an. Jahrelang waren Aktienkurse und Immobilienpreise gestiegen. Die Abrechnung kam, als die Blase platzte. Banken und Finanzinstitute der Wall Street hatten Milliarden verdient – mit komplexen, durch Hypotheken abgesicherten Investments, deren Wert nun abstürzte. Einst stolze Firmen der Wall Street taumelten am Rand des Abgrunds. Der Aktienmarkt rauschte nach unten, was nicht nur großen Investoren verheerende Verluste brachte, sondern auch normalen Amerikanern, deren Pensionsrücklagen stark an Wert verloren. Das Gesamtvermögen amerikanischer Familien stürzte 2008 um elf Billionen Dollar ab – dieser Betrag entspricht der jährlichen Wirtschaftsleistung von Deutschland, Japan und Großbritannien zusammen.[1]
Im Oktober 2008 verlangte Präsident George W. Bush vom Kongress 700 Milliarden Dollar, um die großen Finanzfirmen und Banken zu retten. Dass die Wall Street sich in guten Zeiten riesiger Profite erfreut hatte, nun aber die Steuerzahler bat, die Rechnung zu übernehmen, nachdem die Dinge sich zum Schlechten gewendet hatten, erschien alles andere als fair. Die Banken und Finanzfirmen indes waren so schnell gewachsen und so intensiv mit der gesamten Wirtschaft vernetzt, dass ihr Zusammenbruch möglicherweise das ganze Finanzsystem mit sich gerissen hätte. Sie waren »too big to fail« – »zum Scheitern zu groß«.
Niemand behauptete, die Banken und Investmenthäuser hätten das Geld verdient. Ihre rücksichtslosen Wetten (ermöglicht durch unzureichende gesetzliche Regelungen) hatten die Krise ja erst hervorgerufen. Hier lag jedoch ein Fall vor, bei dem das Wohlergehen der Wirtschaft insgesamt schwerer zu wiegen schien als Überlegungen, was fair sei. Widerstrebendbewilligte der Kongress die Gelder.
Dann folgten die Boni. Kaum hatte das Rettungsgeld zu fließen begonnen, enthüllten neue Berichte, dass einige der jetzt am öffentlichen Tropf hängenden Firmen ihren Führungskräften millionenschwere Bonuszahlungen gewährten. Der ungeheuerlichste Vorgang betraf die American International Group (A. I. G.), einen Versicherungsriesen, der durch riskante Investments seiner Abteilung für Finanzprodukte in den Ruin getrieben worden war. Obwohl die Firma mit massiven Geldtransfusionen aus öffentlichen Mitteln (insgesamt 173 Milliarden Dollar) gerettet worden war, zahlte sie Boni in Höhe von 165 Millionen an Angestellte genau jener Abteilung, die die Krise herbeigeführt hatte. 73 Mitarbeiter erhielten eine Million Dollar oder mehr.[2]
Als das bekannt wurde, entfachte es einen Feuersturm öffentlicher Proteste. Dieses Mal ging es nicht um zehn Dollar teure Säcke mit Eis oder überhöhte Preise für Motelzimmer. Die Entrüstung galt den üppigen, aus Steuermitteln bestrittenen Belohnungen für Mitglieder einer Abteilung, die dazu beigetragen hatte, das globale Finanzwesen fast zur Kernschmelze zu bringen. Hier stimmte etwas nicht. Obwohl die US-Regierung inzwischen 80 Prozent der Firma besaß, plädierte der Finanzminister beim (von der Regierung ernannten) Vorstand der A. I. G. vergeblich dafür, die Zahlung der Boni rückgängig zu machen. »Wir können die besten und hellsten Köpfe nicht rekrutieren und halten«, erwiderte der Vorstandsvorsitzende, »wenn sie befürchten müssen, ihre Vergütung sei willkürlichen Anpassungen durch das Finanzministerium unterworfen.« Er behauptete, die Fähigkeiten der Angestellten seien unverzichtbar, um die toxischen Wertpapiere zum Wohle des Steuerzahlers loszuwerden, denn der besitze schließlich den größten Anteil des Unternehmens.[3]
Die Öffentlichkeit reagierte mit Wut. Eine ganzseitige Überschriftinder New York Post brachte die Gefühle vieler Menschen auf den Punkt: »Nicht so schnell, ihr gierigen Bastarde.«[4] Das Repräsentantenhaus versuchte, sich einen Teil des Geldes zurückzuholen – es billigte ein Gesetz, das eine Steuer von 90 Prozent auf Boni vorsah, die Angestellte von Firmen erhalten hatten, denen substantielle Rettungsgelder gewährt worden waren.[5] Auf Drängen des New Yorker Justizministers Andrew Cuomo willigten 15 der 20 Empfänger von Spitzenboni der A. I. G. ein, die Zahlungen zurückzugeben, was insgesamt etwa 50 Millionen einbrachte.[6] Diese Geste beschwichtigte die öffentliche Entrüstung ein wenig, worauf die Unterstützung für die Strafsteuer im Senat schwand.[7] Doch die Episode sorgte dafür, dass die Öffentlichkeit fortan zögerte, noch mehr Geld auszugeben, um das Schlamassel zu beheben, das die Finanzbranche geschaffen hatte.
Kern der Entrüstung über die Bankenrettung war ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Schon ehe das Thema der Boni hochkochte, war die öffentliche Unterstützung für das Rettungspaket zurückhaltend und umstritten. Die Amerikaner standen unschlüssig zwischen der Notwendigkeit, eine ökonomische Kernschmelze zu verhindern, und ihrer Überzeugung, dass es zutiefst unfair war, gescheiterten Banken und Investmentfirmen große Summen zuzuführen. Um eine gesamtwirtschaftliche Katastrophe zu vermeiden, stimmten der Kongress und die Öffentlichkeit den Hilfszahlungen zu. Doch moralisch gesehen hatte es sich die ganze Zeit wie eine Art Erpressung angefühlt.
Hinter der Empörung über die Bankenrettung stand die Überzeugung, dass die Angestellten, die Boni erhielten (oder die Firmen, die Rettungsgelder bekamen), diese nicht verdient hatten. Aber warum nicht? Der Grund dürfte weniger offensichtlich sein, als es zunächst scheint. Sehen wir uns zwei mögliche Antworten an – eine hat mit Gier zu tun, die andere mit der Tatsache des Scheiterns.
Eine Ursache der Empörung war, dass die BoniGier zu belohnen schienen, was die Öffentlichkeit schlicht moralisch widerwärtig fand. Nicht nur die Bonuszahlungen, sondern auch die Bankenrettung insgesamt schienen perverserweise gieriges Verhalten zu belohnen, anstatt es zu bestrafen. Die Derivate-Händler hatten durch ihre waghalsigen Investments nicht nur ihre Firma, sondern das ganze Land in höchste finanzielle Not gebracht. In guten Zeiten hatten sie die Profite eingesackt, und selbst nachdem ihre Investments abgestürzt waren, sahen sie keinen Fehler darin, Millionen Dollar als Boni einzustreichen.[8]
Die Kritik angesichts der Gier wurde nicht nur von den Zeitungen, sondern auch von Vertretern der politischen Klasse geäußert. Der demokratische Senator Sherrod Brown aus Ohio erklärte, das Verhalten von A. I. G. habe »einen Beigeschmack von Gier, Überheblichkeit und Schlimmerem«.[9] Präsident Barack Obama stellte fest, A. I. G. »befindet sich aufgrund ihrer eigenen Rücksichtslosigkeit und Gier in finanziellen Nöten«.[10]
Das Problem der Gier-Kritikbesteht darin, dass sie nicht zwischen den nach dem Crash gewährten – und staatlich subventionierten – Boni und jenen Boni unterscheidet, die von den Märkten gewährt wurden, als es gut lief. Gier ist ein Laster, eine schlechte Einstellung, eine übertriebene, engstirnige Begierde nach Gewinnen. Aber gibt es irgendeinen Grund für die Annahme, dass die Empfänger von Boni derzeit gieriger sind als ein paar Jahre zuvor, als sie ganz oben schwammen und sogar noch höhere Belohnungen einstrichen?
Die Händler, Banker und Hedgefonds-Manager an der Wall Street sind ein hartgesottener Haufen. Ihren Lebensunterhalt verdienen sie sich mit dem Streben nach finanziellen Gewinnen. Ob ihr Beruf nun den Charakter verdirbt oder nicht – ihre Tugendhaftigkeit wird wohl kaum mit dem Steigen und Fallen der Aktienmärkte korrelieren. Wenn es also falsch ist, ihre Gier mit üppigen Boni aus dem Bankenrettungsfonds zu belohnen, ist es dann nicht ebenso falsch, sie im Einklang mit den Märkten zu belohnen? Die Öffentlichkeit war empört, als 2008 Firmen der Wall Street (einige aus Steuermitteln zur Bankenrettung) 16 Milliarden Dollar an Boni ausschütteten. Diese Summe machte jedoch nur die Hälfte der Beträge aus, die 2006 (34 Milliarden) und 2007 (33 Milliarden) gezahlt worden waren.[11] Wenn Gier der Grund ist, weshalb sie das Geld jetzt nicht verdient haben sollten – auf welcher Grundlage lässt sich dann sagen, dass sie das Geld damals verdient gehabt hätten?
Ein offensichtlicher Unterschied besteht darin, dass die Boni der Bankenrettung vom Steuerzahler stammen, während die in guten Zeiten angezahlten Boni von den Firmen erwirtschaftet wurden. Beruht die Empörung jedoch auf der Überzeugung, die Boni seien unverdient, so ist die Quelle der Bezahlung moralisch nicht entscheidend. Aber damit haben wir einen Hinweis: Die Boni kommen vom Steuerzahler, weil die Firmen gescheitert sind. Das führt uns ins Zentrum der Beschwerden. Die wahren Einwände der amerikanischen Öffentlichkeit gegen die Boni – und die Bankenrettung – beziehen sich nicht darauf, dass sie Gier belohnen, sondern darauf, dass sie das Scheitern belohnen.
Scheitern wird von den Amerikanern schärfer missbilligt als Gier. In marktgesteuerten Gesellschaften wird von ehrgeizigen Menschen erwartet, dass sie ihre Interessen energisch verfolgen, und die Trennlinie zwischen Eigennutz und Gier ist oft verschwommen. Dagegen ist die Trennlinie zwischen Erfolg und Scheitern deutlicher gezogen. Und die Vorstellung, dass Menschen aus ihren Erfolgen Kapital schlagen dürfen, macht den Kern des amerikanischen Traums aus.
Ungeachtet seiner beiläufigen Erwähnung der Gier verstand Präsident Obama nur zu gut, dass die tiefere Ursache für die Empörung darin lag, dass Scheitern belohnt worden war. Als Obama deshalb Gehaltsgrenzen für die Bezahlung von Führungskräften in Firmen ankündigte, die Rettungsgelder bezogen, wies er auf die eigentliche Quelle der Empörung über die Bankenrettung hin:
Dies ist Amerika. Wir setzen Reichtum nicht herab. Wir missgönnen es keinem, wenn er Erfolg hat. Und ganz sicher glauben wir, dass Erfolg belohnt werden sollte. Doch was die Menschen empört – und zu Recht empört – sind Führungskräfte, die für ihr Scheitern belohnt werden – besonders dann, wenn der amerikanische Steuerzahler dafür aufzukommen hat.[12]
Eine der schrägsten Äußerungen über die Ethik der Bankenrettung stammte von dem republikanischen Senator Charles Grassley, einem Fiskalkonservativen aus dem Mittleren Westen. Auf dem Höhepunkt der Erregung erklärte Grassley in einem Radio-Interview, am meisten störe ihn, dass die Führungskräfte der Firmen sich weigerten, für ihr Scheitern die Verantwortung zu übernehmen. Er würde ihnen das alles nicht ganz so übelnehmen, »wenn sie sich dem japanischen Vorbild folgend vor das amerikanische Volk stellen, diese tiefe Verbeugung machen und sagen würden: ›Tut mir leid.‹ Und dann eine von zwei Möglichkeiten wählen: zurücktreten oder Suizid begehen.«[13]
Später ruderte Grassley zurück. Er habe die Führungskräfte nicht aufgefordert, Selbstmord zu begehen. Er wollte jedoch, dass sie die Verantwortung für ihr Scheitern übernähmen, Reue zeigten und sich öffentlich entschuldigten. »Von keinem CEO habe ich je eine Entschuldigung gehört, und das macht es den Steuerzahlern meines Bezirks sehr schwer, einfach weiter Geld aus dem Fenster zu werfen.«[14]
Grassleys Kommentare stützen meinen Verdacht, dass sich die Empörung über die Bankenrettung nicht vorwiegend an der Gier entzündete. Der Gerechtigkeitssinn der Amerikaner litt am meisten darunter, dass ihre Steuerdollars an Versager verschwendet wurden.
Wenn das zutrifft, bleibt zu fragen, ob diese Sichtweise gerechtfertigt ist. Waren die CEOs und Führungskräfte der Großbanken und Investmentfirmen schuld an der Finanzkrise? Sie selbst streiten das natürlich ab. Als einige von ihnen vor Kongressausschüssen zur Untersuchung der Finanzkrise aussagen mussten, bestanden sie darauf, unter Berücksichtigung der verfügbaren Informationen korrekt gehandelt zu haben. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Bear Stearns, einer Investmentfirma von der Wall Street, die 2008 zusammenbrach, erklärte, er habe lange und intensiv darüber nachgedacht, ob er sich anders hätte verhalten können. Er kam zu dem Schluss, sein Möglichstes getan zu haben. »In der Lage, in der wir uns befanden, gab es nichts, was einen Unterschied gemacht hätte.«[15]
Andere CEOs zahlungsunfähiger Firmen stimmten dem zu und bestanden darauf, Opfer eines »finanziellen Tsunamis« gewesen zu sein, den sie nicht hätten steuern können.[16] Eine vergleichbare Haltung war auch bei jungen Händlern zu finden, die nicht wirklich nachvollziehen konnten, warum die Öffentlichkeit sich so sehr über ihre Boni erregte. »Keiner empfindet mehr Sympathie für uns«, klagte ein Händler der Wall Street gegenüber einem Reporter von Vanity Fair. »Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht hartarbeiten würden.«[17]
Die Metapher vom Tsunami wurde – besonders in Finanzkreisen – dankbar aufgenommen. Wenn deren Führungskräfte recht haben und das Scheitern ihrer Firmen umfassenderen ökonomischen Kräften und nicht ihren eigenen Entscheidungen zuzuschreiben war, würde dies erklären, warum sie nicht die Reue zum Ausdruck brachten, die Senator Grassley von ihnen einforderte.
Doch es wirft auch eine weitreichende Frage auf: Falls die katastrophalen Verluste von 2008 und 2009 durch große, systemimmanente ökonomische Kräfte zu erklären sind – könnte man dann nicht sagen, dass eben diese Kräfte auch die schwindelerregenden Gewinne in den Jahren davor erklären? Wenn das Wetter für die schlechten Jahre verantwortlich ist, wie können dann in den guten Jahren die Begabung, Klugheit und harte Arbeit der Wall-Street-Banker für die verblüffenden Erträge verantwortlich sein?
Angesichts der öffentlichen Entrüstung wegen der Bonuszahlungen brachten die CEOs vor, dass finanzielle Erträge nicht ausschließlich von ihrer eigenen Tätigkeit abhingen, sondern das Ergebnis von Kräften seien, über die sie keine Kontrolle hätten. Da mögen sie nichtganzunrecht haben. Doch wenn dies zutrifft, kann man ihren Anspruch auf übermäßige Belohnung in guten Zeiten ebenfalls mit einigem Recht in Frage stellen. Das Ende des Kalten Krieges, die Globalisierung von Handel und Kapitalmärkten, der Aufstieg des PCs und des Internets und eine Menge anderer Faktoren erklären sicherlich einen Teil des Erfolgs der Finanzbranche in den 1990ern und den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts.
2007 bezahlte man CEOs in großen US-Unternehmen das 344-Fache des Lohns eines durchschnittlichen Arbeiters.[18] Aus welchen Gründen, wenn überhaupt, steht es Führungskräften zu, so viel mehr Geld zu erhalten als ihre Angestellten? Die meisten Beschäftigten arbeiten hart und bringen dabei wichtige Fähigkeiten ein. 1980 betrug das Gehalt der CEOs nur das 42-Fache des Lohns ihrer Beschäftigten.[19] Waren die Führungskräfte 1980 weniger qualifiziert und arbeiteten weniger hart als heute? Oder spiegeln sich in unterschiedlicher Bezahlung zufällige Umstände, die mit Qualifikationen und Fähigkeiten nichts zu tun haben?
Man kann auch das Niveau des Einkommens von Führungspersonal in den USA mit dem in anderen Ländern vergleichen. Vorstände der führenden US-Unternehmen verdienten zwischen 2004 bis 2006 jährlich im Schnitt 13,3 Millionen Dollar; europäische Firmenchefs erhielten 6,6 Millionen, japanische 1,5 Millionen Dollar.[20] Sind die Verdienste amerikanischer Führungskräfte doppelt so groß wie die ihrer europäischen Kollegen oder gar neunmal so groß wie die der japanischen Firmenvorstände? Oder spiegeln sich in diesen Differenzen auch Faktoren, die nichts zu tun haben mit den Anstrengungen und Qualifikationen, die Führungskräfte in ihre Arbeit einbringen?
Die Empörung über die Bankenrettung drückte die weitverbreitete Ansicht aus, dass Leute, die die von ihnen geleiteten Firmen durch riskante Investments ruinieren, dafür nicht auch noch mit Boni in Millionenhöhe belohnt werden sollten. Doch der Streit um die Boni wirft auch die Frage auf, wem in guten Zeiten was zusteht. Verdienen die erfolgreichen Führungskräfte die Prämien, die ihnen die Märkte zukommen lassen? Oder hängt ihr Erfolg von Faktoren ab, auf die sie keinen Einfluss haben? Und was ergibt sich daraus für die wechselseitigen Verpflichtungen von Bürgern – in guten wie in schlechten Zeiten? Ob die Finanzkrise auch eine öffentliche Debatte über diese weiterreichenden Fragen auslösen wird, bleibt abzuwarten.
Drei mögliche Annäherungen an die Gerechtigkeit
Fragt man, ob eine Gesellschaft gerecht ist, so läuft dies daraufhinaus, wie sie all das verteilt, was wir schätzen – Einkommen und Wohlstand, Pflichten und Rechte, Befugnisse und Chancen, Ämter und Ehren. Eine gerechte Gesellschaft verteilt diese Güter auf angemessene Weise; sie gibt jeder oder jedem, was ihr oder ihm zusteht. Die Schwierigkeiten beginnen, wenn wir fragen, was denn nun wem zusteht – und warum.
Wir haben schon damit begonnen, uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Als wir darüber nachgedacht haben, was an Preiswucher, der Vergabe des Purple Heart oder der Bankenrettung richtig oder falsch sein könnte, haben wir drei Ideale kennengelernt, die jeweils einen eigenen Zugang zum Phänomen der Gerechtigkeit bieten: das allgemeine Wohl, die Freiheit und die Tugend.
Manche unserer Debatten reflektieren die Uneinigkeit darüber, was es bedeutet, das allgemeine Wohl zu mehren, die Freiheit zu achten oder Tugenden zu pflegen. In anderen wiederum besteht Uneinigkeit darüber, was zu tun ist, wenn diese Ideale miteinander in Konflikt geraten. Die politische Philosophie kann diese Unstimmigkeiten nicht ein für alle Mal auflösen. Doch sie kann unseren Debatten Form geben und die Alternativen verständlich machen, vor denen wir als demokratische Bürger stehen.
In diesem Buch erkunden wir die Stärken und Schwächen aller drei Ansatzpunkte. Beginnen wollen wir mit der Vorstellung von der Mehrung des allgemeinen Wohls oder, damit verbunden, des Wohlstands. Für Marktgesellschaften wie die unsere bietet sie einen natürlichen Ausgangspunkt. Ein großer Teil der zeitgenössischen politischen Debatten dreht sich um die Fragen, wie man den Wohlstand mehren, den Lebensstandard verbessern oder das Wirtschaftswachstum beschleunigen könne.
Warum kümmern wir uns um dergleichen? Die offensichtlichste Antwort lautet, dass wir glauben, unser materieller Wohlstand würde unser Leben entscheidend verbessern – ob auf der individuellen oder der gesellschaftlichen Ebene. Anders gesagt, Wohlstand spielt eine wichtige Rolle, weil er zum Gemeinwohl beiträgt.
Um diese Vorstellung eingehender zu untersuchen, wenden wir uns dem Utilitarismus zu – er ist die einflussreichste Erklärung, wie und warum wir das Gemeinwohl mehren oder (in den Worten der Utilitaristen) das größte Glück der größten Zahl von Menschen anstreben sollten.
Anschließend greifen wir ein Spektrum von Theorien auf, die Gerechtigkeit mit Freiheit verknüpfen. Die meisten dieser Theorien betonen die Rechte des Einzelnen, auch wenn sie untereinander uneins sind, welche Rechte am wichtigsten sind. In der heutigen Politik ist die Meinung, Gerechtigkeit bedeute die Achtung der Freiheit und der Persönlichkeitsrechte, zumindest ebenso verbreitet wie die utilitaristische Idee von der Mehrung des Gemeinwohls. So legen etwa die Zusatzartikel der Verfassung der USA bestimmte Freiheiten fest – einschließlich des Rechts der freien Rede und der Religionsfreiheit – die selbst von Mehrheiten nicht verletzt werden dürfen. Und in der ganzen Welt wird die Ansicht, Gerechtigkeit bedeute, bestimmte universelle Menschenrechte zu achten, zunehmend akzeptiert (jedenfalls theoretisch – wenn auch nicht immer in der Praxis).
Die Ansätze, die von der Idee der Freiheit ausgehen, können dabei sehr verschieden sein. Tatsächlich finden einige der am härtesten geführten Debatten unserer Zeit zwischen zwei rivalisierenden Lagern statt, die beide die Freiheit in den Vordergrund stellen – die einen haben sich den Laissez-faire-Gedanken auf die Fahnen geschrieben, die anderen die Fairness.
Anführer des Laissez-faire-Lagers sind die Marktliberalen, die glauben, der Kern der Gerechtigkeit bestehe darin, die von erwachsenen Menschen in gegenseitigem Einvernehmen getroffenen Entscheidungen zu respektieren. Im anderen Lager finden sich die Theoretiker mit einer eher egalitären Neigung. Sie betonen, dass unkontrollierte Märkte weder gerecht noch frei seien. Ihrer Ansicht nach erfordert Gerechtigkeit eine Politik, die soziale und ökonomische Benachteiligungen ausgleicht und jedem eine faire Erfolgschance bietet.
Schließlich wenden wir uns Theorien zu, für die Gerechtigkeit mit der Tugend und dem guten Leben verknüpft ist. In der heutigen Politik werden Tugendtheorien oft mit Kulturkonservativen und der religiösen Rechten assoziiert. Für viele Bürger freiheitlicher Gesellschaften ist die Vorstellung, Fragen der Moral gesetzlich regeln zu wollen, ein Gräuel, weil damit die Gefahrverbunden ist, in Intoleranz und Zwang zurückzufallen. Doch der Gedanke, dass eine gerechte Gesellschaft gewisse Tugenden und Vorstellungen vom guten Leben bestärkt, hat politische Bewegungen und Diskussionen quer durch das ideologische Spektrum inspiriert. Nicht nur die Taliban, sondern auch die Abolitionisten und Martin Luther King haben ihre Visionen von der Gerechtigkeit aus moralischen und religiösen Idealen bezogen.
Bevor wir versuchen, all diese Theorien zur Gerechtigkeit zu bewerten, lohnt sich ein Blick auf die schwierige Frage, wie philosophische Argumentationen entwickelt werden – besonders auf so umstrittenen Gebieten wie Moralphilosophie und politischer Philosophie. Am Anfang steht häufig eine konkrete Situation. Wie wir in unserer Erörterung von Preiswucher, Verwundetenabzeichen und Bankenrettung gesehen haben, ist eine öffentlich geführte Debatte ein guter Ausgangspunkt für moralische und politische Überlegungen. Oft herrscht diese Uneinigkeit zwischen verschiedenen Fraktionen im öffentlichen Raum, manchmal aber auch nur in uns selber – etwa wenn wir uns angesichts einer schwierigen moralischen Frage nicht für eine Seite entscheiden können.
Wie aber können wir von den Urteilen, die wir anhand konkreter Situationen fällen, argumentativ zu den Grundsätzen der Gerechtigkeit vorstoßen, die unserer Ansicht nach universell anwendbar sein sollten? Kurz, wie funktioniert unsere moralische Vernunft?
Dafür wollen wir uns im Folgenden zuerst zwei Geschichten zuwenden: einer phantasievollen hypothetischen Geschichte, die unter Philosophen häufig erörtert wird, und einer aktuellen Geschichte über ein quälendes moralisches Dilemma.
Sehen wir uns zunächst die hypothetische Philosophengeschichte an.[1] Wie alle Erzählungen dieser Art ist sie vieler realistischer Komplikationen entkleidet worden, damit wir uns auf eine begrenzte Zahl philosophischer Fragen konzentrieren können.
Die Rangierlok ohne Bremsen
Stellen Sie sich vor, Sie sind der Fahrer einer Lokomotive, die mit 90 Stundenkilometern über die Schienen rattert. In einiger Entfernung stehen fünf Arbeiter auf dem Gleis, die Werkzeuge in der Hand. Sie versuchen, die Lok anzuhalten, doch das geht nicht. Die Bremsen greifen nicht. Sie sind verzweifelt, weil Ihnen klar ist, dass die Arbeiter alle sterben werden, wenn Sie sie überfahren (gehen wir davon aus, dass das gewiss geschehen wird).
Plötzlich entdecken Sie ein nach rechts abzweigendes Nebengleis. Auch auf diesem Gleis befindet sich ein Arbeiter – aber eben nur einer. Sie merken, dass Sie die Lok auf dieses Nebengleis dirigieren können, was den einen Arbeiter das Leben kosten, die anderen aber retten würde.
Was werden Sie tun? Die meisten Menschen würden sagen: »Abbiegen! Auch wenn es eine Tragödie ist, einen Unschuldigen zu töten, ist es doch noch schlimmer, gleich fünf umzubringen.« Es erscheint ihnen richtig, ein Leben zu opfern, um fünf Leben zu retten.
Nehmen wir nun eine andere Version der Lokgeschichte. Diesmal sind Sie nicht der Fahrer, sondern ein Zuschauer, der auf einer über die Gleise führenden Brücke steht(und es ist kein Nebengleis vorhanden). Auf den Schienen nähert sich eine Rangierlok, in einiger Entfernung stehen fünf Arbeiter auf dem Gleis. Auch jetzt versagen die Bremsen. Gleich wird die Lokomotive die Arbeiter erfassen. Hilflos erkennen Sie, dass Sie die Katastrophe nicht verhindern können. Doch dann sehen Sie einen ungeheuer dicken Mann neben sich auf der Brücke stehen. Sie könnten ihn so auf die Gleise stoßen, dass er den Weg der Lokblockiert. Er würde sterben, doch die fünf Arbeiter wären gerettet. (Sie denken kurz daran, selbst auf die Schienen zu springen, merken aber, dass Sie zu leicht sind und die Lok nicht stoppen können.)
Wäre es richtig, den dicken Mann auf die Schienen zu stoßen? Die meisten Menschen würden sagen: »Natürlich nicht. Es wäre fürchterlich falsch, den Mann aufs Gleis zu stoßen.«
Es scheint eine schreckliche Tat zu sein, jemanden von einer Brücke in den sicheren Tod zu stürzen, selbst wenn damit fünf unschuldige Leben gerettet werden. Das allerdings führt zu einem moralischen Rätsel: Warum scheint das Prinzip – ein Leben zu opfern, um fünf zu retten – im ersten Fall richtig zu sein, im zweiten dagegen falsch?
Wenn es, wie unsere Reaktion auf den ersten Fall nahelegt, auf die Zahl ankommt – wenn es also besser ist, fünf Leben zu retten als eines: Warum sollten wir diesen Grundsatz nicht auch im zweiten Fall anwenden und den Mann hinabstürzen? Sicher, es wäre grausam, einen Mann zu Tode zu bringen, selbst wenn es um einer guten Sache willen geschieht. Aber ist es weniger grausam, einen Menschen durch den Zusammenstoß mit einer Rangierlok zu töten?
Vielleicht ist es deswegen falsch, den Mann von der Brücke zu stürzen, weil er gegen seinen Willen für einen fremden Zweck benutzt wird. Er stand dort einfach nur herum.
Doch dasselbe ließe sich auch für den Mann auf dem Nebengleis sagen. Auch er machte schließlich nur seine Arbeit und hat nicht freiwillig beschlossen, sein Leben wegen einer Lok mit versagenden Bremsen zu opfern. Man könnte zwar vorbringen, dass Bahnarbeiter immer ein gewisses Risiko eingehen, was für unbeteiligte Brückensteher nicht gilt. Doch wir wollen davon ausgehen, dass es nicht zur Stellenbeschreibung gehört, in einem Notfall sein Leben zu opfern, um andere zu retten, und dass der Arbeiter ebenso wenig damit einverstanden ist, sein Leben hinzugeben, wie der unbeteiligte Zuschauer auf der Brücke.
Vielleicht liegt der moralische Unterschied nicht in der Wirkung – am Ende sind beide tot – sondern in der Absicht des Menschen, der die Entscheidung trifft. Als Fahrer der Lok könnten Sie Ihre Entscheidung, das Fahrzeug auf das Nebengleis zu steuern, vielleicht damit begründen, dass Sie den Tod des Arbeiters nicht beabsichtigt hatten, auch wenn er vorhersehbar war. Ihr Ziel hätten Sie auch erreicht, wenn durch einen sehr glücklichen Zufall nicht nur die fünf Arbeiter verschont blieben, sondern auch der sechste.
Doch genau das gilt auch im Fall des Brückensturzes. Der Tod des Mannes, den ich von der Brücke stoße, ist nicht beabsichtigt. Er soll lediglich die Lok aufhalten; wenn er dabei irgendwie am Leben bleibt, wären Sie höchst erfreut.
Doch vielleicht sollten die beiden Fälle nach demselben Prinzip behandelt werden. Beide schließen eine willentliche Entscheidung ein, einem unschuldigen Menschen das Leben zu nehmen, um noch größere Verluste an Menschenleben zu verhindern. Vielleicht ist Ihr Widerstreben, den Mann von der Brücke zu stürzen, nur zimperlich – eine bloße Überempfindlichkeit, die Sie überwinden sollten. Einen Mann mit bloßen Händen zu Tode zu bringen scheint grausamer zu sein, als nur eine Weiche per Fernsteuerung umzulegen. Doch es ist nicht immer einfach, das Richtige zu tun.
Diese Idee können wir überprüfen, wenn wir die Geschichte leicht abändern. Nehmen wir an, Sie könnten den dicken Mann auf die Schienen fallen lassen, ohne ihn zu stoßen; stellen wir uns vor, er steht auf einer Falltür, die Sie mit einem Hebel auslösen könnten. Kein Stoßen, gleiches Ergebnis. Wäre das besser? Oder ist es immer noch moralisch fragwürdiger, als wenn Sie als Lokführer auf das Nebengleis ausweichen würden?
Es ist nicht einfach, die moralischen Unterschiede zwischen diesen Fällen zu erklären – warum es uns richtig vorkommt, die Lok umzulenken, während es falsch erscheint, den Mann von der Brücke zu stürzen. Trotzdem lastet ein starker Druck auf uns, eine überzeugende Unterscheidung zu finden – und wenn uns das nicht gelingt, unser Urteil darüber, was in jedem Fall das Richtige wäre, noch einmal zu überdenken. Das Nachdenken über moralische Fragen dient eben nicht nur dazu, andere zu überzeugen, sondern es ist auch eine Möglichkeit, die eigenen moralischen Überzeugungen auf die Reihe zu bekommen und herauszufinden, was wir glauben und warum.
Einige moralische Zwickmühlen ergeben sich aus widerstreitenden moralischen Grundsätzen. Ein Grundsatz besagt beispielsweise, wir sollten möglichst viele Leben retten, ein anderer jedoch, es sei falsch, einen Unschuldigen zu töten, selbst um einer guten Sache willen. Angesichts einer Situation, in der die Rettung einiger Leben davon abhängt, einen Unschuldigen zu töten, stehen wir vor einem moralischen Dilemma, das uns zwingt, darüber nachzudenken, welcher Grundsatz gewichtiger oder den gegebenen Umständen angemessener ist.
Andere moralische Zwickmühlen ergeben sich aus unserer Unfähigkeit, zukünftige Ereignisse mit Sicherheit voraussagen zu können. Hypothetische Beispiele wie die Lokgeschichte sparen die Ungewissheit aus, die über den Entscheidungen schwebt, denen wir im richtigen Leben begegnen. Solche Geschichten unterstellen, wir wüssten sicher, wie viele Leute sterben werden, wenn wir nicht auf das Nebengleis fahren bzw. niemanden hinabstoßen. Als Handlungsanleitungen taugen solche Storys nur bedingt. Aber genau deswegen sind sie nützliche Werkzeuge für eine moralische Analyse. Weil zufällig eintretende Umstände ausgeklammert sind – »Was wäre, wenn die Arbeiter die Lok sehen und beiseite springen?« – helfen uns diese hypothetischen Beispiele, die auf dem Spiel stehenden moralischen Grundsätze herauszuarbeiten und zu untersuchen, wie stark sie sind.
Die afghanischen Ziegenhirten
Kommen wir nun zu einer aktuellen moralischen Zwickmühle, die der phantasievollen Geschichte mit der Lok ohne Bremsen in mancher Hinsicht ähnelt, aber wegen der Ungewissheit über ihren Ausgang komplizierter ist.
Im Juni 2005 brach ein US-Sondereinsatzkommando mit Petty Officer Marcus Luttrell und drei anderen Soldaten der US-Navy-SEALs zu einer geheimen Erkundungsmission in Afghanistan auf. Die Gruppe sollte in der Nähe der Grenze zu Pakistan einen Taliban-Führer aus der Umgebung Osama bin Ladens aufspüren.[1] Nach Geheimdienstberichten befehligte die Zielperson 140 bis 150 bewaffnete Kämpfer und hielt sich in einem Dorf in der schwer zugänglichen Bergregion auf.
Kurz nachdem die Gruppe auf einem Bergrücken Stellung bezogen hatte, von dem aus das Dorf zu überblicken war, wurden sie zufällig von zwei afghanischen Bauern mit etwa 100 meckernden Ziegen entdeckt. Ein etwa 14 Jahre alter Junge begleitete sie. Die Afghanen waren unbewaffnet. Die amerikanischen Soldaten richteten ihre Gewehre auf sie, zwangen sie dazu, sich auf den Boden zu setzen, und besprachen dann, was mit ihnen zu tun sei. Bei den Ziegenhirten schien es sich um unbewaffnete Zivilisten zu handeln. Würde man sie ziehen lassen, liefe man allerdings Gefahr, dass sie die Taliban über die Anwesenheit der US-Soldateninformierten.
Während die vier Soldaten ihre Handlungsoptionen erwogen, bemerkten sie, dass sie kein Seil dabeihatten. Damit war ausgeschlossen, dass sie die Afghanen fesseln und so Zeit gewinnen konnten, um in Ruhe nach einem neuen Versteck zu suchen. Ihnen blieb nur, sie entweder zu töten oder freizulassen.
Einer von Luttrells Kameraden plädierte dafür, die Ziegenhirten umzubringen: »Wir sind auf Befehl unserer Vorgesetzten hinter den feindlichen Linien im Einsatz. Wir haben das Recht, alles Notwendige zu tun, um unser Leben zu schützen. Die militärisch gebotene Lösung liegt auf der Hand. Es wäre falsch, sie laufen zu lassen.«[2] Luttrell war innerlich zerrissen. »Als Soldat wusste ich, dass er recht hatte«, schrieb er rückblickend. »Wir konnten sie unmöglich freilassen. Doch mein Problem ist, dass ich auch ein Christ bin und eine christliche Seele habe, die mir sagte, dass es falsch wäre, diese unbewaffneten Männer kaltblütig zu töten.«[3] Luttrell erklärt nicht genau, was er mit seiner christlichen Seele meinte, aber am Ende erlaubte ihm sein Gewissen nicht, die Ziegenhirten zu töten. Er gab die entscheidende Stimme ab, sie freizulassen. (Einer seiner drei Kameraden hatte sich enthalten.) Es war eine Entscheidung, die er bereuen sollte.
Etwa eineinhalb Stunden nach der Freilassung der Ziegenhirten sahen sich die vier Soldaten von 80 bis 100 Taliban-Kämpfern umzingelt, die mit Kalaschnikows und Panzerfäusten bewaffnet waren. In dem folgenden heftigen Feuergefecht wurden alle drei Kameraden Luttrells getötet. Außerdem schossen die Taliban einen US-Hubschrauber ab, der die vier bergen wollte. Alle 16 Soldaten an Bord starben.
Der schwerverletzte Luttrell schaffte es, am Leben zu bleiben – er fiel den Berghang hinunter und schleppte sich sieben Meilen weit in ein Paschtunen-Dorf, dessen Bewohner ihn vor den Taliban versteckten, bis er gerettet wurde.
Im Rückblick verurteilte Luttrell seine Entscheidung, die Ziegenhirten laufen zu lassen. »Es war die dümmste, hirnverbrannteste, schwachsinnigste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe«, schrieb er in einem Buch über das Erlebnis. »Ich muss vollkommen von Sinnen gewesen sein. Ich hatte eine Stimme abgegeben, die unser Todesurteil besiegeln konnte, das war mir klar (…). So sehe ich das zumindest im Rückblick (…). Meine Stimme gab den Ausschlag, und das wird mich verfolgen, bis man mich im Osten von Texas begräbt.«[4]
Das Dilemma der Soldaten war unter anderem deshalb so schwierig zu lösen, weil sie nicht wissen konnten, was geschehen würde, wenn sie die Afghanen laufen ließen. Würden sie einfach weiterziehen oder die Taliban warnen? Aber nehmen wir an, Luttrell hätte gewusst, dass die Freilassung der Ziegenhirten einen verheerenden Kampf nach sich ziehen würde, bei dem seine Kameraden und 16 weitere Amerikaner ihr Leben verlieren sollten – hätte er sich dann anders entschieden?
Für Luttrell ist die Antwort im Nachhinein klar: Er hätte die Ziegenhirten töten sollen. Angesichts der darauf folgenden Katastrophe ist es schwer, dem zu widersprechen. In gewisser Weise ähnelt Luttrells Entscheidung dem Fall mit der Rangierlok. Hätte er die drei Afghanen getötet, hätte er das Leben seiner drei Kameraden und das der 16 Soldaten im Hubschrauber gerettet. Aber welcher Version der Lokgeschichte ähnelt sie? Entspräche die Tötung der drei Afghanen eher dem Umlenken der Lok auf ein Nebengleis oder dem Stoß, der den Mann auf der Brücke in die Tiefe stürzt? Die Tatsache, dass Luttrell die Gefahr vorhersah und es trotzdem nichtüber sich bringen konnte, unbewaffnete Zivilisten zu töten, spricht dafür, dass sie eher dem Fall des Brückensturzes ähnelt.
Dennoch scheint die Argumentation dafür, die Ziegenhirten zu töten, stärker zu sein als die Argumentation dafür, den Mann von der Brücke zu stürzen. Das liegt möglicherweise daran, dass wir angesichts des Resultats den Verdacht hegen, es könnte sich nicht um unschuldige Zivilisten, sondern um Sympathisanten der Taliban gehandelt haben. Sehen wir uns eine Analogie an: Hätten wir Grund zu der Annahme, der Mann auf der Brücke sei für das Bremsversagen der Lok verantwortlich, weil er gehofft hatte, dadurch die Männer auf dem Gleis zu töten (gehen wir davon aus, es seien seine Feinde gewesen), fiele es uns moralisch wesentlich leichter, ihn von der Brücke zu stoßen. Wir müssten allerdings immer noch wissen, wer seine Feinde waren und warum er sie töten wollte. Würden wir erfahren, dass die Arbeiter auf den Schienen zur französischen Widerstandsbewegung gehörten und der dicke Mann auf der Brücke ein Nazi sei, gäbe es moralisch überzeugende Gründe, ihn von der Brücke zu stürzen, um sie zu retten.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, dass die afghanischen Ziegenhirten keine Taliban-Sympathisanten waren, sondern von den Taliban nur gezwungen worden waren, die amerikanischen Soldaten zu verraten. Nehmen wir an, Luttrell und seine Kameraden hätten sicher gewusst, dass die Ziegenhirten nichts Böses im Schilde führten, aber von den Taliban gefoltert würden, damit sie ihre Stellung verrieten. Die Amerikaner hätten die Ziegenhirten dann trotzdem töten können, um ihren Auftrag und sich selbst nicht zu gefährden. Doch die Entscheidung, das zu tun, wäre weit belastender (und moralisch fragwürdiger) gewesen, als wenn sie gewusst hätten, dass die Ziegenhirten Spione der Taliban waren.
Moralische Zwickmühlen
Nur wenige von uns sehen sich vor so schicksalhafte Entscheidungen gestellt wie die Soldaten auf dem Berg oder der Zeuge einer Lok mit versagenden Bremsen. Doch die Beschäftigung mit solchen Dilemmata sensibilisiert uns dafür, wie moralisch argumentiert wird – ob in unserem Privatleben oder in der Öffentlichkeit.
In demokratischen Gesellschaften wird täglich darüber gestritten, was richtig und was falsch, was gerecht und was ungerecht ist. Manche Menschen sind für das Recht auf Abtreibung, andere betrachten Abtreibung als Mord. Manche glauben, es sei eine Frage der Fairness, die Reichen zu besteuern, damit den Armen geholfen werden könne, während andere glauben, es sei unfair, durch Steuern Geld abzugreifen, das die Leute durch eigene Anstrengung verdient haben. Manche verteidigen Sozialquoten beim Hochschulzugang als Weg, Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren, während andere darin eine unfaire Form umgekehrter Diskriminierung gegen Menschen sehen, die es aufgrund ihrer Leistung verdient haben, zum Studium zugelassen zu werden. Manche Leute verwerfen die Folter von Terrorverdächtigen als moralische Abscheulichkeit, die einer freien Gesellschaft unwürdig sei, andere verteidigen sie als letztes Mittel, einen Terroranschlag zu vereiteln.
Mit solchen Debatten werden Wahlen gewonnen und verloren. Sie sind das Thema unserer sogenannten Kulturkämpfe. Angesichts der Leidenschaft und Intensität, mit denen wir moralische Fragen im öffentlichen Leben diskutieren, könnten wir versucht sein zu glauben, dass unsere moralischen Überzeugungen durch Erziehung oder Glauben ein für alle Mal festgelegt seien – außerhalb der Reichweite der Vernunft.
Doch wenn das zuträfe, dann wäre moralische Überzeugungsarbeit undenkbar, und was wir für öffentliche Debatten über Gerechtigkeit und Rechte halten, wäre nichts weiter als eine Flut dogmatischer Behauptungen – ein ideologisch motivierter Grabenkampf, in dem man sich mit Argumenten wie mit Tomaten oder faulen Eiern bewirft.
In ihren schlimmsten Ausprägungen kommt die amerikanische Politik diesem Bild recht nahe. Doch das muss nicht zwangsläufig so sein. Manchmal kann eine vernünftige Auseinandersetzung unser Denken verändern.
Wie also können wir mit unserer Vernunft so erfolgreich durch das umstrittene Terrain navigieren, in dem es um Fragen der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Gleichheit und Ungleichheit, die Rechte des Einzelnen und das Allgemeinwohl geht? Das ist das Thema dieses Buches.
Ein Weg, unsere moralische Reflexion zu schulen, besteht in der Konfrontation mit schwierigen moralischen Problemen. Wir fragen uns, wie wir uns in einer besonders kniffligen Situation verhalten würden, und entscheiden: »Wir lenken die Lok auf ein Nebengleis.« Dann denken wir über den Grund unserer Überzeugung nach und suchen nachdem Prinzip, auf dem sie beruht: »Es ist richtig, ein Leben zu opfern, um den Tod