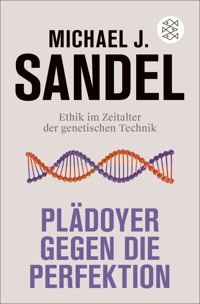
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jeder neue Durchbruch, den die Genetik erzielt, bedeutet Verheißung und Dilemma zugleich: Einerseits werden wir künftig in der Lage sein, tödliche Krankheiten wirksam zu bekämpfen und zu verhindern. Andererseits gibt uns dieses neue Wissen die Werkzeuge an die Hand, die Natur manipulieren und so uns selbst sowie unsere Kinder nach unseren Vorlieben optimieren zu können. Der weltbekannte Philosoph Michael Sandel analysiert die Fortschritte und Möglichkeiten der Gentechnik aus moralischer Sicht: Welchen Einfluss hat das genetische Perfektionsstreben auf Sicherheit und Fairness? Wie verändert es das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern? Und wo liegen die moralischen Grenzen der biotechnologischen Möglichkeiten? Mit einem Vorwort von Jürgen Habermas. »Was für ein grandioser Essay!« Frankfurter Rundschau
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Michael J. Sandel
Plädoyer gegen die Perfektion
Ethik im Zeitalter der genetischen Technik
Über dieses Buch
Jeder neue Durchbruch, den die Genetik erzielt, bedeutet Verheißung und Dilemma zugleich: Einerseits werden wir künftig in der Lage sein, tödliche Krankheiten wirksam zu bekämpfen und zu verhindern. Andererseits gibt uns dieses neue Wissen die Werkzeuge an die Hand, die Natur manipulieren und so uns selbst sowie unsere Kinder nach unseren Vorlieben optimieren zu können.
Der weltbekannte Philosoph Michael Sandel analysiert die Fortschritte und Möglichkeiten der Gentechnik aus moralischer Sicht: Welchen Einfluss hat das genetische Perfektionsstreben auf Sicherheit und Fairness? Wie verändert es das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern? Und wo liegen die moralischen Grenzen der biotechnologischen Möglichkeiten?
Mit einem Vorwort von Jürgen Habermas.
»Was für ein grandioser Essay!« Frankfurter Rundschau
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Michael J. Sandel, geboren 1953, ist politischer Philosoph. Er studierte in Oxford und lehrt seit 1980 in Harvard. Seine Vorlesungsreihe über Gerechtigkeit begeisterte online Millionen von Zuschauern und machte ihn zum weltweit populärsten Moralphilosophen. »Was man für Geld nicht kaufen kann« wurde zum internationalen Bestseller. Seine Bücher beschäftigen sich mit Ethik, Gerechtigkeit, Demokratie und Kapitalismus und wurden in 27 Sprachen übersetzt.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »The Case Against Perfection. Ethics in the Age of Genetic Engineering« im Verlag The Belknap Press, einem Imprint der Harvard University Press
© 2007 by Michael J. Sandel
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2008 Berlin University Press in der Verlagshaus Römerweg GmbH
Covergestaltung/ -abbildung: Kosmos Design
ISBN 978-3-10-491941-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Kapitel]
Vorwort
Plädoyer gegen die PerfektionEthik im Zeitalter der genetischen Technik
Danksagung
1. Die Ethik des Optimierens
Unsere Beunruhigung in Worte fassen
Genetische Zurichtung
Muskeln
Gedächtnis
Körpergröße
Geschlechtsauswahl
2. Bionische Athleten
Das sportliche Ideal: Eifer und Begabung
Leistungsoptimierung: hoch und niedrig technisiert
Das Wesen des Spiels
3. Entworfene Kinder, entwerfende Eltern
Formen und Betrachten
Leistungsdruck
4. Die alte und die neue Eugenik
Die alte Eugenik
Die Eugenik des freien Marktes
Liberale Eugenik
5. Beherrschung und Gabe
Demut, Verantwortung und Solidarität
Einwände
Das Projekt der Beherrschung
Epilog Embryo-Ethik: die Stammzelldebatte
Stammzellfragen
Klone und Überzählige
Der moralische Status des Embryos
Analyse des Arguments
Den Implikationen nachgehen
Die Rechtfertigung von Respekt
Sachregister
Vorwort von Jürgen Habermas
7
Danksagung
17
1. Die Ethik des Optimierens
21
2. Bionische Athleten
45
3. Entworfene Kinder, entwerfende Eltern
65
4. Die alte und die neue Eugenik
83
5. Beherrschung und Gabe
105
Epilog
Embryo-Ethik: die Stammzelldebatte
121
Anmerkungen
151
Register
169
Vorwort
Michael J. Sandel hat bei Charles Taylor in Oxford studiert. Seit mehreren Jahrzehnten lehrt er Philosophie an der Harvard University. Wer sich vom glänzenden Stil und der Darstellungskraft des Autors überzeugt hat, wird nicht überrascht sein zu erfahren, dass der Professor Sandel bei seinen Studenten den Ruf eines begeisternden Lehrers genießt. Schon dem jungen Sandel gelang es, mit seinem ersten Buch – einer Kritik an John Rawls epochaler Theorie der Gerechtigkeit – eine Debatte anzustoßen, an der sich im Laufe der 80er Jahre alle führenden Geister des Faches beteiligt haben. Das 1982 erschienene Buch Liberalism and the Limits of Justice hat auch über die Grenzen der USA hinaus eine lebhafte, bis in die Sozialwissenschaften hinein wirkende Kontroverse zwischen den Anhängern des Politischen Liberalismus und den sogenannten »Kommunitaristen« ausgelöst. Diese stehen in der Tradition der Aristotelischen »Politik« und pochen gegenüber den individualistischen Ansätzen des modernen Vernunftrechts auf der wesentlich sozialen Natur und Traditionsgebundenheit der Bürger eines politischen Gemeinwesens.
Der zunächst überzeichnete Kontrast zwischen der Autonomie des vereinzelten, nach je eigenen Präferenzen zweckrational entscheidenden Gesellschaftsbürgers auf der einen Seite und der »Einbettung« des von Haus aus sozialisierten, an gemeinsamen Werten orientierten Staatsbürgers auf der anderen Seite ist im Laufe der Diskussion entschärft worden. Auch die autonomiebewussten Kantianer zehren ja von der republikanischen Vorstellung einer intersubjektiv geteilten Praxis staatsbürgerlicher Selbstbestimmung. »Liberale« wie Rawls begnügen sich nicht mit einer schwachen Konzeption von Willkürfreiheit, sondern verbinden mit dem Begriff der Autonomie einen Sinn für Gerechtigkeit, der in Konfliktfällen verlangt, die Perspektiven aller Beteiligten einzunehmen und zu berücksichtigen. Als Kern der Auseinandersetzung zwischen Liberalen und Kommunitaristen bleibt die Frage übrig, ob sich streitende Parteien überhaupt so weit von den Sichtweisen ihrer jeweils eigenen Traditionen lösen können, dass der von Rawls behauptete Vorrang des »Gerechten« vor den verschiedenen Vorstellungen vom »konkreten Guten« mehr ist als eine unzumutbare und daher irreführende Abstraktion.
Diese Kontroverse bildet auch den Hintergrund für den vorliegenden Traktat. Mit diesem hat Michael Sandel in eine bioethische Debatte eingegriffen, die in Deutschland ähnliche Frontstellungen hervorgerufen hat wie in den USA. Die hier entwickelten Argumente spiegeln auch Diskussionen wider, an denen der Autor als Mitglied einer von Präsident George W. Bush berufenen nationalen Ethikkommission beteiligt war. Obwohl das Büchlein eher ein Plädoyer und keine im strengen Sinne philosophische Abhandlung enthält, stützt sich die eloquent vorgetragene konservative Stellungnahme zur Frage der Wünschbarkeit und Zulässigkeit eugenischer Eingriffe in den menschlichen Organismus auf eine wohl durchdachte neoaristotelische Position. Es ist dieser belastbare Argumentationshintergrund, der der Intervention, ganz unabhängig vom aktuellen Für und Wider zu einzelnen politischen Entscheidungen, ein philosophisches Interesse sichert.
»Eugenisch« heißt die gezielte Einflussnahme auf das organische Substrat eines Menschen, wenn die Manipulation das Ziel verfolgt, körperliche oder geistige Funktionen oder Fähigkeiten dieser Person zu »steigern«. Zwar kann die Grenze zwischen der Therapie einer Krankheit und der »Verbesserung« einer Disposition oder eines Zustandes nicht immer scharf gezogen werden. Das ist aber kein Grund, auf die Unterscheidung zwischen der Wiederherstellung eines gestörten Gesundheitszustandes und der Erzeugung neuer Eigenschaften zu verzichten. Unter normativen Gesichtspunkten ist nämlich die Abgrenzung zwischen therapeutischen und »verbessernden« Eingriffen von grundsätzlichem Interesse. Das illustriert Sandel in Form einer eindrucksvollen Phänomenologie jenes eigentümlichen Unbehagens, das uns nicht erst beim Gedanken an Designerbabys oder andere »transhumanistische« Zukunftsphantasien ergreift.
Sandel setzt bei unbehaglichen Reaktionen auf heute schon verbreitete Praktiken an. Gleichviel ob es sich um Doping und Schönheitschirurgie oder um die medikamentöse Manipulation von Körpergröße, Muskelkraft, Stimmung und Gedächtnis oder um die pränatale Bestimmung des Geschlechts handelt, auch diese Praktiken zielen bereits auf eine »technische« Verbesserung des menschlichen Organismus und seiner Leistungen ab. Die ambivalenten Gefühle, die manche dieser Praktiken auslösen, werfen schon ein gewisses Licht auf die Szenarien einer künftigen liberalen Eugenik. So begegnet Sandel beispielsweise dem abwiegelnden Einwand, dass sich die Verbesserung der genetischen Anlagen von Embryos nicht wesentlich von der pädagogischen Einflussnahme der Eltern auf ihre unmündigen Kinder unterscheiden, mit einer Analyse der zwiespältigen Gefühle im Anblick von hyperparenting. Schon die Drillpraktiken, mit denen überehrgeizige Eltern ihre Kinder zu sportlichen oder musischen Höchstleistungen abrichten, empfinden wir als problematisch.
Nun sind moralische Gefühle noch keine Argumente. Aber Gefühle haben einen propositionalen Gehalt, der sich explizieren und gegebenenfalls begründen lässt. Auf diesem Wege möchte Sandel moralische Grenzen der Verfügung über die natürlichen Lebensgrundlagen von Personen begründen. Es geht ihm um eine philosophisch einleuchtende Erklärung des Gebots, nicht alles, was technisch machbar ist, in marktgängige Technologien umzusetzen. Aber sollte nicht in einer liberalen Gesellschaft die Nachfrage der Konsumenten darüber entscheiden, was angeboten wird? Wer darf sich zum Richter über die Präferenzen der Bürger aufspielen? Die Frage macht klar, dass die Aussicht auf eine liberalen Eugenik heikle Grundlagen der politischen Theorie berührt. Kritiker, die einer solchen Praxis einen Riegel vorschieben möchten, setzen sich dem Anfangsverdacht aus, die Privatautonomie der Bürger autoritär beschneiden zu wollen. Aber die Anerkennung der privatrechtlich geschützten Autonomie, im Rahmen der Gesetze tun und lassen zu dürfen, was man will, entscheidet noch nicht über die moralische Rechtfertigung der Gesetze selber. Die Autonomie der Bürger erschöpft sich nicht in der privaten Freiheit, nach jeweils eigenen Präferenzen zwischen gegebenen Optionen oder verschiedenen Lebensentwürfen wählen zu können. Der moralische Begriff der Autonomie begrenzt die Verfolgung eigener Präferenzen im Hinblick auf das, was im gleichmäßigen Interesse aller Betroffenen liegt.
Aus dem Kantischen Gebot, die gleiche Autonomie eines jeden zu achten, lassen sich nach meiner Auffassung plausible Argumente gegen die Zulässigkeit einer zu eugenischen Zwecken vorgenommenen vorgeburtlichen Programmierung von Erbanlagen gewinnen.[1] Aber diese Argumente haben, wie Sandel richtig sieht, eine begrenzte Reichweite. Von Instrumentalisierung oder »Fremdbestimmung« einer Person kann nur so lange die Rede sein, wie ein eugenischer Eingriff ohne die informierte Zustimmung des Betroffenen vorgenommen wird. Die heute noch im Laborstadium befindlichen biogenetischen Forschungen und erst recht jene Forschungsprogramme, die Entwicklungen in Nanotechnologie und Hirnforschung mit dem Ziel der Steigerung physischer und kognitiver Fähigkeiten zusammenführen wollen, eröffnen nämlich auch Aussichten auf folgenreiche eugenische Manipulationen an erwachsenen, also zustimmungsfähigen Personen. Das wird Kantianer veranlassen, die moralischen Erwägungen um politik- und rechtstheoretischen Überlegungen zu erweitern: Müsste nicht die demokratische Meinungs- und Willensbildung der Bürger mit einem Regelungsbedarf konfrontiert werden, der im Hinblick auf die zu erwartende Erweiterung biotechnischer Verfügungsmöglichkeiten heute schon entsteht?[2]
Sandel schlägt einen anderen Weg ein. Auf dem Wege einer Explikation des verbreiteten Unbehagens an Manipulationen einer bisher unverfügbaren und als »gegeben« akzeptierten menschlichen Natur möchte er »dichte« oder substantielle Wertorientierungen zu Bewusstsein bringen, die, wie er meint, uns allen intuitiv gegenwärtig sind. Seine Analysen laufen darauf hinaus, dass eugenische Praktiken einen »sense of giftedness« untergraben, der für ein zivilisiertes Zusammenleben unverzichtbar ist. Dabei spielt Sandel mit dem Doppelsinn von giftedness – also von »Begabungen«, die wir dankbar annehmen, und von »Gegebenheiten«, die wir als unvermeidlich hinnehmen. Diese doppelte Einstellung prägt den liebevollen Blick von Eltern auf ihre Kinder, gleichviel wie sie auf die Welt kommen. Aber sollen sie diese fatalistische Einstellung auch dann beibehalten, wenn sie die Möglichkeit erhalten, schon im Embryonalstadium einige Wegweiser für den künftigen Lebensweg ihrer Kinder stellen zu können?
Sandel appelliert an eine Erfahrung, die sich uns in interpersonalen Beziehungen aufdrängt. Im Hinblick auf die verletzbare Integrität des Einen wie des Anderen müssen wir die rechte Balance halten zwischen Selbstbehauptung und Hingabe, zwischen eigenem Interesse und Einfühlung, zwischen molding und beholding, der gestaltenden Einflussnahme auf den Anderen und dem Versinken in dessen Anblick. Aber lässt sich dieses Austarieren von Rücksichten von der Ebene der Interaktionen zwischen verletzbaren Personen auf einen schonend zurückhaltenden Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen von Personen übertragen? Ein solcher Umgang empfiehlt sich, wenn wir Menschen als Geschöpfe Gottes verstehen. Eine gläubige Person wird den Umgang mit der technisch verfügbar gewordenen menschlichen Natur in die interpersonale Beziehung zu ihrem Schöpfergott einbeziehen. In einer weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft dürfen jedoch solche religiösen Gründe den zur Neutralität verpflichteten Gesetzgeber nicht binden.
Sandel verleugnet nicht die religiöse Herkunft jener Art Sensibilität für die Unverfügbarkeit natürlichen Lebensgrundlagen. Aber er meint, die religiösen Gründe in philosophische Argumente überführen zu können, die alle Bürger von der verpflichtenden Qualität einer solchen Sensibilität überzeugen können. Er beansprucht, die in religiösen Überlieferungen aufbewahrten ethischen Gehalte in die begründende Rede einer philosophischen Ethik zu übersetzen. Nur in säkularisierter Gestalt werden semantische Gehalte religiöser Herkunft allgemein zugänglich; und nur so besteht für diese überhaupt eine Aussicht, in der politischen Öffentlichkeit einer liberalen Gesellschaften akzeptiert zu werden.
In der Hauptsache entwickelt Sandel drei Argumente, die gegen eine optimierende Instrumentalisierung der menschlichen Natur sprechen. Eine breitenwirksam eingewöhnte eugenische Praxis würde zunächst jenen »sense of giftedness« zerstören, ohne den die elterliche Erziehungspraxis misslingen muss. Sie würde auch das selbstkritische Bewusstsein, dass unsere Talente nicht unser eigenes Verdienst sind, unterminieren und damit eine wesentlich Voraussetzung für solidarisches Verhalten in der Gesellschaft gefährden. Schließlich würden die Folgen dieser Praxis genau die Grenzen der moralischen Verantwortung überschreiten, innerhalb deren Personen für ihre Handlungen allein zur Rechenschaft gezogen werden können.
Das sind Beiträge zu einer Diskussion, deren Ausgang einstweilen offen ist. Die Leser werden sich über die Stichhaltigkeit der Argumente ein eigenes Urteil bilden.
Starnberg, im Januar 2008 Jürgen Habermas
Plädoyer gegen die PerfektionEthik im Zeitalter der genetischen Technik
Für Adam und Aaron
Danksagung
Mein Interesse an Ethik und Biotechnologie wurde geweckt, als ich im Jahr 2001 unerwartet in den neu gegründeten Rat für Bioethik des amerikanischen Präsidenten berufen wurde. Obwohl ich nicht auf die Bioethik spezialisiert bin, reizte mich die Aussicht, zusammen mit einer Gruppe hervorragender Naturwissenschaftler, Philosophen, Theologen, Ärzte, Rechtswissenschaftler und Fachleuten für die Erarbeitung politischer Leitlinien kontroverse Fragen der Stammzellforschung, des Klonens und der Gentechnik zu durchdenken. Für mich waren die Diskussionen so enorm stimulierend und von so großer gedanklicher Dichte, dass ich mich entschloss, mich mit einigen der Themen auch in Lehre und Forschung zu befassen. Leon Kass, der während meiner vier Jahre als Mitglied des Rates dessen Vorsitzender war, sorgte maßgeblich für das hohe Niveau der Diskussionen. Obwohl wir beide philosophisch und politisch weit auseinander liegen, bewundere ich sein unbeirrbares Auge für wesentliche Fragen und bin ich ihm dankbar dafür, den Rat und mich in weitreichende bioethische Untersuchungen verwickelt zu haben, wie sie sich nur wenige Regierungsgremien vornehmen.
Eine der Fragen, die mich am meisten faszinierten, betraf die Ethik des genetischen Optimierens. Ich verfasste dazu für den Rat ein kurzes Thesenpapier, das ich – von Cullen Murphy ermutigt – 2004 zu einem Essay für das Atlantic Monthly ausgearbeitet habe. Für einen Autor ist Cullen das Ideal eines Herausgebers – ein kluger, einfühlsamer Kritiker mit feinem moralischen Sinn und erstklassigem redaktionellen Urteil. Ich schulde Cullen Dank dafür, den Titel dieses Buches vorgeschlagen und den Essay, der unter dem selben Titel zuerst in seinem Magazin erschien, gefördert zu haben. Mein Dank gilt auch Corby Kummer, der dabei half, den Essay zu redigieren, aus dem dieses Buch entstanden ist.
In den vergangenen Jahren hatte ich das Vergnügen, den Themen dieses Buches mit Studierenden in meinen Seminaren an der Harvard-Universität nachzugehen. Im Jahr 2006 tat ich mich mit meinem Kollegen und Freund Doug Melton zu einem Einführungskurs Ethik, Biotechnologie und die Zukunft der menschlichen Natur zusammen. Doug ist nicht bloß ein hervorragender Biologe und Stammzellpionier, er hat auch das Geschick des Philosophen, scheinbar unschuldige Fragen zu stellen, die zum Kern der Sache vordringen. Es ist ein großes Vergnügen gewesen, diesen Fragen mit ihm gemeinsam nachzugehen.
Ich bedanke mich für die Gelegenheiten, verschiedene der in diesem Buch vorgelegten Argumente vorzutragen: in der Moffett-Vorlesung an der Princeton Universität, der Geller-Vorlesung an der Medizinischen Fakultät der Universität New York; der Dasan-Gedächtnisvorlesung in Seoul, Südkorea, einer öffentlichen Vorlesung anlässlich einer internationalen Konferenz in Berlin, organisiert vom Deutschen Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften (DRZE), einer öffentlichen Vorlesung am Collège de France und einem Bioethik-Kolloquium, gemeinsam veranstaltet von den National Institutes of Health, der Johns Hopkins Universität und der Universität Georgetown. Von den Kommentaren und kritischen Anmerkungen der Teilnehmer dieser Veranstaltungen habe ich viel gelernt. Ich danke ebenfalls für die Unterstützung durch das Sommerforschungsprogramm der Juristischen Fakultät der Harvard-Universität und das Carnegie-Gelehrtenprogramm der Carnegie Corporation, das mir großzügig diesen intellektuellen Ausflug auf dem Weg zu einem künftigen (und durchaus verwandten) Projekt über die moralischen Grenzen von Märkten eingeräumt hat.
Dank sagen möchte ich auch Michael Aronson, meinem Herausgeber bei Harvard University Press, der dieses Buch mit beispielhafter Geduld und Sorgfalt zur Vollendung geführt hat, sowie Julie Hagen für ihr ausgezeichnetes Lektorat. Schließlich schulde ich Dank vor allem meiner Frau, Kiku Adatto, deren intellektueller und geistiger Sinn dieses Buch und mich besser gemacht haben. Ich widme dieses Buch unseren Söhnen, Adam und Aaron, die perfekt sind, genau wie sie sind.
1.Die Ethik des Optimierens
Vor einigen Jahren entschied ein Paar, dass es ein Kind haben wolle, vorzugsweise ein taubes. Beide Partner waren taub – und stolz darauf. Wie andere in der Gemeinschaft derer, die auf ihre Taubheit stolz sind, betrachteten Sharon Duchesneau und Candy McCullough Taubheit als kulturelle Identität, nicht als Behinderung, die es zu beheben galt. »Taub zu sein ist nichts weiter als eine Lebensform«, erklärte Duchesneau. »Wir fühlen uns als taube Menschen vollständig, und wir wollen die wunderbaren Seiten unserer tauben Gemeinschaft – ein Gefühl der Geborgenheit und der Verbundenheit – mit Kindern teilen. Wir sind ganz und gar davon überzeugt, dass wir als taube Menschen ein erfülltes Leben leben.«[1]
In der Hoffnung, ein taubes Kind zu zeugen, wählten sie einen Samenspender, in dessen Familie seit fünf Generationen Taubheit auftritt. Und sie waren erfolgreich. Ihr Sohn Gavin wurde taub geboren.
Die frischgebackenen Eltern waren erstaunt, als ihre Geschichte, über die in der Washington Post berichtet wurde, auf verbreitete Ablehnung stieß. Ein Großteil der Empörung drehte sich um den Vorwurf, sie hätten ihr Kind vorsätzlich mit einer Behinderung belastet. Duchesneau und McCullough (ein lesbisches Paar) bestritten, dass Taubheit eine Behinderung sei, und verwiesen darauf, dass sie schlicht ein Kind haben wollten, dass ihnen ähnlich sei. »Wir betrachten, was wir getan haben, nicht als so sehr anders als das, was viele heterosexuelle Paare tun, wenn sie Kinder bekommen«, sagte Duchesneau.[2]
Ist es falsch, absichtlich ein taubes Kind zu schaffen? Wenn ja, was ist daran falsch – die Taubheit oder die Absicht? Nehmen wir um des Arguments willen einmal an, Taubheit sei keine Behinderung, sondern Merkmal einer besonderen Identität. Ist es dann immer noch falsch, wenn Eltern bestimmen und wählen, wie ihr Kind sein soll? Oder tun Eltern das immer: in der Wahl ihres Partners und, heutzutage, durch den Einsatz neuer Reproduktionstechnologien?
Kurz vor der Kontroverse um das taube Kind erschien im Harvard Crimson und in anderen Studentenzeitungen an so genannten Ivy-League-Universitäten eine Anzeige. Ein unfruchtbares Paar suchte eine Eizellspenderin, aber nicht irgendeine. Sie sollte mindestens 178 Zentimeter groß und athletisch sein, aus einer Familie ohne schwere Erkrankungen stammen und weit überdurchschnittliche akademische Leistungen erzielt haben. In der Anzeige wurden für eine Eizelle von einer passenden Spenderin 50000 Dollar geboten.[3]
Vielleicht wollten die Eltern, die die saftige Summe für eine Premium-Eizelle boten, einfach ein Kind, das ihnen ähnlich ist. Oder sie hofften vielleicht, sich zu verbessern, indem sie ein Kind zu zeugen versuchten, das größer und intelligenter ist als sie selbst. Wie auch immer, ihr ungewöhnliches Angebot provozierte nicht dieselbe öffentliche Empörung, wie sie die Eltern des tauben Kindes traf. Niemand wandte ein, Größe, Intelligenz und Sportlichkeit seien Behinderungen, die man einem Kind ersparen solle. Und dennoch: Irgendetwas an dieser Anzeige hinterlässt einen bleibenden moralischen Zweifel. Selbst wenn kein Schaden angerichtet wird: Muss es einen nicht beunruhigen, wenn Eltern sich ein Kind mit bestimmten genetischen Eigenschaften bestellen?
Manche verteidigen den Versuch, ein taubes Kind zu zeugen, oder eines mit überdurchschnittlichen akademischen Leistungen, als in einer entscheidenden Hinsicht vergleichbar mit der natürlichen Fortpflanzung: Was auch immer die Eltern taten, um ihre Chance zu erhöhen, sie hatten keine Erfolgsgarantie. Beide Versuche unterlagen weiterhin den Unsicherheiten der genetischen Lotterie. Diese Verteidigung wirft eine spannende Frage auf. Warum scheint ein Element der Unvorhersagbarkeit einen moralischen Unterschied zu machen? Angenommen, Biotechnologie könnte die Unsicherheit beseitigen und uns in die Lage versetzen, die genetischen Eigenschaften unserer Kinder vorherzubestimmen: was dann?
Gehen wir dieser Frage nach, indem wir für einen Moment Haustiere statt Kinder betrachten. Ungefähr ein Jahr nach der Furore um das absichtlich taube Kind, betrauerte eine Texanerin namens Julie (sie weigerte sich, ihren Nachnamen zu nennen) den Tod ihres geliebten Katers Nicky. »Er war sehr schön«, erklärte Julie. »Er war außergewöhnlich intelligent. Er reagierte auf elf Befehle.« Sie hatte von einer Firma in Kalifornien gehört, die anbot, Katzen zu klonen – Genetic Savings & Clone. Der Firma war es 2001 gelungen, die erste Katze zu klonen (cc genannt, in Anspielung auf das Englische carbon copy, was soviel heißt wie Durchschrift, aber auch Ebenbild). Julie sandte der Firma eine Probe des Erbguts von Nicky, zusammen mit der verlangten Gebühr von 50000 Dollar. Zu ihrer großen Freude erhielt sie einige Monate später Little Nicky, einen genetisch identischen Kater. »Er ist derselbe«, erklärte Julie, »ich habe keinen Unterschied feststellen können.«[4]
Auf ihrer Internetseite hat die Firma inzwischen eine Preissenkung für das Klonen von Katzen mitgeteilt; es kostet jetzt bescheidene 32000 Dollar. Wenn das immer noch überzogen klingt: Es gibt eine Geld-zurück-Garantie. »Wenn sie das Gefühl haben, ihr Kätzchen würde dem genetischen Spender nicht genug gleichen, erstatten wir ihr Geld ohne Abzüge und ohne Fragen zurück.« In der Zwischenzeit arbeiten die Forscher der Firma an einem neuen Produkt – geklonten Hunden. Weil Hunde schwieriger zu klonen sind als Katzen, will die Firma dafür mindestens 100000 Dollar verlangen.[5]
Viele Menschen finden das kommerzielle Klonen von Katzen und Hunden merkwürdig. Manche beklagen, angesichts tausender streunender Tiere, die ein gutes Zuhause bräuchten, sei es unglaublich, dass jemand für die Sonderanfertigung eines Tieres ein kleines Vermögen ausgibt. Andere machen sich Gedanken über die vielen Tiere, die beim Klonen im Muttertier absterben. Aber nehmen wir einmal an, diese Probleme seien vom Tisch. Würde uns das Klonen von Katzen und Hunden immer noch zu denken geben? Und das Klonen von Menschen?
Unsere Beunruhigung in Worte fassen
Durchbrüche in der Genetik machen uns Hoffnung und bringen uns gleichzeitig in eine Zwickmühle. Die Hoffnung liegt darin, dass wir schon bald eine ganze Reihe schlimmer Krankheiten heilen oder verhindern können. Die Zwickmühle besteht darin, dass uns das neue genetische Wissen ermöglicht, unsere eigene Natur zu manipulieren – unsere Muskeln, unser Gedächtnis, unsere Laune zu optimieren; das Geschlecht, die Größe und andere genetische Eigenschaften unserer Kinder zu bestimmen; unsere physischen und kognitiven Fähigkeiten zu verbessern; uns selbst »wohler als gesund«[1] zu machen. Die meisten Menschen finden mindestens einige Formen der genetischen Zurichtung beunruhigend. Aber es ist nicht einfach, den Ursprung unserer Beunruhigung in Worte zu fassen. Die gewohnten Begriffe des moralischen und politischen Diskurses gestatten es nur mit Mühe, auf den Punkt zu bringen, was daran falsch ist, unsere Natur neu zu arrangieren.
Betrachten wir noch einmal die Frage des Klonens. Die Geburt des Schafs Dolly im Jahr 1997 brachte eine Flut sorgenvoller Äußerungen über die Aussicht auf geklonte Menschen. Es gibt gute medizinische Gründe, sich Sorgen zu machen. Die meisten Forscher sind sich darin einig, dass Klonen unsicher ist und mit hoher Wahrscheinlichkeit Nachwuchs mit schweren Missbildungen und Geburtsfehlern erzeugt. (Dolly starb einen vorzeitigen Tod.) Aber angenommen, die Klontechnologie ist so ausgereift, dass ihr Risiko nicht größer ist als das einer natürlichen Schwangerschaft. Müsste man das Klonen von Menschen dann immer noch ablehnen? Was genau spricht dagegen, ein Kind zu erzeugen, das ein genetischer Zwilling seines Vaters oder seiner Mutter oder vielleicht eines tragisch ums Leben gekommenen älteren Geschwisterkindes oder, warum nicht, eines bewunderten Forschers, eines Sportlers oder einer sonstigen berühmten Person ist?
Manche meinen, Klonen sei falsch, weil es das Recht des Kindes auf Autonomie verletze. Indem sie im Voraus die genetische Ausstattung des Kindes bestimmen, legen es die Eltern auf ein Leben im Schatten eines, der ihm vorausgegangen ist, fest und nehmen ihm so das Recht auf eine offene Zukunft. Der Autonomie-Einwand lässt sich nicht nur gegen das Klonen erheben, sondern gegen jede Form der Biotechnik, die Eltern erlaubt, die genetische Ausstattung ihrer Kinder zu bestimmen. Nach diesem Einwand besteht das Problem mit der genetischen Zurichtung darin, dass »Designer-Kinder« nicht völlig frei sind. Auch vorteilhafte genetische Optimierungen (des musikalischen Talents etwa oder der athletischen Fähigkeiten) richten die Kinder auf bestimmte Lebensentscheidungen aus, beeinträchtigen so ihre Autonomie und verletzen ihr Recht, ihren Lebensplan für sich selbst zu bestimmen.
Auf den ersten Blick scheint das Autonomie-Argument einzufangen, was am Klonen und an anderen Formen der genetischen Zurichtung beunruhigend ist. Aber es überzeugt nicht, und zwar aus zwei Gründen. Erstens unterstellt es fälschlicherweise, dass Kinder ohne Eltern, die Designer spielen, sich ihre körperlichen Eigenschaften selbst aussuchen können. Aber niemand von uns hat sich seine genetische Ausstattung selbst ausgesucht. Die Alternative zu einem geklonten oder genetisch optimierten Kind ist nicht eines, dessen Zukunft voraussetzungslos und nicht an bestimmte Talente gebunden ist, sondern ein Kind, das auf Gedeih und Verderb der genetischen Lotterie ausgeliefert ist.
Zweitens: Selbst wenn unsere Sorge um deren Autonomie die Verunsicherung über Kinder auf Bestellung ein Stück weit erklärt, begründet sie doch nicht unsere moralische Zurückhaltung gegenüber Menschen, die sich selbst genetisch optimieren lassen wollen. Nicht alle genetischen Eingriffe werden an die nachfolgenden Generationen vererbt. Gentherapie an nicht-reproduktiven (somatischen) Zellen, etwa Muskel- oder Gehirnzellen, arbeitet mit der Wiederherstellung oder dem Ersatz beschädigter Gene. Die moralische Verlegenheit entsteht, wenn Menschen solch eine Therapie nicht dazu benutzen, eine Erkrankung zu heilen, sondern jenseits ihrer Gesundheit ihre physischen oder kognitiven Fähigkeiten auszubauen, um sich so über den Durchschnitt zu erheben.
Diese moralische Verlegenheit hat nichts mit der Einschränkung von Autonomie zu tun. Nur genetische Eingriffe in die Keimbahn, die auf Eizellen, Spermien oder Embryonen zielen, betreffen auch nachfolgende Generationen. Ein Athlet, der seine Muskeln genetisch optimiert, gibt seine zusätzliche Schnelligkeit und Kraft nicht an seine Nachkommen weiter. Man kann ihm nicht vorwerfen, er zwinge seinen Kindern Talente auf, die sie auf eine Athletenlaufbahn programmieren. Und dennoch hat die Aussicht auf genetisch veränderte Athleten etwas Beunruhigendes.
Wie die kosmetische Chirurgie benutzt die genetische Optimierung medizinische Mittel für nicht-medizinische Ziele – Ziele, die mit der Heilung oder Verhinderung von Erkrankungen, der Behebung von Verletzungen oder der Wiederherstellung der Gesundheit nichts zu tun haben. Aber anders als die kosmetische Chirurgie ist die genetische Optimierung nicht bloß kosmetisch. Sie geht im wahrsten Sinne des Wortes tief unter die Haut. Sogar somatische Optimierungen, die unsere Kinder und Kindeskinder nicht einbeziehen, werfen schwierige moralische Fragen auf. Wenn wir in Bezug auf plastische Chirurgie und Botulinspritzen gegen ein schlabberiges Kinn und zerfurchte Augenbrauen hin und her gerissen sind, dann machen wir uns wegen der genetischen Zurichtung für einen stärkeren Körper, ein besseres Gedächtnis, höhere Intelligenz und bessere Laune umso mehr Gedanken. Die Frage lautet, ob wir sie uns zu Recht machen, und wenn ja, aus welchen Gründen?
Wenn die Wissenschaft sich schneller entwickelt als unser moralisches Verstehen, wie das heute der Fall ist, tun sich die Menschen schwer, ihre Beunruhigung in Worte zu fassen. In liberalen Gesellschaften greifen sie zunächst nach der Sprache der Autonomie, der Fairness und der Individualrechte. Aber dieser Teil unseres moralischen Vokabulars reicht nicht aus, um die schwierigsten der Fragen in Bezug auf Klonen, Designer-Kinder und genetische Zurichtung anzugehen. Genau deshalb hat die genetische Revolution eine Art moralischen Schwindel erzeugt. In der Auseinandersetzung mit der Ethik der Optimierung müssen wir uns Fragen stellen, die in der modernen Welt zum großen Teil aus dem Blick geraten sind – Fragen über den moralischen Status der Natur und über die angemessene Einstellung der Menschen gegenüber der ihnen vorgegebenen Welt. Weil diese Fragen an die Theologie grenzen, scheuen moderne Philosophen und Politologen vor ihnen zurück. Aber unsere neuen biotechnologischen Kräfte machen sie unvermeidlich.
Genetische Zurichtung
Um zu zeigen, warum das so ist, wenden wir uns vier Beispielen der Biotechnik zu, die bereits am Horizont erscheinen: Muskeloptimierung, Gedächtnisoptimierung, Größenoptimierung und Geschlechtsauswahl. Für jeden dieser Fälle gilt: Was als der Versuch begann, eine Erkrankung zu behandeln oder eine genetische Störung zu verhindern, lockt nun als Instrument der Verbesserung und der Wahlmöglichkeit für Konsumenten.
Muskeln
Jeder würde eine Gentherapie begrüßen, die eine Muskeldystrophie lindert und den schwächenden Muskelschwund im Alter umkehrt. Was aber, wenn die selbe Therapie dafür eingesetzt würde, genetisch veränderte Athleten zu erzeugen? Forscher haben ein synthetisches Gen entwickelt, das in Mäusen zum Muskelwachstum und zur Verhinderung des Muskelschwunds im Alter führt. Der Erfolg ist vielversprechend im Blick auf eine Anwendung beim Menschen. Dr. H. Lee, der die Forschung leitet, erhofft sich von der Entdeckung, dass sie Bewegungseinschränkungen bei älteren Menschen heilt. Aber Dr. SweeneysMuskel-Mäuse haben bereits die Aufmerksamkeit von Sportlern auf sich gezogen, die sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen.[1] Das Gen repariert nicht nur geschädigte Muskeln, sondern stärkt auch die gesunden. Obwohl die Therapie für Anwendungen beim Menschen noch nicht zugelassen ist, kann man sich die Aussicht auf genetisch optimierte Gewichtheber, Baseball-Drescher, Fußball-Verteidiger und Sprinter leicht ausmalen. Der verbreitete Gebrauch von Steroiden und anderer Leistung fördernder Medikamente im Profisport deutet darauf hin, dass viele Athleten erpicht darauf sein werden, sich der genetischen Optimierung zu bedienen. Das Internationale Olympische Komitee macht sich bereits Gedanken darüber, dass veränderte Gene, anders als Medikamente, nicht durch Urin- oder Bluttests nachgewiesen werden können.[2]
Die Aussicht auf genetisch veränderte Sportler bietet eine gute Illustration der moralischen Verlegenheit, in die die Optimierung uns bringt. Sollten das IOCund der Profisport überhaupt genetisch veränderte Sportler ausschließen und wenn ja, mit welcher Begründung? Die beiden offensichtlichsten Gründe, Drogen im Sport zu verbieten, sind Sicherheit und Fairness. Steroide haben schädliche Nebenwirkungen, und Einigen zu erlauben, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, indem sie große Gesundheitsrisiken eingehen, würde deren Mitbewerber unfair benachteiligen. Aber nehmen wir um des Argumentes willen an, dass sich die Muskel optimierendeGentherapie als sicher herausstellt oder jedenfalls als nicht gefährlicher als ein hartes Trainingsprogramm mit Gewichten. Gäbe es dann immer noch einen Grund, ihren Einsatz im Sport zu unterbinden? Die Vorstellung von genetisch veränderten Athleten





























