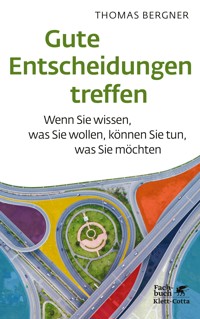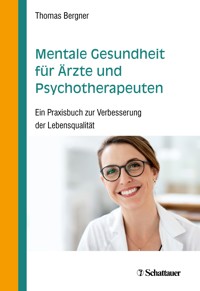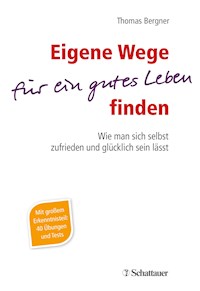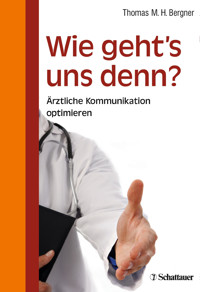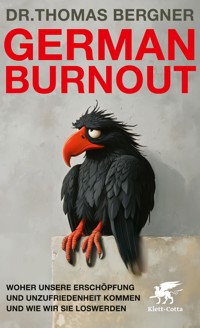
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Deutschland ist ausgebrannt!« Dr. Thomas Bergner Dr. Thomas Bergner hat einen neuen Patienten: Deutschland! Diagnose: Burnout. Absolut verblüffend stellt der Burnout-Experte dar, wie sich Deutschlands politische und gesellschaftliche Entwicklungen sowie die gedrückte Stimmung im Land auf ein und denselben Befund zurückführen lassen – und wie wir der Passivität und dem Missmut entkommen können. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Deutschen eine Neigung zur Apokalyptik haben: Wenn ein Gefühl viele Deutsche bewegt, dann ist es Unzufriedenheit. Immer mehr berichten auch von einem Gefühl der Leere, von Überforderung und Orientierungslosigkeit. Überbürokratisierung und politischer Reformstau scheinen zur Staatsräson geworden zu sein und zerren an unseren Nerven. Die aktuellen Krisen verstärken das negative Empfinden: Kriege, Rechtsruck, Klimawandel, Inflation. Doch was wäre, wenn dies nur Symptome einer Erkrankung sind? Der Arzt und Berater Thomas Bergner sieht in diesen Entwicklungen deutliche Anzeichen von Burnout. Anhand zahlreicher Beispiele aus Politik, Geschichte und Gesellschaft erläutert er Ursachen und Auswirkungen unseres »German Burnout« – und zeigt auf Basis seiner jahrelangen Arbeit, wie wir selbstwirksam aus diesem Zustand herausfinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dr. Thomas Bergner
GERMAN BURNOUT
Woher unsere Erschöpfung und Unzufriedenheit kommen und wie wir sie loswerden
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer KI-generierten Abbildung (Midjourney)
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98859-8
E-Book ISBN 978-3-608-12380-7
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Teil I
Etwas ist faul im Staate Deutschland
Was ich meine, wenn ich über Deutschland spreche
Die Verdachtsdiagnose
Was ist Burnout?
A Short History
Die Erkrankung an sich
Grundlegendes
Wie Burnout entsteht
Persönlichkeit und Burnout
Abgrenzung zur Depression
Die drei Hauptsymptome von Burnout
Emotionale Erschöpfung
Depersonalisation
Leistungsabnahme
Die drei Phasen von Burnout
Phase 1: Anfangszeit – Hyperaktivität
Phase 2: Übergangszeit – Rückzug und Flucht
Phase 3: Das Ende – Isolation und Passivität
Teil II
Anamnese: System Deutschland
Ein kurzer Blick auf die Ausgangssituation
Der Zusammenbruch der
DDR
Enttäuschte Erwartungen
Nie geübte Eigenverantwortung
Die Ära Merkel: Festhalten, was geht
Die
COVID
-19-Pandemie
Zeitenwende(n)
German Burnout
Erstes Hauptsymptom: German Scham
Zweites Hauptsymptom: German Schuld
Drittes Hauptsymptom: German Angst
Nur nichts Falsches sagen
Das Verlangen nach absoluter Sicherheit
Vertrauensverlust macht unsicher
Fehlendes Urvertrauen
Ver-un-sicherungen
Scham, Schuld, Angst und Burnout
Viertes Hauptsymptom: German Unzufriedenheit
Unzufriedenheit: das Leitgefühl bei Burnout
Exkurs: Populistische Parteien als Nutznießer und Beförderer der Unzufriedenheit
Affektualisierung bis zur Gewalt
Weitere Auffälligkeiten in Verhalten und Gefühlsleben
Perfektionismus
Depression
Bindungsebene
Konfliktlösungen zum Schein
Verantwortung loswerden oder abgenommen bekommen
Sucht
Wie die Lösungsversuche des Patienten das Problem unterhalten
Das große Festhalten (weil es sonst keinen Halt gibt)
Der große Stillstand (Deutschlands Prokrastination)
Richtungslosigkeit
Teil III
Therapie des German Burnout
Wie gehen wir ran?
Selbstvertrauen aufbauen
In fünf Schritten aus dem German Burnout heraus
Schritt 1: Verstehen, was war und was ist
Schritt 2: Verständnis und Versöhnung schaffen
DDR
: Doppelte Deutsche Rückschau
Aufarbeitung der Covid-19-Pandemie
Selbstversöhnung
Schritt 3: Akzeptanz. Das Hier und Jetzt anerkennen
Probleme wahrhaftig benennen – die Bedeutung von Krisen
Wertschätzen des Erreichten
Grenzen des eigenen Einflusses anerkennen und bestimmen
Schritt 4: Änderungen jetzt. Selbstwirksamkeit aufbauen
Belohnungen anbieten
Emotionale Intelligenz und Empathie nutzen
Neue Sichtweisen entwickeln
Umgang mit Krisen und anderen Unveränderlichen
Resilienz aufbauen und nutzen
Zufriedenheit steigern: der Verzicht auf Bewertungen
Die Bedeutung von Bindungen erleben
Selbstoptimierung und Perfektionismus beenden
Schritt 5: Die Zukunft gestalten
Mündigkeit entwickeln
Bildung bildet Zukunft
Rente reformieren
Solidarität neu verstehen
Ein modernes Selbstverständnis aufbauen
Nur das noch …
Danksagung
Literaturverzeichnis
Artikel und Berichte (online)
Für Ainoa, die mir eine wundervolle Dimension des Lebens ermöglicht
Vorwort
Was wäre, wenn Deutschland an einer Erkrankung leidet, und niemand diagnostiziert sie? Wenn Merkwürdigkeiten im Politikbetrieb, der Reformstau, die Neigung, alles absichern zu wollen, was nur abgesichert werden kann, die German Angst, Radikalisierung und Populismus, die Zunahme psychischer Erkrankungen, Wutbürger und Unzufriedenheit in der Bevölkerung etc. nur Symptome einer einzigen zugrundeliegenden Erkrankung wären? Diagnose: Burnout.
In diesem Buch betrachte ich Deutschlands Zustand aus der Sicht eines Arztes und Coaches. Um mich Deutschland zu nähern, nutze ich einen kleinen Kniff:
Man kann die Erde als ein System ansehen, das agiert und reagiert. Fast alle Akteure in diesem großen System wissen nicht, welchen Einfluss ihr Tun hat. Dabei sind Systeme oft so komplex, dass sie schwer zu kontrollieren und zu beeinflussen sind. Analog können wir jedes Land, eben auch Deutschland, als ein System betrachten. Ein systemischer Ansatz in der Psychotherapie nimmt eine Metaposition ein, um sich nicht in der detaillierten Analyse von letztlich unwichtigen Einzelheiten zu verlieren. Eine vergleichbare Sicht nutze ich, indem ich sage: Deutschland, das ist nicht nur der Staat mit seinen Institutionen. Das ist nicht nur seine Wirtschaft mit ihren Verästelungen. Das sind nicht ausschließlich die Menschen. All diese und viele andere Faktoren zusammen machen Deutschland aus.
Natürlich kann niemand alle hier wirkenden Kräfte erkennen und beurteilen. Deshalb habe ich vorrangig das implementiert, was seit Längerem oder in besonderer Heftigkeit Deutschland Probleme bereitet und deshalb zur Diagnose des German Burnout passt. Es entspricht einer therapeutischen beziehungsweise ärztlichen Vorgehensweise. Was man für die Diagnosestellung als vernachlässigbar oder unwichtig erachtet, wird außen vor gelassen und das, was die Diagnose stützt, wird genauer gewürdigt, kurzum: Es ist nicht sinnvoll, sich mit einem Hühnerauge zu befassen, wenn jemand an einer Lungenentzündung leidet.
Somit ist das Buch auch subjektiv in seiner Diagnose. Ich bin mir bewusst, weder die Wahrheit gepachtet zu haben noch sie konsequent erkennen zu können. Aber ich hoffe, ihr vielleicht nahe gekommen zu sein und so zu einem Erkenntnisfortschritt beizutragen.
Sie finden viele aktuelle, zeitgeschichtliche Beispiele und Daten im Buch. Aufgrund der Vergänglichkeit und der schnellen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und bei Statistiken wird manches davon bereits beim Erscheinen des Buches nicht mehr auf dem neuesten Stand sein. Ich habe diese Vorgehensweise dennoch gewählt, weil damit am Konkreten das Grundsätzliche plastisch und nachvollziehbar dargestellt werden kann. Das Grundsätzliche wird Bestand haben.
Teil I
Etwas ist faul im Staate Deutschland
Was ich meine, wenn ich über Deutschland spreche
In diesem Buch geht es um meine kulturelle Heimat, um die ich mir große Sorgen mache. Die zunehmende Aggression und Unzufriedenheit, politischen Fragmentierungen und wirtschaftlichen Probleme sind einige der Themen. Inzwischen wird (im Kontext mit der Ertüchtigung der Bundeswehr) sogar von Staatsversagen gesprochen (90). Über mehrere Jahrzehnte habe ich in unterschiedlichen Positionen Menschen beraten. Sie machten sich Gedanken um sich selbst und um ihre Liebsten und wollten Hilfe. Sie wünschten sich Antworten zu verschiedenen Fragen: Woran leide ich? Und: Wie werde ich wieder gesund? Erst die Diagnose, dann die Therapie.
Und genau diese Fragen versuche ich nun für unser Land zu lösen. Nur dass kein Individuum mehr vor mir sitzt, sondern Deutschland. Dafür betrachte ich es als ein System. Es integriert die gleich erläuterten vier üblichen Kategorien Staat, Land, Nation oder Gesellschaft.
Der Staat Dieser Begriff hat keine einheitliche Bedeutung. Was ein Staat ist, sehen Soziologen anders als Politologen, Völkerrechtler oder Juristen. Volkswirte sagen, der Staat sei eine Form von Zwangsgebilde, das durch Gesetze und die eigenen Geldmittel in den Markt eingreift, weil er teilweise etwas selbst produziert, weil er Steuern, Zölle und Abgaben verlangt, weil er Transferleistungen auszahlt wie Subventionen und Sozialausgaben.
Am ehesten ist ein Staat ein System von vielen öffentlichen Institutionen, um das Gemeinwesen zu regulieren. Diese Sicht auf Deutschland definiert es als mächtige Organisation. Ein Staat hat also die vorrangige Aufgabe, Recht und Ordnung zu gewährleisten – nach innen wie nach außen. Dafür nutzt er seinen Staatsapparat. Verwaltung, Polizei und Bundeswehr, das sind die politischen Institutionen. Aus dieser Konstruktion heraus gibt es die Staatsangehörigkeit und international gültige und anerkannte Pässe und Ausweise. Wir alle wären nach dieser Sichtweise dann das deutsche Staatsvolk. Unter einem Staatsvolk werden alle verstanden, die der Regelungsmacht des Staates unterliegen (Zippelius 2010).
Das Land Andere werden sich auf die Geografie beziehen und sagen, Deutschland, das ist unser Land. Damit meinen sie die 357 595 Quadratkilometer, welche unser Gebiet umfassen. Wenngleich sprachlich nicht korrekt, wird der Begriff Land oft auch synonym mit dem Ausdruck Staat benutzt.
Die Nation Eine nächste Sicht auf Deutschland ist die einer Nation. Der Begriff ist mindestens so umstritten wie der eines Staates. Am ehesten finde ich die Definition von Otto Dann nachvollziehbar (in Langewiesche 2000). Demnach ist eine Nation eine politische Willensgemeinschaft, die in einer gemeinsamen geschichtlichen Erfahrung wurzelt und sich als Solidargemeinschaft empfindet. Ihr Grundkonsens ist die gemeinsame politische Kultur. Wer wie rechtsnationale Politiker eine andere »Kultur« anstrebt, wendet sich damit de facto weg von der Nation. Nationale Identität gleicht einem kollektiven Selbstbewusstsein. »Nation« dient dann wie eine Form von Klebstoff, welcher eine Einheit des Volkes stiften soll.
Kurzum: Ohne nationalistischen Beigeschmack ist eine Nation eine Gemeinschaft, die auf einem Staatsgebiet lebt. Die Nation ist der Verband der Staatsangehörigen (93). In der Tat sind Nationen immer von Heterogenität gekennzeichnet. Die Vorstellungen von einem blauäugigen und weißen Deutschland sind ein Hirngespinst (43). Die vor allem von politisch Rechten missbrauchte angebliche »deutsche homogene Identität« existiert genauso wenig wie beispielsweise eine US-amerikanische. Davon unabhängig gibt es aber sicher Inhalte wie Ansichten oder auch Verhaltensweisen, die man lange Zeit als »typisch Deutsch« bewertet hat, wie Pünktlichkeit, Ordnung oder einen Hang zum Zweckpessimismus.
Die Gesellschaft Dann gibt es noch den Begriff der Gesellschaft, die Deutschland ausbildet. Auch dieser ist nicht eindeutig. Ich bevorzuge die Sicht von der Gemeinschaft der dem freiheitlichen Staat gegenüberstehenden Bürger. Zur Gesellschaft werden sowohl die natürlichen Personen als auch die juristischen Personen des Privatrechts gezählt, auf die der Staat keinen direkten Einfluss besitzt. Das sind insbesondere Unternehmen, Gewerkschaften, Vereine, Verbände, Bürgerinitiativen, Medien, Kirchen, und der staatsfreie Kulturbetrieb (93).
Die Gesellschaft spiegelt die zwischenmenschlichen Bestrebungen und Organisationen, die sich außerhalb der beim Staat konzentrierten öffentlichen Gewalt entfalten. Sie ist etwas anderes als die Nation. Die Gesellschaft ist das Gegenüber des Staates und das Objekt von dessen Hoheitsgewalt. Die Nation hingegen ist der Träger aller staatlichen Gewalt. Die Gesellschaft hat somit einen passiven Status gegenüber dem Staat, die Nation einen aktiven.
Welches Deutschland meine ich nun? Wenn ein kranker Mensch einen Therapeuten oder eine Ärztin aufsucht, kommt er mit vielen verschiedenen Aspekten, die allesamt zu ihm gehören. Er hat körperliche Grenzen (sein »Land«), er hat seine Vorgeschichte, im Regelfall auch seine Familie, soziale und mentale Fähigkeiten und vielfältige weitere Eigenschaften. Er ist eine Person in seiner Gesamtheit. Mal wird der eine Aspekt wichtig, mal ein anderer. Kommt er wegen eines Arbeitsunfalls, wird seine kindliche Vorgeschichte vermutlich ohne Bedeutung sein. Belasten ihn Angstzustände, kann ein intensiver Blick auf seine Kindheit erhellend sein. Je nach Fall sammeln Ärzte und Therapeutinnen andere Befunde und versuchen, diese soweit möglich in ihren Zusammenhängen zu verstehen. Daraus wird die Diagnose gebildet. Es kommt also auf das Zusammenspiel typischer Symptome an. Nur selten genügt ein einziger Befund, um eine Diagnose sicher stellen zu können. Meistens braucht es mehrere, um daraus ein Ergebnis abzuleiten. Ich betrachte Deutschland aus seiner Gesamtheit heraus: »Was ist das (und an was leidet es), dieses Deutschland?« Es geht um das Sosein, auch um die Frage: Was ist auffällig, vielleicht sogar krank an unserem Zuhause?
Deutschland als großes Ganzes ist noch mehr als ein Land, ein Staat, seine Geschichte und seine Menschen. Es ist »all dies und vieles andere mehr«. Das System Deutschland beinhaltet vieles, das über die Kategorien hinausgeht, die hier besprochen werden (Abb. 1). Systeme sind Konstruktionen von Beobachtern. Durch ihre Beschreibung wird entschieden, was zum System gehört und was nicht. Dabei setzt sich ein System immer aus verschiedenen Einzelteilen (Komponenten) zusammen, zwischen denen Beziehungen (Relationen) bestehen. Systeme haben die wesentliche Eigenschaft, sich selbst zu organisieren (Lindemann 2023). Meine Ausführungen sind also nicht historischer, politologischer oder soziologischer Art, sondern vorrangig psychologischer. Meistens geht es um das Wechselspiel zwischen der Bevölkerung und der Exekutive, vorrangig den Politikern.
Was Politiker tun oder sagen und was sie unterlassen, wird jeder Politiker nach außen begründen mit den Verpflichtungen für das Amt, die Bürger und auch die Partei, der er angehört. Zutiefst hat es aber erst einmal mit ihr oder ihm selbst zu tun. Darin besteht nur scheinbar ein Konflikt mit der Idee, Politikbetreibende seien Handlanger Deutschlands. Die Entscheidungen sind selbst getroffen, aber finden auch in einem unbewussten Austausch innerhalb des Systems statt. Jeder handelt selbstbestimmt und zugleich als Teil des Ganzen. Das gilt gleichsinnig für die Bevölkerung. Mit dem, was wir tun, denken, sagen und fühlen, wirken auch wir letztlich auf das Ganze.
Wenn wir uns in Bezug zu Deutschland setzen, nimmt dies niemandem die Freiheit und ebenso wenig die Verantwortung für das, was sie oder er tut. Die vielen, individuellen Entscheidungen und Handlungen aller Menschen können gleichsinnig in eine Richtung wirken oder zur Fragmentierung beitragen.
Abb. 1: Das System Deutschland
Die Verdachtsdiagnose
Anfang Februar 2024 sagte Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck über die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit Deutschlands: »Die Stimmung in Deutschland ist gerade eher Moll.« (12) Weitere Nachrichten vermelden: »Deutschlands Tage als industrielle Supermacht sind gezählt« (51). Die Grundpfeiler der deutschen Industrie seien wie Dominosteine umgefallen, und die politische Lähmung in Berlin verschärfe die nationalen Probleme. Außerdem sei unklar, wie dieser Niedergang aufgehalten werden könne. Die Analyse »Willkommenskultur in Krisenzeiten« spricht vom »Eindruck kollektiver Erschöpfung und Überforderung« (74). Die Ursache dafür seien die Aufnahme von rund 1,14 Millionen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und die im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent gestiegenen Erstanträge für Asyl. Die Deutschen hätten Bedenken, ob die Aufnahme dieser vielen Menschen erfolgreich möglich sei. Die Zweifel beziehen sich dabei vorrangig auf die Integration mit den verfügbaren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Möglichkeiten. Weiter heißt es in demoskopischen Umfragen, Deutschland sei genervt. »Kritik, Geschimpfe und Wut sind dabei mehr als anekdotisch. Die Stimmung in der Gesellschaft ist messbar so schlecht wie noch nie.« (1). Es herrsche allgemein Pessimismus vor. Das Vertrauen in Politik und Gesellschaft, gemeinsam Herausforderungen zu meistern können, schwinde (1). Zuversicht oder ein Appell seitens der Politik an die Resilienz der Deutschen fehlen. Man gewinnt den Eindruck, Politik und Medien malten die Zukunft des eigenen Landes nur noch in düsteren Farben, stellten nur fest, dass alles noch schlechter werde. In Ansprachen wird betont, wir alle müssten uns nun doppelt anstrengen und den Mangel gerechter verteilen. In seiner Weihnachtsansprache 2022 sagte der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: »Ja, dies sind raue Zeiten. Wir stehen im Gegenwind« (94). Ein Jahr später: »Ja, wir stehen vor großen Herausforderungen. Und ja, es ist anstrengend« (95).
Diese Aussagen klingen depressiv, verzweifelt, wirken visionär verarmt. Wir erleben Genörgel statt Stolz, Pessimismus statt Selbstbewusstsein und Lebenslust. Dazu passt auch folgende Aufstellung:
immer mehr Beamte, aber keine Digitalisierung
Billionen für die Energiewende, aber Import von Atomstrom
teurer öffentlich-rechtlicher Rundfunk, aber einseitige Berichterstattung
Verteuerung der CO2-Bepreisung, aber keine Entlastung der Bürger
Klimakrise, aber handlungsunfähige Regierung
weit überdurchschnittliche Steuerbelastung, aber marode Infrastruktur
teils unbezahlbare Mieten, aber Neubauziele verfehlt
Kanzleramts-Neubau für fast eine Milliarde Euro, aber kein Geld im Staatssäckel
Grünes Wirtschaftswunder angekündigt, doch die Industrie verlässt das Land.
Die bisher nicht aufgearbeiteten Erfahrungen und Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der Klimawandel mit seinen Naturkatastrophen, die Inflation und die Kriege in Osteuropa und im Nahen Osten verschärfen diesen Eindruck. Wir erleben eine Stapelkrise. Das bedeutet, mehrere Krisen treten gleichzeitig oder rasch hintereinander auf. Sie führen zu Gefühlen der Unsicherheit, emotionaler Überforderung, Unzufriedenheit und Hilflosigkeit.
Weitere Auffälligkeiten sind: Hunderttausende Studierende in unserem Land haben psychische Probleme. Manche von ihnen brechen deshalb das Studium ab und mehr als jeder Dritte wird als Burnout gefährdet beschrieben (33). Der Anteil der Studierenden, denen Antidepressiva verschrieben wurde, ist laut Techniker Krankenkasse von 2019 bis 2023 um 30 Prozent gestiegen.
2024 erreichte der Krankenstand in Deutschland einen neuen Höchststand (136). Einen Hauptfaktor stellten psychische Erkrankungen dar: Zwischen Januar und August kamen bereits mehr solcher Fälle vor als im gesamten Vorjahr. Die Zahl der Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen hat sich von 2014 bis 2024 um fast die Hälfte erhöht (136).
In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Krankheitstage der Arbeitnehmenden in Deutschland sogar mehr als verdoppelt (45). Im Jahr 2022 wurden 132 Millionen Arbeitsunfähigkeits- und Krankheitstage wegen psychischer Probleme und Verhaltensstörungen gemessen. Ein Jahr zuvor waren es noch 126 Millionen Fehltage. Die durchschnittliche Ausfallzeit aufgrund solcher Störungen liegt bei 32 Tagen und ist damit etwa dreimal so hoch wie bei allen anderen Diagnosen.
Die Lebenszeitprävalenz für psychische Störungen liegt bei 43 Prozent. Das bedeutet, nahezu jeder zweite Deutsche erkrankt in seinem Leben an einer seelischen Störung. Der tatsächliche Skandal dabei wird fast vollständig verschwiegen, denn psychische Erkrankungen sind immer noch ein Tabu. Eine der wenigen öffentlichen Ausnahmen ist der Politiker Michael Roth, der von seiner psychotherapeutischen Behandlung sprach (135). Noch immer stellt eine angeschlagene Psyche ein Stigma dar, außer in gewisser Weise Burnout. Insofern steckt in der Diagnose Burnout auch immer ein wenig Selbstbetrug. Der äußert sich durch eine Art Heiligenschein, welcher um die Diagnose herum gesponnen wurde. Burnout hat auch mit intellektualisierender Abwehr zu tun (Hillert, Marwitz 2006). Also weil man so unbeliebte Ausdrücke wie Neurose, Depression oder Selbstüberschätzung nicht gebrauchen möchte, wurde der Begriff zu einer beliebten Alternative.
Neben diesen persönlichen mentalen und seelischen Auffälligkeiten gibt es zahlreiche andere, die zunehmende Akzeptanz populistischer und rechtsgerichteter Parteien, die Radikalisierung im öffentlichen Diskurs oder die stetig überbordende Bürokratie ebenso wie marode Infrastrukturen. Sie sind ein Zeichen dafür, wie lange sich Deutschland schon nicht mehr ausreichend um sich selbst gekümmert hat.
Das lässt mich als Mediziner und Coach aufhorchen: Denn all dies sind Anzeichen, dass etwas Grundlegendes nicht stimmt. Es sind die gleichen Symptome und Gefühle, die im Rahmen von Burnout auftreten und die verdeutlichen, dass sich Deutschland in einer Krise befindet: einem German Burnout.
Es ist ein systemisches Burnout, eine spezifisch deutsche Variante dieser Erkrankung, die unter anderem mit den historischen Vorgängen in unserem Land zusammenhängt.
Was ist Burnout?
Grundsätzlich beschreibt Burnout das Gefühl der Erschöpfung und des Ausgebrannt-Seins. Zuerst dargestellt wurde Burnout 1974 in zwei kurz hintereinander veröffentlichten Aufsätzen zweier New Yorker: Der Verwaltungsexperte Sigmund Ginsburg widmete sich dem Ausbrennen von Führungskräften, der Psychoanalytiker Herbert Freudenberger berichtete über eigene Erfahrungen mit den persönlichen Belastungen von Sozialarbeitenden. Wirklich neu war das Phänomen aber nicht. Man findet immer wieder Geschichten – fiktiv oder real – von Persönlichkeiten, die ein Burnout hatten: Der Philosoph Ludwig Wittgenstein (1889–1951) beispielsweise, der sich als Landlehrer versuchte und nach sechs Jahren verbittert und entnervt aufgab, würde heute vermutlich von seinem Burnout reden. In der Literatur gibt es prominente Fälle, etwa Senator Thomas Buddenbrook in der 1901 erschienenen Familiensaga Die Buddenbrooks von Thomas Mann, oder die Titelfigur in Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden (1947). Sogar im Alten Testament beim Propheten Elias wird man fündig (1. Könige, 17–22).Der Prophet stürzte nach Erfolgen im Angesicht einer drohenden Niederlage in tiefe Verzweiflung. Hierfür wurde von Pastoren der Ausdruck der »Elias-Müdigkeit« geprägt.
Der medizinische Vorgänger von Burnout war die Neurasthenie. Darunter versteht man eine auffallende mentale Erschöpfung und Ermüdbarkeit bei geringer Belastbarkeit durch äußere Reize oder bei körperlichen Anstrengungen. Sie war eine Art Modeleiden des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Schnelllebigkeit und Reizüberflutung durch neue Technologien wie Telegrafen und Dampfzüge sollten zu ihr führen. Interessanterweise waren vor allem Wohlhabende betroffen. Sie ließen sich auch mit Stromstößen behandeln, bevorzugten allerdings eine gesellschaftlich akzeptierte Auszeit im Sanatorium, also eine Kur.
A Short History
Schauen wir uns die geschichtliche Entwicklung unter dem Gesichtspunkt von Burnout an, so stellen wir fest, dass die erlebte und empfundene Erschöpfung sich zunächst vorrangig auf die körperliche Ebene erstreckte. Im 19. Jahrhundert war der Mensch körperlich erschöpft, weil seine Kraft in Fabriken oder Bergwerken unter oft inhumanen Bedingungen ausgenutzt wurde. Die beginnende Industrialisierung leistete dieser Form von Erschöpfung Vorschub. Im 20. Jahrhundert und auch noch jetzt wurde und wird diese Inhumanität – sich ebenfalls als Auswirkungen des Materialismus und Kapitalismus äußernd – auf der mentalen und seelischen Ebene empfunden. Für körperliche Erschöpfung gibt es nun erheblich weniger Anlass. Seit etwa 80 Jahren haben technische Geräte die Körperkraft des Menschen in vielen Bereichen ersetzt. Mental bezieht sich auf den Geist und die Vernunft, seelisch auf die Emotionalität. Da seelische Probleme noch immer gesellschaftlich auch als Makel betrachtet werden, hat sich in der Alltagssprache (und auch in wissenschaftlichen Publikationen, besonders im englischsprachigen Raum) die Rede von mentaler Gesundheit durchgesetzt, die jedoch beide Inhalte, also auch seelische, meint. In der Tat bestehen untrennbare Überschneidungen zwischen der Gefühls- und der Gedankenwelt.
Die Digitalisierung und der zu vermutende Siegeszug von Künstlicher Intelligenz werden die Beschäftigung mit und den Konsum von entsprechenden Medien weiter steigern. Es ist zu vermuten, dass sie Störungen befördern: Die erhöhte Zahl von Angsterkrankungen, Autismus oder das häufiger beachtete ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) können unter diesem Aspekt Vorboten dieser Annahme sein (Bretschneider et al. 2020). Burnout ist eine Art von »Brücken-Erkrankung«, weil es sowohl seelische als auch mentale Anteile beinhaltet.
In den 1970er und 1980er Jahren wurde die Definition von Burnout im Voraus festgelegt (Bianchi et al. 2022). Sie ging nicht aus einem stringenten Forschungsprozess hervor. Auch der zur Diagnosestellung weltweit fast monopolistisch genutzte, kommerzielle psychologische Test Maslach Burnout Inventory (MBI) verfügt über keine ausreichende, wissenschaftliche Grundlage. Eines seiner Defizite ist, dass jeder, der den Test bearbeitet, per definitionem an Burnout leidet. Eine allein aufgrund der Bearbeitung feststehende Diagnose ist natürlich keine Diagnose. So war Burnout zunächst ein Konstrukt, das aus persönlichen Eindrücken und Anekdoten entstand. Dennoch ist der Begriff so stark in der heutigen wissenschaftlichen Literatur vertreten, dass er damit im Nachhinein gerechtfertigt wird.
Burnout ist wissenschaftlich betrachtet so etwas wie ein Modell, um psychosoziale Arbeitsbelastung abzubilden. Das hat einen Vorteil: Burnout stigmatisiert nicht. Es schenkt den Betroffenen das gesellschaftlich anerkannte Recht, erheblich weniger oder gar nichts mehr leisten zu müssen. Burnout – das bedeutet eben auch, keine Neurose zu haben, nicht depressiv zu sein, keine Persönlichkeitsprobleme aufzuweisen. Burnout ist eine kluge Wahl des Betroffenen. Er hat sich gegen die Gesellschaft und deren markante Auswüchse entschieden. Burnout ist eine Erlösung vom Druck der Selbstverwirklichung und davon, erfolgreich sein zu müssen. Doch das hat auch eine unerwünschte Wirkung: Letztlich verharmlost es, ja ignoriert, was mit der Person und auch einem System wie Deutschland tatsächlich geschieht. Daher verwende ich den Begriff Burnout, wie viele andere auch, im Sinne einer Erkrankung und einer Diagnose.
Übrigens gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass wer ausbrennt, jemals wirklich entbrannt gewesen sein muss. Das Gefühl der Verausgabung hängt vorrangig vom Individuum ab und – bis zu einer gewissen Grenze – nur nachrangig von einer objektiv messbaren Belastung. Zudem stellt sich die Frage, ob eine Erschöpfung wie bei Burnout nicht einfach eine gesunde oder normale Reaktion auf markant ungesunde Verhältnisse sein kann. Dazu folgt später mehr.
Es gibt also keine wirklich anerkannten Kriterien für Burnout. Was der eine damit verbindet, passt beim anderen nicht. Das Spektrum der Inhalte, die mit Burnout verbunden werden, ist groß, vielleicht zu groß. Der Begriff Burnout genügt insofern keinen wissenschaftlichen Kriterien und lädt zur Unter- und Überdiagnose ein. Dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – steigt die Zahl der Publikationen zu Burnout stetig an (Bergner 2021).
Im angloamerikanischen Bereich wird Burnout als eigenständige Erkrankung anerkannt (Maslach & Leiter 2016, Slatten et al. 2011), während es bei uns als eine irgendwie geartete Vorform einer möglicherweise entstehenden Depression oder auch einer Angsterkrankung betrachtet wird (Berger et al. 2012).
Für Burnout sind nach offizieller Lesart hierzulande die Sozialpartner verantwortlich. Das hat starke Nähe zur Ursprungsdefinition von Burnout, bei der die zwischenmenschlichen Kontakte als Hauptursache beschrieben wurden. Davon ist man mittlerweile abgekommen. Es kam zu einer Form von Ebenenwechsel. Die für entsprechende Fachfragen zuständige Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde sieht Burnout mittlerweile als Erschöpfungszustand, dessen Ende nicht absehbar sein muss. Sie macht dafür verantwortlich: die Arbeitswelt. Die Arbeitsbedingungen werden nun als ursächlich angesehen (Shanafelt et al. 2015).
Zu den Auslösern von Burnout gibt es also ebenfalls keine einheitliche, wissenschaftliche Meinung. Einige konzentrieren sich auf die Person selbst. Sie machen damit das Innere eines Menschen für Burnout verantwortlich. Sie sagen: Burnout, das ist die Folge einer für die Person unerträglich starken Belastung aufgrund ihres Überengagements (besser wäre es, von Fehlengagement zu sprechen). Für das German Burnout mag das in vielerlei Richtungen gelten.
Andere Wissenschaftler verorten die Ursachen von Burnout in den institutionellen Umständen. Sie sagen: Was der Mensch in seiner beruflichen Umgebung erlebt, das ist für Burnout ursächlich. Für Deutschland wären dies beispielsweise die Strukturen der überbordenden Bürokratie, die es selbst aufgebaut hat und forciert. Noch andere meinen, die emotional fordernden zwischenmenschlichen Belastungen sind krankheitsauslösend. Beim German Burnout wären dies ganz vorrangig der noch fast lautlose Kampf zwischen sehr erfolgreichen und reichen Gruppen und der sich abgehängt fühlenden Mittelschicht. Andere Beispiele sind das dysfunktionale Pflegesystem und der Gender Pay Gap (also die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern für die gleiche Leistung) und überhaupt veraltete Rollenvorstellungen. Schließlich kann Burnout auch auf sich verändernde gesellschaftliche, politische, soziale, soziologische und kulturelle Bedingungen zurückgeführt werden. Das wäre auf der Ebene Deutschlands dann der massive Umbruch der letzten Jahre und die Zeitenwende, die weltweit und in vielen Bereichen sichtbar wird.
Nachdem ich eine sehr lange Zeit Menschen mit Burnout begleitet und beraten habe, ist meine Erfahrung folgende: Personen- und nicht arbeitsplatzbezogene Inhalte sind von erheblich höherer Bedeutung für die Entwicklung von Burnout. Diese Inhalte sind den Betroffenen zunächst nicht bewusst. Zumindest können sie nicht von sich aus den Zusammenhang beispielsweise von einschneidenden, frühen Erfahrungen mit ihrem erwachsenen Erschöpfungszustand erkennen. Erst eine intensive, zeitaufwendige Arbeit fügt die einzelnen, individuellen Puzzleteilchen zu einem Ganzen zusammen. Genau diese Arbeit wird jedoch in den wissenschaftlichen Untersuchungen zu Burnout vermieden. Es werden standardisierte Tests und (semi-)strukturierte Interviews genutzt; viele Stunden des inhaltsoffenen Eins-zu-eins-Kontakts existieren nicht mehr. Deshalb wird systematisch übersehen, worum es tatsächlich geht. Wenn ich voraussetze, die Arbeitswelt sei der Auslöser, und fast ausschließlich in diese Richtung nachfrage, werden kaum Erlebnisse viel früherer Zeiten auf das Gesprächstablett kommen. Es werden also weitgehend Pseudokausalitäten benannt und erforscht. Meine Erfahrungen zeigen bei der Mehrheit der von Burnout Betroffenen einschneidende Traumata in der Zeit von der frühen Kindheit bis etwa zum neunten Lebensjahr. Das Spektrum ist so vielfältig wie beispielsweise eigene Nahtoderlebnisse, Tod von engen Bezugspersonen, Missbrauch jeder Art. Aufgrund der individuellen Persönlichkeit und persönlichen Vorgeschichte nicht ausreichend resiliente Menschen reagieren dann als Erwachsene auf Belastungen und Überlastungen im Sinn eines Burnouts.
In eine Überlastungssituation kommen Menschen, die diese Überlastung nicht rechtzeitig wahrnehmen. Sie verstehen zunächst nicht oder erkennen nicht an, was in ihnen vorgeht. Oder diese Menschen spüren die Anstrengungen zwar, aber sie verfolgen unpassende Lösungsversuche. Typisch ist es, Verhaltensweisen, die sich längst als hinderlich herausgestellt haben, stets zu wiederholen. Die Menschen tun also immer das Gleiche und erwarten andere Ergebnisse ihres Tuns. Das kann jedoch nicht funktionieren. Es hängt damit zusammen, die Bedeutung bestimmter Inhalte für das eigene Leben nicht verstanden zu haben. Womit wir den Bogen zu Deutschland, dem »Patienten« in diesem Buch finden. Was also macht Deutschland in immer gleicher Weise ohne ausreichenden Effekt? Was sollte es ändern? Beim einzelnen Menschen ist dies grundsätzlich klar. Nachdem ein Trauma erkannt wurde, muss es innerlich angenommen werden. Dann kann es mit den Methoden, welche dem Betroffenen heute möglich sind, bearbeitet werden. Die Abfolge lautet damit: Verstehen – Verständnis – Versöhnung. Die Fragen für Deutschland sind somit: Was sind dessen nicht ausreichend beachtete Traumata? Wie können diese integriert werden und wie sollte erwachsen damit umgegangen werden?
Wenn Deutschland wie ein Mensch auf eine Erkrankung hin untersucht wird, ist das Entscheidende die Bedeutung von Symptomen. Burnout ist der Übermittler von Bedeutungen. Es verschwindet, sobald die Botschaft verstanden und ernstgenommen wurde.
Die Erkrankung an sich
Grundlegendes
Christina Maslach hat die moderne Burnout-Forschung nicht nur mit dem nach ihrem benannten, durchaus kritisch zu hinterfragenden Test geprägt, sondern sie benannte davon unabhängig sechs Inhalte, die auf Dauer zu Burnout führen können (Maslach & Leiter 1997). Schauen wir sie uns anhand von Beispielen aus Deutschland an.
Fairnessdefizite: Viele fühlen sich unfair behandelt, was man auch als Opferposition bezeichnen könnte.
Widersprüche: Lange Zeit wurden Grenzkontrollen als nicht durchführbar bezeichnet, im September 2024 wurden diese plötzlich umgesetzt.
Kontrollmangel: Die Lebensumstände sind wenig steuerbar.
Vertrauensverluste: Zugesagte Förderungen für Elektroautos wurden über Nacht gestrichen.
Arbeitsüberlastung: Hierbei geht es sowohl um die Arbeitsdauer als auch um die Dichte der täglichen Herausforderungen.
Belohnungsdefizite: Diese führen zur Unzufriedenheit, einem Nährboden für Burnout.
Diese sechs Bereiche haben kaum etwas mit der allgemein verbreiteten Ansicht über Burnout zu tun.
Wie Burnout entsteht
Das Gefühl von Burnout ist die empfundene Überforderung durch eine nicht gelungene Anpassungsleistung, die sich häufig ihren Weg als Unzufriedenheit bahnt. Es gibt Inhalte, die das Burnoutrisiko erhöhen und solche, die begleitend auftreten. Eine Übersicht zeigt folgende Auflistung. Viele dieser Beispiele werden später in Bezug auf Deutschland detailliert beschrieben.
Disponierende Faktoren
Kontaktstörungen in der frühen Kindheit
Frühkindliche Traumatisierungen
Soziale Kontaktstörungen
Niedriges Selbstwertgefühl
Neurotizismus
Selbstwertprobleme
Moderierende Faktoren
Pathologisches Streben nach Gerechtigkeit
Immer stark sein wollen oder müssen
Auftreten von kritischen Belastungen
Problem, Nein sagen zu können
Verzicht auf Auszeiten
Realisierende Faktoren
Eigene Grenzen nicht kennen und nicht wahren
Es jedem rechtmachen wollen
Unbedingt Ziele erreichen wollen
Weitgehendes Unterdrücken der eigenen Gefühle
Sich keine Fehler erlauben
Perfektionismus, Übergenauigkeit
Verhaltensauffälligkeiten
Zunehmendes Delegieren von Leistungen
Stark eingeschränkte Urteilsfähigkeit
Ungenügende oder nicht wirksame Abgrenzung des Selbst
Immer wieder dasselbe zu tun und dennoch zu meinen, es könne zu anderen Ergebnissen führen, ist ein Beharren, welches typisch ist bei Burnout. Dieses Festhalten entspricht einer Negierung der Wahrheit.
Wahrheit
Wahrheit ist die vollständige Übereinstimmung von Behauptung und objektivem Sachverhalt. Das Wort »objektiv« in dem Sinne zu verwenden, man wisse die Wahrheit, ist eigentlich eine Anmaßung. Wir alle verzerren Sachverhalte, ob wir wollen oder nicht.
Instrumentalisierte Wahrheit
Sie ist ein beliebtes Werkzeug von Politikern: Wahr ist, was mir nützt. Das bedeutet, es wird nur das benannt, was einem passt. Die anderen Wahrheiten werden verschwiegen. Das niemals endende Argument von Angela Merkel, etwas sei »alternativlos«, war instrumentalisierte Wahrheit.
Wahrheitsillusion
Es kommt durchaus vor, dass man von etwas überzeugt ist, was nicht der Wahrheit entspricht. Das nennt sich Wahrheitsillusion. Sie unterscheidet sich in einer Sache von einer Lüge: Wer lügt, weiß, dass er lügt. Wer an eine Wahrheitsillusion glaubt, versteht das nicht. Insofern ist dies ein weniger guter Zustand als zu lügen (Bergner 2022). Wahrheitsillusionen sind überaus häufig bei Selbsteinschätzungen. Menschen, die sich selbst als offen und herzlich beschreiben, werden dann von den anderen beispielsweise als arrogant und abweisend empfunden.
Verleugnung
Durch Verleugnung wird ein Teil der tatsächlich existierenden Realität in seiner Bedeutung verneint. Auf diese Weise werden Veränderungen irgendwie wahrgenommen, aber ihr reales Gewicht wird nicht anerkannt. Es besteht eine emotionale Distanz.
Verleugnung gelingt, indem ein Mensch wesentliche Teile der äußeren Wahrheit nicht zu seiner inneren Wirklichkeit werden lässt.
Die Welt ist stets im Fluss. Veränderungen sind die einzige Konstante. Auch deshalb ist es wenig inspiriert, immer die gleichen Verhaltensmuster zu nutzen, wenn sie sich längst als schädlich oder unwirksam herausgestellt haben. Auf diese Weise schwelt Burnout über lange Zeit, denn es wird zu spät wahrgenommen. Oft zu beobachtende, wiederkehrende Intellektualisierungen tragen ihren Teil bei.
Intellektualisierung