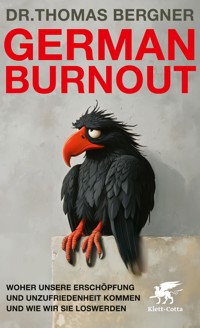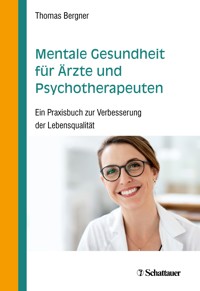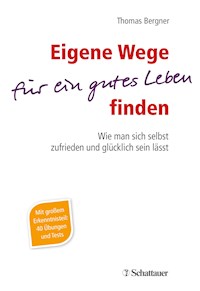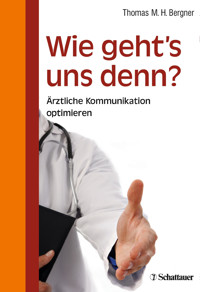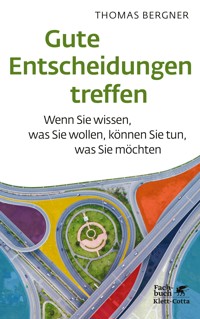
31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Entscheidungs-Coach Entscheidungsfindung – ein Thema, das viele betrifft Praxisorientiert mit vielen Tipps und Hilfen zur Entscheidungsfindung Kompetenter psychologischer Input Ausbildung oder Studium? Ferien am Meer oder in den Bergen? Oder ganz woanders? In nahezu jedem Lebensbereich haben wir heute viele Optionen abzuwägen; entsprechend schwierig gestalten sich für viele Menschen Entscheidungsprozesse, insbesondere in wichtigen Lebenssituationen. Pro-und-Contra-Listen führen hier meist nicht weiter, deshalb gibt das Buch neben konkreten Hinweisen, Tipps und Selbst-Checks ausführliche Einblicke in die Hintergründe von Entscheidungsfindungen. Wie beeinflussen Werte, frühe Prägungen und gerade vorherrschende Gefühle unsere Entscheidungen? Inwiefern ist das Belohnungssystem daran beteiligt, was wir gerade für das Beste halten? Je klarer wir diese Komponenten für uns einordnen können, so die Erfahrung des Autors aus 25-jähriger Beratungstätigkeit, desto erfolgreicher treffen wir unsere Entscheidungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Thomas Bergner
Gute Entscheidungen treffen
Wenn Sie wissen, was Sie wollen, können Sie tun, was Sie möchten
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Weiß-Freiburg GmbH
unter Verwendung einer Abbildung von © Adobe Stock /themorningglory
Gesetzt in den Tropen Studios, Leipzig
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN978-3-608-98073-8
E-Book ISBN 978-3-608-11869-8
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20564-0
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Inhalt
Vorwort
I. Was uns antreibt
1 Unser Hybrid-Antrieb: Was uns unter Strom setzt
2 Unser Hybrid-Antrieb: Der Booster-Effekt
Tabelle 1: Zusammenspiel von Bauch und Kopf
3 Die Belohnungsgier
II
. Was in uns geschieht
4 Die Basis einer erwachsenen Entscheidung
Von der Egozentrik zur erwachsenen Persönlichkeit
5 Der Einfluss
6 Ein Blick ins Gehirn
7 Zentrum der Lust
Bestrafung
Philanthropie und Helfen
8 Zwei markante Hindernisse
Hindernis 1: Das Unbewusste
Hindernis 2: Mangelnde Erfahrung
III
. Was in Entscheidungen steckt
9 Entscheidungsformen und Entscheidungstypen
Persönlichkeit
Entscheidungsformen
Entscheidungstypen
10 Entscheidungskategorien
I. Automatisierte Entscheidungen
II
. Bauchentscheidungen
II.
b Pseudo-rationale Entscheidungen
III
. Verstandesentscheidungen oder Willensentscheidungen
IV
. Intuitive Entscheidungen
11 Was Gewicht hat
Entscheidungen nach Schwierigkeitsgrad
12 Hin oder weg?
13 Entscheidung im Quadrat
IV
. Persönliches und Weltsicht
14 Eine Frage der Moral
15 Das eigene Leben gestalten
16 Die Illusion von Macht
17 Opfer schauen nicht nach vorn
18 Entschieden sein, bevor entschieden wird
19 Widersprüchliches
Weltbildfixierung
Doppelbindung
20 Die eigene Stimme finden
Kernüberzeugung: Mir kann niemand helfen. Ich muss es (alleine) schaffen.
Kernüberzeugung: Niemand mag mich
Kernüberzeugung: Ich will mich nicht festlegen. Niemand kriegt mich. Du kriegst mich nicht.
Kernüberzeugung: Ich gehöre nicht dazu. Ich will nicht dazugehören.
Kernüberzeugung: Ich bin besser als du. Du kommst nicht an mich heran.
Weltsicht überprüfen
Lebenslanges Lernen
21 Spieglein an der Wand
Tabelle 2: Wie wir uns überschätzen
Das eigene Produkt
Eine schlimme Botschaft
V. Falsche Vorstellungen
22 Die Wundertüte
23 Rationale Entscheidungen – ein Märchen
24 Die Grenzen der Intuition
25 Wahrheit und andere Illusionen
Der goldene Käfig
Ignoranz
Wahrheitsillusion und instrumentalisierte »Wahrheit«
Wahres über die Wahrheit
Selektive Wahrnehmung
26 Die Selbsttäuschung
Das ausgeblendete Thema und das ausgeblendete Risiko
Die andere Meinung
Einbildung verhindert vieles
Selbsterkenntnis als Selbsttäuschung
Beobachtung oder Bewertung?
Tabelle 3: Beobachtung versus Bewertung
VI
. Die eigene Vorgeschichte
27 Wer entscheidet tatsächlich?
28 Das Kind, das niemals Ruhe gibt
Thema: Mitmenschlichkeit hilft, wenn Liebe fehlt
Thema: Zu frühe Verantwortung
Thema: Was einem genommen wurde
Thema: Eifersucht und Missgunst
Thema: Platzhalter für die Vorstellungen der Eltern sein
Thema: Wenn Rechte nicht zugestanden wurden
Thema: Trennungserlebnisse und Beziehungsverlust
VII
. Gefühle sind Entscheidungsmacher
29 Gefühle sind nichts für Rosinenpicker
Gefühlsaufforderungen
Das gute Dutzend
30 Im Nebel heftiger Gefühle
Gier
Es dem Tod zeigen
Hoffnung
Zu gute Stimmung
Furchtsamkeit
Wut
Rache
Einsamkeit
Positive Gefühle
31 Wenn Entscheidungen Trauer tragen
32 Die Angst vor der falschen Entscheidung
33 Angst erkannt – Angst gebannt
Nutzen der Angst
Angst vor der Zukunft
VIII
. Wie wir sind
34 Wie Menschen ticken
Ungerechtigkeit
Halo-Effekt (vom Englischen »halo«, also Schein): Das Offensichtliche
Beharren
Verlustschmerz
Die eine Nacht
35 Eine Frage der Ethik
36 Was wir glauben
37 Mit Grenzen umgehen
Multitasking
Prognose
Demütigung
Kontrasteffekt
38 Sinn-voll entscheiden
IX
. Störfeuer von außen
39 Entscheidungsdruck ist Zeitdruck
40 Wann es an der Zeit ist
Zeitnähe
Entscheidungsdauer
Entscheidungsbekanntgabe
Prokrastination
Wenn die Zeit vorbei ist
41 Manipulationsversuche
Umgang mit äußeren EinflüssenAblenkungen erkennen und nicht beachten
Narrative
Öffentlichkeitsverzerrung
Wut und Aggression
Lob und Schmeicheleinheiten
Sinnesmanipulation
42 Alles fließt – nur wohin?
X. Fehlentscheidungen
43 In eigene Ungnade fallen
44 Fehlentscheidungen sind Ablenkung von Ohnmacht
45 Selbstversöhnung heilt Vorwürfe
Der neue Rahmen (
Refraiming
)
46 Einverständnis
47 Loslassen ist eine Kunst
Was das Aufgeben erschwert
Überholte Kindheitsvorstellungen
XI
. Der Goldstandard
48 Optionales Denken
Risikovermeidung
Alternativlosigkeit ist eine Lüge, ein Sachzwang auch
Dilemma
49 Den inneren Kompass finden: Die aufgeschobene intuitive Entscheidung
XII
. Der Grund jeder Entscheidung
50 Der gesunde Menschenverstand
51 Was will ich eigentlich?
52 Sich dem Ziel wahrhaftig nähern
Wir träumen uns die Welt, wie sie uns gefällt
Merkwürdige Abwägungen
Zurechtspinnen statt wissen
53 Der Herde folgen?
XIII
. Entscheidungen konkret umsetzen
54 Fehlerarten
Falsche Gefahreneinschätzung
Tabelle 4: Gefahr oder keine?
Falsche Rahmensetzung
Falsche Verknüpfungen
Umdeutungen
Falscher Verzicht auf eine Handlung
55 Ein Ende finden
Beschränkungen können zur Freiheit beitragen
Satisficing
56 Ehrlichkeit – ein effektiver Ratgeber
Optimierungswahn
Die heutige Ist-Situation
Falsches Abwarten
Nebenkriegsschauplatz
Anspruchsniveau
Klare Benennung – was ist das zu lösende Problem?
Wahrhaftigkeit
Blinde Flecken
57 Experten sollten Fachleute sein
Ein guter Ratgeber
Internet als Ratgeber
Zweifel sind Ratgeber
Eigene Erfahrung als wichtigster Ratgeber
Eigene Position finden
58 Vom Grundsatz ins Konkrete
XIV
. Schritt für Schritt zum Ziel
59
SCHRITT
1: Man kann nicht nicht entscheiden
60
SCHRITT
2: Informationsklarheit schaffen
Availability error
Dunning-Kruger-Effekt
Framing-Effekt
Illusory causality
Slippery slope argument
Hindsight bias
C
onfirmation bias
Gut
feeling error
61
SCHRITT
3: Das Ziel zählt – und der Weg noch mehr
Ein Bild sagt mehr …
62
SCHRITT
4: Den Impuls nutzen und ins Tun kommen
63
SCHRITT
5: Der Sinn von allem
Zeitpunkt
Interesse
Sinn
Das wirkliche Ziel
Das wahrhaftige Ziel
64
SCHRITT
6: Mitmenschlichkeit ist der Kern
65
SCHRITT
7: Sich Gutes tun
66
SCHRITT
8: Das Kernhindernis verstehen
Fehlender Mut
Kindheitsvorgeschichte
In Ruhe gelassen werden
Dilemma
Noch ein Letztes
Abgleich mit der Realität
Ist es mein Ziel?
Ziel ändern oder aufgeben?
Ziel erreicht – was dann?
Das Wichtigste zum Schluss
XV
. Anhang: Sonderfall finanzielle Entscheidungen
67 Geld-Wert
Objektiver und subjektiver Wert
Eigene Ansprüche bewahren
Vergleiche haben ihre Tücken
Klare (Preis)vorstellung
68 Wenn es knapp wird
Verknappung
Weitermachen oder nicht?
Sonderfall: Privatinsolvenz
Heimliche Kosten
Wer Mathematik nutzt, sollte sie beherrschen
Pseudo-Risikovermeidung
»Geschenke«
69 Muss ich es haben?
Ganz oben – oder ganz unten?
Versicherungen
Korrekte Kaufentscheidungen
Vorsorge und Verträge
Literatur
Vorwort
»Es sind nicht die Fähigkeiten, die zeigen, wer wir wirklich sind, sondern unsere Entscheidungen«, sagt am Ende des Films »Harry Potter und die Kammer des Schreckens« der Schulleiter Professor Albus Dumbledore zum jungen Potter.
Unsere Entscheidungen spiegeln viel mehr wider, als wir uns vielleicht verdeutlichen. Sie haben mit unserer Persönlichkeit und mit unserer individuellen Vorgeschichte zu tun. Sie beeinflussen maßgeblich, wie es weitergeht. Gut, wenn Sie sich nun etwas Zeit für dieses wichtige Thema nehmen.
Wir treffen unzählige Entscheidungen jeden Tag, ohne weiter darüber nachzudenken. Stehe ich auf, obwohl der Wecker noch nicht geklingelt hat? Nutze ich dabei das linke oder rechte Bein zuerst? Wenn ich die Zähne putze, achte ich darauf, dass es mindestens zwei Minuten sind? Wie genau halte ich die Zahnbürste? Wie warm stelle ich mir das Wasser ein?
Während unseres wachen Lebens treffen wir fast ununterbrochen Entscheidungen. Fast alle bleiben uns verborgen. Neben offensichtlichen Handlungen entschließt sich unser Gehirn zu einer Unzahl anderer Dinge, die wir nicht mitbekommen. Dies betrifft nahezu alle körperlichen Vorgänge. Wenn es uns darüber informieren würde, würde auf uns eine unfassbare Vielfalt von Inhalten einströmen. Es wäre uns unmöglich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Erfreulicherweise geschieht das meiste automatisiert. Wir müssen nicht darüber nachdenken. Erst wenn etwas Ungewöhnliches passiert, schalten wir unser Bewusstsein ein. Beispielsweise wenn uns die Zahnbürste herunterfällt. Oder wenn wir feststellen, die Tube mit schwarzer Schuhcreme statt Zahnpasta genommen zu haben. Schon sehr einfache Schritte können unangenehme Folgen haben.
In diesem Buch geht es darum, wie Sie wichtige, schwierige und komplexe Entscheidungen erfolgreich treffen. Dafür müssten Sie oft unüberschaubar viele Aspekte überblicken. Jedoch hat sich unser »gesunder Menschenverstand« mit der zunehmenden Komplexität unserer Umwelt nicht gleichsinnig entwickelt. Weil wir vieles nicht objektiv überprüfen können, sind keinem Menschen objektive Entscheidungen möglich. Das ist auch gut so. Wir sind keine Maschinen. Was wir wollen, hat unsere eigenen Erwartungen und Präferenzen zu berücksichtigen. Deshalb geht es in diesem Buch um die für Sie selbst und Ihr Umfeld passenden Entscheidungen. Damit Sie sich für das entscheiden, was Sie wirklich tun wollen.
Ziel des Buches ist nicht die bloße Vermittlung von Entscheidungstechniken. Vielmehr werden Sie erleben, in welch großem Kontext Ihre eigenen Entscheidungen stattfinden. Diese haben oft auch mit Ihrer Kindheit zu tun, sie spiegeln Teile Ihrer Persönlichkeit, haben manchmal mehr mit unserer Erziehung zu tun, als uns lieb sein mag, und letztlich gibt es Vorgänge in uns, die von uns kaum zu beeinflussen sind. Sich darüber Klarheit zu verschaffen, bringt einen großen Schub für wahrhaftige Entscheidungen, die mit Ihnen selbst in tiefem Einklang stehen.
Fehlentscheidungen und die Notwendigkeit, etwas aufzugeben, sind Teile eines Entscheidungsvorgangs. Darüber wird gern aktiv geschwiegen. Bücher über das Scheitern? Fehlanzeige. Hier widmen wir uns auch Fehlentscheidungen und der Frage, wie wir etwas loslassen können. Diese Themen sind überhaupt nicht brisant, wenn wir darauf eine realistische und entspannte Sicht gewinnen.
Menschen, die für die Öffentlichkeit stetig auf der Erfolgsspur wandeln (was es nicht gibt), berichten gerne davon, wie sie selbst erfolgreich wurden. Aber was hat das mit Ihnen zu tun? Das meiste in unserem Leben ist individuell. In diesem Buch geht es deshalb um Ihre eigenen inneren Prozesse, um gut voranzukommen. Mit sich, wie Sie sind, und nicht gegen sich entscheiden. Dabei werfen wir auch den einen oder anderen Blick in unsere Entscheidungsfindungsorgane, in die Seele und in das Gehirn.
Diese Inhalte berühren ein wichtiges Thema für uns alle, unsere Freiheit. Wer irgendwo eingesperrt ist, fühlt sich unfrei. Das muss nicht gleich ein Gefängnis sein, auch Beziehungen oder Situationen können unsere Freiheit einschränken. Wenn wir frei entscheiden können, wo wir sein wollen, was wir tun möchten, wohin wir uns orientieren, dann fühlen wir uns frei. Freiheit ist im Kern immer Entscheidungsfreiheit. Wer sich mit Entscheidungen gut auskennt, arbeitet deshalb auch an der eigenen Freiheit, einem der fundamentalsten Bedürfnisse des Menschen.
Bevor es richtig losgeht, noch vier Bemerkungen:
Die Fallbeispiele sind sämtlich geschehen. Sie sind ein Spiegel von 60 Jahren Leben und von über einem Vierteljahrhundert Beratungstätigkeit. Sie sind selbstverständlich so grundlegend verändert, dass keiner meiner Klienten sich selbst darin erkennen oder von anderen darin erkannt werden kann. Die Beispiele sind ein Ausschnitt, eine Facette von erheblich umfassenderen Inhalten, die während eines auch jahrelangen Prozesses besprochen wurden. Meistens werden Sie von alltäglichen Situationen erfahren, denn sie sind praxisnah und können als Anregungen für Ihr Leben nützlich sein.
Es kommen drei Hinweise vor: Prinzip, Praxis und Klärung. An diesen Stellen sind die wichtigsten Inhalte des Kapitels auf einen oder wenige Sätze konzentriert. Das Prinzip beschreibt dabei, wie etwas grundsätzlich abläuft – was nicht bedeuten muss, dass es gut so ist. Manche Dinge in unserem Gehirn laufen eher so ab, dass es in modernen Zeiten hinderlich ist. Die Praxis ist ein Hinweis darauf, wie Sie etwas praktisch umsetzen können. Beim Hinweis Klärung werden Ihnen Fragen vorgeschlagen, mit deren Beantwortung Sie konkrete Chancen finden. Ehrlichkeit sich selbst und der Situation gegenüber führt zu wahrhaftig guten Entscheidungen.
Ab und zu gibt es einen Abschnitt »Vertiefung«. Dieser dient Ihnen, um sich mit dem Thema – meist anhand von einer Art Übung – intensiver auseinanderzusetzen.
Die Reihenfolge der Kapitel erfolgte mit Bedacht – Sie können dennoch nach Herzenslust selbst entscheiden, wann Sie was lesen und in welcher Reihenfolge. Die ersten drei Teile (Kapitel 1–13) befassen sich eher mit Grundlagen, weil es sinnvoll ist zu verstehen, was in uns abläuft, während wir unser Leben gestalten.
Viel Freude und Erfolg!
Thomas Bergner
I. Was uns antreibt
1 Unser Hybrid-Antrieb: Was uns unter Strom setzt
Es gibt eine Vielzahl von Inhalten, die wir bei unseren Plänen und Entscheidungen berücksichtigen sollten: Ziele, Wünsche, Interessen, Überzeugungen, Werte, Einstellungen, Geschmack, Bildungs- und Wissensstand, Fähigkeiten und Gewohnheiten, finanzielle Möglichkeiten, Kontaktfähigkeiten, Äußerlichkeiten wie das Aussehen – sind wir für andere begehrenswert oder eher nicht? – Ausdauer und Kraft.
Praxis ► Bei der Vielzahl von Inhalten behalten wir die Übersicht, indem wir uns auf unsere Motivation und unsere Ziele konzentrieren.
Beide treiben uns an.
Wenn wir an eine Motivation denken, dann kommen uns wahrscheinlich viele verschiedene Inhalte in den Sinn. Beispielsweise Geld zu verdienen oder jemanden glücklich zu machen oder etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Viele unserer tagtäglichen Motivationen haben jedoch nicht wirklich weltverändernde Horizonte. Bereits wenn wir nur in ein anderes Zimmer gehen wollen, weil wir dort etwas holen wollen, braucht es eine gewisse Motivation, aufzustehen und hinzugehen.
Prinzip ► Motivation ist eine Belohnungserwartung.
Diese Belohnung kann genauso im Wiederfinden von etwas Vergessenem liegen wie in dem zu erwartenden Dank, weil wir jemandem geholfen haben. Motivation ist immer subjektiv. Wir streben dann nach einem Ziel, wenn wir dafür motiviert sind. Ziele, die wir nicht mit irgendeiner Belohnung in Verbindung setzen können, interessieren uns nicht. Dabei kann eine der Belohnungen durchaus sein, nicht bestraft zu werden. Wer schon genügend Strafpunkte in Flensburg angesammelt hat, der mag besonders vorsichtig fahren. Nicht etwa, weil er einsichtig ist, andere nicht zu gefährden. Vielmehr einfach deshalb, weil er seinen Führerschein nicht verlieren mag oder sollte. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen einer positiven und einer negativen Motivation. Die positive Motivation bedeutet, irgendetwas Bestimmtes anzustreben. Das können Hinwendungen zu Menschen sein oder auch etwas Materielles zu bekommen oder angenehme Situationen zu erleben. Eine negative Motivation bedeutet, wir vermeiden etwas, wie bestimmte unliebsame Menschen, Gegenstände oder Situationen.
Wie kommt es nun zu einer Belohnungserwartung? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir die Erfahrung gemacht haben, durch etwas belohnt zu werden, gehen wir davon aus, bei Wiederholung unseres Verhaltens erneut belohnt zu werden. Ganz verkürzt: Belohnungserfahrung macht Belohnungserwartung.
Prinzip ► Wir sind dann motiviert, wenn wir bereits die Erfahrung einer Belohnung erleben konnten.
Warum schreibe ich das hier in einem Buch über Entscheidungen? Weil jede Entscheidung aufgrund einer oder mehrerer Motivationen entsteht. Wenn uns nichts motiviert, werden wir auch nichts tun. Unser Ziel entspricht dem, wofür wir motiviert sind. Die dafür notwendigen Handlungsentscheidungen werden durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst.
Wir schätzen ab, welcher Art unser Ziel ist und als wie bedeutsam wir es empfinden. Diese Einschätzung ist wie jede höchst subjektiv. Ziele können materieller Art sein, ganz vorrangig ist es Geld und alles, was wir davon kaufen können, nachrangig jedoch auch Suchtsubstanzen oder Sex. Ideelle Ziele sind beispielsweise, der Mitarbeiter des Monats zu werden, und soziale Ziele bedeuten beispielsweise, Menschen zu treffen, mit denen wir gerne zusammen sind.
Als unangenehm bei einem Entschluss empfinden wir es oft, mit der Unsicherheit der Risiken fertigwerden zu müssen. Risiken sind, das Ziel nicht zu erreichen oder die Belohnungserwartung nicht erfüllt zu bekommen – Frust. Lohnt sich das alles überhaupt? Habe ich überhaupt eine Chance? Was, wenn alles vergeblich ist? Sobald diese Fragen nicht mit hinreichender Sicherheit positiv beantwortet werden können, sinkt unsere Motivation.
Nicht nur das Ziel interessiert uns, bevor wir uns für etwas entscheiden, sondern auch, wie wahrscheinlich es ist, dass unsere Belohnung eintritt. Dabei gehen wir recht differenziert vor, wie Glücksspiele zeigen. Bei ihnen etwas zu gewinnen, ist überaus unwahrscheinlich. Von der anderen Seite her betrachtet, besteht bei jedem Glückspiel ein hohes Risiko, nicht zu gewinnen. Jedoch ist unser Einsatz für dieses Risiko meistens sehr gering. Es stört uns nicht wirklich, wenn wenige Euro in unserem Portemonnaie fehlen. Wenn etwas sehr unwahrscheinlich eintritt, werden wir das Risiko also nur eingehen, wenn uns ein möglicher Verlust wenig stört. Wenn etwas sehr unwahrscheinlich ist, wir jedoch wie blind sind, es also unbedingt erreichen wollen, werden wir das Risiko ausblenden. Dies ist beispielsweise der Zustand der Verliebtheit. Die oder der Angebetete erscheint als so erstrebenswert, dass ihre oder seine negativen Seiten einfach übersehen werden.
Je wahrscheinlicher eine Belohnung erfolgt, wir unser Ziel erreichen, umso eher werden wir uns einsetzen. Wenn uns jedoch das Ziel banal erscheint, wird unser Interesse versiegen. Stellen wir uns einmal vor, eine Straße entlang zu gehen. Auf einmal sehen wir vor uns etwas kupferfarben aufblitzen. Es handelt sich um einen Cent. Die meisten von uns werden sich bücken und die Münze aufheben. Nicht deshalb, weil wir uns wirklich über diesen einen Cent freuen, sondern weil wir es fehlinterpretieren als ein Zeichen des Glücks, das wir wahrnehmen und nicht missachten wollen. Hier wirkt nicht die Münze an sich, sondern als Symbol für etwas.
Unsere Motivation ist vollkommen selbstbezogen. Sie hängt mit unseren unbewusst agierenden Hirnzentren zusammen. Diese handeln individuell aufgrund unserer Erbanlagen und unserer eigenen Lebenserfahrung. Entsprechend kann die nach außen gegebene Begründung für unsere Motivation richtig oder wahr oder falsch oder unwahr sein. In den meisten Fällen werden wir dies nicht entscheiden können – und andere noch weniger.
Wir setzen uns nicht einfach so für etwas ein. Auch der Zeitpunkt des Eintreffens der Belohnung spielt dafür eine große Rolle. Erwarten wir beispielsweise unsere Belohnung sehr zeitnah? Dann werden wir uns mit hoher Wahrscheinlichkeit auch engagieren.
Praxis ► Bereits mittelfristig erreichbare Ziele brauchen ein höheres Maß an Motivation, erst recht langfristig zu verwirklichende Ziele. Je länger wir für eine Zielerreichung benötigen, umso attraktiver muss das Ziel werden.
Am unangenehmsten ist es für uns, wenn wir überhaupt nicht einschätzen können, wann oder ob wir das Ziel erreichen werden. Damit bleibt nämlich unklar, wann wir unsere Belohnung abholen oder einfordern können. Das bedeutet eben auch, eine Belohnung wird umso unattraktiver, je länger es dauert, sie zu erreichen.
Prinzip ► Aufgrund unserer Lebenserfahrung können wir in der Regel recht gut einschätzen, wie leicht oder schwer es sein wird, unsere Ziele zu erreichen. Da den meisten Menschen ein echter Masochismus fehlt, freuen sie sich, wenn ein Ziel möglichst leicht und rasch erreichbar sein wird.
Unbewusst bewerten wir das Ausmaß des Aufwandes, um ein Ziel zu erreichen. Wenn wir beispielsweise Lust haben, einen Schokoriegel zu genießen und ein Verkaufskiosk direkt neben uns geöffnet ist, kann uns kaum etwas aufhalten, eine Süßigkeit zu kaufen. Wenn wir jedoch gerade eine Wanderung durch die unberührte Natur machen und uns erinnern, dass es auf der Alm mehrere Kilometer hinter uns und 500 Höhenmeter über uns den Riegel zu kaufen geben könnte, werden wir nicht umkehren.
Zum Aufwand gehört auch, sich zu fragen, ob wir etwas aufgeben müssen, was wir bereits besitzen oder bald besitzen werden. Es geht also nicht nur darum, ob sich das Ziel an sich lohnt, sondern welche Preise bereits vorher bezahlt werden müssen, um es zu erreichen. All das kann bewusst bearbeitet werden, jedoch genauso auch völlig unbewusst ablaufen.
So verschieden wie Menschen sind, so unterschiedlich sind auch ihre Belohnungen. Versetzen wir uns einfach zurück in unsere Zeit vor der Einschulung. Wie nett waren wir, nur um einen kleinen roten Lutscher geschenkt zu bekommen. Heute muss dafür bei manchen schon ein großer, roter Ferrari her.
Es gibt so etwas wie Wandergeschenke. Dinge, die von einem zum nächsten gegeben werden, weil sie kaum jemandem gefallen. Peinlich ist es nur, wenn sie zu einem zurückkehren, nachdem sie eine oder mehrere Ehrenrunden gedreht haben. Irgendjemand hat jedoch dieses Geschenk als Erster erworben. Ihr oder ihm muss es also gefallen haben. Wer schon einmal über eine große Konsumgütermesse gelaufen ist, hat sich vielleicht bei der Vielzahl der dort angebotenen Waren gedacht, wer kauft das bloß? Es ist ganz einfach: Es gibt immer auch Menschen, die etwas toll finden, was wir selbst überhaupt nicht mögen. Kein Mensch muss das begehren, was Sie selbst begeistert.
Prinzip ► Was uns freudig stimmt, muss niemand anderen erfreuen und umgekehrt.
Übliche, also häufige Belohnungen sind alle Suchtmittel, insbesondere Zigaretten oder Alkohol, und Sex, Geld, beruflicher Erfolg, der sehr stark zum Status beiträgt, Lob und Anerkennung bis hin zum Ruhm. Das sind alles Inhalte, die uns letztlich von außen zufließen. Selbst wenn wir genug Geld haben, um uns beispielsweise ein erlaubtes Suchtmittel zu kaufen, kommt dies von außen.
Was geschieht nun in uns, wenn wir etwas als Belohnung empfinden? Es werden in unserem Gehirn bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, welche auf das mittlere limbische System (siehe auch Kapitel 6) wirken. Gleich, welche Belohnung es konkret ist, sobald wir es als eine solche empfinden, werden diese Botenstoffe in uns selbst gebildet und stimmen uns froh. Belohnungen bewirken einen Lernerfolg. Haben wir eine Belohnung erhalten, entwickeln wir umgehend eine Belohnungserwartung: Wenn ich das noch einmal tue, werde ich wieder entsprechend belohnt werden und mich gut fühlen. Das mittlere limbische System wacht darüber, ob dies tatsächlich der Fall ist. Wir kontrollieren also stetig und unbewusst, ob unsere Erwartungen auch Realität werden.
Das Ganze ist sehr sinnvoll. Wir fühlen uns wohl, deshalb wiederholen wir das, was zu diesem Wohlbefinden geführt hat. Wir wiederholen also die Belohnungsreaktion. In unserem Inneren werden folgende Faktoren quasi gemessen:
wenn eine Belohnung ausbleibt,
wie hoch unsere Erwartung der Belohnung war,
wie stark wir die Belohnung empfinden,
wie hoch wir das Risiko einschätzen, die Belohnung zu bekommen oder eben nicht.
Die chemischen Faktoren, welche das Gefühl von Belohnung und Lust maßgeblich bestimmen, sind endogene Opioide. Wie der Name schon sagt, sind es drogenähnliche Stoffe. Die Erwartung einer Belohnung hingegen wird vorrangig durch Dopamin vermittelt. Beide chemischen Wirkstoffe zusammen begründen unsere Motivation, unsere darauf beruhende Entscheidung und erst dann folgt unser Handeln. Die Wirkstoffe haben auch viel damit zu tun, wie wir unbewusst kontrollieren, ob unsere Erwartung tatsächlich erfüllt wurde. Es ist faszinierend, welch hochkomplexes Netzwerk in uns wirkt. Es verrechnet stetig, was wir erwarten und was wir bekommen. Es bestimmt damit unseren Motivationszustand. Es bestimmt also, was wir tun und was wir lassen. Dabei ist die Art der Belohnung ohne jede Bedeutung. Es spielt also für unser Inneres keine Rolle, ob wir Geld bekommen oder Lob. Verbindungen in bestimmte Bereiche der Großhirnrinde sorgen für soziale Kontrolle. Dort wird dann als Letztes mehr oder weniger bewusst abgewogen, ob das, was wir vorhaben, andere verletzen könnte. Es findet beim gesunden Menschen auch immer eine solche Einbettung in soziale Gegebenheiten statt. Wir überlegen, ob wir das tun können, was wir tun möchten, oder ob wir damit andere schädigen, was uns dann wiederum vorgeworfen werden kann.
2 Unser Hybrid-Antrieb: Der Booster-Effekt
Prinzip ► Der Wille ist unser innerer Verstandesantrieb, um etwas zu tun, das nicht selbstverständlich abläuft.
Um voranzukommen, brauchen wir den Willen, wenn wir einen – auch noch so kleinen – Widerstand in uns spüren. Der Wille baut also unsere inneren Mauern ab. Oder er hilft uns, diese zu überwinden. Wenn Wille nötig ist, um einen inneren Widerstand zu überwinden, bleibt dieser bestehen. Das ist meistens anstrengender, als den Widerstand abzubauen. Gelingt dies, stört er Sie beim nächsten Mal nicht mehr.
Praxis ► Es ist sinnvoller, erkannte innere Widerstände zu verringern oder loszuwerden, als sie immer wieder durchbrechen zu müssen.
Willenseinsatz sollte dosiert werden, sonst erschöpfen wir. Der Wille gleicht einem Muskel, der bei steter Benutzung lahmt und durch gezieltes Training und durch Einsatzpausen aufgebaut wird. Vereinfachend wird der Wille als »Kopf« bezeichnet – nicht zu verwechseln mit der Vernunft (siehe Kapitel 50). Wer mit dem Kopf durch die Wand will, braucht seinen Willen. Dem Willen ist etwas Unbedingtes eigen; sein Charakter hat oft etwas Mühevolles.
Schopenhauer sagte einmal: Man kann zwar wollen, aber man kann den Willen nicht wollen. Eine gewisse Zeit gelingt es uns schon, Willen für ein Ziel aufzubringen. Meistens erschöpfen wir jedoch irgendwann, wenn eine Motivation fehlt, die aus uns selbst heraus entsteht. Auch diese lässt sich nicht einfach so wollen.
Unseren Willen brauchen wir somit, um Motivationsdefizite auszugleichen. Das bedeutet, der Wille ist unsere Technik, gegen unseren Bauch (im Sinn von Belohnungserwartung wie als Gier oder Verlangen, nicht im Sinn von Intuition; siehe auch Kapitel 24) zu entscheiden und voranzukommen. Der Wille ersetzt quasi unsere Motivation oder unsere Belohnungserwartung. Das macht ihn einmalig auf der Erde. Ein solches Verhalten kennt kein anderes Lebewesen.
Folgende vier Konstellationen sind hierbei möglich:
Tabelle 1: Zusammenspiel von Bauch und Kopf
Kopf
Bauch
Gefühl dabei
Motivation
notwendiger Wille
ja
ja
reibungslos
hoch
keiner bis gering
ja
nein
vernünftig, lustlos
gering bis fehlend
hoch
nein
ja
unüberlegt, geil
hoch bis unüberlegt
gering
nein
nein
Stillstand, Blockade
fehlt
extrem hoch
Wann kommt es vor, dass weder Kopf noch Bauch ein Ziel spüren? In Zwangssituationen und in Situationen, in denen wir stark erschöpft sind. Auch bestimmte Prüfungen können zu dieser innerlichen Konstellation beitragen: Wer den Sinn einer Prüfung, warum auch immer, nicht einsehen mag, muss sich quälen – mit vollem Willenseinsatz.
3 Die Belohnungsgier
Motivation ist ein Antrieb, der von außen angeboten wird oder von innen kommt. Die von außen wirkende Motivation heißt auch extrinsische Motivation. Zu ihr gehören die Bezahlung für eine Leistung oder ein verliehener Titel (Mitarbeiter des Monats). Diese Motivationsform hat einen entscheidenden Haken: Sie erschöpft sich und verlangt nach Steigerung. Eine Gehaltserhöhung wirkt zwei, drei Monate motivationssteigernd, dann ist deren Effekt verpufft. Effektiver ist die intrinsische, von innen kommende Motivation. Freude an Leistung, Vorfreude auf eine Belohnung, die Vorstellung, einen geliebten Menschen wiederzusehen, durch eigene Initiative ein Problem zu lösen – sehr viele unterschiedliche Inhalte motivieren uns. Meistens handelt es sich um die Erfüllung unserer Selbstwirksamkeitserwartung (Ich bewirke etwas) oder um die Erfüllung einer angestrebten Bindung (Ich werde geliebt). Je stärker unsere Motivation ist, umso weniger Widerstände spüren wir in uns – oder umso leichter fällt es uns, bestehende Widerstände zu überwinden. Intrinsische Motivation hat viel von einer Verlockung. Allgemein wollen wir einen positiv empfundenen Gefühlszustand erreichen:
Wir möchten Glück empfinden und Schmerz vermeiden.
Wir möchten Freude spüren und Traurigkeit loswerden.
Wir möchten Höhepunkte erleben, statt uns von Langeweile quälen zu lassen.
Prinzip ► Fast alle unsere Taten richten sich nach einer der drei Grundmotivationen aus: Macht, Liebe und Leistung.
Macht bedeutet Geld, ein hoher Status, gesellschaftliche Anerkennung, Anerkennung in der Freundesgruppe, Kontrolle, Einfluss.
Liebe bedeutet Anschluss zu finden, Geborgenheit, Freundschaft, Bindung, angenommen zu werden, ohne sich verstellen zu müssen.
Mit der Motivation allein ist es noch nicht getan. Hinter jeder Motivation steckt auch etwas weniger Angenehmes, eine Angst. Weil diese fundamental existiert, nenne ich sie Grundangst. Macht streben wir an, um die Angst vor der Ohnmacht und damit vor dem Tod in den Griff zu bekommen. Liebe streben wir an, um die Angst vor dem Alleinsein (nicht geliebt zu werden, verlassen zu werden) in Schach zu halten. Leistung streben wir an, um die Angst vor dem Versagen abzubauen.
Praxis ► Um weiterzukommen, kann die Frage danach weiterhelfen, mit welcher Angst Sie zu tun haben. Wollen Sie mit Ihrer Entscheidung unbedingt etwas vermeiden oder besänftigen – und sollten Sie das überhaupt tun oder gibt es bessere Wege?
So mancher, der stetig Höchstleistung bringt, tut dies, um geliebt zu werden. Fatalerweise kann das nicht gelingen, weil Liebe und Leistung zwei Paar Schuhe sind. Das zu verstehen und sein Verhalten entsprechend anzupassen, kann durchaus schwerfallen.
Jede Motivation von außen wirkt nur dauerhaft, wenn sie zur eigenen Motivation wird. Jede Belohnung von außen wirkt auf Dauer nur dann, wenn wir uns selbst damit belohnen. Um dies zu klären, genügen die Antworten auf folgende zwei Fragen:
Klärung ► Was passt wirklich zu mir?
Was will ich wahrhaftig erreichen?
Ein persönliches Beispiel: Im Alter von 13 Jahren entschied ich mich, kochen – und auch backen – zu lernen. Der Anlass dafür war ein Familienurlaub am Gardasee, bei dem ich das erste Mal original italienische Kost genießen durfte und mir dachte: Holla die Waldfee (also gut, meine Formulierung wird etwas anders gewesen sein), so fantastisch kann Essen schmecken. So war es nicht zufällig eine Pizza, die ich als Erstes produzierte. Ich wollte einfach so essen, wie es mir schmeckte. Dieses schlichte Ziel war eine intrinsische Motivation. Niemand hat es mir eingeredet, ich selbst habe es erkannt und entschieden (Selbstwirksamkeit). Seitdem, seit fast 50 Jahren, backe und koche ich gerne. Vor langer Zeit fragte mich einmal ein privater Gast, warum ich nicht Profi-Koch werden würde. Ein zweites Mal dachte ich mir: Holla die Waldfee. Ich will damit kein Geld verdienen, ich will keine Angestellten triezen, ich will keine Räume anmieten. Ich will nicht acht Stunden am Tag fünf bis sieben Tage die Woche am Herd stehen. Das alles passt nicht zu mir. Ich will einfach ab und zu gutes Essen mit meinen Freunden genießen, und das zu Hause.
Und schon sind die beiden eben benannten Fragen beantwortet.
Intrinsische Motivation bedeutet, es kommt aus Ihnen selbst heraus. Damit erfüllen Handtaschen, Autos oder Pralinen nur schwerlich unsere intrinsische Motivation. Woran erkennen Sie Ihre eigene Motivation? Meistens daran, dass diese nicht nach irgendeiner Steigerung verlangt. Wer gerne kocht, kann auch wochenlang ohne auskommen. Wer hingegen jede Woche in ein teures Lokal gehen muss, um sich seines Selbstwerts zu vergewissern, wird nervös, wenn auch nur ein Termin ausfällt. Extrinsische Motivationen sind sehr oft im materiellen Bereich angesiedelt. Dazu gehören auch Geld und Macht an sich.
Prinzip ► Alles Materielle hat einen Gewöhnungseffekt.
Dessen Anreiz muss wieder und wieder gesteigert werden, damit es zu einer gleichbleibenden Wirkung kommt. Materielle Dinge können letztlich nur zur Ersatzbefriedigung eingesetzt werden. Wer traurig ist, kauft sich Schokolade oder Schuhe. Nur über deren Mangel war der Käufer nicht traurig. Wer einsam ist, den umhüllt die neue Luxus-Felldecke nicht so, wie er es bräuchte. Wer Liebe vermisst, den wird auch Alkohol nicht erfüllen.
Prinzip ► Ersatz befriedigt niemals tiefgehend.
Ein gutes Ziel folgt damit unserer intrinsischen Motivation. Ein Ziel ist konkret, benennbar und auch bewusst. Das alles gilt nicht unbedingt für unsere Motivation. Ein Problem haben wir, wenn beide nicht an einem Strang ziehen. Es ist überaus effektiv, die eigenen Ziele danach auszurichten, wonach Motivation und Wille gleichsinnig streben.
Praxis ► Wenn uns etwas mühsam erscheint, sollten wir uns rasch fragen, ob es am Willen oder an der Motivation scheitert oder an beidem – und was unser Ziel tatsächlich ist.
Wenn beide übereinstimmen, kommen meistens keine Zweifel über den Weg auf. Zudem stärkt es das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Was wir anstreben, muss uns auch möglich sein zu erreichen.
Prinzip ► Ziele, die uns nicht anregen, erreichen wir kaum.
Unsere Motivationslage hingegen steuert eher unsere langfristig wirkenden Entscheidungen. Das bedeutet, unsere Erfahrungen, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, unsere Werte, unsere Moralvorstellungen sind wesentlich für unsere Entscheidungen.
Schauen wir uns nun einmal an, was eigentlich in uns abläuft, wenn wir etwas entscheiden wollen.
II . Was in uns geschieht
4 Die Basis einer erwachsenen Entscheidung
Grundsätzlich handeln wir als berechnende Wesen. Diese Berechnung findet vorrangig in den Gehirnregionen statt, deren Aktivitäten uns meistens unbewusst bleiben. Zum geringeren Teil können wir unsere Berechnung auch wahrnehmen und entsprechend bewusst steuern. Dafür nutzen wir unsere Gefühle.
Unser Ich, unser Bewusstsein, bildet diese Gefühle jedoch nicht. Wir interpretieren sie, wir deuten sie, wir finden Erklärungen für sie. Wir schauen, in welchem Zusammenhang sie entstanden sind, und meinen dann, sie gehörten dorthin. Wir verbinden sie mit unseren Erwartungen. Wir meinen, sie hätten etwas mit unseren aktuellen sozialen Kontakten zu tun. Dabei kann es um ganz andere Vorkommnisse gehen: Wer Angst spürt, weil er als Kind lebensbedrohliche Situationen erleben musste, bekommt möglicherweise daraufhin als Erwachsener eine Angsterkrankung. Wenn er dann, beispielsweise beim Autofahren, eine Panikattacke erleidet, verbindet er die Panik mit dem Autofahren. Dabei präsentiert ihm sein Unbewusstes »nur« das Gefühl, was es damals erlebt und abgespeichert hat. Es hat also nichts mit dem Autofahren zu tun. Allerdings wird das Autofahren dadurch markant beeinflusst.
Schauen wir uns an, an welcher Stelle was geschieht: Bestimmte Bereiche in unserem Gehirn (die obere limbische Ebene) sind für folgende, sehr wesentliche Inhalte zuständig (Roth 2012). Hierzu zählen:
Gewinn und Erfolgsstreben,
Anerkennung und Ruhm,
Freundschaft und Liebe,
soziale Nähe und Hilfsbereitschaft,
Moral und Ethik.
Es sind offenbar ziemlich wichtige Strukturen für uns Menschen.
Die von ihnen geformten Inhalte entwickeln sich erst in der späten Kindheit und in unserer Jugendzeit. Sie werden wesentlich durch die in dieser Zeit gemachten sozial-emotionalen Erfolge beeinflusst. Je besser es uns in diesem Lebensabschnitt gelingt, uns empathisch mit anderen Menschen zu verbinden oder in sozialen Gruppen einzufinden, umso besser können wir dies unser Leben lang. Ein typisches Beispiel ist der Gruppenführer einer Sportmannschaft, wie einer Fußballmannschaft. Was Hänschen lernt, kann Hans immer noch. Andererseits gilt meistens auch: Wer in seiner Kindheit und Jugendzeit ein zurückgezogener Eigenbrötler war, wird als Erwachsener meist keine Kontaktkanone. Entsprechende Kompetenzen können wir später, als Erwachsene, ausschließlich mit sozialen oder emotionalen Einflüssen verändern. Sie sind der reinen Kognition nicht zugänglich. Allein mit dem Kopf werden wir also nicht mitmenschlicher oder extrovertierter.
In Verbindung mit dem bereits Gelernten und den vielen unbewussten Steuerungen in unserem Gehirn entwickeln sich neben der Empathie in der späten Kindheit und der Jugendzeit weitere Persönlichkeitsmerkmale aus: Machtstreben, Dominanz, Zielverfolgung und Kommunikationsbereitschaft.
Von der Egozentrik zur erwachsenen Persönlichkeit
Erste Lernerfolge bemerken wir selbst meistens ab dem fünften Lebensjahr. Diese Lernerfolge sind deshalb so wichtig, weil unsere unbewussten Anteile vollkommen egozentrisch funktionieren. Ihre Egozentrik basiert auf zwei verschiedenen Ansätzen. Einmal im Versuch der vollkommenen Verschmelzung mit der wesentlichen Bezugsperson (meistens der Mutter), zum anderen in der vollkommenen Egozentrik, mit der ein Kleinkind die Welt zu beherrschen versucht.
Zwischen dem fünften und zwanzigsten Lebensjahr beginnt dann die obere limbische Ebene gemeinsam mit bestimmten Anteilen im Großhirn, die Egozentrik in sozialverträgliche Bahnen zu lenken. Wir versuchen bei einer gesunden Entwicklung also von uns aus, die Egozentrik mit einer sozialen Ausrichtung zu vereinbaren. Es geht dabei um die Steuerung unserer Aufmerksamkeit weg von uns selbst. Es geht um die Fehlererkennung und die Kontrolle von eigenen Entscheidungen. In dieser Lebenszeit beginnen wir damit, nicht mehr zu meinen, immer die richtige Wahl zu treffen. Als kleine Kinder nehmen wir noch spontan jeden Schmerz wahr und äußern ihn meistens lautstark. Schrittweise kommt es dazu, den eigenen Schmerz und das eigene Leid rationaler hinzunehmen und einzuordnen. Nach außen gerichtet ist die emotionale Erwartungshaltung. Wir zeigen, was wir an Zuneigung oder Abneigung vom anderen erwarten. Die in diesem Zusammenhang notwendige Risikoabschätzung erfolgt immer genauer. Nun erst können wir auch soziale oder emotionale Belohnungen und Bestrafungen korrekt registrieren. Und wir lernen immer besser, die emotionalen Inhalte unserer Wahrnehmungen zu erkennen. Dies bezieht vorrangig die Stimme, die Mimik und Gestik des anderen ein. Nicht zuletzt streben wir an, die Macht über unsere emotionalen Erinnerungen zu erlangen.
Das alles geschieht in einem bestimmten Bereich der Großhirnrinde. Dieser ist erst im Alter von 20 Jahren komplett ausgereift. Dort ist der Sitz unseres höchsten moralischen Kontrollzentrums. In ihm bilden sich unsere bewussten Handlungsantriebe, bewussten Motive und Ziele. Dieser Orbitofrontale Cortex ist unser bewusstes Entscheidungszentrum. In ihm finden auch die Emotionskontrolle (Kontrolle der Gefühle), die Impulskontrolle (Kontrolle der Spontaneität), die Wertung von Belohnungen und Bestrafungen statt. Hier also kontrollieren wir, wie wir unsere Gefühle nach außen zeigen. Konsequenterweise ist dies der Sitz unserer Empathiefähigkeit. Sie ist deshalb so wichtig, weil es uns damit erheblich leichter möglich ist, den Sinn eines Verhaltens zu verstehen. Direkt damit verbunden ist unsere Fähigkeit zu sozialem Verhalten. Auch die Konsequenzen des eigenen Verhaltens können wir mit diesem Gehirnareal abschätzen.
Es gibt übrigens einen Bereich in unserem Gehirn, der tatsächliche Verbindung zu Nervengeflechten in unserem Bauchraum hat. Es ist also heute keine Frage mehr, dass wir in Wahrheit auch einiges aus dem Bauch heraus entscheiden können. Viele Inhalte, die mit Verlust, mit Empathie oder Schmerz zu tun haben, sind hier angesiedelt.
5 Der Einfluss
Bei einer Entscheidung geschieht Folgendes in uns: Aus einem Wunsch oder Motiv heraus planen wir etwas. Daraus entwickelt unser Gehirn eine Skizze über die notwendigen Bewegungen. Dann läuft das dafür notwendige Bewegungsprogramm ab. Was hat ein Entschluss mit einer Bewegung zu tun? Selbst wenn wir uns vornehmen, ein bestimmtes Telefonat zu führen und bestimmte Inhalte dabei mitzuteilen, ist dies letztlich nichts weiter als ein Bewegungsprogramm. Wir müssen uns zum Telefon bewegen, die richtige Nummer wählen und dann unsere Stimme so formen, dass unser Gesprächspartner verstehen kann, was wir wollen. Dieser Ablauf funktioniert nur in Koordination mit bestimmten Anteilen unseres limbischen Systems. Es findet also eine stete Abstimmung zwischen unseren bewussten und unseren unbewussten Instanzen statt.
Bevor wir das Gefühl haben oder uns darüber bewusstwerden, etwas entschieden zu haben, hat immer unser Gehirn es bereits getan. Zentral ist, dass es natürlich unser eigenes Gehirn ist, das entschieden hat, und sonst niemand. Bei schwierigeren Inhalten vergehen bis zu zehn Sekunden, während derer die Handlung vorbereitet wird, bevor wir etwas tun.
Prinzip ► Wenn wir denken, dass wir denken, denken wir nur, dass wir denken.
Somit haben auch bewusste Entscheidungen einen zeitlichen, unbewussten Vorlauf. Dieser ist unbedingt notwendig, damit wir unsere Erfahrungen in unsere Handlungen einbeziehen. So werden unsere gesamten Erfahrungen unbewusst abgefragt. Sie geben uns den Hinweis, ob wir etwas wirklich tun sollen oder nicht. Meistens besitzen wir umso mehr Erfahrungen, je älter wir werden. Das ist der Grund, warum es uns dann besser gelingt abzuwägen. Es ist auch ein Grund dafür, dass wir ins Zweifeln kommen, weil wir im Lauf der Jahre in aller Regel sehr unterschiedliche Erfahrungen machen. Je mehr wir kennen und wissen, umso mehr Alternativen, Risiken, Überraschungen, Unbedachtes kennen wir eben auch.
Vermutlich erinnern Sie von sich selbst Vorhaben oder Handlungen, über die Sie später dachten, dabei nicht komplett zurechnungsfähig gewesen zu sein. Dann kann es sehr wertvoll sein, wenn Sie sich folgende Fragen beantworten:
Klärung ► Wer handelte (damals) eigentlich?
Entsprachen meine Vorstellungen tatsächlich einer realistischen, erwachsenen Weltsicht?
Es kann durchaus schwerfallen, diese Fragen ehrlich zu beantworten. Hinzu kommt: Wissen alleine ändert nichts. Selbst wenn Sie wissen, dass Sie eine kindliche oder kindische Idee verfolgen, bedeutet es noch lange nicht, diese auch aufgeben zu können. Friedrich Dürrenmatt nannte es so: Das Rationale am Menschen sind seine Einsichten; das Irrationale, dass er nicht danach handelt.
Wie kommen Sie sich nun selbst auf die Schliche? In der Regel haben wir als Erwachsene sehr wohl ein Gefühl dafür, was stimmig oder passend ist und was nicht. Manuela beispielsweise beklagt sich, immer wieder – wie sie es ausdrückt – auf dieselben Männer hereinzufallen. Tobias findet es merkwürdig, immer wieder Aufgaben in seinem Beruf anzunehmen, die andere ihm aufschwatzen. Aaron fällt auf, dass er stets Geldprobleme hat, obwohl er eigentlich genug verdient. Unsicherheit in der Partnerwahl, nicht Nein sagen zu können oder kein Maß zu finden bei den eigenen Ausgaben sind keine erwachsenen Verhaltensweisen. Hier ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Problem aus der Kindheit nicht gelöst worden.
Als Erwachsener können Sie das erreichen, was Sie als reifes Wesen erreichen können. Das hat oftmals nichts mit dem zu tun, was ein Kind im Erwachsenen gerne hätte. Dazu gehört beispielsweise bedingungslose Liebe. Oder ohne Anstrengung ein Star zu werden. Oder von jedem geliebt zu werden. Oder Zuwendungen zu erhalten, ohne selbst etwas zu geben. Oder Macht über andere Menschen zu haben. Oder die Vorstellung, dass einem stets geholfen wird. Oder die Idee, dass alles gut ausgeht. Das sind häufige und zugleich nicht erfüllbare Wünsche von Erwachsenen. Aber es sind keine erwachsenen Wünsche! Es gibt eine Reihe von Dingen, die wir wirklich erreichen können. Dazu zählen Erfolg im Beruf, genug Geld zu verdienen, Freunde zu finden und zu behalten, anerkannt zu werden, eine Familie zu gründen und mit dieser liebevoll zu leben.
Es geht nicht immer gerecht auf der Welt zu. Oft stehen wir alleine da oder müssen alleine vorangehen. Oft müssen wir auch etwas tun, obwohl uns wesentliche Informationen dafür fehlen. Mit diesem Wissen den eigenen Weg weiterzugehen, das ist erwachsen.
6 Ein Blick ins Gehirn
Die mehr extrovertierten Menschen sind risikofreudig und impulsiv und schießen deshalb nicht selten über das Ziel hinaus. Die emotional sensitiven Typen sind risikoscheu und ängstlich und wagen deshalb zu selten etwas. Zwischen diesen zwei Polen findet sich ein jeder Mensch wieder. Die Pole beschreiben das Temperament. Das Temperament selbst ist einer der zwei wesentlichen Faktoren für unsere Entscheidungen.
Der andere Faktor ist die Persönlichkeit des Menschen. Unsere Persönlichkeit ist uns nur zum allerkleinsten Teil bewusst. Sie ist außerdem zu einem noch kleineren Teil rational. Neurobiologen haben sie in einem definierten Bereich unseres Gehirns lokalisiert. Diese Persönlichkeitsstruktur ist mittendrin zu finden, in höheren Anlagen, welche zuerst während der embryonalen Zeit gebildet werden.
Betrachten wir zunächst andere, zentrale Bereiche genauer (Roth 2012): Wir alle haben eine für unser Überleben notwendige Ebene in unserem Gehirn (untere limbische Ebene), die für wesentliche und sehr effektive angeborene Impulse notwendig ist. Hier wird festgelegt, ob wir schlafen oder wach sind. Hier wird über unsere Nahrungsaufnahme entschieden, wie aggressiv wir sind, ob wir eher zur Verteidigung neigen oder zur Flucht, wie leicht wir wütend werden, ob wir eher dominant oder unterwürfig sind.
Diese Ebene wird sowohl durch unser Erbgut definiert als auch durch vorgeburtliche Einflüsse. Vor nicht allzu langer Zeit hat die Wissenschaft nachgewiesen, von welch hoher Bedeutung es ist, was wir vor unserer eigenen Geburt erleben. Von Faktoren wie dem Alkoholkonsum der Mutter wissen wir das. Auch hat vieles, was auf die Mutter seelisch eingreifend wirkt, Auswirkungen auf den werdenden Menschen. Ereignisse und Situationen, welche das werdende Kind negativ beeinflussen, sind beispielsweise: eine Depression der Mutter, eine schwere, andere Erkrankung der Mutter, Trauer, Verlustsituationen, andauernder Stress, gleich welchen Ursprungs, ob finanziell, mitmenschlich oder beruflich. Je stärker die Mutter während der Schwangerschaft belastet ist, umso eher werden diese zentralen Bereiche des Gehirns eines entstehenden Menschen negativ besetzt. Es werden damit grundlegende Persönlichkeitsmerkmale festgelegt. Dazu gehören Offenheit oder Verschlossenheit, Kreativität, Vertrauen oder Misstrauen, der Umgang mit Risiken, Neigung zu Ordnung oder Chaos, Zuverlässigkeit oder Unzuverlässigkeit, Bewusstsein für die eigene Verantwortung oder Nachlässigkeit.
Grundsätzliche Persönlichkeitsmerkmale aus diesem Bereich unseres Gehirns heraus sind unverrückbar festgeschrieben. Schlimme, vorgeburtliche Ereignisse haben einen besonders schwerwiegenden Effekt auf markante Persönlichkeitsstörungen. Zudem wird dadurch einprogrammiert, wie widerstandsfähig wir auf Stress reagieren können. Dies alles läuft über chemische und hormonelle Faktoren ab.
Vermutlich kennen wir alle Menschen, die sich sehr leicht aufregen und nicht abregen können. Das liegt letztlich nicht in deren Gewalt. Oftmals liegt bei ihnen eine frühkindliche oder vorgeburtliche Schädigung vor. Diese Traumatisierung greift während des gesamten Lebens störend in den Abbau von Stresshormonen ein.
Es ist uns nicht möglich, auf diese Ebenen unseres Gehirns Einfluss zu nehmen. Was dort ist, bleibt dort, wirkt dort und lässt sich praktisch nicht verändern. Hier gilt also ganz klar: Es ist, was ist. Was in dieser Ebene entschieden wird, hat sichtbare Auswirkungen, die wir im Verhalten des Menschen erleben können. So können wir beispielsweise sagen, ob es sich um einen zuverlässigen oder eher weniger zuverlässigen Menschen handelt. D. h., die von dieser Ebene ausgehenden Effekte sind offensichtlich. Jedoch nicht für uns selbst, uns ist diese Ebene vollkommen unbewusst. Niemals wird unser Bewusstsein in diese Regionen vordringen können. Das hat einfache, anatomische Gründe. Aus bestimmten Hirnregionen führen quasi nur Leitungen heraus und keine wirksamen hinein.
Wer mehrere Kinder hat, wundert sich nicht selten, mit welch unterschiedlichen Persönlichkeiten er es zu tun hat. Dies liegt zu einem guten Teil an der Ausprägung der zentralen Anteile in deren Gehirn.
Eine zweite Ebene ist die mittlere limbische Ebene. Sie trägt ebenfalls wesentlich zur Persönlichkeit eines Menschen bei. In dieser Ebene ist die unbewusste emotionale Konditionierung angesiedelt. Wenn ein Mensch zur Welt kommt, ist er schutzlos und ohne helfende Menschen dem Tod geweiht. In der Regel ist es die Mutter, welche für diesen schutzlosen Menschen vorrangig verantwortlich ist. Sie ist nun einmal diejenige, welche natürlicherweise den Säugling ernähren kann. Innerhalb kurzer Zeit nach der Geburt versteht dies der junge Mensch und baut, wenn alles gut geht, eine Bindung zu dieser wichtigsten Bezugsperson auf. Ist dieser Bindungsaufbau gelungen, vertraut der Säugling der Beziehungsperson (der Mutter). Damit ist die wesentliche Basis geschaffen worden, um später Selbstvertrauen aufbauen zu können. Denn Selbstvertrauen ist letztlich nichts anderes als die Wiederholung oder Kopie des Vertrauens anderen Personen gegenüber. Solange man sich selbst nicht als eigenständige Person wahrnehmen kann (etwa bis zum Alter von eineinhalb Jahren), kann man entsprechend keine Bindung zu sich selbst fühlen und ebenso kein Vertrauen oder Misstrauen sich selbst gegenüber aufbauen.
Ist der Bindungsaufbau gestört, kommt es zu wesentlichen, die spätere Persönlichkeit prägenden Störungen. Üblicherweise ist der Bindungsaufbau gestört, wenn die Mutter fehlt oder nicht in der Lage ist, eine solche Bindung aufzubauen. Wenn die Mutter fehlt, kann jedoch der Bindungsaufbau über andere liebende und sich kümmernde Personen genauso positiv vonstattengehen.
Während der ersten Lebensmonate werden in der mittleren limbischen Ebene unsere elementaren Emotionen festgelegt. Das sind Furcht und Angst, Freude und Glück, Verachtung und Ekel, Neugierde und Hoffnung, Enttäuschung und Erwartung. Diese spielen eine maßgebliche Rolle dabei, wie wir später Entscheidungen treffen.
Gemeinsam mit der unteren limbischen Ebene wird hier der Kern unserer Persönlichkeit festgeschrieben. Die Entwicklung findet zunächst sehr rasch statt, dann in Phasen und ist mit dem Eintritt der Geschlechtsreife mehr oder minder abgeschlossen.
Prinzip ► Etwa im Alter von 15 Jahren ist die Persönlichkeit eines Menschen determiniert.
Nur sehr starke emotionale und / oder langandauernde Einwirkungen können danach noch gewisse Veränderungen möglich machen. Dies geschieht beispielsweise bei einer effektiven Psychotherapie, die sich deshalb über eine relativ lange Zeit erstrecken muss. Effekte auf die untere limbische Ebene sind jedoch durch eine Psychotherapie nicht möglich.
Die Ausgeglichenheit eines Kindes und auch des späteren Erwachsenen wird in dieser Zeit und dieser Ebene festgelegt. Beruhigungs- und Selbstberuhigungsfähigkeiten werden dann und dort gelernt.
Im mittleren limbischen System wird etwas Wesentliches für jede Entscheidung bewertet: Ist eine Belohnung zu erwarten oder eine konkrete Belohnung bereits vorhanden? Eine Belohnungserwartung ist nichts weiter als das Versprechen des Gehirns für eine Belohnung. Die Aussicht auf eine Belohnung (Zuneigung, Sex, Geld, Status, Anerkennung usw.) oder die Belohnung an sich oder das Wissen, nicht bestraft zu werden (kein Schmerz, kein Statusverlust, keine Beleidigung, keine Demütigung) sind unsere tatsächlichen Motivationen. Damit sind diese drei Inhalte (Belohnung, Belohnungserwartung oder Verzicht auf Strafe) der Kern einer jeden Entscheidung. Dies gilt auch für scheinbar altruistische Entscheidungen.
Die meisten von uns wissen, wie ein menschliches Gehirn aussieht. Die Regionen, um die es bislang ging, sind von außen nicht sichtbar. Sie befinden sich in der Mitte des Gehirns. Das gilt auch für ein weiteres System in unserem Gehirn, die obere limbische Ebene. In dieser werden unsere Erfahrungen abgespeichert, die mit unseren Emotionen und unserem Sozialverhalten zu tun haben. Hier sind wesentliche Anteile unserer Mitmenschlichkeit verankert. Freundschaft, Liebe, soziale Annäherung, ethische und moralische Inhalte sowie unser Gewinnstreben und unser Streben nach Erfolg. Diese überaus menschlichen Fähigkeiten entwickeln sich erst in der späten Kindheit und in der Jugend. Dabei spielen die in dieser Zeit gemachten emotionalen und sozialen Erfahrungen eine wesentliche Rolle. Entsprechend sind sie auch nur so veränderbar. Die obere limbische Ebene wird deshalb als Sozialisierungsebene bezeichnen. Sie ist der Sitz unseres sozialen Gewissens. Gemeinsam mit einer bestimmten Region der Großhirnrinde (Orbitofrontaler Cortex) ist sie maßgeblich an unseren Entscheidungen beteiligt.
Unser Sozialverhalten und alle für unsere soziale Persönlichkeit wichtigen Merkmale werden vom Orbitofrontalen Cortex mit beeinflusst. Dazu gehört unser Wunsch, eigene Ziele zu erreichen und sie zuvor festzulegen, unsere Fähigkeit zur Kommunikation mit anderen, auch unser Machtstreben oder unsere Dominanz. Etwas dem Menschen Einmaliges ist auch hier, in der Großhirnrinde, angesiedelt: unsere Fähigkeit zur Empathie. Zu dieser ist kein anderes Lebewesen auf der Erde fähig. Um einen anderen Menschen einzuschätzen, brauchen wir in etwa 600 Millisekunden, also nicht mehr als etwa eine halbe Sekunde. In dieser Zeit haben wir entschieden, was wir vom anderen zu halten haben. Bis uns dies bewusst wird, kann es jedoch deutlich länger dauern. Damit nicht genug. Im Kasten 1 ist zusammengefasst, was alles in diesen Bereichen unseres Gehirns abläuft.
Kasten 1: Aufgaben unserer Großhirnrinde (alphabetisch)
aktuelle Verarbeitung von Schmerz, Leiden, Verlust und anderen, negativ bewerteten Emotionen
Bewerten der Folgen des eigenen Verhaltens
Bewertung und Festlegung von eigenen und fremden Handlungsmotiven und Handlungsantrieben sowie von Zielen
Einschätzen von sozialen Risiken
Emotionen anderer korrekt einschätzen können (Teil der Empathie)
Erinnerung an Gedächtnisinhalte im emotionalen Zusammenhang (Was hat mir schon einmal Spaß gemacht? Wer hat mich schon einmal verletzt? Warum klappte etwas damals schon nicht und hat mich enttäuscht? Auf den kann ich mich immer verlassen. Bei dem muss ich vorsichtig sein.)
Kontrolle der eigenen Emotionen (in der Regel: Lasse ich sie zu? Muss ich sie dämpfen?)
Kontrolle von Impulsen (Schlage ich jetzt zu oder doch nicht?)
Kontrolle, ob Fehler vorliegen
Lernen und Steuerung von sozial adäquatem Verhalten
Rechtfertigung finden
Schmecken
Schmerzen handhaben
Selbstdarstellung
sich die Welt erklären und anderen die Welt erklären
Sprechen
Steuerung unserer Aufmerksamkeit
Verluste empfinden können
Wahrnehmung von Belohnung oder Bestrafung
Wenn wir Kasten 1 durchlesen, wirkt es imposant, was alles in der Großhirnrinde stattfindet. Wir könnten deshalb auf die Idee kommen, dort würden unsere Entscheidungen gefällt werden. Schlimme Versuche, welche vor Jahrzehnten mittels Operationen am Gehirn durchgeführt wurden, und insbesondere neuere Messungen mittels Kernspintomographie und auch Erfahrungen von Patienten, die Erkrankungen im Gehirn hatten, zeigten eines eindeutig: Sobald es keine Verbindung von der Großhirnrinde (vereinfachend gesagt dem Bewusstsein) in das limbische System (vereinfachend dem Unbewussten) hinein mehr gibt, sind Menschen unfähig zur Entscheidung. Sie können sich nicht mehr festlegen.
Prinzip ► Wir können ausschließlich dann Pläne umsetzen, wenn uns Informationen aus dem Unbewussten zur Verfügung stehen.
Diese Informationen entsprechen unserer emotionalen Konditionierung. Die unbewussten Informationen sind festgelegt. Sie formen und bestimmen unsere Motivation. Sie beeinflussen wie ein Taktgeber unsere Körper- und Gefühlsreaktionen. Dieses Unbewusste bildet unsere Persönlichkeit und unser Temperament ab, und nur gemeinsam mit beiden können wir tatsächlich Entscheidungen treffen. Es ist unmöglich, ohne die von dort stammenden Informationen sich sozial adäquat im Alltag zurechtzufinden.
Der sogenannte affektive Zustand (Gefühlszustand), in dem wir uns befinden, ist extrem wichtig für unsere Entschlüsse. Dabei spielt das Ausmaß unserer Vorerfahrungen eine Rolle. Je mehr Erfahrung wir haben mit einer bestimmten Situation, umso ruhiger werden wir in der Regel sein. Nicht zuletzt ist bedeutsam, welche Ängste und Befürchtungen mit unserer Wahl in Verbindung stehen. Wenn uns mögliche Risiken oder von uns unerwünschte Konsequenzen klar sind, wird uns die Entscheidung schwerer fallen. Das, was so banal als Sachlage bezeichnet wird, ist oftmals ein belastender oder bedrückender Inhalt.
Die Psychologie ist sich noch immer uneins darüber, welche und wie viele Grundfaktoren unsere Persönlichkeit ausmachen. Für Entscheidungen sind zwei von zentraler Bedeutung: die Extraversion und der Neurotizismus, auch als emotionale Labilität bezeichnet. Diese Einteilung geht auf Eysenck zurück. Einer seiner Schüler, Gray, hat letztlich dieses Prinzip aufgenommen und eine etwas andere Formulierung gewählt: Impulsivität und Ängstlichkeit. Die impulsiven Menschen sind eher empfänglich für Belohnungen. Die ängstlichen Menschen konzentrieren sich mehr auf mögliche Bestrafungen. Das bewirkt einen großen Unterschied. Die einen wollen etwas haben und die anderen wollen etwas vermeiden. In unserem Kulturkreis ist die überwiegende Zahl der Menschen eher ängstlich und will somit etwas vermeiden. Die Anteile in uns, welche unseren Stoffwechsel steuern, steuern übrigens auch unser Verhalten. Das ist der Grund dafür, weshalb wir zum Beispiel in unangenehmen Situationen zugleich fliehen wollen als auch Angstschweiß entwickeln.
Vertiefung
Versuchen Sie folgende Selbstreflexion:
Stellen Sie sich eine Skala von 1–10 vor. Eins bedeutet »Ich habe praktisch nie Angst« und zehn bedeutet das genaue Gegenteil. Wo auf der Skala schätzen Sie sich ein? Seien Sie dabei so ehrlich wie möglich mit sich selbst. Vielleicht helfen Ihnen folgende Fragen:
Überlegen Sie sich Situationen, in welchen Sie Mut gebraucht haben oder gebraucht hätten. Wie schwierig war es für Sie, eine entsprechende Situation zu bewältigen?
Meinen Sie, es wird schon wieder gut gehen oder befürchten Sie eher, was alles Schlimmes passieren könnte?
Macht es Ihnen etwas aus, alles auf eine Karte zu setzen?
Empfinden Sie eine gewisse, Ihnen angenehme Spannung in Situationen, in denen andere bereits sich vor Angst in die Hose machen?
Können Sie wirklich ruhig schlafen, wenn Sie in einer ungewissen Lage sind?
Besteigen Sie vollkommen cool ein Flugzeug einer Fluggesellschaft, die in Europa nicht mehr landen darf? Oder sagen Sie sich: Gott wird es schon richten?
7 Zentrum der Lust
Wenn unser Unbewusstes einen Gewinn erwartet, der besonders hoch oder verlockend ist, strengen wir uns mehr an. Solche Aussichten empfindet unser Gehirn als lustvoll. Wir wollen belohnt werden – dabei hilft uns eine Vielzahl von Belohnungen (Kasten 2).
Kasten 2: Belohnungen für unser Gehirn
13. Monatsgehalt
Lob
Anerkennung
Macht
Applaus
Prämien
Essen
Sex
Geld
Status
Gerechtigkeit und Genugtuung
Trinken
Hierarchieaufstieg
Verehrt werden
Kauf von materiellen Dingen
Sehr ähnlich wirkt die angestrebte Vermeidung von unerwünschten Gefühlen. Hierhin gehört, weniger Verlust zu erleiden. Das ist der Trick von billigeren Preisen oder Sonderangeboten. Sie zielen in unseren Kern.
Prinzip ► Wir gieren nach Gewinn – je verlockender, umso mehr strengen wir uns an.
Bestrafung
Menschen neigen dazu, moralisch positives Verhalten zu belohnen und Verletzungen von moralisch inadäquatem Verhalten zu bestrafen. Warum eigentlich? Weil es uns befriedigt. Das Lustzentrum in unserem Gehirn wird hochaktiv, wenn wir andere bestrafen können. In Kurzform:
Prinzip ► Bestrafung macht Spaß!