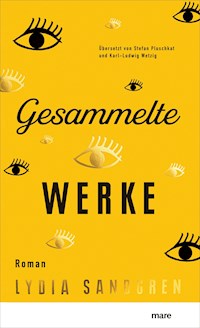
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Göteborger Verleger Martin Berg steckt in einer Krise: Die Verlagsgeschäfte stocken, Martins Frau Cecilia ist Jahre zuvor spurlos aus seinem Leben verschwunden, sein großes Romanprojekt liegt unvollendet in der Schublade und seine Freundschaft zu dem gefeierten Künstler Gustav Becker scheint endgültig erkaltet. Während Martin in Erinnerungen an seine Studienzeit in der Göteborger und Pariser Bohème versinkt, blickt seine Tochter Rakel an jeder Straßenecke in die Augen ihrer verschwundenen Mutter, deren Porträt das Plakat einer großen Gustav-Becker-Retrospektive ziert. Als Rakel glaubt, Cecilia in dem Roman eines Berliner Schriftstellers wiederzuerkennen, scheint es an der Zeit, den Schatten, der über ihrer Familie liegt, endlich zu vertreiben. Feinfühlig und klug erzählt Lydia Sandgren in ihrem gefeierten Debütroman von einer besonderen Freundschaft und einer besonderen Liebe – und setzt nicht zuletzt der Liebe zur Literatur ein Denkmal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1161
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lydia Sandgren
Gesammelte
WERKE
Roman
Aus dem Schwedischenvon Stefan Pluschkat undKarl-Ludwig Wetzig
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Samlade verk im Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
Copyright © Lydia Sandgren, 2020
Der Verlag dankt dem Swedish Arts Council für die Förderung dieser Übersetzung.
© 2021 by mareverlag, Hamburg
Lektorat Sibylle Klöcker, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coveradaption mareverlag, nach Heike Schüssler
Typografie (Hardcover) mareverlag, Hamburg
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-396-5
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-661-4
www.mare.de
Martin Berg lag, die Hände auf dem Bauch gefaltet, im Wohnzimmer auf dem Fußboden. Um ihn herum waren alle möglichen Papiere verstreut. Neben seinem Kopf lag ein halb fertiger Roman, zu seinen Füßen breiteten sich haufenweise Servietten aus, auf die er in den letzten fünfundzwanzig Jahren Einfälle notiert hatte. Sein rechter Ellbogen stieß an eine Anthologie vielversprechender Nachwuchsautoren in den Achtzigern – das einzige Buch, in dem jemals etwas von ihm veröffentlicht worden war. In der Nähe seines linken Ellbogens befanden sich einige mit Kordel verschnürte Bündel, die mit Rotstift beschriftet waren: PARIS. Zwischen seinem Kopf und seinem Ellbogen und vom Ellbogen bis zu den Füßen lag Papier über Papier, mit Tinte oder Bleistift beschrieben, mit der Maschine getippt, mit Kugelschreiberkorrekturen an den Rändern, Computerausdrucke mit doppeltem Zeilenabstand, zerknittert, voller Kaffeeflecken, leer und glatt, einige zusammengeheftet, manche von Büroklammern gehalten, andere lose Blätter. Es handelte sich um angefangene Erzählungen, Essays, Romanskizzen, mehrere erste Entwürfe von Theaterstücken, Notizbücher mit abgewetzten Einbänden nach einem Leben in den Innentaschen von Sakkos und Stapel von Briefen.
Er hatte den Couchtisch beiseite geschoben, um Platz zu haben.
Es war ein Sommernachmittag in jenem Jahr, in dem er fünfzig wurde. Die Hitze waberte über der Stadt. Alle Fenster zur Straße standen offen, Kinderlachen, Fahrradklingeln, das entfernte Wummern von Musik, die er nicht kannte, und das Kreischen einer Straßenbahn auf der Karl Johansgatan drangen zu ihm herauf. Im Park draußen sonnten sich Menschen, bleich und reglos wie Robben auf einer Sandbank. Vorhin hatte Martin den Impuls verspürt, sie aus dem Fenster heraus anzuschreien, doch jeder Laut schien in seinem Hals festzustecken. Er spürte ein Kribbeln unter der Haut, und im Bauch hatte er ein tiefes, beständig saugendes Loch, seine Hände schwitzten und zitterten.
Er befand sich in einer der Übergangsphasen der Geschichte. Überflüssige Zeit zwischen zwei wichtigeren Ereignissen. Etwas, das man gern überspringt, um Fluss und Schwung in den Text zu bringen. Nichts zu tun, außer zu warten. Darauf, dass die Kinder nach Hause kommen. Auf die Beerdigung. Auf einen Bescheid. Man bekam Lust, seinen Rotstift zu zücken und das ganze Blatt dick durchzustreichen. Weg mit dem Mist! Der Lektor von Raymond Carver hatte in dessen Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden große Teile brutal gelöscht, hatte ganze Schlüsse von Kurzgeschichten gestrichen, vor allem die glücklichen. Und wie gut waren sie dadurch geworden.
Vielleicht hätte Martin versuchen sollen, eine gewisse Normalität aufrechtzuerhalten. Leute treffen, etwas essen und ein paar Stunden arbeiten. Schließlich war er noch immer Verleger, und für den Verleger Martin Berg gab es immer etwas zu tun. Doch stattdessen hatte er seine alten Papiere zusammengesucht. Lange Zeit hatte er auf dem Speicher verbracht, der zum Platzen vollgestopft war mit Winterjacken in Kindergrößen, einem Fahrrad ohne Kette, Elis’ alten Skateboards, Rakels Ballkleid von der Abiturfeier, Schlafsäcken, einem Zelt, Plakaten, die er unbedingt ausrollen und betrachten musste, sowie Cecilias aufgetragenen Laufschuhen. Wie viele Paar Schuhe hatte diese Frau eigentlich verschlissen, und wieso hatte sie sie nicht einfach weggeworfen? Martin hatte in den Sachen gewühlt, und ihm war dabei der Schweiß den Rücken und die Schenkel hinabgeströmt, weil es dort oben unter dem First kochend heiß war. Am Ende hatte er einen Karton gefunden, auf dem unverkennbar in seiner eigenen Handschrift stand: Martins unvollendete Werke.
Er war nicht sicher, wie lange er versucht hatte, den Faden zu entwirren, der von seiner derzeitigen Situation zu einer Art Anfangspunkt zurückführte. Irgendwo musste es eine Wegscheide gegeben haben, doch anscheinend war er ohne Vorstellung von der Richtung lange Zeit einfach immer weitergetrottet. Und wo war überhaupt die ganze Zeit hin? Denn vergangen war sie nachweislich. Beide Kinder waren von Minderjährigen zu Erwachsenen geworden. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hatte er für niemanden mehr das Sorgerecht zu tragen.
Elis, der kleine Elis, der sich gerade – Gott sei Dank in Begleitung seiner Schwester – auf einer Reise durch Europa befand, würde vermutlich nicht so bald zu Hause ausziehen. Aber er hatte seinen Blick schon auf den Horizont gerichtet, und früher oder später würde Martin wohl mit ansehen müssen, wie sein Sohn seine Anzugwesten packte und in eine WG auf Hisingen zog, wo er mit halb geschlossenen Augen Jacques Brel hören konnte und nicht mehr heimlich rauchen musste. Und dann wäre es völlig leer. Dann wäre es vorbei.
Rein rational, dachte Martin auf dem Teppich liegend, weil er den Verdacht hatte, Rationalität sei in seiner Lage das ihm einzig Zugängliche; rein rational verstand er, dass dies hier Teil eines Prozesses war. Dass Kinder groß werden, gehört zu den Unvermeidlichkeiten des Lebens. Vor dreißig Jahren hatte er das Gleiche getan, wenn auch mit einem fragwürdigeren Haarschnitt. So etwas passierte. Er war nur nicht darauf vorbereitet, dass es so bald geschah. Er hatte sich die Trostlosigkeit nicht vorgestellt und nicht begriffen, wie sich die Einsamkeit in sämtlichen Zimmern ausbreiten und die ganze Wohnung einnehmen würde, während sein Haar grau wurde, die Beine dünner, das Hörvermögen schlechter und die Jahre verschwanden, ohne im Austausch dafür etwas zu geben.
Und eines Tages würde alles vorbei sein. Er hinterlässt Stöße von Papier.
Martin schloss die Augen und sah Gustav Becker vor sich; dabei war es wichtig, nicht zu viel an Gustav zu denken. Vor allem nicht an den lachenden Gustav, an die schmalen Hände, die eine Zigarette hielten, an die Augen, die dem Blick standhielten, bis man selbst wegsah.
Martin schaute nach rechts (Papier), nach links (Papier) und richtete den Blick wieder zur Decke. Wie weiß und jungfräulich sie war, gänzlich unbeschrieben!
INHALT
TEIL 1: DIE BIBLIOTHEK VON ALEXANDRIA
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
GRUNDSTUDIUM 1
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
GRUNDSTUDIUM II
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
HAUPTSTUDIUM GEISTESWISSENSCHAFTEN 1
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
HAUPTSTUDIUM GEISTESWISSENSCHAFTEN 2
Kapitel 13
Kapitel 14
TEIL 2: DEUTSCHE GRAMMATIK
EIN JAHR STUDIUM IN PARIS 1
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
EIN JAHR STUDIUM IN PARIS 2
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
EXAMEN
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
DIE DOKTORANDIN
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
DIE DISPUTATION
TEIL 3: KAIROS
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
TEIL 1
DIE BIBLIOTHEK VON ALEXANDRIA
1
Der Wecker riss ihn ins Leben zurück. Es war März und noch immer stockdunkel draußen. Martin richtete sich schwerfällig auf, knipste die Nachttischlampe an und stellte den Wecker ab. Auf dem Handybildschirm leuchtete eine SMS seines Sohns, abgeschickt um 3.51 Uhr: Komme bald. Achtung: Verbitte mir jegliche Gratulationsbekundung!
Martin seufzte. Elis hatte im Jazzhuset in seinen Geburtstag hineingefeiert, und irgendwo zwischen Lokal und Zuhause hatte er es anscheinend für notwendig erachtet, seinen Vater darauf hinzuweisen, dass er keine Lust auf ein Geburtstagsständchen hatte.
Auf dem Weg ins Bad klopfte Martin an die Zimmertür seines Sohns und erhielt ein dumpfes Grummeln zur Antwort.
»Alles Gute zum Geburtstag«, sagte Martin.
Er stellte die Kaffeemaschine an, holte die Zeitungen aus dem Flur, toastete Brot und kochte ein Ei. Als er gerade die Kulturseiten aufgeschlagen hatte, tauchte sein jüngstes Kind auf, marschierte schnurstracks zur Spüle, ließ ein Glas voll Wasser laufen und leerte es in einem Zug.
In den letzten Jahren war Elis um mehrere Dezimeter gewachsen, und immer deutlicher zeigte sich, dass er im Aussehen nach seiner Mutter kam, hoch aufgeschossen und blond gelockt. Martins auffälligster Beitrag zu Elis’ genetischer Ausstattung waren die braunen Augen und, behauptete jedenfalls Gustav, ein Hang, bockig und verstockt zu sein, aber so zu tun, als sei er es nicht.
»War’s schön gestern?«
Elis nickte und trank noch ein Glas Wasser.
»Möchtest du deine Geschenke jetzt oder später?«
Sein Sohn überlegte einen Moment, dann krampfte sich plötzlich sein Brustkorb zusammen. »Später«, würgte er und stürzte zur Toilette.
Martin kippte den letzten Schluck Kaffee hinunter und ging sich anziehen. Die Gestalt im Spiegel der Schranktür würdigte er keines Blickes. Er wusste sehr genau, wie er aussah. Die Haare auf der Brust waren grau geworden, die Waden dünn und die Knie knubbelig. Es half auch nicht, dass er drei Mal die Woche in Göteborgs teuerstem Fitnessstudio trainierte. Es war ein erbärmlicher Versuch, dem Unausweichlichen etwas entgegenzusetzen. Sein Körper hatte ihn verraten: Er gab vor, weiter wie gewohnt zu funktionieren, doch in Wahrheit hatte er ihn dem Altern ausgeliefert. Peu à peu, während seine Aufmerksamkeit von anderem in Anspruch genommen war. Früher war es kein Problem, nach einem Tag, an dem er von Mittag an mehr oder weniger betrunken gewesen war und eine Zigarette nach der anderen geraucht hatte, am nächsten Morgen aufzuwachen, festzustellen, dass es der Tag des Göteborgsvarvet war, zu dem man sich aus Spaß angemeldet hatte, seine Laufschuhe hervorzukramen und den Halbmarathon in zwei Stunden herunterzuspulen. Man wiegte sich in dem Glauben, so würde der Körper eben funktionieren. Und dann baute man nach und nach ab, ohne dass man es merkte.
Schwarze Hose, schwarzes Sakko. Martin Berg kleidete sich wie jemand, der zur Beichte ging.
Wie üblich erschien er als Erster im Verlag. Er mochte es, wie die Lampen aufflackerten, wie der Tag erwachte und vor seinen Augen Gestalt annahm.
Mitten auf dem Computerbildschirm klebte ein Post-it: Location für Fest zum 25-jährigen Jubiläum – Kulturhaus Frilagret ok??? Die runde, säuberliche Handschrift stammte von der Volontärin Patricia. Eine blasse Erinnerung an eine unbeantwortete E-Mail regte sich in seinem Hinterkopf. Er klebte den Merkzettel an den Rand, wo schon eine Menge anderer Post-its pappten, die ihn an Dinge erinnerten, um die er sich sowieso erst kümmern würde, wenn es absolut unvermeidlich wäre. Es schien gar keine Rolle zu spielen, wie viel man arbeitete, die Zahl der Dinge, die »sofort« erledigt werden mussten, blieb konstant. Das Jubiläum stand erst im Juni an.
Martin legte die Fingerspitzen an die Stirn und lauschte dem Surren der hochfahrenden Festplatte. Elis hatte heute Französischprüfung. Wahrscheinlich hatte er sich in der Warteschlange vor dem Jazzhuset darauf vorbereitet.
Die Zensuren seines Sohns gaben insofern Anlass zur Sorge, als sie weder richtig gut noch richtig schlecht waren. Wären sie schlecht gewesen, hätte man sie als gegeben akzeptieren müssen, weil er es nicht besser konnte. Sie lagen aber permanent auf der Höhe der Mittelmäßigkeit, denn stets erlahmte Elis’ Einsatz irgendwann. Dann legte er den Stift aus der Hand und guckte aus dem Fenster, anstatt seine Antworten noch einmal durchzugehen. Wenn man ihn aufforderte, wenigstens noch ein bisschen mehr zu tun, stöhnte er und setzte ein gequältes Gesicht auf, als hätte man ihn gebeten, den Mond vom Himmel zu holen oder einen Eisbären zu zähmen, und sagte: Ja, ja, ich mach ja schon. Martin hörte seine Stimme lauter werden, während er auf Hochschulstudium und Arbeitsmarkt zu sprechen kam und darauf, was vermutlich aus dem zweiten Bildungsweg würde, sofern der liberale Björklund seine schwachsinnigen Ideen umsetzen dürfe, sowie darauf, wie wichtig es sei, dass Elis endlich begriff, wie wichtig das alles sei. Rakel brauchte man solche Vorhaltungen nie zu machen. Sie hatte in allen Fächern Bestnoten nach Hause gebracht.
Die Außentür schlug zu, und auf dem Flur erklangen schnelle Schritte.
»Guten Morgen!«, rief Per dröhnend. Er hörte sich jedes Mal so an, als meine er, was er sagte. Martin musste mit zu wenig Enthusiasmus reagiert haben, denn nur Minuten später trat sein Kompagnon mit zwei Bechern Kaffee in sein Büro. Per Andrén trug ein hellrosa Hemd unter einem weinroten Sakko und war unerträglich gut gelaunt.
»Warum so schwermütig, mein Freund? Sieh mal, was gestern gekommen ist«, sagte er und hielt Martin ein Buch hin. »Sieht das nicht gut aus?«
Die Neuausgabe von Ludwig Wittgensteins Tagebuch war eine leicht übereilte Idee gewesen. Die alte Auflage war bei Weitem noch nicht vergriffen, aber ein anderer Verlag wollte noch in diesem Jahr eine große schwedische Wittgenstein-Biografie herausgeben, und die würde hoffentlich das Interesse an dem österreichischen Philosophen neu entfachen. Sie hatten einen Ideengeschichtler der Hochschule Södertörn dafür gewinnen können, ein neues Vorwort zu schreiben.
»Sehr schön«, sagte Martin. Die gebundene Ausgabe war solide und sah mit breitem Seitenrand und seidenem Lesebändchen gut aus. Er schlug das Exemplar auf und strich über das holzfreie, cremefarbene Papier, las aber auch jetzt nicht darin, genauso wenig, wie er es einmal ganz durchgelesen hatte, bevor es in Druck ging.
Per strahlte. »Amir hat mit der alten Druckvorlage hervorragende Arbeit geleistet. Das solltest du ihm sagen.«
»Ich nehme an, das hast du bereits getan.«
»Er möchte es aber von dir hören.«
Martin lachte auf. »Glaubst du wirklich?«
»Die jungen Leute wollen es vor allem von dir hören. Und jetzt zieh dir mal den Kaffee rein, damit du wach wirst, bevor die anderen kommen.«
Früher einmal wäre Martin ernsthaft um sich besorgt gewesen, wenn er erfahren hätte, dass dreißig Jahre später Per Andrén die Person sein sollte, mit der er am meisten zu tun hatte. Sie hatten sich kennengelernt, als sie in frühester Jugend die inkompetente Hälfte einer Rockband bildeten. Martin war davon überzeugt, Gitarre spielen zu können, und diese Überzeugung übertünchte lange die Tatsache, dass er nicht sonderlich musikalisch war. Per wurde durch eine solche Gewissheit nicht gerettet. So über seinen Bass gebeugt, dass man lediglich seinen hoffnungslos unpunkigen Haarschopf sah, schwitzte, fummelte und probierte er und sah nur selten auf, mit einem Ausdruck tiefster Verwirrung auf seinem Mondgesicht. Die Haut an seinen Fingerkuppen wollte nie hart werden, und er hatte ständig Blasen. Dafür las er jede Ausgabe der Zeitschrift Kris mehrmals durch, kannte sämtliche Neuerscheinungen auf dem schwedischen Buchmarkt und stammte in dritter Generation aus einer Unternehmerfamilie. Das mit dem Verlag war seine Idee gewesen. Von sich aus wäre Martin vermutlich nicht einmal der Gedanke gekommen, einen Verlag zu gründen.
Per und seine Frau hatten die schöne Gewohnheit entwickelt, Martin zum Essen zu sich nach Hause einzuladen, mit zunehmender Frequenz in den letzten Jahren. Sie spielten diese Essen als ganz informelle, spontane Angelegenheiten herunter (»Möchtest du nicht am Samstag auf ein paar Häppchen zu uns kommen?«), die sich aber jedes Mal als Drei-Gänge-Menüs mit einer ganzen Reihe von Gästen, flackerndem Kerzenlicht und mehr oder weniger intellektuellen Gesprächen bei fünfundzwanzig Jahre altem Portwein herausstellten, den sie im letzten Sommer von einem kleinen Gut bei Porto mitgebracht hatten, auf das sie ihre erstaunlich braven Kinder mitschleppten. Martin hatte seit Langem durchschaut, dass sie auch jedes Mal irgendeine Singlefrau in passendem Alter einluden. Martin bevorzugte allerdings das Wort »alleinstehend«, »Single« fand er albern. Der Ausdruck versuchte, Verzweiflung mit Forschheit zu kaschieren. Der aktuelle Beziehungsstatus wurde immer zwischen den Zeilen zu verstehen gegeben: »Mein Ex-Mann und ich …«, »Das war, als ich mit meinem Ex auf Brännö wohnte«, und so fort.
Er selbst sprach von Cecilia immer als Cecilia. Was hätte er sonst sagen sollen?
Per warf ihm dann jedes Mal über den Tisch hinweg einen resignierten Blick zu.
Die übrige Belegschaft trudelte ein. Als Erste Patricia, die Volontärin, die täglich ihren Computerbildschirm abstaubte und ihren Schreibtisch stets so aufgeräumt hielt, dass man sich fragte, was sie eigentlich arbeitete. Aber sie war eine tüchtige Korrekturleserin, übersah nie einen unschönen Zeilenumbruch oder eine falsche Worttrennung, und sobald in ihrem Leben ein Problem auftauchte, rückte sie ihm mit einer Excel-Tabelle zu Leibe. Martin war nicht mit ihr warm geworden, bevor sie ihm gestand, dass Sturmhöhe das Leseerlebnis ihres Lebens war. Doch Patricia war definitiv keine Cathy, und einen Heathcliff würde sie sich im wahren Leben niemals suchen. Andererseits lechzte etwas in ihrem ansonsten so wohlgeordneten Wesen nach Zusammenbruch und Verrücktheit, gerade so wie in Brontës Roman.
Nach ihr schwebte Sanna herein. Sie war Lektorin seit den Tagen, als der Verlag noch in einer ehemaligen Fabrikhalle residiert hatte, telefonierte über Festnetz und rauchte in geschlossenen Räumen. Sie warf allen und niemandem ein Hej zu, ließ ihre Yogamatte fallen, schleuderte ihre Halbstiefel zugunsten von Hausschuhen von den Füßen und zog los, um sich einen Teller mit Cornflakes anzurichten, den sie dann an der Küchenzeile stehend binnen drei Minuten leer putzte.
Martin holte sich noch einen Kaffee, als Sanna gerade die Spülmaschine mit dem Fuß zuklappte.
»Ich habe Karins Manuskript gelesen«, sagte sie. »Es ist wirklich sehr lang ausgefallen.«
»Ich habe mit ihr darüber geredet, einen Teil zu streichen.«
»Was heißt ›einen Teil‹? Ich dachte so an ein Viertel. Wird sie beleidigt sein?«
Martin überlegte. »Das Risiko besteht. Können wir uns das später ansehen?«
Sanna seufzte und füllte Kaffee in den größten Becher, den sie auftreiben konnte.
Zurück in seinem Büro, verbrachte Martin einige Zeit damit, die Erstausgabe von Wittgensteins Tagebuch zu suchen. In den zurückliegenden Jahren hatte Berg & Andrén jährlich etwa zwanzig Titel veröffentlicht, und allmählich wurde es eng im Regal. Auf einem der Lamino-Sessel balancierend, fand er das Buch ganz oben, verstaubt und ein wenig ausgebleicht. Ansonsten hatte es sich erstaunlich gut gehalten, obwohl es 1988 mit einem minimalen Budget gedruckt worden war. Der Rücken war nur geleimt und das Papier billig, und doch ließ es eine gewisse stramme Eleganz erkennen. Der Umschlag war in sattem Kastanienbraun gehalten, Titel und Verfassername darauf in Schwarz. Der Text auf der Rückseite nannte in der letzten Zeile die Übersetzerin: Cecilia Berg (geb. 1963), Doktorandin der Wissenschafts- und Ideengeschichte an der Universität Göteborg. In der Neuauflage stand lediglich: Übersetzung: Cecilia Berg.
»Amir!«, brüllte Martin, als er den jungen Mann auf dem Weg zur Küche vorbeigehen sah. Amir blieb schlagartig stehen. Sein Hemd war bis zum Hals zugeknöpft, aber seine Haare standen in alle möglichen und unmöglichen Richtungen. Wenn Martin ihren Herstellungsleiter recht kannte, dann war er im Dämmerzustand eines Halbschlafs zur Arbeit gefahren, aus dem er noch nicht richtig erwacht war.
»Gute Arbeit, das Wittgenstein-Buch«, sagte er.
Amirs Schultern fielen herab, und auf seinem Gesicht machte sich ein Lächeln breit.
»Findest du?«
Er war ein paar Jahre älter als Rakel, näher an der Dreißig als an der Fünfundzwanzig. Er hatte als Volontär bei ihnen angefangen und seine Karriere mit ehrlichem Entsetzen über ihre Homepage begonnen (»Wann habt ihr die das letzte Mal relauncht? Ist das ein Witz?«). Dann hatte er sich der Sache auf seine Art angenommen: isoliert unter Kopfhörern, die nicht ein Dezibel von dem, was er hörte, nach draußen ließen, den Blick auf den Bildschirm fixiert, unablässiges Klappern der Tastatur. Als sein Volontariat endete, war Per überzeugt, dass ohne Amir nichts mehr laufen würde, also stellte er ihn ein und kaufte einen sündhaft teuren Computer.
Martin nickte, und Amir ging mit einem Danke Richtung Küche.
Der Tag verfloss wie üblich: in einer langen Reihe von E-Mails und Telefonaten, Kaffeetassen, Sitzungen und Beschlüssen. Nach dem Mittagessen traf er sich mit einer Autorin, um mit ihr über ihren nach wie vor fast ungeschriebenen Roman zu sprechen. Ihr Debüt hatte gute Rezensionen und einen Preis bekommen, jetzt war diese etwas labile Person von den Erwartungen an einen Nachfolger paralysiert. Martin überlegte, ihr zu versichern, es komme nicht so darauf an – ihr Erstling hatte sich gut verkauft, wenn auch von der Taschenbuchausgabe noch etliche Kartons unten im Lager standen. Der Versuch könnte allerdings auch nach hinten losgehen. Martins Erfahrung zufolge funktionierte die Erziehungsstrategie, abwechselnd streng und nachgiebig zu sein, bei Künstlerseelen genauso gut wie bei Kindern. Man musste jedoch das richtige Wort zur rechten Zeit treffen. Lisa Ekman hockte ganz vorn auf der Sofakante, ihre Jacke hatte sie anbehalten, und spielte unaufhörlich mit einer Snusdose, während sie von ihrem neuen Projekt berichtete.
»Es handelt von einer jungen Frau, die an eine Heimvolkshochschule geht«, sagte sie und hielt den Blick auf Gustavs großes Paris-Gemälde gerichtet. »Sie ist ein wenig spontan dahin gezogen und begegnet dort einem jungen Paar. Daraus entsteht ein heftiges Dreiecksdrama, aber ich weiß noch nicht genau, wie es ausgeht. Ich habe verschiedene Ideen dazu. Ich denke, ich werde den Sommer über daran schreiben.«
»Das klingt sehr spannend«, sagte Martin mit seiner freundlichen Stimme. »Schick mir etwas, wenn du ein gutes Stück weiter bist, dann reden wir drüber.«
Nach diesem Gespräch wanderte er in Pers Büro auf und ab, um ein Buch über den Kunstmarkt der Achtzigerjahre zu erörtern. Sie hatten überlegt, Nils von Dardels Sterbenden Dandy aufs Cover zu setzen, aber bei Natur & Kultur sollte offenbar eine Biografie erscheinen, die dasselbe Bild verwendete. Per schlug eins von Gustavs Bildern vor, denn Gustav habe seinen Durchbruch in ebendieser Blase auf dem Kunstmarkt gehabt. An sich keine dumme Idee. Allerdings bestand das Risiko, dass sich Gustav nicht gern in Zusammenhang mit dem »Markt« gebracht sähe, was er natürlich nicht sagen würde. Er würde Ja dazu sagen, weil es Martin war, der ihn fragte. Anschließend wäre er sauer und ungenießbar und würde zumachen wie eine Auster. Am liebsten würde man ihn an den Schultern packen, schütteln und sagen: Verdammt noch mal, es ist doch bloß ein beschissenes Buch, wenn du dein blödes Bild nicht auf dem Titel haben willst, dann sag es doch einfach!
»Aber genauso gut kann er eingeschnappt sein, wenn wir ihn nicht fragen.« Martin seufzte. »Fortsetzung folgt. Ich muss jetzt zur Markthalle. Elis hat Geburtstag und hat sich Lammkoteletts gewünscht.«
»Ist er nicht Vegetarier geworden?«, fragte Per.
»Es gibt offenbar eine Ausnahmeklausel, was Lammfleisch betrifft.«
Draußen war es noch hell. Martin konnte sich nicht erinnern, wann er den Verlag das letzte Mal bei Tageslicht verlassen hatte.
Während er seine Sachen zusammensuchte, fiel sein Blick auf einen Stapel Bücher, die er von der Londoner Buchmesse mitgebracht hatte. Die englischen und französischen Titel würde er selbst durchsehen, aber es befand sich auch ein Roman auf Deutsch darunter. Den musste jemand anders lesen. Er hatte gleich an seine Tochter gedacht. Sie konnte ruhig ein paar Gutachten übernehmen.
Das Buch lag ganz unten im Stapel. Es trug den Titel Ein Jahr der Liebe, was er trotz seiner begrenzten Deutschkenntnisse verstand. Mehr stand da nicht. Aber die deutsche Lektorin Ulrike Ackermann kannte er seit vielen Jahren, und sie hatte ihm das Buch mit großem Nachdruck ans Herz gelegt.
»Das ist ein ausgesprochen feiner Roman«, hatte sie gesagt. »Ich glaube, der könnte wirklich gut zu euch passen.« Das musste sich noch zeigen. Das Buch umfasste knapp zweihundert Seiten. Das sollte Rakel in ein paar Wochen schaffen.
Obwohl er kein Wort verstand, las Martin ein paar Zeilen. Ihm war, als hörte er Cecilias Stimme.
2
In der Markthalle stieg das Stimmengewirr zum Dach auf. Mäntel wurden aufgeknöpft, Schals abgewickelt, und die Leute hielten die Handschuhe in der Hand, wenn sie sich zu den Verkäufern vorbeugten. Martin wartete darauf, seine Koteletts auseinandergehackt zu bekommen, als er aus den Augenwinkeln die Gestalt einer Frau wahrnahm. Sie hatte die richtige Größe und einen lockigen Pagenschnitt. Einen Moment fühlte es sich so an, als würde sich der Boden unter seinen Füßen öffnen. Ist es …
Nein, sagte sich Martin selbst. Sie war es nie. Er schüttelte leicht ein Bein nach dem anderen aus, um sie wieder unter Kontrolle zu bringen. Sobald die Frau sich umdrehte, würde jede Ähnlichkeit verschwinden. Achtung, sie bewegt sich …
Und natürlich war es ein völlig unbekanntes Gesicht. Sie hatte einen stechenden Blick und resolute Falten zwischen Nase und Mund. Sie trug Handschuhe aus taubenblauem Wildleder und die Handtasche in der Ellenbeuge, und bestimmt würde sie bald zu ihrer Familie nach Hause fahren, in einem bürgerlichen Vorort wie Askim oder Billdal, würde mit einem Glas Rotwein Platz nehmen und sich über das Hantieren ihres Ehemanns in der Küche ärgern, sein Scheppern und Klappern, dieses ewige Geklapper, obwohl sie ihm schon hundert Mal erklärt hatte, wie ihr das in den Ohren wehtat, und sie würde ihre Kinder fragen, wie es in der Schule gewesen war, ohne auf ihre Antworten achtzugeben.
Sie bemerkte seinen Blick, und er ließ ihn rasch weiterschweifen, als habe er sich bloß umgesehen und nur Sekunden bei ihr verweilt. Er bekam seine Koteletts und verließ eilig die Halle.
Die Sonne stand tief, und Martin musste geblendet die Augen schließen, bis sich sein Pulsschlag beruhigte. Er wollte zu Fuß nach Hause gehen. Das half in der Regel.
Das Eis lag noch dick auf den Kanälen, und ein kalter Wind pfiff durch die Straßen. An den Ecken und in den Parks lagen von den Schneepflügen aufgeworfene, schmutzige Haufen von Altschnee. Die nackten Bäume spreizten ihre dürren schwarzen Äste vor einem blassblauen Himmel. Martin ging am Hagabadet vorbei, wo er sich regelmäßig unter die präzise Kommandogewalt der Trainingsgeräte beugte. Jedes Mal, wenn er durch das Portal ging, dachte er daran, wie das Gebäude aus dem neunzehnten Jahrhundert ausgesehen hatte, bevor es zu Spa und Fitnesscenter umgebaut worden war. Er rührte an die Erinnerung, wie man einen Talisman anfasst. Damals hatte drinnen ein obskures Plattenlabel seine Räumlichkeiten gehabt, die man nur durch den Hintereingang und verwinkelte Gänge erreichte. Gustav hatte ihn mitgeschleppt, um irgendeinen Kumpel dort anzupumpen. Anstandshalber hatten sie dort eine Zeit lang herumgehangen, anerkennend zu einer Platte mit anstrengender elektronischer Musik genickt und Wermut aus Plastikbechern getrunken. Die Schwimmbecken unten waren längst geleert, und manchmal fanden darin improvisierte Theatervorstellungen statt, die laut von den Kachelwänden widerhallten. Heutzutage waren die Höfe von Haga abgesperrt und gepflegt, die Kinder trugen gestreifte Pullis, und auf dem Kopfsteinpflaster flanierten Sonntagsspaziergänger und Touristen, die übergroße Zimtschnecken mampften. Sprängkullen war längst kein illegaler Musikclub mehr, sondern beherbergte Universitätseinrichtungen. Die einzigen Typen von damals, die noch im Viertel wohnten, rauchten kein Gras mehr und waren Architekten geworden. Und ins Hagabadet gingen nur noch solche wie Martin Berg, die es sich leisten konnten, siebzehnhundert Kronen im Monat dafür zu bezahlen, auf einem Laufband zu joggen. Anfangs hatte er sich nackt und albern gefühlt in den hautengen Jogging-Tights und den T-Shirts aus Synthetikmaterial, das angeblich atmungsaktiv war und Feuchtigkeit vom Körper wegleitete (wohin?). Seine Laufschuhe waren noch tipptopp sauber und wie neu, weil er sie kein einziges Mal im Freien getragen hatte. Er vermied es, darüber nachzudenken, was sein fünfundzwanzigjähriges Ich dazu gesagt hätte. Nach und nach hatte er das Schöne an der Sache entdeckt. Es unterschied sich nicht sehr von seiner Arbeit und funktionierte nach dem gleichen Prinzip: Man investierte ein gewisses Maß an Anstrengung x, und das erbrachte ein bestimmtes Resultat y. Manchmal bestand y in der Erhaltung des Status quo: Man nahm nicht zu, der Umsatz im Unternehmen blieb gleich. Es konnte schon einigen Einsatz erfordern, y konstant zu halten. Es war eigentlich gar kein schlechter Erfolg, wenn man es schaffte. Um y zu erhöhen, musste auch x erhöht werden. Dummerweise bestand keine direkte Relation zwischen beiden Größen. Außerhalb des Hagabadet konnte man x unbegrenzt steigern, ohne dass y größer wurde. Dort drinnen gab es eine Art linearer Verbindung zwischen den beiden Variablen: Wenn man sich eine halbe Stunde auf einem Crosstrainer abstrampelte, hatte das unmittelbare Auswirkungen auf die eigene Physiologie.
Hinterher war man angenehm erschöpft. Man las ein wenig, bis der Herr Sohn gegen zehn nach Hause kam, die Tür knallte und kaum Hallo sagte. Man war müde genug, um sich auf kein Palaver einzulassen, registrierte nur am Rand, dass er sich die Lasagne in der Mikrowelle aufwärmte und sie mit in sein Zimmer nahm. Müde genug, um einzuschlafen, nachdem man das Licht gelöscht hatte. Müde genug, um in eine narkotische Dunkelheit zu fallen, bis der Wecker klingelte und einen wieder an die Oberfläche holte.
Die kühle Luft machte einen klaren Kopf. Martin war immer gern zu Fuß gegangen. Er war durch Paris gewandert, bis er sich ohne Stadtplan zurechtfand, und durch Göteborgs Stadtviertel musste er insgesamt Tausende von Kilometern gelaufen sein. Und dennoch gab es eine Straße, in der er niemals landete.
Die Kastellgatan lag eigentlich mitten in seinem Bewegungsschema. Täglich ging er über den Järntorget. Oft lief er die Linnégatan hinauf oder die Övre Husargatan hinab. Manchmal musste er Querstraßen zwischen beiden nehmen, aber welchen Weg er auch immer nahm, nie kam er in die Kastellgatan. So ging es über ein Jahrzehnt, mit der einen Ausnahme, als er in Cecilias alter Einzimmerwohnung gelandet war.
Das war vor vielen Jahren gewesen, als er mit einer sehr netten Grafikdesignerin zusammen war. Sie schleppte ihn andauernd zu irgendwelchen Wohnungsbesichtigungen, womöglich weil sie ihm ihre Unabhängigkeit demonstrieren wollte. »Ich überlege, mir eine Wohnung zu kaufen«, sagte sie, und Martin bekam nie heraus, ob sie damit noch etwas anderes sagen wollte. Doch irgendetwas war stets verkehrt an den Wohnungen: Eine lag im Erdgeschoss, eine andere hatte eine dunkelgrün gekachelte Küche, zu teuer, zu klein, zu neu. Während sie mit den Maklern über Grundsanierungen und mögliche Balkonanbauten redete, inspizierte Martin die Wohnungen fremder Menschen, die jeweils so aufgeräumt waren, als wohne zwar jemand darin, aber nicht richtig, und er machte sich ein Vergnügen daraus, die Algorithmen solcher Besichtigungstermine herauszufinden. Immer standen in der Küche frische Kräuter in Töpfen, an denen noch das Preisschild klebte. Auf den Sofas war ein bestimmter Typ Kissen platziert. Auf dem Waschbecken brannte ein Teelicht.
»Da bist du ja«, sagte die Grafikdesignerin mit Namen Mimmi, als sie sich am Skanstorget trafen. Sie küsste ihn hastig auf die Wange und ging los. »Ich muss nur noch nachsehen, welche Hausnummer«, sagte sie. Während sie in ihrer Handtasche wühlte, überkam Martin eine stille Gewissheit. Es wird Nummer II sein.
»Elf!«, sagte Mimmi und zog an ihm. »Was ist mit dir? Es wird doch nicht eins der Häuser sein, die abgesackt sind?«
Sie stiegen die wie das Innere eines Schneckenhauses gewendelte Treppe hinauf. Auf jeder der sechs Etagen befanden sich drei Wohnungstüren. Die Chance stand also eins zu achtzehn. Sein Puls beschleunigte sich, und er hörte Mimmis Stimme wie aus größerer Entfernung: »Ich glaube, es ist ganz oben.«
Sie erreichten den obersten Treppenabsatz, und da stand die Tür zu Cecilias Wohnung offen, aufgehalten durch ein Schild der Immobilienfirma und einen Eimer mit blauen Schuhüberziehern.
Ein junger Mann in einem Anzug aus Polyester erschien, streckte lässig die Hand vor, und während Mimmi den kommunikativen Part übernahm, betrat Martin die Wohnung.
Von der Decke im Flur strahlten Spots, und das abgetretene Linoleum war durch Fliesen ersetzt worden. Martin linste durch die Klotür, aber natürlich waren das gesprungene Waschbecken und das Porträt von Haile Selassie mit dem zugehörigen Löwen spurlos verschwunden. Alles weiß gekachelt. Auf der Küchenanrichte eine Schale mit Limetten. Das Parkett im Wohnzimmer war abgeschliffen, die Wände hatte man frisch gestrichen. Das Bett war unter Zierkissen begraben, und ein weißes Sofa nahm die gesamte Wand ein, an der Cecilias Bücherregal gestanden hatte.
Aber die Aussicht – wie eine Zeitreise in die Vergangenheit: Blechdächer und Schornsteine, die Festung Skansen Kronan, der Fluss und die Kräne.
Er stand am Fenster, während Mimmi mit scharfem Blick Fußleisten und Fenstersprossen inspizierte. Einige Wochen danach machte sie Schluss. Begründung: Es sei »völlig krank«, dass er noch immer seinen Ehering trage. »Mein Therapeut sagt, ich muss besser darin werden, eigene Grenzen zu setzen.«
Und er dachte: Das braucht eine Menge Zeit.
3
Als Martin nach Hause kam, stieß er in der Küche auf seine Tochter. Die Ellbogen aufgestellt und das Kinn in eine Handfläche gestützt, saß Rakel über ein Buch gebeugt am Küchentisch. Sie war derart in die Lektüre versunken, dass sie nicht bemerkte, wie er den Raum betrat. Genau wie Cecilia. Als könnten sie beide einen Schalter umlegen, hörten sie nichts und sahen nichts. Man konnte nicht im Geringsten erahnen, was in ihnen vorging. Als Rakel klein war, musste man sie wieder und wieder beim Namen rufen, und wenn man die Stimme laut genug erhoben hatte, damit man zu ihr durchdrang, starrte sie einen wütend an, schlurfte los und tat, worum man sie gebeten hatte, räumte ihre Spielsachen auf oder machte ihr Bett.
Diesmal schrak sie auf und fragte, ob sie beim Kochen helfen solle.
»Nicht nötig«, sagte Martin. »Was liest du gerade? Freud? Jenseits des Lustprinzips. Oh Gott! Fürs Studium, hoffe ich.«
Sie schob das Buch weg, ließ es aber offen liegen. »Höre ich da Skepsis in deinem Tonfall?«, fragte sie.
»Überhaupt nicht«, sagte er und schüttete Kartoffeln ins Spülbecken. Er musste allerdings zugeben, dass er nicht wenig verwundert bis misstrauisch gewesen war, als Rakel vor ein, zwei Jahren stur darauf beharrt hatte, Psychologie studieren zu wollen. Gegen das Studienfach selbst hatte er nichts einzuwenden, zumal er gelernt hatte, dass ein Studienplatz ebenso schwer zu ergattern war wie für Medizin oder Jura, aber es enttäuschte ihn, dass sie nichts aus ihrer offensichtlichen Begabung für Sprache und Texte machen wollte. Die ganze Zeit, die sie dafür aufgewendet hatte, Deutsch zu lernen! Und was machte sie jetzt aus ihren Sprachkenntnissen? Las die Theorien eines alten Seelenklempners über das menschliche Triebleben.
Martin hatte geglaubt, nach ihrem Jahr in Berlin würde sie beruflich eher in Richtung Literatur und Verlagswesen tendieren. Mit Sicherheit hätte er ihr ein Praktikum bei Ulrike im Schmidt-Verlag verschaffen können, wenn sie denn nun ausgerechnet nach Deutschland wollte. Doch auch wenn sie selten bis nie sporadische Gutachtenaufträge ablehnte, zeigte sie auch kein darüber hinausgehendes Engagement bei Berg & Andrén. Wenn er selbst mit vierundzwanzig solche Möglichkeiten gehabt hätte! Wenn Abbe Verleger gewesen wäre und kein abgemusterter Seemann, und wenn er, Martin, so geradewegs in die Welt der Literatur und Bildung hätte einsteigen können …
»Warum guckst du so unzufrieden?«
»Hier sind sehr viele grüne Kartoffeln dabei … Ach, übrigens, ich hab was für dich.« Er trocknete die Hände ab und ging den deutschen Roman holen. »Ich frage mich, ob es sich lohnen könnte, den hier zu übersetzen. Kannst du ihn lesen und mir sagen, was du davon hältst?«
»Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe«, sagte sie mit einem Blick auf den Klappentext.
»Es ist nicht sehr eilig.« Das stimmte nicht ganz. Wenn er Ulrike Ackermann richtig kannte, würde es nicht mehr lange dauern, bis sie auf eine Entscheidung zu drängen begänne. Sie müsse wissen, ob er interessiert sei oder nicht.
»Ich muss gerade viel für die Uni tun. Über das da muss ich eine Hausarbeit schreiben«, sagte sie mit einem Nicken zu Freud.
Martin sah ihren Händen beim Blättern zu, schmalen Händen mit langen Fingern, ganz wie Cecilias. Ansonsten kam sie äußerlich mehr auf ihn.
»Jenseits des Lustprinzips«, schnaubte er. »Was soll es denn jenseits davon geben?«
»Die unablässige Reise des Menschen zu Tod und Auflösung, scheint es.«
»Das sind ja schöne Aussichten. Könntest du mal nachsehen, ob wir noch Sahne haben?«
Nach dem Essen löste sich die kleine Gesellschaft rasch auf. Elis verschwand, um ein weiteres Mal das Erreichen der Volljährigkeit zu feiern, und Martin verkniff sich seine Einwände, als ihm die unangenehme Einsicht dämmerte, dass die Worte, die ihm bereits auf der Zunge lagen (»Du warst doch gestern schon unterwegs«), direkt aus einem abgedroschenen Schlager stammen könnten. Und Rakel wollte ihre Clique im Haga-Kino treffen.
»Kino? So spät noch?«
»Es gibt da auch eine Bar, Papa.«
Ihre Stimmen hallten im Treppenhaus wider, abgebrochen vom Schlagen der Haustür. Obwohl Martin sämtliche Reste vom Essen in diverse Tupperdosen verpackte, obwohl er die Spülmaschine einräumte und den Rest mit der Hand abwusch, obwohl er sich ein Glas Wein einschenkte und eine Vinylscheibe mit Billie Holiday auflegte, bewegten sich die Zeiger der Uhr verdächtig langsam.
Er könnte einen Film gucken. Er könnte etwas lesen. Er könnte, und bei dem Gedanken flammte etwas in ihm auf, das an Enthusiasmus grenzte, er könnte sich wieder an das William-Wallace-Projekt setzen.
Mit dem Blick aus dem Erker über den Allmänna vägen mit seinem Kopfsteinpflaster und den baufälligen Holzhäusern formulierte er in Gedanken seine Argumente für eine Neuübersetzung von Wallace’ Werken. Doch Per würde seufzen und seine runde Hornbrille abnehmen, die er sich schon zugelegt hatte, bevor alle runde Hornbrillen trugen. Sogar Elis hatte eine, obwohl ihn seine minimale Fehlsichtigkeit lange Zeit nicht im Mindesten beeinträchtigt hatte. Per hatte dagegen ziemlich schlechte Augen, nahm aber die Brille jedes Mal ab, wenn er Kritik oder eine abweichende Meinung kundgeben wollte. »Ich weiß nicht, ob das eine ökonomisch kluge Investition wäre«, würde er einwenden.
»Aber die alten Übersetzungen sind so schrecklich unsensibel …«
»Hätte sie jemand gelesen, wenn sie gut gewesen wären?«
Dann würde es so laufen wie immer: Martin behauptete, Wallace sei ein vergessenes Genie, Per hielt dagegen, er sei vergessen, Punkt. Martin verwies auf geglückte Beispiele von Neuausgaben vergessener Werke, Per konterte mit weniger erfolgreichen Fällen. Martin betonte, dass es wichtig sei, nicht alles ökonomischen Gesichtspunkten zu unterwerfen, Per wies darauf hin, dass man auch mal seine Lieblingssteckenpferde opfern müsse. Eventuell, sagte er, eventuell könne man William Wallace einmal aus der Versenkung holen, falls er noch einmal aktuell werden sollte. Falls es einen Film oder dergleichen geben sollte. Aber derzeit sei er nichts weiter als ein Zwischenkriegsautor im Schatten von Hemingway, Fitzgerald und Joyce.
Zwar lagen fast alle verlegerischen Entscheidungen in der Praxis bei Martin, ausgerechnet zu Wallace aber hatte Per einen festen Standpunkt.
Unentschlossen, was er tun sollte, bis er müde genug wäre, um ins Bett zu gehen, wanderte Martin durch die Wohnung. Als er und Cecilia Ende der Achtzigerjahre in das Haus in der Djurgårdsgatan eingezogen waren, beherbergte es mindestens zwei Wohngemeinschaften, die Nachbarn zogen im Garten erfolgreich Marihuana, und der Hauseingang war ständig mit Graffiti vollgesprayt. Die Familie unter ihnen, deren Krach und Partylärm stets durch den Fußboden heraufdrang, war längst umgezogen, um woanders laut zu sein und Partys zu feiern. Als die Mietwohnungen zu solchen mit teurem Dauerwohnrecht umgewandelt wurden, verschwanden sämtliche Studenten und sonstige lichtscheue Gestalten aus den Einzimmerwohnungen, ihre Nachfolge traten junge Leute mit besser geschnittenen Haaren an, die sogar an den Gemeinschaftsaufräumtagen teilnahmen. Der Alki aus dem Erdgeschoss war ebenfalls verschwunden, nachdem sich die besseren Eltern in der Hausgemeinschaft (nicht Martin) zusammengeschlossen und einhellig Maßnahmen gegen seinen räudigen, im Allgemeinen aber harmlosen Schäferhund gefordert hatten, weil er »den Kindern Angst« mache. Nach der Jahrtausendwende tendierte die Zahl der verkatert grillenden Punks gegen null, und der Hof war vollständig von Kindern aus Bullerbü okkupiert worden. In der Adventszeit leuchteten Sterne in allen Fenstern. Es gab keine einzige Satellitenschüssel.
Martin wanderte von der Küche ins Wohnzimmer und von dort in den Flur. Die Tür zu Elis’ Zimmer stand einen Spalt weit offen. Er öffnete sie ganz und verharrte einen Moment auf der Schwelle. Er konnte sich kaum erinnern, wie der Raum ausgesehen hatte, als dies noch sein Arbeitszimmer gewesen war.
Der Einrichtung nach zu urteilen, war das Zimmer in der Metamorphose zwischen zwei Entwicklungsstadien (Larve – Schmetterling) befangen. Die Wände waren in dem freundlichen hellgrünen Farbton gestrichen, den er und Elis vor bald zehn Jahren ausgesucht hatten und der inzwischen einige Narben aufwies, teils von früheren Posterwechseln, teils von einer Phase in der Mittelstufenzeit, in der sich Elis für Graffiti begeistert hatte. Frühere Popkünstler hatten Platz machen müssen für eine Reproduktion von Magrittes Pfeife und zwei Filmplakate. Das eine von Truffauts Jules et Jim, auf dem Jules und Jim mit flatternden Jackenschößen über eine Brücke rannten, dicht hinter Jeanne Moreaus Catherine mit einem aufgemalten Schnurrbart und die Haare unter eine Mütze gestopft. Auf dem zweiten, Lost in Translation von Sofia Coppola, saß Bill Murray desillusioniert auf einer Bettkante. Über dem Titel stand: »Everybody wants to be found«.
Martin setzte sich Bill Murray gegenüber aufs Bett.
Elis hatte seine Sachen immer in mustergültiger Ordnung gehalten. Als er klein war, lagen seine Comics in perfekt ausgerichteten Stapeln, und seine Transformers-Figuren standen in schnurgeraden Linien ausgerichtet. Das Bett war gemacht wie in einer Kaserne. Jetzt zeigte sich sein Ordnungssinn bei seiner Kleidung: An einer Kleiderstange hingen eine Reihe wohlerzogener Hemden und Fünfzigerjahrehosen mit Bügelfalten, einige Westen und ein Sakko, das er nach einer Woche besessener Suche auf eBay erstanden und seitdem so gut wie nie getragen hatte.
Der Schreibtisch war für eine kleinere und zartere Person gemacht. Locher, Hefter, Tesafilmhalter und ein Stifthalter standen in Habachtstellung an der Tischkante. Ein weißes MacBook mit leichten Macken lag im rechten Winkel zu einigen Büchern. Martin neigte den Kopf, um die Verfassernamen zu lesen: Arthur Rimbaud und Charles Baudelaire. Sieh mal an! Als Elis jünger war, las er nur, wenn er musste, abgesehen von Harry Potter, den er mochte, aber wohl als etwas Singuläres betrachtete und nicht als Indiz dafür, dass es irgendwo auch andere Bücher geben mochte, die ihn interessieren könnten. Daher hatte es Martin verblüfft, als er vor etwa einem halben Jahr seinen Sohn am Frühstückstisch über die Reise ans Ende der Nacht die Stirn runzeln sah, während er sein Marmeladenbrot in einem bedenklichen Winkel schräg hielt.
»Ist das für die Schule?«, hatte Martin über den Zeitungsrand gefragt.
»Hmmh?«, machte Elis.
»Céline«, sagte Martin und deutete mit dem Kinn auf das Buch. Elis hatte etwa zwanzig der vierhundertfünfzig Seiten gelesen. »Ist das für ein Fach in der Schule?«
»Nein, habe ich von Michel geliehen.«
Martin goss Kaffee ein. Hätte er wissen müssen, wer dieser Michel war? War es ignorant von ihm, es nicht zu wissen? Handelte es sich überhaupt um einen Jungen oder um ein Mädchen, Michelle? Und welche von beiden Alternativen war weniger beunruhigend?
»Wer ist Michel?«
»Ein Kumpel. Studiert Literaturwissenschaft«, erklärte Elis in einem Anfall von Mitteilsamkeit.
»An der Uni also.« Es war nicht einfach, sich den Teenager Elis im Gespräch mit einem angehenden Literaturwissenschaftler vorzustellen, aber sein Sohn nickte.
»Ich hätte nicht gedacht, dass dir Céline gefällt«, sagte Martin und schlug die Zeitung wieder auf.
»Doch, der ist richtig gut.«
»Aber wenn ich mich recht entsinne, hast du einmal gesagt, die Reise ans Ende der Nacht sei ›etwas zu langsam‹ für dich.«
Elis blickte mit einem Ausdruck von Verärgerung und ehrlicher Verwirrung auf. »Was meinst du?«
Martin wollte seinen Sohn darüber aufklären, dass er ihm den Roman in seiner Eigenschaft als wohlmeinender und an der intellektuellen Entwicklung seines Sohns interessierter Vater zu dessen sechzehntem Geburtstag überreicht hatte. Ein paar Seiten hatte Elis gelesen und dann sein Urteil gefällt. Vielleicht, hatte er hinzugesetzt, müsste er für diese Art Bücher erst noch etwas älter werden. »So dreißig etwa.« Und wenn Elis einmal in sein Zimmer ginge und auf dem gottvergessenen, unter der Decke umlaufenden Regalbord gründlich nachsähe, würde er das Buch dort finden. Die schwedische Erstausgabe von 1971 (erschienen bei Gebers), mit einer Widmung auf dem Vorsatzblatt.
»Ach, nichts«, sagte er stattdessen.
Elis hob die Augenbrauen und las weiter.
Der neue, Céline lesende Elis schien den alten, Céline ablehnenden Elis praktisch über Nacht ersetzt zu haben. Plötzlich lief sein Sohn in einer fusseligen Strickjacke aus dem Secondhandladen herum und ließ die Haare zu dem lockigen Strahlenkranz wachsen, zu dem sie von Natur aus strebten. Durch seine geschlossene Tür drang eines Tages tatsächlich die vibrierende Stimme von Jacques Brel. Auf seinem Spotify-Account tauchten neue Playlists auf mit Namen wie Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, France Gall oder Juliette Gréco. Alle mit schwankendem Grammofonton, der spröde Sound von Paris im Herbst und Boulevards mit gelb werdenden Platanen.
Trotz allem ließ Elis nicht die geringste Bereitschaft erkennen, auf den Fundus väterlicher Kenntnisse über tote, europäische, männliche Autoren zurückzugreifen. Elis tat so, als sei er der erste Mensch, der den Fremden las, als sei Der Fremde eine coole neue Rockband, und ältere Generationen im Allgemeinen wie Martin im Besonderen sollten sich bloß nicht lächerlich machen, indem sie so taten, als ob sie davon Ahnung hätten. (Martin verspürte Lust, ihn zu fragen, ob er wisse, wie es zu dem Songtitel Killing an Arab gekommen sei; aber es stand zu bezweifeln, ob Elis überhaupt jemals The Cure gehört hatte.)
Die Ironie des Ganzen bestand darin, dass Michel, auf den sich Elis berief wie auf eine Art mythisches Wesen, den Jungen haargenau auf das Gleis gesetzt hatte, auf das Martin ihn selbst hatte setzen wollen. Elis hatte gescheut und gebockt und war in seinem Ausweichen im Kreis gelaufen, bis er wieder am Ausgangspunkt stand. Er hatte den Ziegelstein von Reise ans Ende der Nacht aus Michels Händen nur entgegengenommen, weil es Michels Hände waren.
Martin beobachtete seinen Sohn, wie er sich durch Céline kämpfte, wie er dazu überging, Hosenträger und Westen zu tragen, mit vor Konzentration herabhängender Unterlippe seine Französischhausaufgaben zu machen … und das Rauchen anfing. Das fand er nicht mehr so rührend.
»Das sind nicht meine«, behauptete Elis, als er mit einem Päckchen Marlboro Lights konfrontiert wurde, das Martin in einer Jackentasche gefunden hatte. »Die gehören Oskar. Er kann sie nicht bei sich zu Hause aufbewahren, weil seine Mutter sich aufführt wie die Gestapo und seine Sachen durchwühlt. Wie anscheinend auch gewisse andere Eltern.«
»Du weißt, was wir dazu vereinbart hatten.«
»Aber es sind ja nicht meine! Du kannst Oskar fragen. Hier, ruf an! Frag ihn selbst! Aber sag seiner Mutter nichts! Dann bezahlt sie seinen Führerschein nicht mehr.«
Martin sah Elis an, dann das Handy, das er ihm hinhielt, dann wieder Elis.
»Das ist Oskars Sache«, sagte er schließlich. »Hauptsache, du denkst an unsere Abmachung.«
»Bevor ich achtzehn werde, darf ich nicht saufen, nicht rauchen, nicht kiffen, mir kein Tattoo stechen lassen und nicht Motorrad fahren«, leierte Elis herunter und hielt die Augen halb geschlossen wie ein Prüfling, während er diese fünf Gebote an den Fingern einer Hand abzählte.
»Exakt. Mit achtzehn wirst du volljährig, und dann habe ich leider nicht mehr das Recht, dir etwas vorzuschreiben. Ich kann nur hoffen, dass dein Vermögen, Risiken zu beurteilen, bis dahin einigermaßen entwickelt sein wird.«
»Du bist ja gestört.«
Und er hatte gedacht: Es muss Regeln geben. Es soll nur keiner kommen und behaupten, sie hätten bei mir tun und lassen dürfen, was sie wollten. Ich hätte nicht auf sie achtgegeben.
Wenn die jungen Leute ab und zu eine qualmten, wenn sie sich die komplette Baskenmützen-Melancholie-und-Zigaretten-Nummer gaben, war das vielleicht nicht wirklich gefährlich. (»Nun lass mal gut sein«, stöhnte Gustav.) Martin hatte selbst als Teenager das Rauchen angefangen, wovon ihn seine Eltern nicht einmal abzuhalten versucht hatten. (»Herrgott, das war in den Siebzigern«, sagte Gustav, »das gelobte Dezennium der ewig glühenden Kippen.«) Er hatte gequalmt, bis ihm aufging, dass er bald vierzig wurde. Eine von den Einsichten, die einem in zwei Etappen kommen: erst die rationale Erkenntnis, dann der emotionale Schlag mit dem Vorschlaghammer. Seine Kondition war zu nicht vorhanden geschrumpft. Er hatte erwogen, sich einen Bart stehen zu lassen. Dann hatte er sich selbst am Kragen gepackt und mit dem Rauchen aufgehört, ein auf ganzer Linie betrüblicher und quälender Prozess. An sich gab es keinen Grund, sich vor solchen quälenden Prozessen zu fürchten, aber je trauriger und quälender sie verliefen, desto größer wurde das Risiko, dass am Ende doch kein Aufhören stand. Der einzige Mensch, den Martin jemals auf die hundertprozentige, unerbittlich konsequente Art mit dem Rauchen aufhören sah, ohne schwanger, lungenkrank oder durch sonst was gezwungen zu sein, war Cecilia.
Aus Martins Sicht bestand das große Problem darin, dass Jugendliche ihre Sterblichkeit nicht begriffen. Sie lebten in der Illusion, alle Zeit der Welt zu haben und dass ihnen nichts zustoßen könne. Dass sich das Leben wie ein endloser roter Teppich vor ihnen ausrollen werde: Willkommen! Wir haben nur auf dich gewartet. Blitzlichtgewitter, Applaus. Tatsächlich aber war die Zigarette ein kleiner Tod, eine Mahnung an den irgendwann kommenden großen Tod; doch weil sie den Begriff TOD nicht in ihre hormonstrotzenden Hirne bekamen, viel zu ausschließlich ausgerichtet auf Fortpflanzung, um sich eine Vorstellung von ihrem absoluten Gegenpol machen zu können, dem einsamen, gleichgültigen Tod, verstanden sie die dem Tabak innewohnende zerstörerische Kraft nicht, ebenso wenig wie sie begriffen, dass Alkohol und Drogen eine Art physischer Manifestationen des körperlichen Verfalls darstellten, der nur auf eine Art enden konnte. Sie waren dumm genug, das unbekümmerte Rauchen, Saufen und Kiffen mit Leben zu verwechseln. Sie bildeten Generationen über Generationen kleiner James Deans, die auf einen Abgrund zurasten und glaubten, das bedeute zu leben, obwohl sie in Wirklichkeit nur ein Bremspedal vom Sterben entfernt waren.
Es war derselbe Mangel an Differenzierung und Überlegung, der auch hinter der Modeerscheinung des Tätowierens steckte. Was war eigentlich der Witz daran, seinen Körper auf immer und ewig zu brandmarken? Es stellte sich die Frage, ob die überlegt angebrachten Tattoos nicht schlimmer waren als die unüberlegt gestochenen und vorfabrizierten Motive wie alberne Schmetterlinge oder chinesische Schriftzeichen. Spontane Idiotie war leichter zu entschuldigen als die Überzeugung, zu einem gewissen Zeitpunkt etwas so Wichtiges zu wissen, dass man es sich für eine ältere Version des eigenen Ichs unbedingt in die Haut gravieren lassen musste. Junge Menschen waren meist davon überzeugt, dass sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt klüger und erfahrener seien als je zuvor, was sicherlich manchmal auch zutreffen mochte. Sie machten sich jedoch mit all ihrer Klugheit und Erfahrung selten klar, dass dieser Glaube konstant bestand und sie sich somit ständig selbst widerlegten.
An die Wand über dem Kopfende seines Betts hatte Elis ein Foto gepinnt. Cecilia lag auf dem Sofa auf dem Rücken und las Zeitung. Ein Säugling lag auf ihrer Brust, und sie hielt die Zeitung so, dass sie ein Dach bildete. Ihr Gesicht war der Kamera zugewandt, und ihr Blick leuchtete.
Nur war das Baby auf dem Bild nicht Elis, dachte Martin. Jenes Sofa hatten sie ’89 ausrangiert. Das Neugeborene musste Rakel sein.
Martin betrachtete Cecilias Gesicht in Schwarz-Weiß. Sie sah aus, als wollte sie gerade etwas sagen.
Er stand auf und ließ die Tür exakt so weit offen, wie er sie vorgefunden hatte.
Er könnte Gustav in Stockholm anrufen. Es bestand ja durchaus die Möglichkeit, nach Stockholm zu fahren. Er könnte eine Fahrkarte buchen, vielleicht für morgen früh, sich in den Zug setzen und Sonntagabend zurückkommen. Oder, Teufel noch mal, er könnte auch gleich bis Montag bleiben. Sie könnten ausgehen, irgendwo was essen, ein paar Bier trinken und quatschen. Die Luft wäre dort klarer und kälter.
Gustav ging nicht ans Telefon, aber es war Freitagabend, er war wohl ausgegangen. Ein Handy besaß er nicht. Martin hinterließ eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Danach blieb er am Fenster stehen und blickte über die dunklen Straßen und den Park.
GRUNDSTUDIUM 1
INTERVIEWER [räuspert sich]: So, ich freue mich auf das Gespräch mit Martin Berg. Martin, wann hast du dich für eine literarische Laufbahn entschieden?
MARTIN BERG [lehnt sich zurück und umfasst mit gefalteten Händen das Knie]: Oh, nun, das war nicht unbedingt etwas, für das ich mich entschieden hätte. Es war eher etwas, das ich schon immer gewusst habe. Es muss wohl auch in meiner Kindheit eine Phase gegeben haben, in der ich Feuerwehrmann werden wollte oder so, doch davon abgesehen kommt es mir so vor, als sei es schon immer die einzige Option für mich gewesen. Als hätte ich nie eine Wahl gehabt.
INTERVIEWER: Es war also so etwas wie Schicksal?
MARTIN BERG: Ja, so kann man es nennen.
Martin Berg war in einem ereignisreichen Jahr zur Welt gekommen. Europa war durch einen Eisernen Vorhang geteilt. Marilyn Monroe starb mit Barbituraten im Blut in ihrem Bett. In Jerusalem wurde Eichmann gehängt. Die Sowjets veranstalteten Atombombenversuche auf Nowaja Semlja. An einem Küchentisch in der Kennedygatan saß die junge Bibliothekarin Birgitta Berg und las in der Morgenzeitung von der Kubakrise, während die Asche an der Spitze ihrer Zigarette wuchs und wuchs.
Doch auch in jenem Jahr wurde niemand in einem Atomkrieg umgebracht. Stattdessen erlangte eine Reihe von Staaten die Unabhängigkeit, als die Kolonialmächte den Griff um ihre Protektorate lockerten. In den Diskotheken wanden sich schwitzende Teenager rhythmisch in einer neuen Art von Tanz. Astronauten wurden in Umlaufbahnen geschossen, denn wenn man sich schon nicht gegenseitig in Grund und Boden bombardierte, konnte man wenigstens einen Wettlauf um die Vorherrschaft im All veranstalten.
In Göteborg wuchsen neue Stadtteile aus dem Boden, wo vorher Wälder und Wiesen gelegen hatten. Es staubte und dröhnte von Abrissen und Neubauten, es hallte und knallte auf den Werften, vor dem Himmel zeichnete sich ein Wirrwarr von Kränen ab. Große Frachter, umgeben von Schleppern, liefen aus dem Hafen aus, um ihre Fahrt über die Weltmeere anzutreten.
Als ihr Sohn zu weinen begann, zuckte Brigitta zusammen, als ob sie für ein Weilchen vergessen hätte, dass es ihn gab.
Martins Vater hieß Albert, aber der Name stand lediglich auf den Briefumschlägen von Behörden oder in seinem Seefahrtsbuch. Er war ein mittelgroßer, schlanker Mann mit dunklen Haaren und Augen, der Oberkörper voller Tätowierungen, die mit den Jahren die blaugrüne Farbe des Meeres angenommen hatten. Abbes Vater hatte als Nieter auf der Werft von Götaverken gearbeitet und war gestorben, als er einen Eisenträger an den Kopf bekam. »Ein nüchterner Kerl wär schlau genug gewesen, zur Seite zu springen«, war das Einzige, was seine Mutter dazu gesagt hatte. Sie blieb alleinstehende Versorgerin der Familie, und mit fünfzehn ging Abbe zur See. Nach einigen Gelegenheitsjobs erhielt er eine Anstellung bei der Reederei Transatlantic.
Abbe war ein ruhiger Zeitgenosse, der sich bei lauteren Veranstaltungen lieber am Rand hielt, wo er Kreuzworträtsel löste und eine Prise nahm. Mit Brettspielen kannte er sich aus und war ein anerkannt guter Schachspieler. Beim Pokern gewann er häufig, schien sich aus dem Ausgang einer Partie aber nichts zu machen. Bücher las er selten, doch stets die Tageszeitungen. Wenn etwas übersetzt oder auf Englisch, Französisch, Niederländisch oder Deutsch formuliert werden musste, rief man ihn. Sprachen lagen ihm genauso gut wie das Hantieren mit Schraubenzieher oder Engländer.
Eines Abends gegen Ende der Fünfzigerjahre lernte er auf Lisebergs Tanzboden Birgitta Eriksson kennen.
Die Begegnung, die der Auftakt zu Martins Existenz war, hatte dermaßen viel Zufälliges an sich – es war eins der seltenen Male, dass Abbe jemanden zum Tanzen aufforderte und Birgitta sich auffordern ließ –, dass Martin später nicht ohne Zittern und Beben daran zu denken vermochte. Sie hätten ihre Lebenswege ebenso gut in ganz verschiedene Richtungen fortsetzen können. Es hätte alles Mögliche aus ihnen werden können, aber sie wurden ein Paar.
Auf den Fotografien aus der damaligen Zeit besaß Birgitta eine vage Ähnlichkeit mit Esther Williams. Sie war niedlich auf eine adrette Art, blickte nie kokett über die Schulter, strahlte nicht wie ein Filmstar. Stattdessen hatte ihr Ausdruck etwas leicht Abwesendes, als ob sie in Gedanken woanders sei und in das, was gerade vor sich ging (das Fotografieren), nur zufällig hineingeraten sei. Auf dem gerahmten Hochzeitsfoto, das auf einer Kommode im Fernsehzimmer verstaubte, hielt sie einen Strauß Rosen im Arm, als wüsste sie nicht, was sie damit anfangen solle. Abbe guckte in dem geliehenen Anzug und dem Hemdkragen, der den Hals abschnürte, etwas betreten aus der Wäsche.
Abbe zeigte Martin auf dem Globus, den er mit sieben zu Weihnachten bekam, einmal die Städte, die er schon besucht hatte: Antwerpen, Le Havre, New York, Rio de Janeiro. Beunruhigend viel Wasser erstreckte sich zwischen dem kleinen Punkt, der Göteborg darstellen sollte, und dem jeweils größeren Viereck des Zielorts. Martins Mutter nahm den Jungen mit zum Hafen, um zuzusehen, wie Vaters Frachter auslief, und er war gigantisch, so groß, dass Martin vollkommen sicher war, er würde mit der neuen Brücke kollidieren. Entsetzen überlief ihn kalt, und dass seine Mutter so ruhig blieb, machte es nur noch schlimmer. Doch dann glitten die Schornsteine vollkommen reibungslos unter der Brücke hindurch, Martin atmete auf und protestierte nicht einmal, als seine Mutter ihn an die Hand nahm, um nach Hause zu gehen.
Das Wort »Atlantik« hatte einen Doppelklang von Gefahr und Abenteuer, während sich »Stiller Ozean« schon freundlicher anhörte. Die Nordsee musste kalt und stürmisch sein, andererseits war sie näher und sah auf dem Globus auch hinreichend klein aus, um stets Land in der Nähe zu haben. Die Größe des Schiffs wirkte ebenfalls beruhigend, bis Tante Maud im Glauben, ihr Neffe fände Gefallen an einer »spannenden Geschichte aus dem wirklichen Leben«, von der Titanic erzählte. Danach lag Martin abends wach im Bett, dachte über Eisberge und Havarien nach und darüber, wie schnell selbst große Schiffe von der Tiefe verschlungen werden konnten. Tausende von Metern konnten sie sinken, bis auf den Meeresgrund, den kein Tageslicht mehr erreichte.
Doch dann ertönten im Flur die schweren Schritte und die Stimme, die tiefer klang als jede andere im Haus, und das Klimpern von Münzen, die aus Taschen auf die Kommode geleert wurden. (Hatte man Glück, dann fanden sich unter dem ganzen Kleingeld in falschen Größen und mit Löchern in der Mitte auch ein paar Einkronenmünzen.) Darauf folgten ein oder zwei Wochen der Anwesenheit von Abbe. Nie polterte er mit erhobener Stimme, er wurde überhaupt selten böse, aber trotzdem spielte man vorsichtiger, wenn er da war. Mit der Zeitung und einem Bier saß er auf der Hollywoodschaukel. Martin beobachtete ihn durch einen Spalt im Gebüsch am hinteren Ende des Gartens, wo es eine Höhle aus Ästen und Zweigen gab, die gerade groß genug für einen kleinen Jungen war.
So lagen die Dinge für lange Zeit: Mama und Martin, dazu ein Papa, der manchmal auftauchte, aber auch immer wieder verschwand. Martin spielte mit den Kindern in der Nachbarschaft, lernte lesen, bekam jeden Tag eine warme Mahlzeit, bekam vor dem Zubettgehen noch eine Gutenachtgeschichte vorgelesen, auch wenn seine Mutter etwas eigenwillige Vorstellungen davon hatte, was unter diese Gattung fiel. So hatte er einmal mehrere Nächte nacheinander Albträume, in denen er wie Gregor Samsa in ein Insekt verwandelt wurde, und er grübelte lange, was eigentlich falsch war an Mrs Dubose.
Dann fing Mama an, sich irgendwie unbeholfen zu bewegen, und zog so weite Kleider an, dass man sie kaum wiedererkannte. Eines Abends erklärte Papa, er werde von jetzt an in einer Druckerei arbeiten und jeden Tag von der Arbeit nach Hause kommen. Mama erklärte Martin, er werde ein Geschwisterchen bekommen. Er stocherte in seinem Rübenmus. An einem Samstag erschien Tante Maud, um auf ihn aufzupassen.
»Sie kommen bald mit deiner Schwester nach Hause«, verkündete sie und beugte sich aus ihrer Unheil verheißenden Höhe zu ihm hinab.
Kristina oder Kicki, wie sie von allen genannt wurde, war zuerst uninteressant und später, als sie größer wurde, vor allem nervig. Erst hing sie immer an seinem Rockzipfel, dann wurde sie zu einem lauten Gör, das mit eckigen Bewegungen herumstolzierte, stundenlang Himmel und Hölle spielte, Seilchen sprang, beim Gummitwist gewann und mit Kaugummi phänomenale Blasen machen konnte. Sie maulte und zeterte, um sich vor den Hausaufgaben zu drücken, hüpfte aber mühelos über Bock und Kasten, beherrschte Ringe und Sprossenwand souverän und konnte stundenlang Tanzschritte einstudieren. Sie behauptete, Martin sei eine Schlaftablette, versteckte sich aber in seinem Schrank, wenn er Freunde zu Besuch hatte, und rannte kreischend davon, wenn sie entdeckt wurde. Ihre Mutter Birgitta erklärte immer wieder, sie habe sie beide gleich lieb, aber Martin fragte sich, ob das wirklich ganz stimmte. Denn sie und Kicki waren so verschieden; seine Schwester kam eigentlich mehr nach Tante Maud.
Ihre Mutter war die Einzige in der Familie, die sich Bildung über die Volksschule hinaus verschafft hatte. Was das genau bedeutete, wusste Martin nicht, aber es unterschied sie irgendwie von Maud, einer Büroangestellten mit kratziger Stimme und Lippenstiftflecken auf den Zähnen, und von ihren Eltern, die immer in der Weihnachtszeit mit kryptischen, spitzen Bemerkungen bei ihnen aufschlugen, bevor sie beide innerhalb eines Jahres starben. Mama weinte nicht bei der Beerdigung (im Gegensatz zu Tante Maud, die laut schluchzte), sondern betrachtete mit leicht gerunzelter Stirn die bunten Kirchenfenster.
Jede Woche suchten sie die Bibliothek auf, aßen Plätzchen mit Mamas Kolleginnen und kehrten mit einem Stapel Bücher nach Hause zurück. Mama legte ihre ordentlich auf dem Nachttisch ab. Wenn Martin aus der Schule kam, saß sie oft lesend am Küchentisch, eine Tasse mit kalt werdendem Kaffee und einen Aschenbecher neben sich. Wenn Martin in der Tür erschien, zuckte sie zusammen, sortierte ihre Züge zu einem Lächeln, legte das Buch beiseite und richtete eine Kleinigkeit zu essen her.
Birgitta Berg bewältigte alle Anforderungen, die das Leben stellte, mit neutraler Sachlichkeit und ohne auffällige Besonderheit in irgendeiner Richtung. Selten regte sie sich auf, niemals hörte Martin seine Eltern streiten. Nur einige wenige Male erlebte er sie verblüfft; einer dieser Anlässe ergab sich, als er mit zwölf oder dreizehn einen Schulaufsatz nach Hause brachte. Das Thema lautete »Meine Sommerferien«, und Martin hatte über ihre alljährlichen Ferien auf dem Segelboot geschrieben, die für ihn gewöhnlich eine echte Prüfung darstellten. Er hatte ihr den Aufsatz nicht zeigen wollen, ihn dann aber zusammen mit seinen Matheaufgaben auf dem Küchentisch liegen gelassen.
»Das hier ist sehr gut geschrieben«, sagte seine Mutter mit einem Gesichtsausdruck, den sie sonst fast nie hatte. »Wirklich sehr gut.«
Die Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger vergessend, las sie weiter, ohne den Blick noch ein einziges Mal vom Papier zu heben.
INTERVIEWER: Also, wie hat es angefangen?
MARTIN BERG





























