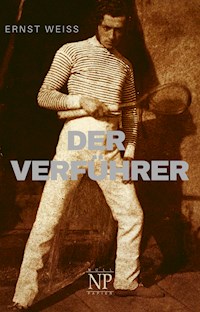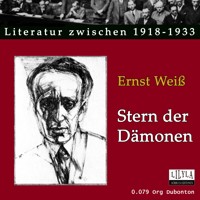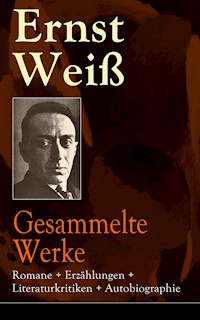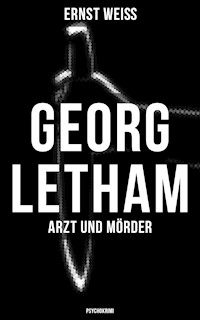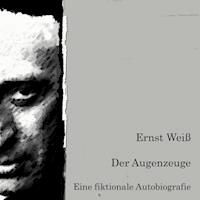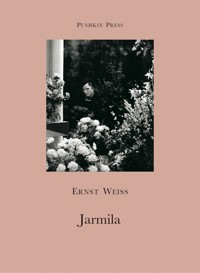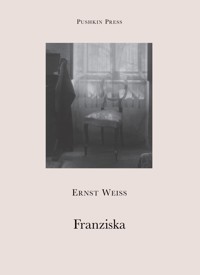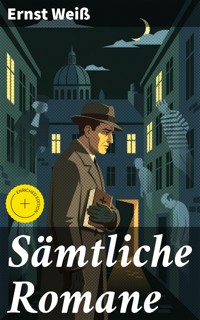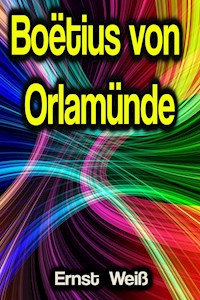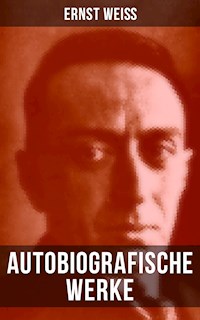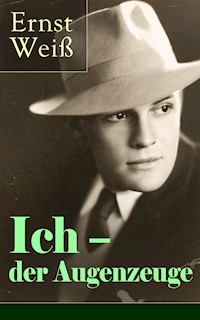1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die "Gesammelten Werke" von Ernst Weiß vereinen ein facettenreiches Schaffen, das Romane, Erzählungen, Literaturkritiken und seine Autobiographie umfasst. Weiß, ein prägendes Mitglied der literarischen Bewegung der Moderne, vereint in seinem Werk eine dichte, oft melancholische Prosa mit tiefen psychologischen Einblicken. Seine Texte reflektieren das Aufeinandertreffen von Individuum und Gesellschaft, insbesondere im Kontext der politischen und kulturellen Umwälzungen des frühen 20. Jahrhunderts, sodass sie sowohl zur Unterhaltung als auch zur intellektuellen Auseinandersetzung anregen. Ernst Weiß, geboren 1882 in Prag, war nicht nur ein Schriftsteller, sondern auch ein scharfsinniger Beobachter der menschlichen Natur. Er lebte in einer Zeit des Wandels, das einstige Habsburgische Reich hinter sich lassend, vermischte sich in der Kulturszene Mitteleuropas und erlebte direkt die Spannungen und Herausforderungen seiner Zeit. Diese Erfahrungen und sein vielfältiger literarischer Einfluss manifestierten sich in seinen Arbeiten und verleihen ihnen eine authentische Stimme. Die "Gesammelten Werke" sind ein unverzichtbares Kompendium für alle, die die deutsche Literatur und ihre Entwicklung im 20. Jahrhundert verstehen möchten. Weißs einfühlsame Erzählweise und differenzierten Perspektiven machen diese Lektüre zu einem bereichernden Erlebnis, das sowohl literarisch als auch historisch beeindruckt. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine umfassende Einführung skizziert die verbindenden Merkmale, Themen oder stilistischen Entwicklungen dieser ausgewählten Werke. - Ein Abschnitt zum historischen Kontext verortet die Werke in ihrer Epoche – soziale Strömungen, kulturelle Trends und Schlüsselerlebnisse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen. - Eine knappe Synopsis (Auswahl) gibt einen zugänglichen Überblick über die enthaltenen Texte und hilft dabei, Handlungsverläufe und Hauptideen zu erfassen, ohne wichtige Wendepunkte zu verraten. - Eine vereinheitlichende Analyse untersucht wiederkehrende Motive und charakteristische Stilmittel in der Sammlung, verbindet die Erzählungen miteinander und beleuchtet zugleich die individuellen Stärken der einzelnen Werke. - Reflexionsfragen regen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der übergreifenden Botschaft des Autors an und laden dazu ein, Bezüge zwischen den verschiedenen Texten herzustellen sowie sie in einen modernen Kontext zu setzen. - Abschließend fassen unsere handverlesenen unvergesslichen Zitate zentrale Aussagen und Wendepunkte zusammen und verdeutlichen so die Kernthemen der gesamten Sammlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gesammelte Werke: Romane + Erzählungen + Literaturkritiken + Autobiographie
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Diese Ausgabe versammelt unter dem Titel Gesammelte Werke: Romane + Erzählungen + Literaturkritiken + Autobiographie das erzählerische und essayistische Hauptwerk von Ernst Weiß. Ziel ist es, die zentralen Texte in verlässlicher Ordnung bereitzustellen und in ihrer ganzen Spannweite erkennbar zu machen: von frühen Experimenten bis zum späten Prosawerk, flankiert von kritischen Schriften. Die Edition ist als Lesebuch und als Arbeitsgrundlage konzipiert; sie respektiert die Eigenständigkeit der einzelnen Genres und macht zugleich Entwicklungsfäden sichtbar. Anstelle einer musealen Gesamtausgabe bietet sie eine konzentrierte Zusammenführung der maßgeblichen Texte, die die innere Logik dieses Œuvres nachvollziehbar und intertextuell erfahrbar macht.
Im Zentrum stehen die Romane, die als fortlaufendes Labor des Erzählens erscheinen. Titel wie Die Galeere, Franziska, Die Feuerprobe, Boëtius von Orlamünde, Georg Letham, Der Gefängnisarzt oder Die Vaterlosen, Der arme Verschwender, Der Verführer und Ich – der Augenzeuge markieren eine Entwicklung, in der sich psychologische Genauigkeit, moralische Zuspitzung und formale Strenge verbinden. Wiederkehrend sind Konstellationen von Prüfung, Beruf und Gewissen, Figuren im Konflikt mit sich und ihrer Zeit sowie Erzählhaltungen, die Nähe und Distanz kunstvoll austarieren. Die Romane bilden so den Kern einer Prosa, die Erfahrungswissen, analytische Schärfe und erzählerische Spannung bündelt.
Die Erzählungen treten dazu als dichtes Komplement. Stücke wie Dämonenzug, Atua, Legende einer Mutter, Südseelegende, Panik auf einem Schiff, Die Messe von Roudnice oder Die Verdorrten zeigen Weiß’ Sinn für Verdichtung, Variation und formale Versuchsanordnungen. In der kurzen Form entfalten sich Parabel, Legende, Fallgeschichte und Momentaufnahme; Schauplätze wechseln zwischen städtischer Enge, klinischer Observanz und weltläufigen Horizonten. Die Figuren wirken wie Brennpunkte eines psychischen und sozialen Klimas, das in wenigen Strichen erfasst wird. Diese Prosa erprobt Perspektiven, Stimmen und Tempi und erlaubt Einsichten, die den großen Romanen motivisch und gedanklich zur Seite stehen.
Die literaturkritischen und essayistischen Texte erweitern das Bild um Reflexion, Dialog und Standortbestimmung. Beiträge zu Goethe, Kleist, Balzac, Flaubert und Maupassant stehen neben Betrachtungen zu Heine, Conrad, Jack London, Cervantes, Rousseau oder Daumier. Aufsätze wie Der neue Roman, Die Kunst des Erzählens, Der Krieg in der Literatur, Die Jugend im Roman oder Der Vorwurf in der Kunst verhandeln Poetik, Ethik und Gattungsfragen. Andere Stücke greifen kultur- und wissensgeschichtliche Themen auf, etwa in Ernest Shackleton, James Watt, der Schöpfer des Industriezeitalters oder Recentissime oder die Zeitung als Kunstwerk. So entsteht ein Panorama der Lektüren und Denkwege, die das erzählerische Werk mitprägen.
Die Sammlung wird durch autobiographische Elemente gerahmt, die Werdegang und Selbstverständnis von Ernst Weiß erhellen, ohne die Grenzen zwischen Leben und Dichtung zu verwischen. Selbstreflexive Passagen, Skizzen und programmatische Notate machen sichtbar, wie eng biographische Erfahrung, Berufserfahrung und poetisches Verfahren miteinander korrespondieren. Die Edition verzichtet auf Sensation und ordnet solche Stimmen behutsam neben die großen Texte, sodass sich ein Bild des Schreibens aus der Nahsicht ergibt: die Entstehung von Motiven, die Veränderung von Tonlagen, die Präzisierung eines Ethos des Erzählens. Autobiographisches fungiert hier als Resonanzraum, nicht als Schlüsselroman-Register.
Was diese Werke verbindet, ist der unerschrockene Blick auf Gewissen, Körper und Macht sowie ein Stil, der Beobachtung, Diagnose und dramatische Verdichtung vereint. Oft stehen Fachwissen, methodische Nüchternheit und existenzielle Dringlichkeit in produktiver Spannung: das Analytische schärft den Sinn für Leid, das Empirische prüft die Sprache. Wiederkehrende Themen sind Verantwortung und Versuchung, Identität und Maskerade, die Verletzlichkeit des Einzelnen und die Härten der Moderne. Weiß kombiniert realistische Genauigkeit mit parabelhafter Überhöhung, variiert Ich-Nähe und sachliche Distanz und entwickelt eine Prosa, die Erkenntnis sucht, ohne didaktisch zu werden, und Intensität erzeugt, ohne zu effekthascherisch zu sein.
Als Gesamtheit bleibt dieses Œuvre bedeutsam, weil es die moralischen und intellektuellen Belastungsproben einer Epoche exemplarisch durchspielt und Fragen formuliert, die weiterhin fortwirken: nach der Verantwortung des Wissens, der Autorität von Institutionen, der Belastbarkeit von Sprache angesichts von Krisen. Die Romane, Erzählungen und Essays treten miteinander in Dialog und schärfen das Verständnis für die Werkpolitik eines Autors, der die Mittel der Literatur als Prüfapparat des Selbsterkennens nutzt. Diese Edition lädt dazu ein, Weiß als vielseitigen Erzähler und wachen Beobachter zu lesen, dessen Texte durch Klarheit, Haltung und formale Konsequenz auch heute Orientierung bieten.
Historischer Kontext
Ernst Weiß wurde 1882 in Brünn (Brno) in Mähren, damals Österreich-Ungarn, geboren und gehörte der deutschsprachigen jüdischen Minderheit an. Er studierte Medizin an der Deutschen Universität in Prag und wurde Chirurg, bevor er sich als Schriftsteller etablierte. Seine Doppelrolle als Arzt und Autor wurzelt im Umbruch der Jahrhundertwende: Wilhelm Röntgens Entdeckung der X-Strahlen (1895), Robert Kochs und Paul Ehrlichs Bakteriologie sowie Sigmund Freuds Deutung der Träume (1900) prägten ein neues Verständnis von Körper, Psyche und Gesellschaft. Diese wissenschaftlichen Revolutionen bildeten den intellektuellen Hintergrund für eine Prosa, die Beobachtung, Diagnose und ethische Selbstprüfung miteinander verschränkt.
Vor dem Ersten Weltkrieg arbeitete Weiß zeitweise als Schiffsarzt, ausgehend von Triest, dem Hafen Österreich-Ungarns, dessen Linien des Österreichischen Lloyd das Mittelmeer und den Indischen Ozean verbanden. Stationen wie Alexandria, Port Said oder Bombay standen für eine vernetzte, von Kolonialverwaltungen, Quarantäneregeln und Migration geprägte Moderne. Medizinische Notfälle an Bord, Tropenkrankheiten und die Begegnung mit fremden Kulturen verschärften seinen Blick für Vulnerabilität und Machtasymmetrien. Die maritime und globale Erfahrung speiste Motive von Reise, Fremdheit und Grenzüberschreitung, die in Erzählungen und Essays ebenso präsent wurden wie in Romanen, und sie verband sich mit einem ethnographischen Interesse, das stets moralische Fragen mitschwingen ließ.
Der Krieg von 1914 bis 1918 traf Weiß als Militärarzt an Operations- und Verbandsplätzen des Habsburgerreichs. Verwundungen durch Granatsplitter, Gasangriffe, Typhuswellen und die Spanische Grippe von 1918 konfrontierten ihn mit massenhaftem Leid und mit den Ambivalenzen ärztlicher Verantwortung zwischen Triage, Gehorsam und Mitleid. Der Zusammenbruch der Monarchie und die Gründung der Tschechoslowakei 1918 veränderten Zugehörigkeiten und erschütterten die Loyalitäten deutschsprachiger Juden in Böhmen und Mähren. Aus dieser Erfahrung von Staatszerfall, Lagerdisziplin und Verwaltungsgewalt erwuchs eine Sensibilität für Schuld, Schicksal und Entscheidung, die seine narrative Ethik, seine Figurenpsychologie und seine spätere politische Aufmerksamkeit grundierte.
Das Prager deutschsprachige Milieu, mit dem Café Arco als Knotenpunkt, verband Weiß mit Autoren wie Franz Kafka, Max Brod und Franz Werfel; in Wien standen Arthur Schnitzler und Karl Kraus für eine medizinisch-psychologische und sprachkritische Moderne. Die Auseinandersetzung mit Dostojewskij, Flaubert und Maupassant sowie mit Freud und der Kriminalanthropologie (Cesare Lombroso, Hans Gross) schärfte sein Interesse am Fall, am Protokoll, an der Tat und ihrem inneren Motiv. So entstanden Erzählformen, die zwischen Expressionismus und heraufziehender Neuer Sachlichkeit oszillieren: genau, nüchtern, zugleich von Visionen und Albträumen durchsetzt, und bereit, Recht, Schuld und Krankheit in erzählerische Versuchsanordnungen zu überführen.
In der Weimarer Republik (1919–1933) lebte Weiß zeitweise in Berlin, einem Labor der Moderne mit UFA-Studios, Neonlichtern und einer expandierenden Presse. Das Feuilleton der Vossischen Zeitung oder des Berliner Tageblatts verband Reportage, Kunstkritik und gesellschaftliche Diagnose; filmische Verfahren der Montage prägten den Blick. Theaterreformen um Max Reinhardt und Erwin Piscator sowie die sachliche Kühle der Neuen Sachlichkeit boten ästhetische Modelle, auf die Weiß in Essays über den neuen Roman, die Ruhe in der Kunst, Lebensfragen des Theaters und den Film reagierte. Die Spannung zwischen Massenmedien, aktueller Politik und klassischer Tradition wurde zum Experimentierfeld seiner poetologischen Reflexion.
Die sozialen Erschütterungen der Zwischenkriegszeit – Hyperinflation 1923, Stabilisierung und dann der Börsenkrach von 1929 mit Massenarbeitslosigkeit – verschoben die Koordinaten des Lebens. Debatten um Eugenik, Forensik, Todesstrafe und soziale Hygiene stellten den Arzt ebenso wie den Schriftsteller vor normative Konflikte. Weiß reagierte darauf mit Essays zu Ordnung und Gerechtigkeit, Frieden, Erziehung und Politik, zur Jugend im Roman und zur Aktualität und entwarf Figuren- und Erzählanordnungen, in denen Autorität, Angst und Verführung zusammenstoßen. Eine Sprache der Präzision, geschult an Diagnostik und Protokoll, verband sich mit Skepsis gegenüber Heilslehren und einem wachen Gespür für die Rhetorik der Macht.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933, den Bücherverbrennungen vom 10. Mai und der Gleichschaltung der Kultur sah sich Weiß als jüdischer Autor zur Emigration gezwungen; Paris wurde sein wichtiger Exilort. Im Kreis anderer Emigranten – etwa Heinrich Mann, Joseph Roth oder Lion Feuchtwanger – entstanden Texte, die Terror, Propaganda und Selbstentfremdung analysierten. Der Anschluss Österreichs am 12. März 1938, das Münchner Abkommen im September 1938 und die Okkupation Prags am 15. März 1939 verschärften die Verzweiflung. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Paris am 14. Juni 1940 nahm Weiß sich am 15. Juni 1940 das Leben. Sein Spätwerk atmet die Logik des Zeugnisses.
Quer durch Romane, Erzählungen, Kritiken und autobiographische Notate verknüpfte Weiß die europäische Tradition mit der krisenhaften Gegenwart. Essays zu Goethe, Kleist, Heine, Balzac, Cervantes, Rousseau, Stifter, Conrad, Jack London und Albert Ehrenstein vermessen einen Kanon, der Realismus, Abenteuer, Ironie und moralische Strenge vereint. Beiträge über James Watt, Shackleton, den Krieg in der Literatur und den Genius der Grammatik zeigen das Interesse an Technik, Erkundung, Sprache und Darstellung. Stadttexte wie Prag erinnern an kulturelle Herkunft. So bildet sein Gesamtwerk ein Panorama der mitteleuropäischen Moderne, in dem medizinische Rationalität, poetische Form und politische Erfahrung unlösbar ineinandergreifen.
Synopsis (Auswahl)
Die Galeere
Ein junger Mann gerät in ein System rigider Arbeit und Hierarchien; eine frühe Studie über Disziplin, Anpassung und den Preis persönlicher Selbstbehauptung.
Franziska
Porträt einer Frau zwischen Gefühl, Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Erwartungen in der Moderne; die innere Konsequenz von Entscheidungen steht im Zentrum.
Mensch gegen Mensch
Konflikte und Abhängigkeiten zwischen Menschen unter Druck; eine psychologische Verdichtung von Machtspielen, Verletzbarkeit und Behauptungswillen.
Tiere in Ketten
Parabel über Trieb, Zivilisationszwang und Gefangenschaft – äußerlich wie innerlich; der Mensch als ‚gezähmtes‘ Wesen in engen Räumen und Verhältnissen.
Nahar (Erste Fassung)
Exotisch grundierter Entwicklungs- und Schicksalsstoff; die Erstfassung zeigt das Thema als experimentelle Annäherung an Fatalität und Selbstfindung.
Nahar (Zweite Fassung)
Überarbeitete Variante desselben Stoffes mit verschobenen Akzenten; schärfer gefasst in Psychologie, Rhythmus und Motivführung.
Die Feuerprobe
Figuren werden in Krieg, Leidenschaft oder gesellschaftlicher Bedrängnis auf ihre innere Haltbarkeit geprüft; eine Erzählung über Bewährung und Verlust.
Männer in der Nacht
Nächte als Schauplatz moralischer Grenzgänge: Männer in Ausnahmesituationen zwischen Loyalität, Angst und Tatentschluss.
Boëtius von Orlamünde
Historisch-psychologische Studie über Schuld, Glaube und Gewissen; eine Existenz gerät unter den Druck eines unerbittlichen inneren Gesetzes.
Georg Letham
Ein Arzt und Forscher verstrickt sich in Schuld und Flucht; Wissenschaft, Gewissen und Selbstzerlegung prallen in einer radikalen Ich-Analyse aufeinander.
Der Gefängnisarzt oder Die Vaterlosen
Ein Mediziner im Strafvollzug ringt mit Verantwortung, Strafe und Fürsorge; ‚Vaterlosigkeit‘ erscheint als soziale wie seelische Diagnose.
Der arme Verschwender
Charakterstudie eines Menschen, der Chancen und Mittel verausgabt; über Selbstbild, Vergeblichkeit und die Mechanik des Scheiterns.
Der Verführer
Ein charismatischer Manipulator nutzt Begehren und Schwäche; eine präzise Vermessung von Einfluss, Abhängigkeit und moralischem Absturz.
Ich – der Augenzeuge
Ein Arzt berichtet aus der Nähe eines aufsteigenden Diktators; ein eindringliches Protokoll über Verführung durch Macht, Verdrängung und Mitschuld.
Erzählungen – Psychologische Miniaturen
Kurzprosa über Obsession, Zufall und moralische Kippmomente (u. a. Dämonenzug, Daniel, Wer hat, dem wird gegeben, Sered, An Rurky, Das Mahl, Familiengeschichte, Die Verdorrten); konzentrierte Studien der inneren Logik von Entscheidungen.
Erzählungen – Medizin und Existenz
Erzählungen aus klinischen und Grenzsituationen des Lebens (Der Arzt, Die Herznaht, Die Mixerin): präziser Blick auf Körper, Verantwortung und das Unabwägbare.
Erzählungen – Historische und legendarische Stoffe
Parabeln und Legenden zwischen Geschichte und Sage (Legende einer Mutter, Der große und der kleine Gargantua, Die Messe von Roudnice, Der Fall Vukobrankovics); Tradition als Spiegel zeitloser Konflikte.
Erzählungen – Südsee und Exotik
Ferne Räume als Resonanzboden für Glaube, Ritual und Gefahr (Atua, Ahira, Südseelegende, Panik auf einem Schiff); das Fremde schärft den Blick auf das Eigene.
Essays – Poetik und Ästhetik
Grundsatztexte zu Erzähltechnik, Romanform und Stil (z. B. Der neue Roman, Die Kunst des Erzählens, Die Ruhe in der Kunst, Der Vorwurf in der Kunst, Die Jugend im Roman, Über die Sprache, Der Genius der Grammatik); Plädoyers für Genauigkeit und innere Notwendigkeit der Form.
Essays – Autorporträts und Literaturkritiken
Würdigung und kritische Lektüren großer Autoren (u. a. Goethe, Balzac, Kleist, Kleist als Erzähler, Cervantes zu Ehren, Die Freunde Flaubert und Maupassant, Heinrich Heine, Adalbert Stifter, Albert Ehrenstein, Jack London, Conrad, [Robert Stevenson]); Charakter, Werkgestalt und Wirkung im Fokus.
Essays – Theater und Bühne
Über Dramaturgie, Wirkung und Zeitgenossenschaft des Theaters (Ein Wort zu Macbeth, Ein Wort zu Wedekinds »Schloss Wetterstein«, Lebensfragen des Theaters); das Verhältnis von Formstrenge und Gegenwartsbezug.
Essays – Kunst, Medien, Moderne
Reflexionen zu Bildender Kunst, Musik, Film und Presse (Daumier, Mozart, ein Meister des Ostens, [Der Film hat keine Tradition], Recentissime oder die Zeitung als Kunstwerk, Aktualität); Medien als Formen der Wahrnehmungslenkung.
Essays – Osten, Reisen, Städte
Beobachtungen zu Kultur, Religion und Orten (Von Chinas Göttern, Östliche Landschaft, Prag, Rousseau als Grenzfigur zwischen Natur und Gesellschaft); Begegnung mit dem ‚Fremden‘ als Erkenntnisprobe.
Essays – Gesellschaft, Politik, Wissenschaft
Texte zu Frieden, Erziehung, Technik und Geschichte (Frieden, Erziehung, Politik, Der Krieg in der Literatur, Ernest Shackleton, James Watt, das Industriezeitalter); Ethos, Fortschritt und ihre Ambivalenzen.
Weitere Essays und Feuilletons
Zusätzliche Gelegenheitsaufsätze und Würdigungen, die Motive der Hauptgruppen fortführen; pointierte Miniaturen über Sprache, Haltung und Zeitdiagnosen.
Autobiographische Schriften
Selbstzeugnisse und autobiographisch grundierte Texte beleuchten Ausbildung, Kriegserfahrung, Exil und das ärztliche Ethos; Erinnerung dient als Prüfstein für Gewissen und Poetik.
Gesammelte Werke: Romane + Erzählungen + Literaturkritiken + Autobiographie
Romane:
Die Galeere
1
Doktor Erik Gyldendal ging jetzt langsam die Prater-Hauptallee hinab; es war gegen halb sechs Uhr abends. Er liebte es, andern Leuten beim Tanzen zuzusehen, konnte stundenlang beim »Prochaska« oder bei der Wirtschaft »Zum Vater Radetzky« stehen und den böhmischen Köchinnen, den Wiener Stubenmädchen und den slowakischen Bauerntöchtern zusehen, wie sie mit Soldaten der verschiedenen Regimenter Polka, Walzer und die »Beseda« tanzten. Das war etwas, was seine Kusine nicht verstehen konnte. Wenn ihr Bruder (zur Zeit, als er beim Train diente) mit seiner Geliebten in die Praterbuden tanzen ging, weil an Wochentagen in Wien sonst nirgends getanzt wurde und er sich an Sonntagen der Familie widmen mußte, so bewunderte sie ihn (wie alle jungen Mädchen ihre Brüder, solange sie »Einjährige« sind) – aber dastehen, ganz in den Staub eingehüllt, den die schweren Stiefel aufwirbelten, bis in die feinsten Fibern erschüttert von dem Dröhnen und Zittern des Fußbodens – das erschien ihr im höchsten Grade häßlich und unästhetisch.
Aber die Leute kamen erst um sieben Uhr in die Tanzbuden (nach Ladenschluß und nach der Befehlsausgabe) – Gyldendal hatte also noch Zeit. Er kehrte um. Seit drei Nächten hatte er nicht geschlafen; das sah man ihm an, wenn er seine hünenhafte Gestalt über die grünen, laubbeschatteten Wege schleppte. Sein Gesicht war fast grau und seine Unterlippe zitterte unaufhörlich, wie wenn er an irgend etwas angestrengt dächte. Aber es war nur der Gedanke an Schlaf, der ihn beschäftigte. Er dachte: Wenn ich jetzt im kühlen Zimmer wäre – die Rolläden wären herabgelassen – da würde ich schlafen, schlafen, schlafen! Aber das war eine Täuschung – das wußte er; wenn er jetzt nach Hause fuhr, daheim war er wieder wach, unerträglich wach, jeder seiner Nerven hatte wieder die gequälte Lebendigkeit, das unwillkürliche Zittern und Zucken, alle infamen Martern, welche sein Schicksal waren seit einem halben Jahr. Zu oft hatte er die Probe gemacht. –
Plötzlich hörte er sich angerufen: »Herr Gyldendal!« Er wandte sich um, wollte nach dem Hut greifen, besann sich, steckte die Hand wieder in die Tasche und ging weiter, den gleichen Weg, den gleichen Schritt, die gleiche Maske auf seinem Gesicht. Dina Ossonsky kam ihm schnell nach, ging neben ihm her, sah ihm von unten her in das erstarrte Gesicht und versuchte selbst zu lächeln.
»Kennen Sie mich nicht mehr?« fragte sie.
Gyldendal zog den Hut und wandte sich ab. Dina kam ihm nach, schweigend gingen sie nebeneinander her. Sie war hübscher geworden seit dem letzten halben Jahr, seit dem letzten »Adieu auf immer«.
Sie war sehr elegant in ihrer weißen Spitzenbluse, die so einfach aussah, aber aus echten Brüsseler Spitzen gearbeitet war. – Über ihrem blassen, großäugigen Gesicht schaukelte ein schwarzer Hut mit kleinen dunklen Moosröschen. Und dann lief ein Parfüm neben ihr einher, ganz zart, wie ein Hauch von einer fernen Wiese, die gemäht wird. Ihre Augen leuchteten... Sie versuchte ihren Arm in den seinen zu hängen, aber er ließ ihren Arm fallen. So gingen sie nebeneinander.
»Ich muß dich sprechen, Erik«, sagte sie. »Ich darf dir doch noch ›Du‹ sagen? Du hast es mir ja auch gesagt... Aber ich möchte nicht hier mit dir sprechen, nicht hier vor den vielen Leuten. Komm zu mir, ich wohne jetzt allein. Janina ist wieder in Odessa, sie läßt dich tausendmal grüßen. Also – komm zu mir, gleich jetzt; oder ich gehe zu dir, willst du?« »Ich habe nichts mit Ihnen zu reden, Fräulein Ossonskaja«, sagte er.
»Du«, flüsterte sie, »du – ich tu alles, was du willst. Alles, alles. Ich habe geweint, Gott, die Augen hab’ ich mir ausgeweint nach dir, damals, als du fort warst; habe dich gesucht – einmal hab’ ich dich in der Universitätsbibliothek gesehen; du hattest den Kopf zwischen die Hände gestützt ... Und du warst so blaß. Sag’, was hast du, bist du nicht gesund? Was fehlt dir? Nicht wahr, du kommst zu mir?«
»Nein.«
»Warum? Glaubst du, daß du mich zurückstoßen kannst wie einen bösen Hund? Sei doch lieb, Erik, du, du! Sieh, wie oft hast du mir das gesagt: ›Sei lieb, sei brav – sei mein Liebling!‹ Und jetzt soll alles zu Ende sein? Nach einem halben Jahr?«
»Du hast es ja selbst so gewollt.«
»Ich habe damals nicht gewußt, was du mir bist. Ich dachte, es würde vorübergehen. Wenn du nur wüßtest, wenn du dir nur vorstellen könntest, was ich gelitten habe!«
»Liebes Fräulein Ossonskaja«, sagte er kalt, »damals haben Sie nicht gewollt, heute...«
»Nein, wie hart... Wie hart du damals warst: ›Alles oder nichts‹, erinnerst du dich? Ich konnte nicht ›ja‹ sagen, kein anständiges Mädchen konnte ›ja‹ sagen.«
»Nun«, sagte er ironisch, »heute verlange ich es auch nicht mehr von dir; ich habe meinen Irrtum eingesehen. Jetzt solltest du doch zufrieden sein.«
»Nein, Erik, ich werde nie zufrieden sein ohne dich. Ich gebe dir alles; alles verzeih’ ich dir – ich habe dich ja mit ihr, mit der Helene Blütner gesehen; alles will ich vergessen, was du mir getan hast, aber du mußt wieder gut zu mir sein. Ich bin dir ja treu geblieben. Warum quälst du mich? Warum?«
Er geriet in Wut. »Und du? Und du? Ruhe will ich, hörst du? Gar nichts will ich von dir als Ruhe. Laß mich gehen, wohin ich will; ich will nicht mehr mit dir gehen.« Eine Pause.
»Es kann nicht anders sein. Fühlst du das nicht? Nach solch einer Szene, wie der am 26. November, können zwei Menschen nichts mehr miteinander zu tun haben, weder im Bösen, noch im Guten, weder heute, noch sonst.«
»Du kannst ja auf diese Szene stolz sein«, sagte sie.
»Dina, bring mich nicht auf! Du kennst mich nicht!«
»Ja, Erik, du hast ganz recht; drohe nur; aber ich fürchte dich nicht. Du hast mich unglücklich gemacht – was kannst du mir noch antun?«
Sie gingen schnell die Donaustraße herauf. Plötzlich blieb er stehen. »Ich kann nicht weiter«, sagte er. »Laß mich allein! Seit drei Nächten hab’ ich kein Auge zugetan. Ich kann Aufregungen nicht ertragen, ich kann nicht. Wenn du noch eine Spur Neigung für mich hast, ich bitte dich, laß mich allein, Dina!«
Dina senkte den Kopf. Ihr schwarzer Hut mit den roten Samtrosen schwankte. Sie zog ihre langen, grauen Handschuhe aus. Sie reichte ihm ihre bloße Hand, die bloße, kleine, braune Hand, an deren kleinem Finger vier oder fünf Ringe waren.
Er nahm ihre Hand zwischen seine breiten, blassen Hände, die zitterten. »Seit wann trägt Dina Ringe?« fragte er freundlich und doch unendlich fern.
Dina erwiderte sein Lächeln nicht. Sie ging dem Donaukai zu; ihr eleganter schwarzer Taftrock leuchtete durch den Staub. Ihr Parfüm war noch da, während sie schon weit weg war.
»Diese Russinnen können sich doch nie daran gewöhnen, Kleider so zu tragen wie Damen! Wenn es wenigstens auf einer Bergwiese im Ural wäre, daß sie so gingen!« Seine Phantasie war jetzt unglaublich reizbar. Erinnerungen kamen und gingen, freundlich und quälend, wie sie wollten. Er stellte sich alles mögliche vor und war dann gequält durch diese Bilder, die sich jetzt an den geringsten Eindruck knüpften und die doch nicht zu seinem Leben gehörten. Langsam kehrte er in den Prater zurück und dachte: Schlafen, o Gott, nur eine einzige Nacht wieder schlafen!
2
Erik Gyldendal hatte diesmal keine Freude daran, den Leuten beim Tanzen zuzuschauen. Die kreischende Musik peinigte seine Nerven; in all den lustigen, lebhaften oder müden Gesichtern sah er immer wieder Dinas Züge.
Was er vergessen dachte, längst versunken in den Staub alltäglicher Ereignisse, die kleinen Erinnerungen, die etwas von Komik und etwas von Rührung hatten, alle kamen wieder. Er stand da, an eine Barriere gelehnt, sah lächelnde und verträumte Gesichter im Tanz auf sich zukommen und sich im Tanz von ihm wenden, hörte ganz aus der Nähe die rohe Blechmusik – und dann, in den Pausen, zarte Geigentöne, die von weither über allmählich dunkelnde Wiesen getragen wurden, und all dies war die Begleitung zu der Erinnerung, welche Dina Ossonskaja hieß.
Seit zwei Jahren war Gyldendal Privatdozent an der Wiener Universität. Er las im Wintersemester in einem kleinen Hörsaal, der auf den Maximilianplatz hinausging, jeden Dienstag und Donnerstag von halb zehn bis elf Uhr.
Er wollte ursprünglich die Dozentur nicht. Aber sein Vater, der Bankier Christian Gyldendal, sagte: »Du wirst doch nicht die akademische Karriere zurückweisen? Das darfst du nicht. Du hast dich niemals viel um uns gekümmert. Aber jetzt, tu deiner Mutter die Freude! Sie hat es dir heut noch nicht verziehen, daß du ihr den Tag deiner Promotion nicht gesagt hast und daß sie nicht dabei sein konnte.«
Erik Gyldendal habilitierte sich. Mit einer gewissen Angst hielt er seine Probevorlesung ab: »Über die Röntgenstrahlung und ihre mathematisch-physikalische Grundlage.«
Professor Eschenbrand, der Mathematiker, der ihn immer protegiert hatte, klopfte ihm nachher auf die Schulter und meinte: »Bravo, Kollege! Avanti, avanti!« Er war so jugendlich trotz seiner neunundsechzig Jahre. Hofrat Braun, Mitglied der Akademie, berühmt durch seine Arbeiten über Molekularströmungen und über die kinetische Gastheorie, er, der bei den Studenten so gefürchtet und zugleich bewundert war wegen seiner Grobheit, die aber unvergleichlich witzig sein konnte – Braun meinte: »Na, morgen kommen’s noch nicht zu uns in die Akademie der Wissenschaften. Aber schauen Sie dazu, daß wir uns später dort wiedersehen. Alsdann servus!«
Und die beiden alten Leuchten der Wissenschaft gingen Arm in Arm fort und überließen Gyldendal den Gratulationen und den unsinnigen Fragen der Verwandten und zahllosen Bekannten der Familie.
Die Gyldendals waren reich; so konnte der alte Herr dem Dozenten ein Privatlaboratorium in einer Villa in Döbling einrichten, die schon seit Jahren von der Familie nicht mehr bewohnt war; dort draußen lebte Erik fast mehr als in der Stadt. Er kam nur an zwei Vormittagen der Woche in die Universität, um dort vor sechs oder sieben Studenten über die seltenen Strahlungsphänomene und deren mathematische Grundlagen vorzutragen.
Wenn er sich von den Händen die Kreidespuren abgewaschen hatte, ging er fort, tauchte unter in dem bewegten, zitternden, süßbeschwingten Leben dieser blühenden Stadt, nicht als Gelehrter, Mathematiker oder Physiker, sondern einfach als Mensch – aber das nur auf Stunden, auf wenige Stunden in Tagen oder Monaten. Alles andere gehörte seiner Wissenschaft.
An einem Vormittag – während Gyldendal lange Reihen von Integralen auf die Tafel schrieb – tat sich die Tür seines Hörsaales auf, und ein junges Mädchen von einer in den Räumen der Universität ungewohnten Eleganz trat ein und schlich sich zu den letzten Bänken.
Gyldendal wandte dieser Dame seine Aufmerksamkeit erst zu, als sie zum dritten- oder viertenmal wiedergekommen war. Da hatte er Experimente mit Kathodenstrahlen im verdunkelten Hörsaal gemacht und beim Herablassen der Vorhänge hatte ihm die junge Dame geholfen.
Gyldendal war geschickt bei seinen Rheostaten, Hittorffröhren, Wehneltunterbrechern, bei all den überaus empfindlichen Apparaten, die keine Erschütterung vertrugen, aber er war ungeschickt, wenn er einen Vorhang herablassen sollte.
Endlich war es dunkel; draußen rollten unaufhörlich die Räder der Droschken, die elektrische Straßenbahn ratterte vorüber, die Automobile huschten vorbei; in der Dunkelheit des Saales aber sprangen die Funken unter lautem Krachen hin und wider, die dünnen Leitungsdrähte waren wie die Loïe Füller, die Serpentintänzerin, in einen wehenden Mantel von Licht gekleidet; das war der Strom, der den gebahnten Weg des Drahtes verließ und nebenher hüpfte wie ein Knabe.
Aber dieser tanzende Schimmer war nichts gegen dies ungeheure, intensiv blitzende Licht, das die Röntgenröhre selbst von der Antikathode her ausstrahlte und in mächtigen Wellen hineinwarf in den kleinen Saal, wie ein Feuerwerk, voller Unruhe und getaucht in blaue Glut. Das Unbegreifliche war, daß dieses unbeherrschbar intensive Licht ganz regellos war im Gange seiner Strahlen, daß es kaum einen Schatten warf und sich durch keine Linse, keinen Magnet, keine Vorrichtung den Gang und die Richtung vorschreiben ließ. Man konnte es fühlen, daß dieses ungezähmte, wild durchdringende Licht, vor dessen Bissen kein Körper standhalten konnte, auch in die tiefste Tiefe der Organismen drang und alles Lebende mühelos durchwühlte.
Es war erst kurze Zeit her, seitdem Röntgen diese Wirkung der Kathodenstrahlen beschrieben hatte, die Gyldendal, Braun und Rutherford schon vorausgeahnt hatten. Eine neue Welt war es, ein gefährlicher, unerforschter Archipel, der seinesgleichen nicht hatte auf Erden.
Nach der Vorlesung ging Dina Ossonskaja zum Katheder und half Gyldendal die Meßinstrumente, Röhren und Kontakte wieder versorgen. Als aber das junge Mädchen nach der Röntgenröhre langte, da wurde Gyldendal unruhig: »Bitte, lassen Sie – der Apparat ist unersetzlich – man darf ihn kaum anfassen; denn er ist fast luftleer. Der Luftdruck kann ihn zusammenpressen. Ich habe Karl Unger zugesehen, dem eine ganz ähnliche Röhre zerbrach; es gab eine Explosion, und Splitter drangen in Ungers rechtes Auge; das war verloren, und heute noch fürchtet er für das linke; er hat seitdem nichts mehr gearbeitet.«
Gyldendal und Dina gingen die breite Marmortreppe der Universität hinab. Ringsum war es still. »Man konnte noch viel von ihm erwarten«, fügte er hinzu. Sie schwieg und sah ihn an. So kamen sie bis an die Löwenbastei.
»Ich muß Sie eigentlich um Entschuldigung bitten«, begann dann Dina mit dem harten Akzent der Russen, »daß ich mich nicht vorgestellt habe.« Er sah sie fragend an. »Sie glauben jetzt natürlich, daß ich eine Studentin bin? Sie haben mich für eine Studentin gehalten? Ich bin nichts – mein Name ist Dina Ossonskaja.«
Er gab ihr die Hand.
»Darf ich Sie etwas fragen?«
»Bitte, ich bin ja dazu da«, sagte er, »Ihnen dies alles zu erklären, und es freut mich, wenn jemand Interesse dafür hat. Ich habe sechs Hörer; drei davon sind regelmäßig inskribiert, die andern kommen ab und zu. Das ist wenig für ein Gebiet, das so großartig ist – großartig über alles Bekannte hinaus.«
»Ich wollte Sie nur das eine fragen: Nicht wahr, solch eine Röhre leuchtet nicht, wenn sie voll Luft oder Wasserstoff ist?«
»Sie leuchtet vielleicht auch dann«, sagte er. »Das sind die Geißler-Röhren – die kennt man seit fünfzig Jahren oder hundert; es ist ein hübsches Spielzeug für Kinder unter dem Weihnachtsbaum; aber Kathodenstrahlen oder Röntgenstrahlen entstehen nur, wenn die Röhre absolut luftleer ist.« »So habe ich es mir auch vorgestellt«, sagte die Russin, »und deshalb haben mich Ihre Versuche so stark interessiert. Nicht deshalb allein. Auch deshalb, weil ich glaube, jede physikalische Erscheinung müßte in der Seele der Menschen etwas Ähnliches haben. Wenn zum Beispiel irgend jemand einsam ist, ganz ohne Beziehungen, ohne irgendeine Interessengemeinschaft mit den andern – ein luftleerer Raum mit einem Mantel von Glas darüber, müßte nicht auch solch ein völlig einsamer Mensch, einer ohne Güte und ohne Haß – einen starken Einfluß auf andere Menschen haben, so daß sein Blick durch sie hindurchgeht...? Sie wundern sich, daß ich solch eine Frage an Sie richte, aber ich mußte immer wieder daran denken, seitdem ich diese Röhren sah – und Sie. Ich wollte nicht mehr kommen, und heute kam ich schon zum viertenmal. Sind Sie mir böse?«
»Ich Ihnen böse?... nein. Aber soll ich das sein, Fräulein Ossonskaja?«
»Sie lachen über mich?« fragte Dina ganz ernst.
»Nein, ich wollte nur wissen, ob Sie mich für solch einen Menschen halten – für eine luftleere Seele, ganz ohne Güte und ohne Haß – meinten Sie es nicht so?«
»Ja«, sagte sie einfach.
Er sah sie an; jetzt war sie schön, groß und elegant mit ihrem schwingenden Gang, der etwas Leidenschaftliches hatte, mit ihrem Mund, der etwas von Carmen besaß: lieben oder hassen; nur glühen, aber nicht glimmen.
Sie waren tief in die innere Stadt, in die Gegend der Wipplinger Straße, gekommen. »Sie überschätzen mich«, sagte er, »ich bin ein Mensch wie alle andern, wie Ihre Bekannten, wie Ihre Brüder.«
»Ich habe keinen Bruder; ich bin allein, ganz allein. Warum, wieso, das ist eine lange Geschichte – die interessiert keinen.«
»Sie könnten doch Vertrauen zu mir haben«, sagte Gyldendal.
»Ja, ich könnte Vertrauen zu Ihnen haben; ich glaube, Sie sind klüger und vielleicht auch besser als die andern. Aber Sie müssen Geduld mit mir haben, Sie dürfen mich nicht auslachen, wenn Sie sehen, wie wenig ich weiß. Ich kann nicht einmal gut Deutsch oder Russisch schreiben und nicht viel Französisch. Was liegt daran? Was liegt an all den Dummheiten, die man in der Schule und in den Pensionaten lernt?«
Sie standen vor einer Kirche. Inmitten der vierstöckigen Geschäftshäuser, die von oben bis unten mit Firmenschildern aller Branchen bedeckt waren, ragte eine kleine graue, gotische Kirche empor: Maria am Gestade.
»Ich muß Ihnen für heute adieu sagen«, sagte Dina. »Meine Freundin Janina erwartet mich.«
Erik Gyldendal sah Dina an; sie strahlte vor Glück. »Weshalb, weshalb?« fragte er sich.
»Wenn Sie mich wiedersehen wollen«, sagte er, »ich arbeite die ganze Zeit oben in Döbling – aber ich komme Donnerstag wieder her...«
»Hierher?« fragte Dina leise.
»Ja, wenn Sie wollen, hierher. Donnerstag um elf. Etwas nach elf.«
Sie gab ihm die Hand. Nach drei Schritten wandte sie sich um, nickte ihm nochmals zu und rief einen Fiaker an, der dann auf seinen grauen Gummirädern bald verschwand.
3
Was für Frauen hatte er vor Dina Ossonskaja gekannt?
In seiner Erinnerung erschienen nun die unendlichen Tage der Jugend, voll von dumpfer Sehnsucht, voll von leise tastender Furcht – Furcht vor den Frauen und Sehnsucht nach ihnen, die er für unsagbar glückbringende Wesen hielt. So lange hielt er sie dafür, bis er – mit neunzehn Jahren – zum erstenmal in seinem Leben unter vier Augen mit einer Frau sprach: Sie hieß Franzi Dollinger.
Sie sah auf der Bühne immer noch sehr jugendlich aus, war aber in Wirklichkeit schon weit über die Jahre der Torheiten hinaus. Er erwartete sie einmal am Bühnenausgang des Karl-Theaters – es schien anfangs wirklich, als ob sie sich über ihn und seine knabenhaft überquellende Liebe freue; denn sie konnte immer noch lächeln, die Franzi Dollinger, irgendeinem Menschen zulächeln – wenn sie Theater spielte.
Vom Parkett aus sah man die Goldplomben nicht, man sah nicht die Einlagen im künstlich gefärbten Haar. Erik Gyldendal sah das alles, aber er wollte seinen Roman; um jeden Preis.
Er schickte ihr Blumen, holte sie im Wagen ab – wollte mit ihr in die Hauptallee, in die Krieau fahren. – »Was würden die Leute von uns denken?« fragte sie; aber sie nahm seine Geschenke, seine Blumen, seine Liebesbriefe an, die er, fern von ihr, in blinder Ekstase schrieb – denn zu Hause, in seinem rot tapezierten Zimmer, löschte er das Licht aus und dichtete sich in eine stürmische Leidenschaft voll großer Gefühle hinein.
Einmal kam er nachmittags zu ihr – sie hatte sich eben das Haar gewaschen und das hing nun feucht und nach Kamillentee duftend über ihre gestickte Matinee herab – da beugte er sich über sie und küßte ihre Wangen, die schon etwas schlaff waren, und ihre Lippen, die unbeweglich und gleichgültig seine Küsse entgegennahmen, seine ersten Küsse, die Küsse eines Neunzehnjährigen.
Er wurde kühner; sie wies ihn zurück, ganz leicht schüttelte sie ihn ab mit einem halben Ruck ihres weichen, vollen Körpers.
Erik Gyldendal war verletzt, enttäuscht, entmutigt; er fürchtete sich vor der Lächerlichkeit. Franzi sah ihn mit ihren Junoaugen an und machte ihren Zuckermund wie in ihrer Rolle der »Mia« in der »Prinzessin vom Donaustrand«.
»Was willst du denn, Bubi, bist ja noch so jung, hast ja nichts davon!«
Sie nahm seine Hand, sah schmachtend zu dem jungen Millionärssohn auf und sagte: »Was hast denn davon?«
Er glaubte wirklich daran; er nahm ihre Worte für Ernst – und sie hätte ihn doch so gerne glücklich gemacht, mit dem bißchen Glück, das eine Franzi Dollinger noch zu geben hatte. So aber ging dieser Augenblick in schweigender Verlegenheit zwischen ihnen vorbei. Franzi stand auf, nahm ihre rotblonden Haare (sie waren schon ein wenig dünn) zusammen.
»Schämen müßt’ ich mich eigentlich, wenn mich jemand so sieht.«
Erik küßte ihr die Hand und ging fort. Schon auf der Treppe bereute er seine Schüchternheit. Aber sie kam nicht wieder, diese Gelegenheit, die noch keiner verpaßt hatte bei der feschen Franzi Dollinger.
Er sandte ihr die Briefe zurück und ihre kleinen Geschenke – und erwartete einen großen Auftritt, eine tragische Szene, in der er ihr alles vorwerfen konnte. Aber nichts kam, sie schwieg; dann ging er mit der beleidigten Wut ganz junger Menschen zu ihr. Sie erschrak, als sie ihm die Tür öffnete; ihr Dienstmädchen hatte Ausgang.
»Sieh da, der Erich!« sagte sie. »Was bringt dich her? Willst deine Geschenke zurück? Ich hab’ jeden Tag dran gedacht – aber ich bin nicht dazu gekommen.«
Nein, er wollte nicht die Geschenke, bloß seine Briefe, die er nicht in einer fremden Hand wissen wollte.
Die Silbersachen, die er ihr geschenkt hatte, standen hübsch blank geputzt auf der Kredenz; aber die Briefe konnte sie nicht finden.
Sie suchte sie überall, in der Schublade des Küchentisches, auf dem Nachtkästchen, unter ihren Haarnadeln, in ihrem Necessaire, und fand sie nirgends; schließlich rief sie ihn aus dem Salon, wo er ungeduldig wartete, in ihr Schlafzimmer, wo der Schreibtisch stand, und dort räumten sie nun der Reihe nach alle Schubfächer aus, fanden alte Verträge, Juxartikel, Photographien aus vergangenen Jahren, Textbücher von Operetten mit Widmungen, alte Federschachteln, Rechnungen für Blumen, all den Kram, der sich angesammelt hatte – und während sie beide an dem heißen Sommernachmittag die Sachen auspackten, kam die Dollinger in Stimmung und erzählte ihm Anekdoten von »Papa Strauß«, der ihr nach einer »Fledermaus«-Aufführung gesagt hatte: »Meine Franzi, das ist doch ein Prachtmädel! Was? So sollte meine Tochter sein.« Sie erzählte entzückend, und beide lachten; die Briefe fanden sie natürlich nicht.
»Weißt was«, sagte sie endlich, »ich koch’ dir einen guten Kaffee, das ist schon etwas für die dalkerten Briefe. Einen Kaffee von der Franzi Dollinger hast sicher noch nicht getrunken!« Erik Gyldendal sagte zu – nach zwei Stunden verabschiedete er sich und mußte zugeben, daß er sich noch nie so gut amüsiert hatte wie an diesem Nachmittag. So endete die tragische Szene und sein erster Roman.
4
Sein zweites Erlebnis war das Stubenmädchen seiner Mutter; eine kleine Slowakin mit sehr brauner Haut und wilden, weißen Zähnen. Die Haare hatte sie ganz dicht geflochten; sie hatte viel Haar, aber ihre Zöpfe sahen aus, wie aus schwarzen Schuhbändchen geflochten.
Trotzdem verliebte er sich in sie; er hatte ja beide Hände voll von Zärtlichkeit und gab sie jedem, den er gerade traf. Während sie auftrug, sah er sie an und freute sich, wenn sie rot wurde. Hinter der Portiere zum Salon haschte er im Vorübergehen nach ihrer Hand, die sie ihm entzog. Schließlich verstanden sie einander doch. In ihren Augen war Erik Gyldendal ein gnädiger Herr, beinahe ein Herrgott. An einem Sonntagnachmittag – es war Besuch da – küßte er die kleine Slowakin.
»Hör zu«, flüsterte Erik, »heute abend komm’ ich zu dir. Marie hat Ausgang, sie ist nie vor elf Uhr zurück ... Nicht wahr? Laß die Tür offen!«
»Aber gnädiger Herr ...«
Er sah sie an; sie zitterte und schwieg; dann besann sie sich und rannte in die Küche, um den Tee nicht zu lange kochen zu lassen. Das Dienstmädchen hatte den Sieg über das Weib in ihr errungen; aber abends in der Freude, in der Angst, in der stummen Erwartung, da war sie es wieder, war es vielleicht nie früher, nie später so wie an diesem Tag.
Erik war den ganzen Nachmittag über sehr nervös, aber seine Tante und die hübsche, rothaarige Kusine fanden ihn geistreich. Sein Herz klopfte; aber er bezwang sich und sprach von dem Gymnasium und von tausend Nebensächlichkeiten. Dann zählte er die Stunden, lief in seinem Zimmer hin und her, denn solange er sich bewegte, fühlte er nicht das bösartige Pochen des Herzens. Um halb elf zog er die Schuhe aus und schlich sich zu dem Dienstbotenzimmer; er öffnete die Tür, sah Bronislawa im Schein einer kleinen Petroleumlampe in ihrem Bett, die beiden Hände vor dem Gesicht gefaltet. Unter dem Polster lagen zwei Orangen, Geschenke der Schwester, die damit im fünften Bezirk hausieren ging.
Erik stand beim Bett. Mit gierigen, brutalen Händen riß er die Decke von dem Körper der Schlafenden. Die Slowakin erwachte, erkannte Erik anfangs nicht – dann schlug sie um sich und kratzte ihn mit ihren schwarzen Nägeln, mit den Nägeln ihrer abgearbeiteten Dienstbotenhand ins Gesicht. Er packte sie an den Handgelenken, es entspann sich ein Kampf zwischen ihnen, eine abstoßende und lächerliche Szene, stumm, ohne Worte, in dem Halbdunkel des Dienstbotenzimmers der Slowakin. Sie war stärker als Erik. Sie würgte ihn an seinem Halskragen, und er mußte sie loslassen. Tiefatmend standen sie einander gegenüber.
Da wandte sich das Mädchen zur Wand, begann tief zu schluchzen in ihrer Hilflosigkeit, in ihrer Sehnsucht nach ein bißchen Liebe, nach einem guten Wort ... sie weinte, wie jede Frau, die getröstet werden will.
Eine rotgemusterte Bettdecke war zur Erde gefallen; Erik sah Bronislawas jungen, schönen Körper unter dem kurzen Hemd – alle Konturen, die etwas gelbliche Farbe ihrer Haut – die braunen Flecken über beiden Knien und die grün und rot geringelten alten Strümpfe an ihren Füßen.
Wie schmutzig sie sind, dachte er; er war voll von Ekel und körperlichem Widerwillen. Ohne ein Wort zu sagen, ging er fort und ließ sie weinen, schluchzend, stoßweise weinen. Er schlich sich fort, leise, auf den Zehen, und war überzeugt, daß niemand davon wüßte.
Bronislawa Novacek weinte die ganze Nacht hindurch und kündigte am nächsten Tage den Dienst.
In dieser Zeit begann Erik Gyldendal schlecht zu schlafen – und diese Nacht war die erste schlaflose in seinem Leben. Er legte sich sofort zu Bett, starrte mit offenen Augen zur Decke, überlegte alles noch einmal, sah wieder die schmutzigen Füße des siebzehnjährigen Bauernmädchens vor sich. Als die Uhr zum zweitenmal schlug, dachte er: Es ist halb zwölf, und ich schlafe noch nicht? Aber er schlief auch um halb eins nicht. Er bereute jetzt seine Härte, seine Kälte – dachte daran, nochmals in das Dienstbotenzimmer zu gehen und die Wangen der Slowakin zu streicheln, die ihm zuliebe die Tür offengelassen hatte, wartend im Lichte der kleinen Petroleumlampe, bis er käme. Und inzwischen war sie eingeschlafen, er beneidete sie mit ganzer Seele um diesen Schlaf, er beneidete alle Welt um den Schlaf, er geriet in eine fürchterliche Wut darüber, daß alle andern ausruhen sollten, nur er allein nicht. Er wollte auf einem Klavier mit beiden Fäusten darauflosdonnern, keiner sollte schlafen, wenn er selbst nicht schlief.
Er stand auf, ging ans Fenster und sah lange in die blinkende, tiefe, gleichsam gelähmte Sommernacht hinaus – so lange, bis es dämmerte und Tag wurde. Er hatte später noch ein paar schlaflose Nächte, war dann bei Tage gereizt, unruhig und konnte nicht arbeiten. Zu dieser Zeit begann die Wissenschaft in seinem Leben eine Rolle zu spielen. Eine ungeheure Welt tat sich ihm auf, die erobert sein wollte, die alle Kräfte verlangte, Energie, Klarheit, Tiefe und so zwang er sich mit einer unerhörten Anstrengung zur Arbeit. Es gelang ihm. Er studierte durch sechs Jahre fast täglich bis tief in die Nacht hinein, experimentierte, machte Reisen nach Paris zu Curie, nach Berlin, zu Sabouraud in Lyon, nach London zu Rutherford, nach Würzburg zu Röntgen. In sein Abteil erster Klasse nahm er seine wissenschaftlichen Zeitschriften und Bücher mit; er lief der mit kolossalen Schritten voraneilenden Wissenschaft nach und bekam einen Vorsprung vor all den andern. Er fand Neues, begriff alles bisher Gefundene, er lebte nur seiner Wissenschaft und ging ganz in ihr auf. Er hütete sich vor allen fremden Eindrücken, er fürchtete die Erotik, er vermied jede starke Aufregung, jedes Mitleid, jede Mitfreude.
Da wurden seine Nerven ruhig, gehorsam, untertänig wie Haustiere. Er schlief Nacht für Nacht tief und mühelos, er hielt die Überanstrengung seiner geistigen Tätigkeit leicht aus. Er fühlte sich durchaus gesund. Aber Dina hatte recht. Er war der Mensch, der aus seinem Innern alle Gemeinsamkeitsgefühle und Interessen ausgepumpt hatte, wie die Quecksilberluftpumpe und der elektrische Motor alle Luft aus der Röntgenröhre pumpt. Er war Egoist durch Anlage und durch Entwicklung.
Die junge Russin kam; er traf sie bei der Kirche »Maria am Gestade«, sie gingen Hand in Hand spazieren – sie erzählte ihm alle möglichen Dummheiten, einmal war sie in die Universität gegangen und hatte die erste beste Tür geöffnet (genau so, wie sie es bei Doktor Erik Gyldendal getan hatte). Da war ein alter Professor, der vor drei Studenten orientalische Sprachen vortrug. Sie war die vierte. Eine Stunde lang mußte sie nun dasitzen und hören, welche Differenzen die einzelnen persischen Dialekte untereinander aufwiesen; dabei verfolgten sie die verwunderten und erfreuten Augen des alten Gelehrten. Ein andermal kam sie zu einem Germanisten, der von Richard Wagner und seinen Schlafröcken aus rotem Samt erzählte. »Und wenn er tausend Ellen roten Samt für seine weihevollen Kleider braucht, die deutsche Nation bewilligt sie ihm, wenn er eine ›Götterdämmerung‹ schreibt«, diktierte der Germanist. Ja, das war amüsant.
»Auf Abenteuer ausgehen«, nannte sie das, sie lief überall umher, staunte, freute sich wie ein Kind, wie ein Barbar über alles mögliche, das ihr auffiel. Sie kannte Wien sehr gut, viel besser als Gyldendal. Ihre Eltern wohnten in London. Sie hatte ein großes Vermögen, lebte aber sparsam, weil sie von nichts wußte, das sie sich hätte kaufen sollen.
An einem Regentage gingen sie in das Laboratorium in Gyldendals Wohnung. Er zeigte ihr alle Apparate; aber es machte wenig Eindruck auf sie.
Sie waren einander schon zu nahe, als daß irgend etwas Fremdes, Unpersönliches ihr Interesse hätte wecken können.
Sie schwiegen beide. Eine schwüle, bedrückende Wolke wuchs aus diesem Schweigen empor. Sie verabredeten einen Ausflug für den nächsten Tag. Sie trafen sich dann um sieben Uhr früh bei der Haltestelle der Stadtbahn »Nußdorfer Straße«. Dina, in einen grauen, englischen Paletot gehüllt, erwartete Erik.
Sie nahmen eine Karte nach Hadersdorf-Weidlingau. »Können Sie sich vorstellen, daß wir jetzt nach Paris fahren?« sagte sie. »Oder nach den Kanarischen Inseln ... und nie wiederkommen, hören Sie, nie!« Er antwortete nicht.
»Woran denkt der Herr Dozent?« fragte sie.
»Ach, Fräulein Ossonskaja«, meinte er, »fragen Sie mich nicht! Ich würde Sie ja doch nur langweilen.«
»Wie Sie wollen«, sagte sie kurz.
Sie stiegen in Hütteldorf um; der Einhalbacht-Uhr-Schnellzug nach München und Paris kam eben heran, hielt, glitt leise wieder vorbei.
»Morgen um sechs Uhr früh ist er an der gare de l’Est«, sagte er und sah nach der Uhr.
Sie schwieg. Erst in Hadersdorf, einem ganz kleinen Villenort, mitten in dem herbstlich verlassenen Wald, begann sie zu reden.
»Eigentlich ist es eine Grausamkeit, daß Sie die armen Tiere, die unschuldig gequälten Kreaturen martern!«
Sie meinte die drei Meerschweinchen, die Gyldendal täglich eine Stunde lang mit Röntgenröhren bestrahlte.
»Nennen Sie das grausam? Die Tiere spüren ja nichts.«
»Woher wissen Sie das?« sagte sie eigensinnig.
»Haben Sie denn nicht gesehen, daß sie ruhig ihren Kohl und Hafer fressen, auch wenn die Röhre geht?« antwortete er.
»Sie wissen ja immer alles besser«, sagte sie trotzig.
»Was wollen Sie eigentlich von mir?« fragte er aufgebracht.
»Vielleicht fürchten sich die Meerschweinchen doch vor dem blitzenden Licht?« fragte sie schüchtern. Erik zuckte die Achseln. Er lächelte leise; und in diesem Lächeln war etwas, das sie erschreckte und zugleich beglückte.
Ob er sie liebte? Vielleicht ja, vielleicht nein. Und doch war sie die erste Frau, die seinem Wesen nähergekommen war.
In einem kleinen Tal, zwischen entlaubten Birken und regenfeuchten Kiefern, war ein dürftiges Kaffeehaus »Zum Sillertal«.
Sie gingen hinein, riefen endlos lange, bis eine verschlafene Kellnerin kam. Sie bestellten: für Dina Tee, für Gyldendal ein Glas Wein.
Inzwischen standen sie vor dem Fenster.
Draußen schichtete ein alter Mann mit einem Rechen feuchtes, purpurnes, safrangelbes, goldbraunes Laub zusammen. Irgendein Vogel schrie durch das Schweigen, durch den Nebel, der langsam vom Boden aufstieg, seinen melancholischen Schrei. Ohne daß sie es wollten, fanden sich ihre Blicke. Sie sahen sogleich wieder fort. Gyldendals Herz begann zu klopfen, wie es nicht geklopft hatte seit dem Tage, an dem er die arme Bronislawa Novacek in ihrem Zimmer hatte küssen wollen. Von einer unnennbaren Kraft getrieben, legte er seinen Arm um Dinas bloßen Nacken. Sie machte sich wild los. Rot, zitternd, aufgewühlt. Gyldendal biß die Zähne zusammen, wandte sich ab.
Da warf sich Dina Ossenskaja an seine Brust und küßte seinen Mund. Erik hielt sie fest und streichelte langsam ihr Haar, ihr dunkles, weiches, feingesträhntes Haar. Er hielt sie an sich gepreßt, selbst dann noch, als das Mädchen mit dem Frühstück gekommen und der alte Mann im Vorgarten draußen verschwunden war.
»Sag’, Erik, hast du mich lieb?«
»Ja«, flüsterte er.
»Sag’s noch einmal, es ist so süß, das Wort zu hören«, sagte sie.
»Das Wort?«
»Hast du mich lieb? Wirklich lieb?«
»Ja –«, sagte er und log; er wußte, daß er sie nicht liebte. Seitdem sie ihn geküßt hatte, wußte er es.
Sie strahlte vor Glück und ließ seinen Arm an diesem Vormittag nicht mehr los. Sie lehrte ihn russische Kosenamen und lachte, wenn er sie nicht aussprechen konnte. Er küßte sie, und sie erwiderte seine Küsse. Er fühlte seine Sinne aufgeregt, aber sein Herz blieb kühl. Er dachte daran, sich loszumachen, und konnte die Worte nicht finden. Die Szene im Sillertal erschien ihm sentimental und geschmacklos, und doch war sie eine der schönsten seines Lebens.
Aber die Güte andrer machte ihn nicht gut. Dinas Glück machte ihn nicht glücklich. Dinas Instinkt hatte – wie der Instinkt jeder Frau – recht: Er kannte keine Gemeinsamkeit, weder in der Seligkeit noch im Schmerz. Er war ein leerer Raum, luftleere Seele, umhüllt von einem gläsernen Mantel, den nichts durchdringen konnte und der selbst alles durchdrang.
Aber Dina selbst wußte es nicht mehr.
Sie liebte ihn mit der ganzen ungebrochenen, ja barbarischen Gewalt einer ersten Liebe.
5
Sie besprachen ein Wiedersehen für den nächsten Tag um elf Uhr bei der Kirche »Maria am Gestade«.
In dieser Nacht konnte Erik Gyldendal nur schwer einschlafen, und er erwachte beim ersten Schlag der Uhr; er stand auf und stellte den Pendel fest. Es war jetzt ganz still, aber gerade diese Ruhe beunruhigte ihn.
Ohne daß er es wollte, richteten sich alle seine Gedanken auf Dina. Nicht sein Gehirn allein dachte, nein, auch seine Lippen dachten an den Druck von Dinas Lippen, seine Haare fühlten das feine Streicheln von Dinas Hand, seine Arme schlangen sich eng um Dinas Hals, seine Knie berührten Dinas weiche Mädchenknie.
Sein ganzer Körper dachte an Dina, nur nicht sein Herz. Mit unendlicher Mühe schlummerte er gegen Morgen ein, unsagbar gequält durch diese fremde Welt voller Gewalt und voll von tiefziehenden, schwülen Wolken.
Er träumte: Er sah Dina, aber nicht als Mädchen, sondern als sechzehnjährigen Jungen, halb nackt, mit seidenen, dunkelgrünen Strümpfen, auf denen das Monogramm D. O. in gelber Seide gestickt war. Sie hatte enganliegende Kniehosen aus weißer Leinwand. Um den Oberkörper trug sie eine Matrosenbluse mit blauem Kragen. Er fragte sich im Traum: Woher weißt du denn, daß dieser da Dina Ossonskaja ist? Die Gestalt sah ihn an und sprach zu ihm, ohne daß er etwas hörte. Es war eine gläserne Wand zwischen ihnen. Ihre schlanken Beine mit den dunkelgrünen Seidenstrümpfen glänzten, wie wenn sie eben aus dem Wasser gestiegen wäre.
Er erwachte. Jetzt erinnerte er sich; es war ja ihr Monogramm auf den Strümpfen, D.O. in gelber Seide. Er stand auf, fuhr nach Döbling in sein Laboratorium. Seine Arbeit wartete auf ihn. Und er kam hin, um zu arbeiten. Aber so oft er an Dina dachte, zitterte er.
Ich darf sie nicht wiedersehen – ich kann nicht; was soll daraus werden? Dann wieder kamen Gewissensbisse: Sie wartet auf mich, sie sieht sich nach jedem Wagen um und kann nicht glauben, daß ich nicht komme. Das Warten ist schrecklich, ich weiß es, aber ich kann nicht anders. Er fürchtete, sie könnte zu ihm kommen, und die Türen wurden abgesperrt.
Er ging in sein Laboratorium, ließ die Röhren spielen, experimentierte, nahm einen Funken photographisch auf. Nach und nach wurde er ruhiger. Er aß mit der Mutter zu Mittag (der Vater war in Paris) und fuhr bald wieder in sein Laboratorium zurück. Dina war nicht gekommen. Es wurde Abend. Gyldendal ging aus, streifte in den herbstlichen Weinbergen umher, kam bis auf den Kahlenberg, wartete darauf, daß er endlich müde würde. Aber er wurde nicht müde. Nachts: Er sah Dina vor sich, Dina im englischen Paletot, wie sie auf dem pylonenartigen Turm der Stadtbahn, hoch oben auf dem Viadukt, stand und auf ihn wartete und ihm weiße Tücher und Spitzen hinunterwarf ...
Dann wieder waren sie beide in dem Dunkelzimmer, die Röntgenröhren zischten und knatterten und in ihrem blauen, wogenden Licht sah er, wie sich Dina entkleidete. Es ging schrecklich langsam. Der Apparat schickte seine Funken krachend hin und her... Dina knüpfte ihre Schuhe auf und sah dabei mit ihren großen Kinderaugen zu ihm empor; die Augen aber hatten etwas Fremdes, Ängstliches und Gespanntes. Nach einer halben Stunde, nach einer Ewigkeit hakte sie ihren Strumpfbandgürtel auf, immer bloß den obersten Haken, der sich dann von selbst wieder schloß.
Es war grauenhaft quälend, dieses verworrene Träumen, all diese schmutzigen, erotischen Gedanken, so quälend, daß Erik Gyldendal aufstand und wie in jener Sommernacht sich aus dem Fenster beugte, vor dem aber keine milde, blaue Finsternis lag, sondern eine kalte, unbestimmte Dämmerung. Unendlich, unendlich lang war diese Nacht. Er schloß kein Auge.
Als er am nächsten Morgen auf die Gasse kam, wankte er. Er rief seinem Kutscher Dinas Adresse zu. Sie wohnte mit Janina zusammen, einer Medizinerin aus Odessa. Ihr Zimmer war sehr groß und sehr einfach. Zwei ungeheure gelbe Lederkoffer standen nebeneinander. Auf dem Tisch brannte ein Spirituskocher. Dina war blaß, hatte dunkle Ringe um die Augen, war aber vollständig ruhig und unbefangen.
Sie stellte Gyldendal ihrer Freundin Janina vor. Die beiden sprachen nun miteinander. Dina räumte das Teegeschirr fort und sah dann plötzlich Gyldendal an, starr und unverwandt. Gyldendal erzählte von seinen Tierversuchen, von den merkwürdigen Erscheinungen, die er beobachtet hatte. Das Blut der bestrahlten Tiere veränderte sich in eigenartiger Weise, die Haare des Felles fielen aus, es waren ganz ungeahnte, meist schädliche Wirkungen dieser noch unerforschten Strahlen.
Die Tiere starben. Alle starben daran.
Janina interessierte sich für diese Experimente und auch für Gyldendal, dessen Existenz sie aus den schlaflosen Nächten ihrer Freundin und aus ihren Aufregungen ahnte. Sie schützte aber als gute Kameradin Vorlesungsstunden vor und ging.
Gyldendal und Dina blieben allein.
»Verzeihen Sie mir, Dina, ich konnte gestern nicht kommen.«
»Bitte, ich habe Sie ja heute nicht gebeten, zu kommen.«
Gyldendal fürchtete, sie zu verlieren; jetzt war er nicht mehr von ihrer Liebe zu ihm überzeugt. Deshalb wurde er milder.
»Aber Dina«, sagte er, »weshalb willst du mir böse sein? Sei doch lieb, sei brav, sei mein Liebling!«
Sie schwieg.
»Komm mit mir«, sagte er, »wir gehen wieder zu der alten Kirche – oder nach Schönbrunn – wohin du willst. – Wenn du wüßtest, wie elend mir zumute ist.«
Sie sprang auf. »Du!?« Es war ein fragender, aus dem tiefsten Grunde der Seele kommender Ton –, »Erik!« sanft, milde, traurig, voller Güte – Mitleid – und voll von Liebe. Sie gingen fort, und Erik fühlte sich ruhiger werden, er spürte nicht mehr die bösartige, wütende Gewalt des geschlechtlichen Wollens. Er war glücklich darüber, daß er ruhig war. Unten bei den Käfigen in Schönbrunn wurden sie beide übermütig, wie Kinder, welche die Schule geschwänzt haben, neckten die Tiere hinter dem Gitter und neckten einer den andern.
Plötzlich holte Dina aus ihrer Tasche ein kleines Päckchen hervor und reichte es ihm hin.
»Was soll das sein?« fragte Erik. »Rate nur«, lachte sie, ganz rot im Gesicht. Es war eine kleine, aus Golddraht gestrickte Börse, welche Dina gestern morgen für Gyldendal gekauft hatte. Gyldendal, beschämt und gerührt, nahm an.
Der Tag war schön, friedlich und herbstlich, voller Milde, feuchtem Glanz und Resignation. Er hoffte, er rechnete auf den Schlaf in dieser Nacht, ja, er war dessen sicher. Er schlief von neun bis zwei Uhr ganz ruhig, aber dann kamen böse Gesichte und Erscheinungen – Begierden von solcher Gewalt, und er stand ihnen so hilflos, so ganz unglücklich gegenüber, daß er sich mitten in der Nacht ankleidete und auf die Straße hinablief und in die innere Stadt ging, endlose Straßenzüge entlang, in denen nur ab und zu ein verschlafener Droschkenkutscher, ein verliebtes Paar oder eine Prostituierte zu sehen war.
Er hatte nie etwas von dieser Art gefühlt. In seinem Leben der Wissenschaft hatte er nie Platz dafür gehabt. Er hatte nie eine Frau berührt; und er begriff es auch jetzt noch nicht, wie man eine Frau umarmen konnte, die man vor einer Stunde nicht gekannt hatte. Er wollte nie von sexuellen Dingen reden hören, es ekelte ihn vor den Worten. Und nun war er mitten in einer Welt von dumpfen, unbestimmten Wünschen und Begierden. Ihm war, als wäre er ein Kahn, der von der Brandung immer wieder unermüdlich gegen die Felsen des Ufers geworfen wird, der dann zurücksinkt, um nach eine Weile wieder gegen den Stein zu prallen. Auch das Wasser brach sich; auch das Wasser wurde gegen den Felsen getrieben, vielleicht fühlte auch Dina etwas von dieser Gewalt. Aber sie konnte es vielleicht ertragen, überwinden, sich getreu bleiben, ihrer Natur als Weib – er aber mußte Dina besitzen oder zugrundegehen. Das begriff er in dieser schrecklichen Nacht.
Er ging in ein Kaffeehaus, starrte bei seiner Schale schwarzen Kaffees all die fremden Leute an: Dirnen, Kellner, Kutscher, Tramwayangestellte, den Schutzmann, der beim Büfett Glühwein trank, und sah nichts als Dina, Dina, die ihm gehörte und die er besitzen mußte. Eine Prostituierte wollte sich ihm auf die Knie setzen. Er stieß sie weg, so wie er den Kellner weggestoßen hätte, wenn er sich ihm hätte auf die Knie setzen wollen.
Es wurde Morgen, es wurde Tag. Nie war Erik so herzlich, so gut zu Dina gewesen wie an diesem Tage, dem 26. November. Es kam ihm vor, als wäre selbst seine Stimme anders, menschlicher, rührender, weicher als sonst. Sie fuhren wieder hinaus nach dem Sillertal – das Kaffeehaus war geschlossen –, tiefe Einsamkeit war ringsum – selten ein Vogelschrei –, hohes, feuchtes Laub unter den Füßen, das nach Pilzen duftete. Auf den Wiesen Herbstzeitlosen. Weit in der Ferne tiefgrüne Flecken Nadelwald unter den grauen, verschleierten Laubbäumen.
»Sieh, Dina«, sagte er; er hatte den Arm um ihre Hüfte gelegt, sie trug ihren großen, schwarzen Hut auf dem Arm. »Dina!« er drückte seinen Kopf in ihr Haar und küßte es. Ganz leise war der Ton seiner Stimme. »Sieh, Dina, die Liebe eines Menschen erkennt man daran, was er dem andern opfern kann.«
»Ja, Erik«, sagte sie.
»Es gibt so viele Arten von Liebe – Liebe, die gerade eine Stunde wert ist oder ein Stück Geld, und eine andre, die alles wert ist – da gibt einer dem andern alles, ohne es sich zu überlegen, aus freiem Herzen, bloß um dem andern Glück zu bringen. Eine Julia ... ihr Herz – ihren Körper, ihr Leben. Ist das nicht schön?«
»Ja«, sagte Dina leise.
»Und könntest du es tun? Könntest du alles für mich tun, mir alles geben? Du?«
»Wie kannst du nur fragen, Erik?«
»Alles, wie Julia?«
»Ja, alles.«
»Das Herz, das Leben?«
»Ja, alles.«
»Den Körper?«
Dina senkte den Kopf und schwieg.
»Ist das das Wertvollste an dir? Das, was du am schwersten geben kannst?«
»Nein«, sagte Dina, »wenn du eine Schwester hättest, würdest du sie nicht mit solchen Fragen quälen!«
»Und weißt du, ob du mich quälst? Ich will nur das eine wissen, kannst du mir alles geben – oder kannst du es nicht?«
»Nein, ich kann nicht«, sagte sie trotzig. »Ich darf nicht, und ich will nicht.«
»Du kannst nicht«, sagte er böse, »weil du zu feig bist, du willst nicht, weil du herzlos bist, und du darfst nicht, weil du zu dumm bist.«
Dina starrte ihn an, mit großen Augen.
»Ja«, sagte er, »soviel ist dir deine Liebe eben nicht wert. Die andern haben alles dem Manne gegeben, geopfert, den sie geliebt haben – aber du stehst unendlich hoch über ihnen. Was soll ich tun? Soll ich zugrunde gehen? Ich schlafe nicht mehr, seitdem ich dich kenne, ich bin unglücklich, ich sehe dich immer vor mir, immer, immer dich, ich sehne mich nach dir, nie in meinem Leben habe ich mich nach jemandem gesehnt wie nach dir. Aber du, Dina, bist kalt, du weißt ja nichts davon, was liegt dir daran?«
Sie schwieg.
Plötzlich warf sich ihm Dina an die Brust, wie damals in dem kleinen Kaffeehaus, wo im Vorgarten der Gärtner altes Laub gesammelt hatte.
Er drückte sie an sich, und Minute um Minute blieben sie stehen, aneinandergepreßt. Erik fühlte Dinas junge, zarte Brust, er hörte das Schlagen ihres Herzens. Er flüsterte:
»Dinka, süße Dinka, sag’ du – –«
»Nein, quäl’ mich nicht mehr, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin nicht kalt, glaub’ es mir! Frag’ Janina, sie weiß es, daß ich nicht schlafen kann, so wie du. Aber das ... nein, ich kann nicht.«
»Soll ich zu einer Dirne gehen, ihr Geld auf den Tisch legen? Soll ich? Schickst du selbst mich hin und wagst noch, mir zu sagen, daß du mich liebst? Nein, solch eine Liebe will ich nicht. Entweder ... oder ...«
In Dina ging etwas Schreckliches vor. Ihr Instinkt fühlte: Der Mann, der so zu dir spricht, kann dich nicht lieben. Dein Instinkt hat recht gehabt. Ein Egoist, wie er, liebt dich nicht, wie du ihn. Tu’s nicht! Ihr Kopf, ihr Verstand sagte: du verlierst ihn, wenn du ihm nicht alles gibst. Du gehörst ja schon ihm, keinen Mann wirst du nach ihm lieben. Tu’s. Sie schwieg. Ein gutes, ein freundliches Wort von ihm, und sie hätte sich ihm hingegeben, ohne Zaudern. Sie wäre für ihn zugrunde gegangen und an ihm.
Aber ihr Schweigen erbitterte ihn. Er kannte kein Gefühl der Gemeinsamkeit, er verstand sie nicht, so wie er nie in seinem Leben einen andern verstanden hatte. Der luftleere Raum leitete keinen Ton der Außenwelt.