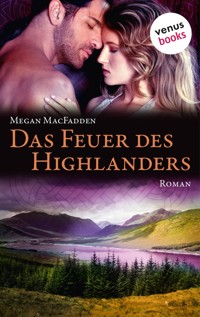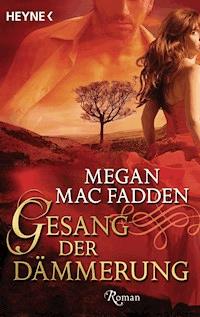
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
England, im 19. Jahrhundert: Die zarte Marian besitzt eine Gabe, von der sie nichts weiß. Mit ihrer Stimme kann sie die Quelle des ewigen Lebens, die einst von den Lichtelben gehütet wurde und nun versiegt ist, wiedererwecken. Doch ihre besondere Befähigung stellt gleichzeitig eine tödliche Gefahr für sie dar, denn die Mächte der Finsternis sind schon auf sie aufmerksam geworden. Wird der zwielichtige Schattenkrieger Darion, der nicht mehr von ihrer Seite weicht, sie retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
England, im 19. Jahrhundert. Seit dem Tod ihrer Eltern ist Marian einsam. Sie zählt die Tage, die sie noch in dem strengen Mädchenpensionat verbringen muss, bis sie endlich volljährig ist. Eines Nachts hat sie im Schlafsaal eine merkwürdige Erscheinung: Ein Fremder beugt sich über sie – und verschwindet in den Schatten der ersten Dämmerung wie ein Geist. Marian ahnt nicht, dass der Schattenkrieger Darion im Auftrag seines dunklen Herrn gekommen ist, um sie zu überwachen. Seltsame Dinge geschehen von nun an, sie gerät unter den Einfluss des undurchsichtigen Gesangslehrers Sereno, zugleich scheinen jedoch auch andere, finstere Kräfte ihre Hände nach ihr auszustrecken. Denn in dem jungen Mädchen schlummert eine überirdische Fähigkeit, die das Angesicht der Welt verändern kann. Wird der Schattenkrieger Darion, der sich in seine schöne Schutzbefohlene verliebt hat, Marian vor den düsteren Machenschaften bewahren können? Oder wird der dunkle Herrscher der Nachtschatten auch ihn vernichten?
Die Autorin
Megan MacFadden ist das Pseudonym einer Autorin, die bereits viele Erfolge im Bereich der Unterhaltungsliteratur vorweisen kann. Ihr Spektrum reicht von historischen Liebesromanen über erotische Literatur bis hin zu humorvollen Ratgebern.
Lieferbare Titel
978-3-641-04333-9 - Die wehrhafte Braut
978-3-641-04557-9 - Herzensstürme
978-3-641-05728-2 - Schattengefährte
Megan MacFadden
Gesang
der Dämmerung
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 07/2013
Copyright © 2013 by Hilke Müller
Copyright © 2013 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Satz: IBV Satz- und Datentechnik GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-08891-0V002
www.heyne.de
Teil I
Kapitel 1
War sie aufgewacht oder träumte sie noch? Marian war sich nicht sicher. Falls es sich hier um einen Traum handelte, war er erstaunlich nah an der Wirklichkeit, denn sie lag in ihrem wackligen Eisenbett im Schlafsaal des Mädchenpensionats. Falls sie aber wach sein sollte – weshalb hatte sie dann dieses seltsam schwebende Gefühl? Es war eine Empfindung, als weilte sie in einer fremden Dimension, in einer sanften und doch beunruhigenden Welt, in der alles möglich war: das Wunderbare, das Beglückende, aber auch das Schreckliche. Eben wie in einer Traumwelt.
Es war die Zeit zwischen Nacht und Morgengrauen. Der Schlafsaal lag noch in tiefer Dämmerung, die Laterne, die nachts immer neben der Eingangstür auf einem hölzernen Schemel stand, war jedoch schon erloschen. Durch die Vorhänge an den hoch angesetzten Fenstern des Saals drang kaum merklich ein erstes fahles Morgenlicht. Nein, sie musste wach sein, sonst hätte sie doch die Schlafgeräusche der Mädchen nicht so deutlich vernommen: Lisas leises Schnarchen und Blasen, Kates beständiges Husten, das Knarren und Quietschen der Metallbetten, wenn eine der Schlafenden sich auf die andere Seite drehte.
Der Saal bestand aus einem schmucklosen, lang gezogenen Raum, in der Mitte von sechs Säulen aus Eichenholz gestützt, rechts und links davon waren die Betten der Mädchen aufgereiht. Es gab für jede der zweiundvierzig Pensionatszöglinge einen Nachttisch – ein ziemlich verschrammtes Möbelstück, das eine Schublade und ein Fach mit zwei Einlegeböden besaß. Dort war Platz für Schachteln, Büchlein, kleine Heimlichkeiten, die nicht für die Augen und Finger der anderen Mädchen bestimmt waren. Abschließen konnte man das Fach nicht. Außer dem Nachttisch und dem Bett stand jedem Mädchen ein schmaler Spind für seine Kleider zur Verfügung – das war alles, was man für sich allein hatte. Auch Bett, Nachttisch und Spind stellten im Grunde nichts Eigenes, sondern Allgemeingut dar. Die Möbel kennzeichneten Kratzer und Scharten zahlloser Vorgängerinnen und ohne Zweifel würden sie, von Marians Gebrauchsspuren ergänzt, später einem anderen Mädchen zugewiesen werden.
Der Morgen graute. Marian konnte inzwischen die ersten beiden Säulen erkennen. Auch einige Betten, die sich in ihrer Nähe befanden, traten aus der Dämmerung hervor. Der Schemel mit dem erloschenen Nachtlicht war jedoch zu weit entfernt. Er verschmolz mit der Wand, genau wie die Eingangstür des Saals und das große schon etwas schadhafte Gemälde, auf dem eine herbstliche Landschaft mit einer Jagdgesellschaft abgebildet war. Das alles war ihr wohlvertraut, es gehörte seit fast zwei Jahren zu ihrem täglichen Leben, ebenso wie der schmale Waschraum nebenan mit den vielen Porzellanbecken und das Speisezimmer mit den zerkratzten Tischen und Stühlen. Und doch hatte Marian jetzt wieder das Gefühl, sich in einem Traum zu befinden. Standen einige der Fenster offen? Es musste wohl so sein, sonst hätten sich doch die Vorhänge nicht gebauscht. Konnte das schwache Morgenlicht bewegliche Schatten im Saal erzeugen?
Etwas Graues strich an der schwarzen Form einer Säule vorüber, ähnlich einem Nebelstreifen oder einem Wesen, das ein weites schleierartiges Gewand trug.
Das wird Miss Woolcraft sein, überlegte Marian. Sie ist im Nachtgewand und geht auf Zehenspitzen zwischen den Betten umher, damit keine von uns aufwacht. Weshalb tut sie das wohl? Ob Emily wieder einmal einen verbotenen Liebesroman von zu Hause mitgebracht hat?
Ein wenig spürte Marian jetzt ihr Herz klopfen, nicht besonders heftig, aber doch lauter und rascher als zuvor. Ihre Vermutung erwies sich als falsch. Die seltsame Erscheinung hatte sich einem der Fenster genähert, war im fahlen Morgenlicht durchsichtig geworden und schließlich zerfallen. Es konnte also auf keinen Fall die füllige und überaus erdenschwere Miss Woolcraft gewesen sein, die den Mädchen Unterricht in Schönschrift, Handarbeit und englischer Literatur erteilte. Und doch war Marian sicher, dass zwischen den Betten der schlafenden Mädchen ein Wesen umhergegangen war, das ihre Gesichter und Körper musterte, als suchte es etwas, das ihm verloren gegangen war.
Marian verspürte bei dieser Erkenntnis keine Angst. Was sie wahrnahm, war ja eine Traumerscheinung, und der Traum hatte nichts Erschreckendes an sich, er war nur seltsam und machte sie neugierig. Wenn dieses Wesen sich in der Nähe der Fenster auflöste, dann vertrug es wohl das Morgenlicht nicht. Doch sobald es sich der Mitte des Raums nähert – dort, wo die Säulen noch als schwarze Schatten in grauer Dämmerung standen –, würde es möglich sein, seine Konturen zu erkennen. Es gab Träume, die man mit seinem Willen beeinflussen konnte, und dieser schien ein solcher zu sein, denn dieses Mal stimmte ihre Vermutung.
Da war sie wieder, die seltsame Gestalt, sie schien sich aus den wehenden Grautönen der Dämmerung zusammenzufügen, war jetzt sogar deutlicher als zuvor, die Umrisse härter, das Wesen fast Materie. Das war kein Nebelstreifen, was da an den Säulen vorüberglitt, um nun auf der anderen Seite des Saals zwischen den Eisenbetten der Schlafenden umherzuschleichen. Es glich auch nicht mehr Miss Woolcrafts üppiger wabernder Form – kein Schleier, kein wehendes Gewand.
Dort stand ein fester Körper, ein Mensch, der sich jetzt ein wenig vornüberbeugte, um ein schlafendes Mädchen zu betrachten. Marian konnte den langen Gehrock erkennen, über dessen Kragen sich ein Schal oder ein Tuch bauschte, das Kinn und Mundpartie des Wesens verbarg. Sicher war nur, dass es sich um einen Mann handelte. Ob alt oder jung, bärtig oder glatt rasiert war nicht auszumachen. Aber vermutlich war er jung, denn sein Haar war rabenschwarz.
Sie träumte, daran konnte nicht gezweifelt werden. Wäre Marian wach gewesen, hätte sie jetzt laut um Hilfe schreien müssen. Ein fremdes männliches Wesen, noch dazu im langen Gehrock, das im Schlafsaal der Mädchen umherstieg und die nur mit ihren Nachthemden bekleideten Zöglinge mit frechem Blick anstarrte – großer Gott! Ein solches Vorkommnis konnte dazu führen, dass das Pensionat in Verruf geriet, schlimmstenfalls sogar seine Pforten schließen musste. Auch der gute Ruf der ahnungslosen Mädchen würde in diesem Fall Schaden nehmen, zumal man befürchten musste, dass der Eindringling es nicht dabei bewenden ließ, die schlafenden Zöglinge nur anzustarren. Nein, Marian hätte spätestens jetzt mit lauter Stimme nach Mrs. Potter, der Institutsleiterin, und Mr. Crincle, dem Hausmeister, rufen müssen. Was sich dann hier im Schlafsaal ereignet hätte, war unschwer zu erraten, denn ihr Geschrei hätte auch die Mädchen aus dem Schlaf gerissen …
Aber da es sich ja nur um einen Traum handelte, tat sie nichts dergleichen. Stattdessen verfolgte sie das Tun des Fremden mit gelassener Neugier, spürte das immer rascher werdende Klopfen ihres Herzens und empfand es als angenehm. Was auch immer dieser Traum mit ihr vorhatte, er war schön und aufregend, denn ihm haftete die süße Verlockung des Verbotenen an.
Die Erwartung schärfte Marians Sinne – oder war es ihr Vorstellungsvermögen? Obgleich der Fremde sich ihrem Bett nur wenig näherte, konnte sie jetzt weitere Details erkennen. Wenn er sich gerade aufrichtete, erschien er ihr sehr groß. Der graue Gehrock saß nur an den Schultern fest an seinem Körper, ansonsten war das Kleidungsstück zu weit und ganz sicher für einen anderen Träger geschneidert. Während die Schlafgeräusche der Mädchen ungehindert an ihre Ohren drangen, verursachte der seltsame Besucher keinen einzigen Laut, nicht einmal seine ledernen Stiefel hörte man knarren, von Fußtritten auf dem steinernen Boden ganz zu schweigen. Er bewegte sich gemächlich, als befände er sich in vollkommener Sicherheit, während doch in jedem Augenblick eine der Schlafenden erwachen und in panisches Geschrei ausbrechen konnte. Auch diese Tatsache bewies, dass das Ganze nur ein Traum war.
Der Mann schien bisher nicht fündig geworden zu sein – oder suchte er vielleicht gar nichts, sondern hatte eigenartigerweise nur Gefallen daran, schlafende Mädchen zu betrachten? Jetzt erschien er wieder in der Mitte des Raumes, blieb dort einen Moment lang zögernd stehen, und während er den Saal abschätzend musterte, konnte Marian endlich sein Gesicht sehen. Er war bartlos, seine Haut von einer fahlen Blässe, die an Mondlicht erinnerte, die Züge ebenmäßig, Kinn und Nase kräftig, die Lippen schmal, doch schön geformt. Seltsam waren seine Augen, die Marian sehr tief und dunkel erschienen und die von Schatten umgeben waren.
Er näherte sich, ging mit lautlosen Schritten auf ihr Lager zu. Sein Körper hatte etwas Schwebendes, als wöge er nichts, doch sie fühlte – konnte man in einem Traum überhaupt fühlen? – einen sachten Luftzug wie einen leisen Hauch, nicht kühl, sondern warm wie der Atem eines Lebenden. Unwillkürlich begann ihr Körper zu zittern, zuerst nur die Hände und Finger, dann floss die Unruhe durch ihre Arme zu ihrem Herzen, verstärkte sein hastiges Schlagen und breitete sich über Bauch und Schenkel bis hinunter zu den Füßen aus. Er schritt direkt auf sie zu, sah weder nach rechts noch nach links, sondern hatte den Blick bereits fest auf sie geheftet, und die plötzliche Beschleunigung seiner Schritte zeigte ihr an, dass er nun ganz offensichtlich fündig geworden war.
Ich bin es, nach der er gesucht hat, dachte Marian, und obgleich sie immer noch keine Angst verspürte, war sie doch erschrocken. Für einen Augenblick war sie versucht, sich die Bettdecke bis an den Hals hochzuziehen, um sich vor diesen dunklen, umschatteten Augen zu verstecken. Dann aber wurde ihr klar, dass er in diesem Fall bemerkt hätte, dass sie wach war und ihn beobachtete. Also blieb sie reglos liegen, halb betäubt vom lauten Hämmern ihres Herzens, und – wieder ein Beweis dafür, dass sie träumte – obgleich sie die Augen geschlossen hielt, konnte sie den schattenhaften Besucher deutlich erkennen.
Sein schwarzes dichtes Haar fiel ihm über Stirn und Schläfen, als er sich über sie beugte. Sie glaubte, zu erstarren, regte kein Glied, obgleich sie innerlich zitterte wie Espenlaub. Durch ihre geschlossenen Lider hindurch konnte sie seine Augen sehen, die schwarz wie die Nacht waren, samtig. Dann meinte sie, einen schwachen dunkelblauen Glanz darin wahrzunehmen. In seinen Zügen las sie lächelndes Erstaunen.
Langsam, fast scheu, hob der Fremde die rechte Hand, ließ sie über Marians Gesicht schweben, und sie fieberte dieser nahenden Berührung entgegen, die das Wunderbarste und Aufregendste sein würde, das sie je in ihrem Leben gespürt hatte.
Da drang der erste Vogelruf aus dem Garten in den stillen Schlafsaal, ein Triller aus voller Brust geschmettert, der Morgengesang eines Amselmännchens, das den erwachenden Sommertag begrüßte. Der dunkle Besucher erstarrte in seiner Bewegung, ließ die Hand sinken, trat von Marians Lager zurück. Er hatte den Kopf gehoben, und sie bemerkte, dass seine Nasenflügel bebten – tatsächlich drang jetzt ein stechender Geruch in den Schlafsaal: Mrs. Crincle verbrannte um diese frühe Stunde gewöhnlich die Gartenabfälle. Marian sah den fremden Gast an den Säulen vorübergleiten, jetzt schon konturenlos, einem Nebel gleich, dann vereinigte sich die Erscheinung mit dem dunklen Viereck des Gemäldes, das inzwischen an der gekalkten Wand erkennbar war.
»Du bist ja schon wach«, vernahm sie die morgenheisere Stimme ihrer Bettnachbarin Kate. »He – gibt’s da auf dem alten Ölschinken was Aufregendes zu sehen, oder starrst du nur so in die Luft?«
Die schwebende, traumähnliche Stimmung zerriss unter Kates fröhlichem Gekicher, und Marian hatte das Gefühl, aus großer Höhe herabzustürzen. Sie seufzte tief und schloss die Augen.
»Ich fürchte, du hast wieder mal Gespenster gesehen, wie?«, meinte Kate nun und gähnte dann herzhaft.
»Aber nein. Es war … ich dachte, ein Vogel hätte sich in den Saal verirrt …«
»Ein Vogel?«, fragte Kate ungläubig und rieb sich die Stirn, weil die schweißfeuchten roten Löckchen kitzelten. »Wohl eher eine Fledermaus.«
Kate hatte keine Zeit mehr, über ihren Scherz zu kichern, denn in diesem Augenblick vernahm man die wohlbekannten und allseits verhassten Schritte der Pensionatsleiterin auf dem Steinfußboden des Flurs. Der Messingknauf quietschte, als Mrs. Potter die Tür öffnete – es war seltsam, dass Mr. Crincle niemals auf die Idee kam, diesen Knauf zu ölen. Mrs. Potters Händeklatschen schallte wie eine Salve Pistolenschüsse durch den Schlafsaal.
»Aufstehen – die Nacht ist vorbei! Heute ist die gelbe Gruppe zuerst im Waschraum, dann die blaue und am Schluss die grüne. In einer halben Stunde will ich euch alle beim Frühstück sehen! Und wenn ich sage ›alle‹, dann meine ich genau das!«
Kapitel 2
Wie immer klangen die Stimmen der Mädchen beim Absingen des fünfstrophigen Morgenliedes ziemlich heiser, auch fehlte die rechte Begeisterung, denn alle waren hungrig und hätten sich gern niedergesetzt und mit dem Frühstück begonnen. Mrs. Potter erteilte die Erlaubnis dazu jedoch erst, nachdem sie das obligate Morgengebet gesprochen und alle Zöglinge an die Tugenden eines jungen Mädchens – nämlich Fleiß, Gehorsam und Bescheidenheit – gemahnt hatte. Früher hatte sie dem noch einige Sätze über die Bestimmung der Frau zur Ehefrau und Mutter angeschlossen, da aber zwei der Neuzugänge unter Blutarmut litten und schon mehrfach während Mrs. Potters Morgenansprache bewusstlos zu Boden gesunken waren, hatte die Leiterin sich inzwischen zu einer gekürzten Version entschlossen.
»Setzt euch jetzt zum Frühstück nieder! Ich will kein albernes Geschwätz und kein Gekicher hören – Jessica Meller, ich habe deine Grimasse sehr wohl gesehen und werde einen Eintrag machen …«
Mit einem Plumps ließ die mollige Lisa sich auf ihren Stuhl fallen und riss erleichtert den Löffel an sich. Der Stuhl knackte bedenklich unter dem Ansturm ihrer Pfunde, doch das alte Möbelstück hatte schon viele Zöglinge überlebt und wusste auch Lisas beachtlichem Gewicht standzuhalten.
»Wenn diese Pampe doch wenigstens ein wenig süßer wäre!«, seufzte sie, während sie in ihrem lauwarmen Porridge rührte. »Aber natürlich – Zucker und Honig sind teuer, an uns können sie ja sparen!«
»Psst!«, ermahnte die rothaarige Kate sie und sah mit bedeutungsvollem Blick zu Gwendolyn hinüber, die neben Marian saß und scheinbar gleichgültig ihren Löffel ableckte. Gwendolyn stand im Verdacht, solche Äußerungen Mrs. Potter zu überbringen. Das war ihr durchaus zuzutrauen, weil sie gern Mrs. Potters Lieblingsschülerin sein wollte. Neulich hatte sie im Flur vor der Schulleiterin geknickst und gebeten, das zusammengefaltete Schultertuch, das über Mrs. Potters Arm hing, für sie tragen zu dürfen.
Doch die blonde Lisa zuckte nur mit den Schultern und fügte kalt lächelnd hinzu, dass der Porridge heute nicht einmal steif, sondern ausgesprochen wässrig wäre. Sie konnte sich einiges herausnehmen, weil ihr Vater eine Stellung in der Finanzbehörde innehatte. Er war dort zwar kein großes Tier, aber Mrs. Potter und vor allem Mr. Duncester, dem das Pensionat gehörte, hatten großen Respekt vor ihm und behandelten die mollige Lisa stets nachsichtiger als alle anderen Mädchen.
Kate gab es auf und wandte sich lieber Marian zu, die heute ganz besonders verträumt dreinblickte und den Haferbrei gedankenschwer in sich hineinlöffelte.
»Am Sonntag wollen meine Eltern mich besuchen, Marian. Und ich wette, sie haben sich meinen Vorschlag überlegt und laden dich ein! Du liebe Güte – es wäre einfach großartig, wenn du meinen Vetter George kennen lerntest …«
»Ach, Kate! Was du immer für verrückte Einfälle hast! Weshalb sollte ich wohl deinen Vetter George kennen lernen?«
»Weshalb? Natürlich damit er um dich anhält! Er wohnt doch mit seinen Eltern in unserer Straße. Wenn du also seine Frau wärst, könnten wir einander täglich besuchen. Wäre das nicht großartig?«
»Schon …«, murmelte Marian, die von solchen Gesprächen nicht viel hielt. Weshalb dachten eigentlich all ihre Freundinnen an nichts anderes als ihren zukünftigen Ehemann? Aber natürlich, die grüne Gruppe – das waren die älteren Zöglinge, zu denen auch Marian und Kate gehörten – würden das Pensionat in wenigen Monaten verlassen. In diesem Winter sollten die jungen Mädchen dann »in die Gesellschaft eingeführt werden«, was nichts weiter bedeutete, als dass man Jagd auf eine gute Partie zu machen hatte. Für Kate, die in guten Verhältnissen lebte und hier in London eine weitverzweigte Familie besaß, war das nicht allzu schwer. Marians Chancen hingegen standen denkbar schlecht. Ihre Eltern lebten nicht mehr, und die Familie ihres Vaters würde ganz sicher keinen Finger rühren, um dem jungen Mädchen zu einer günstigen Heirat zu verhelfen. Auch ihr Vormund Mr. Strykers, der immer so gönnerhaft tat, würde in dieser Beziehung nicht viel unternehmen. Wenn Kates Eltern sie tatsächlich zu einer Abendgesellschaft einluden, bedeutete das eigentlich eine große Chance für Marian. Dennoch konnte sie sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, Kates Vetter schöne Augen zu machen, um von ihm geheiratet zu werden. Sie war ihm bei einem gemeinsamen Sonntagsausflug im Frühling begegnet. Er war spindeldürr, hatte rotes Haar wie Kate und stotterte vor Schüchternheit.
Am oberen Tischende, wo Mrs. Potter und Miss Woolcraft saßen, war inzwischen auch Reverend Jasper zum Frühstück erschienen, ein pensionierter Geistlicher, der den Mädchen täglich Religionsunterricht erteilte. Er war weißhaarig und hatte eine Nase wie ein Haken, dazu zwang sein Rheuma ihn zu einer gekrümmten Körperhaltung. Dennoch war sein Unterricht nicht übel, denn er konnte die biblischen Geschichten auf spannende Weise erzählen, und wenn er sich einen Scherz erlaubte, blitzten seine kleinen hellblauen Augen unter den buschigen Brauen.
»Der kommt doch bestimmt nur hierher, weil er daheim nichts zu fressen kriegt!«, hatte Lisa einmal behauptet. Marian hatte das ziemlich respektlos gefunden, aber ganz unrecht hatte Lisa nicht. Reverend Jasper, der an allen Mahlzeiten teilnahm, aß mit großer Leidenschaft. Es war geradezu fantastisch, welche Mengen an Kartoffeln, Gemüse und Pudding er verschwinden lassen konnte, während er gleichzeitig mit Miss Woolcraft oder auch den Zöglingen des Pensionats eifrige Gespräche führte. Noch merkwürdiger fand Lisa die Tatsache, dass die Nahrungsmittel bei ihm überhaupt nicht anschlugen. Reverend Jasper konnte noch so viel Pudding vertilgen, er blieb trotzdem dünn wie ein Fädchen.
»Ist das nicht ungerecht? Und ich brauche nur einen Löffel von diesem wässrigen Porridge zu essen – schon muss ich das Mieder zwei Löcher weiter schnüren!«
Wenn Lisa sich über ihren Körperumfang beschwerte – was sie häufig tat –, stieß sie immer einen tiefen theatralischen Seufzer aus. Im Grunde aber störte sie sich kein bisschen an der eigenen Körperfülle, ganz im Gegenteil: Sie war davon überzeugt, wegen ihrer rosigen Pfunde besonders begehrenswert zu sein. Und tatsächlich schien sie – wenn ihre Ferienberichte nicht gelogen waren – bei den jungen Herren in ihrer Bekanntschaft viele Sympathien gewonnen zu haben. Dies war aber – und da waren Kate und Marian sich sicher – weniger ihrem molligen Körperbau als vielmehr ihrer unbefangenen, selbstbewussten und fröhlichen Art zu verdanken.
Marian hatte ihren Porridge noch nicht aufgegessen, da erhob Mrs. Potter sich und klatschte in die Hände. Damit war das Frühstück beendet. Man sah, wie Reverend Jasper sich den Mund mit der Serviette abwischte und rasch einen Schluck Tee nahm, da er jetzt das Gebet zum Tagesbeginn sprechen musste.
»Herr, schenke uns Deine Gnade bei allem, was wir heute verrichten werden, gib uns Zuversicht und Fröhlichkeit, und lass uns nicht …«
Immer noch konnte man den Rauch riechen, der aus dem Garten in den Speiseraum drang. Mrs. Crincle hatte an diesem Morgen offensichtlich eine ordentliche Menge an Unkraut und trockenen Ästen angezündet. Während Marian mit den übrigen Mädchen der grünen Gruppe zum Klassenzimmer ging, schnupperte sie immer wieder und fand, dass der Rauch heute anders roch als sonst. War das Salbei? Thymian? Pfefferminze?
»Das stinkt wirklich bestialisch«, bemerkte Lisa hinter ihr. »Sie muss das halbe Kräuterbeet in Brand gesteckt haben, die verrückte Person!«
Marian blieb an einem der kleinen Flurfenster stehen, um einen kurzen sehnsüchtigen Blick in den Garten zu werfen. Er war weitläufig, denn das Gebäude, in dem sich das Mädchenpensionat befand, war vor Zeiten der Wohnsitz einer adeligen Familie gewesen. Als der letzte Spross des Adelsgeschlechts den Familienbesitz verkauft hatte, waren Haus und Parkanlage schon ziemlich verfallen gewesen. Mr. Duncester hatte mit dem Kauf dennoch ein Schnäppchen gemacht: Er ließ das alte Herrenhaus notdürftig renovieren und umbauen, der Park wurde größtenteils in einen Gemüsegarten verwandelt, um die Kosten für die Ernährung der Pensionatszöglinge niedrig zu halten. Mr. Crincle, der Gärtner, wurde bei seiner Arbeit von den Zöglingen unterstützt. Unkraut jäten, den Boden lockern oder die Obst- und Gemüseernte waren Teil des Erziehungsprogramms.
Marian liebte diesen Garten trotz allem. Es war Anfang Mai, und die Apfelbäume reckten ihre blühenden Zweige über die Wiese. In den abgezirkelten Beeten wuchsen Kohlpflänzchen, Feldsalat und Petersilie, das helle Kraut der Karotten schoss aus dem Boden, Schnittlauch wucherte in dichten saftig grünen Büscheln. Weiter draußen lagen die Felder mit Kartoffeln, Bohnen und sogar Hafer, dahinter verloren sich die Pflanzungen zwischen den letzten alten Bäumen der ehemaligen Parkanlage. Es waren gewaltige Eichen und Buchen, die dort nahe der bröckeligen Ummauerung wie Wächter einer vergangenen Zeit überdauert hatten. Auch eine Pinie und einige Zypressen hatten sich dazwischen verirrt, vermutlich hatte der adelige Vorbesitzer die Schösslinge von einer Italienreise mitgebracht.
»Es hat gewirkt«, sagte jemand draußen im Garten. »Salbei und Pfefferminze haben ihn vertrieben.«
Marian erkannte die Stimme von Mr. Crincle, dem Gärtner. Er war ein merkwürdiger Kauz, Lisa hatte ihn einmal ein Monster genannt, was ganz sicher übertrieben war. Alles an ihm war lang und dürr, besonders seine Arme und Hände, dazu hatte er ein lahmes Bein und humpelte. Aber Kate schwor Stein und Bein, dass er sich trotz dieses Handicaps mit großer Schnelligkeit bewegen konnte. Angeblich hatte sie ihn einmal hinten bei den alten Bäumen wie ein Wiesel umherrennen gesehen.
»Aber es wird nicht lange anhalten«, erwiderte jetzt Mrs. Crincle. »Jetzt, wo er uns entdeckt hat, werden sie kommen.«
»Er hat nicht nach uns gesucht, Millie.«
»Gewiss nicht. Aber er ist dennoch auf uns aufmerksam geworden – schon wegen des Räucherwerks.«
»Wir mussten das tun, Millie. Sie ist eine von uns, und wir müssen sie schützen.«
»Wir können sie nicht schützen, Josef. Wir sollten lieber an uns selbst denken …«
»Aber wenn sie diejenige ist, die sie suchen?«
»In diesem Fall werden sie ihr nichts tun.«
»Zuerst wohl nicht …«
Marian stand immer noch am Fenster, obgleich alle anderen Mädchen längst im Klassenraum verschwunden waren. Ein vielstimmiges Summen erhob sich jetzt in ihren Ohren, bedrohlich wie ein Bienenschwarm, und sie verspürte plötzlich eine unbestimmte Angst. Was für ein seltsames Gespräch! Wen hatten die beiden schützen wollen? Und vor wem?
Ich muss vollkommen verrückt sein, sagte sie sich und trat vom Fenster zurück. Vermutlich reden sie von irgendwelchen Gartenschädlingen, die Mrs. Crincle heute Früh durch ihr stinkiges Räucherwerk vertrieben hat. Mücken vielleicht oder Wühlmäuse. Am Ende hat sie die Kartoffelkäfer, die sich letztes Jahr in übergroßer Zahl auf dem Kartoffelkraut eingefunden hatten, mit ihrem Rauch in die Flucht schlagen wollen.
Das Summen in Marians Gehör verlor sich, und sie lief rasch ins Klassenzimmer, wo Reverend Jasper bereits seinen Platz vorn am Lehrerpult eingenommen hatte. Er bedachte sie mit einem strafenden Blick, als sie in den Raum schlüpfte und sich hastig auf ihren Stuhl setzte, doch er sagte nichts. Reverend Jasper hatte eine Schwäche für Marian, es geschah selten, dass er sie tadelte, und manchmal versuchte er sogar, sie Mrs. Potter gegenüber in Schutz zu nehmen.
»Der Reverend mag dich, weil du solches Engelshaar hast«, hatte Lisa einmal gewitzelt. »Wirklich, wenn man dir zwei Flügelchen an den Rücken binden würde, könntest du gut als Weihnachtsengel durchgehen.«
Marian hatte sich über diesen Vergleich geärgert, denn sie hielt nicht viel von Engeln. Außerdem war ihr krauses hellblondes Haar fürchterlich störrisch, sodass sie am Morgen zum Kämmen und Zusammenbinden meist doppelt so viel Zeit brauchte wie die anderen Mädchen.
»Und wenn du ein Ringelschwänzchen hättest, könntest du leicht für ein Schweinchen gehalten werden«, hatte Marian mit spitzer Zunge zurückgegeben.
Leider verfehlte die Beleidigung ihre Wirkung, denn Lisa lachte nur fröhlich und drückte sich den Zeigefinger gegen ihre Stupsnase, um daraus so etwas wie einen kleinen Schweinerüssel zu formen. Dieses Mädchen besaß ein solch dickes Fell, dass selbst eine Kanonenkugel daran abgeprallt wäre.
Reverend Jasper hatte inzwischen die Bibel aufgeschlagen und einige Verse vorgelesen, danach aber war er vom Bibeltext abgekommen und erzählte die Geschichte mit seinen eigenen Worten. Drei Weise aus dem Morgenland liefen einem Stern hinterher, weil sie fest daran glaubten, er würde sie zu dem neugeborenen König führen. Was für Dummköpfe sie doch waren! Ausgerechnet bei dem hinterlistigen König Herodes erkundigten sie sich nach dem Weg, und natürlich hatte dieser nichts anderes im Sinn, als diesen frisch geborenen Konkurrenten aus der Welt zu schaffen.
»Suchet ihn nur!«, meinte Herodes zu den Weisen. »Und wenn ihr ihn gefunden habt, dann sagt mir, wo er ist …«
Marian stützte ihren Kopf in die Hände und freute sich an dem gleißenden Sonnenstrahl, der wie ein leuchtender Schleier quer durch den Raum fiel. Gleich würde Lisa den Finger heben und vorschlagen, die Gardinen zuzuziehen, weil das Licht sie blendete und sie nicht schreiben könnte. Marian hingegen hatte niemals Schwierigkeiten, ins Licht zu sehen. Es musste an ihren Augen liegen, sie konnte sogar in die Sonne schauen, so lange sie wollte, es schadete ihren Augen kein bisschen.
Auch wenn Reverend Jasper sich Mühe gab, die Geschichte recht anschaulich zu erzählen – Marians Gedanken schweiften heute ab. Vielleicht lag es an der schläfrigen Stimmung, die über dem Klassenzimmer hing. Auch Kate schien vor sich hinzudösen, und Lisa hatte sogar die Augen geschlossen. Dazu vernahm Marian das beharrliche Summen einiger Stubenfliegen, die immer wieder verzweifelt versuchten, durch die Fensterscheiben hindurch in den blühenden Garten zu gelangen.
Was das heute Früh doch für ein merkwürdiger Traum gewesen war! Sie hatte doch geträumt, oder etwa nicht? Marian beschloss, nicht mehr über dieses Problem nachzudenken. Im Grunde war es gleich, ob Traum oder nicht, es war auf jeden Fall nicht die Wirklichkeit gewesen. Leider nicht. Sie spürte noch einmal dem Moment nach, als der geheimnisvolle Fremde sich über sie beugte und mit nachtblauen, dunkel umschatteten Augen betrachtete. Ein süßer Schauder durchlief ihren Körper, eine aufregende Mischung aus Sehnsucht und Erschrecken. Noch nie hatte sie etwas so sehr herbeigewünscht wie die Berührung seiner Hand, und zugleich verspürte sie die unbestimmte Furcht, dabei Schaden zu nehmen, vielleicht sogar daran sterben zu müssen.
»Was wissen wir noch über die drei Weisen? Marian!«
Reverend Jasper blinzelte mit leichtem Spott zu ihr hinüber, denn es war ihm nicht entgangen, dass Marian vor sich hinträumte. Das Mädchen fuhr tatsächlich zusammen und erhob sich von ihrem Stuhl, wie es eine Schülerin üblicherweise zu tun hatte, wenn sie aufgerufen wurde.
»Sie … sie kamen nach Bethlehem und brachten dem Jesuskind Gold, Weihrauch und … und … noch was.«
»Aha!«, tat Reverend Jasper erstaunt, obgleich diese Antwort nun wirklich leicht gewesen war. »Gold, Weihrauch und was noch? Wer weiß es?«
»Myrten!«, vermutete Gwendolyn mit ernsthafter Miene.
Reverend Jasper behielt Haltung und bemerkte nur bissig, es gäbe Mädchen, die Tag und Nacht über ihr künftiges Hochzeitskleid und den dazugehörigen Myrtenkranz nachsinnen würden, im Stall von Bethlehem hätte es für derartigen Tand jedoch keine Verwendung gegeben.
»Gold, Weihrauch und …?«, forschte er und ließ seinen Blick im Zimmer umherwandern.
»Möhren«, schlug Lisa vor und erntete Kopfschütteln.
»Na, die konnten sie doch wirklich gebrauchen«, verteidigte sie sich unverdrossen. »Für den Ochsen und den Esel!«
Betsy wusste die richtige Antwort, sie hatte sich schon eine ganze Weile gemeldet, doch Reverend Jasper nahm sie nicht dran. Das schmale blasse Mädchen hatte eine ungeheure Merkfähigkeit, sie lernte ganze Kapitel aus der Bibel ohne Schwierigkeiten auswendig. Mit dem Verständnis für das Gelernte haperte es jedoch. Auch jetzt konnte sie nicht erklären, was Myrrhe eigentlich war.
»Das ist ein Harz, so ähnlich wie Weihrauch«, erklärte der Reverend. »Ein sehr teures und wertvolles Geschenk. Braune Krümel, die man anzündet, damit sie ihren Räucherduft verbreiten. Räucherwerk dient dazu, unreine Geister zu vertreiben …«
Die Tür des Unterrichtsraums wurde ohne Vorwarnung geöffnet, und Mrs. Potter platzte herein. Als Leiterin von Schule und Pensionat nahm sie sich die Freiheit heraus, in jeden Raum einzutreten, ohne sich vorher durch Anklopfen bemerkbar zu machen. Sie drückte sich den Zwicker, der an einem Seidenband vor ihrer flachen Brust baumelte, auf die Nase und überflog die Reihen der Schülerinnen.
»Marian Lethaby!«
Marian fuhr von ihrem Stuhl hoch, begleitet von mitleidigen und hämischen Blicken ihrer Mitschülerinnen. Oha, da musste ja etwas Schlimmes passiert sein, wenn Mrs. Potter höchstpersönlich anrückte! Arme Marian! Die Potter konnte sie sowieso nicht leiden.
»Ja, Mrs. Potter?«
Die Schulleiterin betrachtete das Mädchen von oben bis unten, als müsste sie Maß für ein neues Sommerkostüm nehmen.
»Folge mir! Du hast Besuch.«
»Ja, Mrs. Potter …«
Besuch – das konnte eigentlich nur Mr. Strykers, ihr Vormund sein, andere Leute besuchten sie nicht. Erleichtert atmete Marian auf, im Vorübergehen stieß sie zu ihrem Unglück jedoch an ein Buch, das auf Kates Pult gelegen hatte und nun mit einem lauten Knall auf den Boden fiel. Hastig bückte sie sich, um das Missgeschick wieder in Ordnung zu bringen, und sah dann kurz in Lisas grinsendes Gesicht. Die hatte gut lachen, sie war bei Mrs. Potter gut angeschrieben, da musste schon viel passieren, dass Lisa einmal bestraft wurde!
»Kannst du nicht aufpassen?«, schalt auch schon die Schulleiterin. »Heute Nachmittag, wenn die anderen im Garten sind, wirst du dich in der Küche nützlich machen!«
»Ja, Mrs. Potter …«
Marian ging hinter der Schulleiterin her, und sie hatte Mühe, ihren Zorn zu verbergen. Wie gemein und ungerecht diese Frau war! Nur weil sie einen kleinen Augenblick nicht aufgepasst hatte, sollte sie nun den ganzen schönen Nachmittag in der dunklen Küche verbringen, um beim Abwasch zu helfen und Zinngefäße zu polieren! Ach, und sie sehnte sich so nach dem Garten, den grünenden Pflanzen und den hohen alten Bäumen, den duftenden Blüten und dem lauen Frühlingswind, der Rock und Bluse bauschte …
Aber Marian hätte sich lieber die Zunge abgebissen, als Mrs. Potter um eine Milderung der Strafe zu bitten. Oh nein, sie würde nicht zu Kreuze kriechen! Aber schade war doch, dass dieses blöde Buch nur auf den Fußboden und nicht auf Mrs. Potters empfindliche Zehen gefallen war.
Mr. Strykers erwartete Marian im Speiseraum, der inzwischen von den beiden Küchenfrauen aufgeräumt und für das Mittagessen mit Suppentellern eingedeckt worden war. Mr. Strykers hatte sich jedoch die Freiheit genommen, die Teller am Kopfende des Tisches – dort, wo er sich niedergelassen hatte –, zusammenzuschieben, um seine Ellenbogen auf der Tischplatte aufstützen zu können. Als Mrs. Potter mit Marian in den Raum trat, erhob er sich höflich und machte in Richtung der Pensionatsleiterin eine kleine Verbeugung. Mrs. Potter, die schon über fünfzig und seit zwanzig Jahren verwitwet war, quittierte diese Höflichkeit mit einem geradezu herzlichen Lächeln, das zwei rote Tupfer auf ihre gelblichen Wangen zauberte. Marian kannte das bereits – Mr. Strykers war zwar dick und hässlich, dennoch machte er jeder Frau den Hof, gleich ob jung oder alt, verheiratet oder ledig, Küchenmagd oder Leiterin eines Mädchenpensionats. Und erstaunlicherweise hatte er dabei ziemlich oft Erfolg. Was wohl Mrs. Strykers dazu sagen mochte? Sie sollte eine »respektable Dame aus guter Familie« sein, zumindest hatte Strykers sie einmal so bezeichnet.
»Ich bin wirklich untröstlich, dass ich Ihnen solche Unannehmlichkeiten bereite, meine liebe Mrs. Potter!«, rief er und legte theatralisch eine Hand dorthin, wo unter der seidenen Weste seine Brust sein sollte, wo aber eigentlich schon der Bauchansatz war.
»Aber lieber, geschätzter Freund«, gab Mrs. Potter zurück, und ihre Stimme erschien Marian jetzt ganz ungewohnt weich, geradezu schmelzend. »Ich weiß doch, wie sehr Sie von Terminen bedrängt werden, da ist es doch selbstverständlich, dass wir uns ein wenig nach Ihnen richten.«
Tatsächlich war Mr. Strykers Rechtsanwalt und hatte angeblich viel zu tun. Während Eltern, Verwandte oder Vormunde der Zöglinge normalerweise am Sonntag kamen, wenn die Mädchen Besucher empfangen durften, konnte Mr. Strykers es sich erlauben, mitten in der Woche am Vormittag hereinzuschneien, um ein paar Worte mit seinem Mündel zu reden. Jetzt, da Marian vor ihn trat, um ihn mit einem höflichen Knicks zu begrüßen, nahm sie auch den zarten Duft nach Wacholdergeist wahr, der ihr mit dem Atem ihres Vormundes entgegenwehte. Aha, er hatte vermutlich zuvor mit Mrs. Potter in ihrem geheiligten Boudoir, das die Mädchen so gut wie nie betreten durften, gesessen und mit der Dame einen Wacholderlikör getrunken! Ach was – mindestens vier bis fünf Likörchen hatte er intus, Mrs. Potter hatte sich gewiss nicht geizig gezeigt!
»Guten Morgen, Marian. Nein, wie hübsch du geworden bist, mein Kindchen! Haare wie gesponnenes Silber, Augen, so unergründlich wie der weite Ozean und die Lippen so rot wie frische Kirschen …«
Er hatte ihr die Hand gereicht, und als sie die ihre hineinlegte, schnappten seine Finger zu wie ein Fangeisen. Mit einer Festigkeit, gegen die Marian keine Chance hatte, umschloss er ihre Hand und hielt sie, seine Finger waren grob und heiß, rieben sich begehrlich an ihrer jungen Haut.
»Guten Morgen, Mr. Strykers …«
Sie zog an ihrer Hand, bekam sie jedoch immer noch nicht frei. Währenddessen spürte sie die hasserfüllten Blicke von Mrs. Potter, der Strykers begeisterte Komplimente in Richtung des jungen Mädchens überhaupt nicht gefallen hatten.
»Nun, ich sehe, dass ich Sie beide jetzt wohl besser allein lasse«, bemerkte die Pensionatsleiterin unterkühlt. »Sie haben gewiss einige wichtige Dinge mit Ihrem Mündel zu besprechen, Mr. Strykers.«
»Oh – nichts, das ich nicht in Ihrer Gegenwart aussprechen könnte, meine liebe Mrs. Potter!«, rief Strykers, seinen Fehler einsehend, und ließ nun endlich Marians Hand los. »Aber natürlich darf ich Sie nicht länger von Ihren Pflichten abhalten.«
Da hatte er recht. Mrs. Potter unterrichtete jetzt eigentlich die Gruppe der blauen Zöglinge, die bei ihr das perfekte Benehmen einer jungen Dame in Gesellschaft erlernten. Vermutlich hatte sie die arme Mrs. Crincle abgestellt, auf die Mädchen aufzupassen, während sie selbst mit Mr. Strykers plauderte und Wacholderlikör trank.
»Setz dich hier neben mich, Marian!«, befahl Strykers, als Mrs. Potter den Speiseraum verlassen hatte. »Wir haben ein paar Kleinigkeiten miteinander zu besprechen, nichts Weltbewegendes, aber es muss ja doch alles geregelt sein.«
Er zog die Lippen breit und lächelte, wobei er sich bemühte, seine Zähne nicht zu zeigen. Marian hatte jedoch längst gesehen, dass ihm ein Schneidezahn fehlte und auch der Rest seines Gebisses nicht viel wert war. Bevor sie sich setzte, zog sie den Stuhl ein wenig weiter von ihm fort, weil sie seine Neigung kannte, mit den Knien ihre Beine zu berühren, und ekelte sich davor. Sie hatte jedoch Pech, denn Strykers rutschte mitsamt seinem Stuhl einfach ein Stück näher, und der Abstand, den sie listig geschaffen hatte, war so wieder aufgehoben.
»Da wäre diese Einladung, Marian«, begann Strykers und unternahm einen Versuch, seine seidene Weste ein wenig herabzuziehen. Sein Bauch war jedoch so füllig, dass das Kleidungsstück gleich wieder hochrutschte.
»Mrs. Featners schickte sie mir – sie ist die Mutter deiner Freundin Kate, wie du ja weißt. Man möchte dich zu einer Abendgesellschaft bitten, was ich jedoch als sehr unpassend empfinde. Außerdem fehlt mir die Zeit für derartige Kindereien.«
»Aber … Sie müssen mich nicht auf diese Abendgesellschaft begleiten, Mr. Strykers. Ich bin ja Kates Freundin, sozusagen ein Familienmitglied, und brauche keinen Begleiter.«
Marian war zwar an dieser Abendgesellschaft wenig gelegen, sie wollte ihre Freundin Kate jedoch nur ungern enttäuschen. Kate war ein aufrichtiger und anhänglicher Mensch, eine Freundin, wie man sie nur selten fand, und auch ihre Eltern waren ausgesprochen nett.
»Nun, ich denke, wir müssen jetzt erst einmal über deine Zukunft reden«, wich Strykers ihr aus. »Im September endet dein Aufenthalt hier, dann wirst du in ein vollkommen anderes Leben eintreten.«
Sie nickte eifrig. Ihr verstorbener Vater hatte ihr einen kleinen Landsitz, genannt »Maygarden«, hinterlassen, außerdem ein nicht unbeträchtliches Vermögen, das ihren Lebensunterhalt sicherte. Sie würde also nach Yorkshire zurückkehren und in dem schönen alten Landhaus wohnen – dort, wo sie früher mit ihren Eltern so glücklich gewesen war. Es war zwar reichlich einsam, aber sie liebte diese hügelige waldreiche Landschaft. Sie würde lange Ausritte unternehmen, ihre Freunde einladen, Bücher lesen und Klavier spielen. Vielleicht auch heiraten, irgendwann, wenn sich der Richtige fand.
Marian zuckte zusammen, da sie jetzt wieder die Annäherung von Strykers feistem Knie an ihrem rechten Bein spürte. Er strich an ihrem Oberschenkel entlang, kostete den Moment ihrer Überraschung aus, um sein Knie fest an ihr zu reiben, und blies ihr dabei seinen warmen Wacholderatem ins Gesicht. Als sie jetzt angewidert mit dem Stuhl beiseiterückte, hörte sie ihn unwillig knurren.
»So sitz doch ruhig, Mädchen!«, tadelte er sie. »Weshalb bist du so nervös? Ich meine es gut mit dir, das weißt du doch.«
»Natürlich, Mr. Strykers.«
Ihre Stimme klang kühl, und der Blick ihrer blauen Augen war so eisig, dass sogar dem eingefleischten Schürzenjäger klar wurde: Hier gab es für ihn nichts zu gewinnen. Verärgert zog er sich zurück, holte seine goldene Taschenuhr aus der Westentasche und pfiff durch die Zähne.
»Du liebe Güte, wie spät es geworden ist! Hör mir jetzt zu, Marian, und unterbrich mich nicht mehr! Was ich dir zu sagen habe, ist nicht unwichtig.«
Marian dachte amüsiert, dass sie ganz gewiss nicht die Ursache für seine Verspätung war. Doch sie schwieg – je eher er ausspuckte, was er zu sagen hatte, desto rascher würde er wieder von hier verschwinden.
»Ein junges Ding wie du, Marian, kann in der heutigen Zeit nicht ausschließlich auf eine Heirat hoffen, um versorgt zu sein. Ich denke, du solltest dir deine musikalischen Fähigkeiten zunutze machen – man weiß nie, ob du nicht später einmal allein zurechtkommen musst, dann könntest du singen oder Klavierstunden geben …«
Marian begriff nicht recht. Sie besaß doch ein kleines Vermögen, das Strykers als ihr Vormund für sie verwaltete, dazu ein Landgut. Damit war sie im Vergleich zu vielen anderen Mädchen hier im Pensionat sehr gut gestellt. Wenn sie volljährig war – also in drei Jahren –, würde sie ihr Vermögen selbst verwalten, das hatte sie sich fest vorgenommen. Es sei denn, sie war bis dahin verheiratet, dann – so war es von Gesetzes wegen geregelt – würde ihr Ehemann über ihren Besitz verfügen. Wieso glaubte Strykers, sie könnte eines Tages so arm sein, dass sie ihren Lebensunterhalt mit Musikunterricht verdienen musste?
»Aber meine verstorbene Mutter hat mir das Singen verboten, Mr. Strykers«, wandte sie ein, froh, dass ihr das noch eingefallen war.
Er schüttelte unwillig den Kopf, wobei seine schlaffen Wangen hin und her wabbelten. Das wäre purer Unsinn, meinte er. Sie hätte eine sehr schöne Stimme, das wäre bereits aufgefallen.
»Vor einigen Tagen sprach ein gewisser Sereno bei mir vor. Ein Professor für Belcanto, natürlich italienischer Herkunft, aber er unterhält hier in London eine Schule für Gesangskunst. Ich habe mich erkundigt – er ist kein Unbekannter und hat schon einige junge Talente ausgebildet, die später sogar auf der Bühne und im Konzertsaal zu Ruhm und Ehre kamen …«
Marian starrte ihren Vormund ungläubig an. Was erzählte er ihr denn da für Märchen? Woher sollte dieser geheimnisvolle Professor wissen, dass sie, Marian, eine schöne Stimme hatte? Sie kannte ihn ja gar nicht!
Strykers hatte ihre Zweifel erraten und bemühte sich, sie zu zerstreuen. Mr. Sereno hätte Sonntag vor zwei Wochen in der Kirche St. Jacob die Messe besucht, weil eine seiner Schülerinnen dort eine Kirchenarie vortrug. Bei dieser Gelegenheit hätte er Marians Stimme gehört, die – so hätte er sich ausgedrückt – beim Singen der Choräle wie flüssiges Silber aus den Stimmen der anderen Pensionatszöglinge herausstach.
»Er wird am Sonntag vorbeikommen, Marian, und ich wünsche, dass du ihm vorsingst!«
Das klang wie ein Befehl. Auch der Ausdruck seiner blassgrauen Augen hatte sich gewandelt, alle Begehrlichkeit war daraus verschwunden. Stattdessen entdeckte Marian dort eine seltsame Hast, die ihr verdächtig vorkam. Ihr Vater hatte diesem Mann vertraut, ihn bei Rechtsangelegenheiten als Anwalt und Notar herangezogen, in seinem Testament hatte er Strykers zum Vormund seiner Tochter bestimmt. Aber ihr Vater war ein weltfremder, liebenswerter Einzelgänger gewesen – konnte es sein, dass er sich in Strykers getäuscht hatte?
»Ich werde nicht singen, Mr. Strykers!«, erwiderte sie entschlossen und hob den Kopf, um seinem Blick zu begegnen. »Ich habe es meiner Mutter versprochen und werde mein Versprechen halten.«
Strykers spürte, dass er keine Chance hatte. Dieses Mädchen benahm sich zwar meist wie ein scheues Reh, wenn sie jedoch zu etwas entschlossen war, konnte man ihr nur schwer beikommen.
»Verdammt – weshalb bist du so stur, Mädel!«, seufzte er und sah bekümmert zu Boden. »Ich meine es wirklich gut mit dir. Es gibt nicht wenige junge Leute, die Leben und Seligkeit dafür geben würden, von Sereno unterrichtet zu werden. In Scharen belagern sie ihn, flehen ihn auf Knien an, versuchen, seine Angestellten zu bestechen – nur um ihm vorsingen zu dürfen. Und zu dir kommt er selbst gelaufen!«
»Es tut mir leid, Mr. Strykers«, beharrte sie dickköpfig.
Es ging ihr weniger um dieses Versprechen, das sie in Wirklichkeit gar nicht gegeben hatte. Ihre Mutter hatte sie tatsächlich einmal gebeten, niemals öffentlich zu singen – das war jedoch schon lange her, und Marian hatte es fast vergessen gehabt. Aber erstens hatte sie Lust, sich diesem ekelhaften Kerl zu widersetzen, und zweitens hegte sie den Verdacht, dass die ganze Geschichte von diesem großartigen italienischen Gesangsprofessor nur ein Schwindel war. Strykers verheimlichte ihr etwas, und so jung sie auch war, sie ahnte, dass es mit dem Vermögen zusammenhing, das ihr Vater ihr hinterlassen hatte.
Ihr Vormund nahm die Entschuldigung mürrisch zur Kenntnis und meinte nur, sie könnte ihre Entscheidung dem Professor am Sonntag ja selbst verkünden, er wäre nun einmal angesagt und würde gewiss auch kommen. Dann zog er zum zweiten Mal seine goldene Taschenuhr zurate, und als er das gute Stück wieder in die Westentasche zurücksteckte, hatte Marian Gelegenheit, die blitzenden Diamantsplitter zu bewundern, die auf dem Uhrendeckel eingesetzt waren. Sie schienen vor ihren Augen förmlich zu explodieren, und die Lichtblitze, die sie aussandten, leuchteten in allen Farben des Spektrums.
Mrs. Potter musste draußen gelauscht haben, denn sie trat genau in dem Augenblick in den Speiseraum, als Mr. Strykers Marian verkündete, sie könnte jetzt wieder in den Unterricht zurückgehen, das Gespräch wäre beendet.
»Am Sonntag gegen drei Uhr wird Marian einen wichtigen Besuch erhalten«, hörte Marian ihn zu Mrs. Potter sagen, während sie selbst schon an der Tür war. »Ich hoffe, das Klavier im Salon ist gut gestimmt? Wenn nicht, dann empfehle ich Ihnen …«
Sie schloss die Tür hinter sich und tat einen tiefen Atemzug, um das ungute Gefühl loszuwerden, das sie bei diesem Gespräch erfasst hatte. Wenn ich doch nur schon volljährig wäre!, dachte sie. Dann könnte ich mir einfach eine Kutsche mieten und nach Hause fahren. Wie mag es dort oben in Maygarden wohl aussehen? Bestimmt haben die Angestellten alles verkommen lassen. Ach, es ist so ärgerlich, noch drei lange Jahre warten zu müssen und dabei von diesem widerlichen Kerl abhängig zu sein!
Sie hatte keine Eile, zurück in den Unterrichtsraum zu gelangen, sondern schlenderte gemächlich den Flur entlang und dachte dabei sehnsüchtig an den einsamen Landsitz in Yorkshire. Durch die Flurfenster fielen jetzt die Sonnenstrahlen in breiten glitzernden Streifen in den dämmrigen Flur, und schließlich blieb Marian stehen, um einen Blick in den Garten zu werfen.
Ein zauberhaftes friedliches Bild bot sich ihr. Die Apfelblüten schimmerten in der Morgensonne, als wären die weißen Blütenblättchen mit Silberstaub bestreut. Im hellgrünen Gezweig der Johannisbeerbüsche hatte sich ein Schwarm Sperlinge niedergelassen, zwei Amselmännchen mit blau schimmerndem schwarzen Gefieder wühlten hinten im Kartoffelacker herum. Liebevoll ließ Marian den Blick über die alten Bäume gleiten, die sie an den verwilderten Park von Maygarden erinnerten. Wie knorrig die Eichen gewachsen waren! Sie schienen wie alte kampferprobte Krieger, die sich im Frühling mit zartgrünem Mailaub angetan hatten. Sie warfen bizarre Schatten über das schmale Wiesenstück, das sich an den Kartoffelacker anschloss und vor Jahren einmal eine gepflegte Rasenfläche gewesen war. Marian wollte sich schon vom Fenster abwenden, da bemerkte sie eine Bewegung in den Schattengebilden und sie glaubte zuerst, ein Windstoß habe die Baumkrone der Eiche geschüttelt. Doch der alte Baum stand bewegungslos in der Morgensonne, kein Lüftchen ging, kein Blättchen rührte sich.
Der Schatten auf der Wiese krümmte sich zusammen, formte sich zu einer Gestalt und glitt zum Eichenstamm hinüber. Marians Herz klopfte plötzlich so heftig, dass sie sich am Fensterbrett festhalten musste. Da stand er – und dieses Mal handelte es sich nicht um einen Traum. Der Fremde lehnte ruhig an dem knorrigen Stamm der Eiche, dunkel wie ein Schatten und doch für Marians scharfe Augen nur allzu deutlich erkennbar. Der lächerliche Gehrock, der ihm fast bis zu den Knien reichte. Das Halstuch aus nachtblauem Stoff, schmale graue Beinkleider, halbhohe Stiefel aus Leder. Er hatte den Kopf zurückgelegt, als dächte er über etwas nach, und tatsächlich glaubte sie zu erkennen, dass seine Augen geschlossen waren. Sein Mund stand ein wenig offen, und seine Lippen waren voller, als sie es in Erinnerung gehabt hatte. Eine Verlockung, die ihr bisher fremd gewesen war, ging von diesem Anblick aus. Sie glaubte, plötzlich ein Brennen auf ihren eigenen Lippen zu spüren, als hätte ein glühendes Eisen sie berührt.
Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie am Fenster gestanden und die Erscheinung angestarrt hatte. Vielleicht zog die Wolke schon nach wenigen Sekunden vor die Sonne, vielleicht aber auch erst nach einer halben Stunde – wer konnte das wissen? Doch als die Sonnenstrahlen die Erde nicht mehr erreichten, vergingen auch die Schatten, und die Erscheinung löste sich auf.
Kapitel 3
Er grüßte die Nacht mit einem leisen dunklen Summen, das tief aus seiner Brust drang und die Umgebung mit Wärme erfüllte. Es war angenehm, den Schatten der feuchten Mauer endlich verlassen zu können, aus dem schmalen Streifen Dunkelheit, in den er sich verkrochen hatte, zu voller Größe und Gestalt emporzuwachsen und die Glieder zu recken. Die letzten Stunden des Tages waren eine Qual für ihn gewesen, was er jedoch seiner eigenen Dummheit zurechnen musste, denn er hätte diesen Ort längst im Schutz der Morgennebel verlassen können. So aber blieb ihm schließlich nur der Mauerschatten als Versteck, wo die jahrzehntelange Feuchtigkeit grünes Moos auf Boden und Steinen hatte wachsen lassen, weil kein Sonnenstrahl diese Stelle je erreichte. Besonders ärgerlich dabei war, dass er sich diese Tortur völlig umsonst angetan hatte. Diejenige, die er hatte beobachten wollen, war gar nicht im Garten aufgetaucht.
Er streckte seine Arme empor und dehnte den Brustkorb, spürte, wie das fahle Mondlicht seinen Körper mit sanften Händen streichelte, und überließ sich für ein Weilchen diesem erregenden Gefühl. Den albernen Gehrock hatte er längst abgeschüttelt, auch die übrige Kleidung, die er vorsichtshalber angelegt hatte, um jene, die ihn sehen konnten, zu täuschen. Jetzt bedeckte nur noch das graue Tuch der Nacht seinen Körper, ein anschmiegsamer und zugleich unzerstörbarer Anzug, der ihn wärmte und schützte, solange er denken konnte. Vermutlich war er schon mit dieser zweiten Haut geboren worden.
Er raffte die abgestreiften Kleider und Stiefel an sich, um keine Spuren zu hinterlassen, und stieg als grauer Nebelstreif von der Wiese empor. Behutsam schlängelte er sich durch das krumme Geäst der Eiche und mied die Stelle, wo ein brütender Vogel auf seinem Gelege saß, um ihn nicht unnötig zu erschrecken. Die meisten wilden Tiere erkannten die nächtlichen Schattenwesen, und einige fürchteten sie. Viele Haustiere der Menschen hatten diese Fähigkeit jedoch verloren, sie waren fast genauso blind und ahnungslos wie ihre Herrschaft.
Das stundenlange Warten, auf engstem Raum zusammengedrängt, hatte ihn zuerst verärgert, später jedoch, als die Mädchen im Garten ihr Unwesen trieben und eine von ihnen so dicht an der Mauer vorüberlief, dass sie ihm fast auf den Kopf getreten wäre, fand er die Sache skurril und war erheitert. Auch jetzt, während er auf Höhe der Baumkronen und Dachfirste durch die nächtliche Stadt schwebte, musste er bei der Erinnerung an die braven Pensionatsschülerinnen mit ihren Gartenhacken und Gießkannen immer wieder grinsen. Ihre Kleider waren alle grau und vom gleichen Schnitt, offensichtlich eine Art Uniform, die sie blass und geschlechtslos wirken ließ. Tatsächlich waren die meisten dieser Mädelchen noch unfertig wie junge Gänse, pummelig oder spindeldürr, mit rundlichen Kindergesichtern und Stupsnasen, hohen Stimmchen und dünnen Beinchen. Nur die älteren glichen schon erwachsenen Frauen, doch keine dieser fleißigen Gärtnerinnen hatte auch nur den winzigsten Ansatz von Liebreiz besessen. Möglicherweise lag es an dem alten feuchten Gemäuer, in dem sie eingesperrt waren, vielleicht auch an der unförmig dicken Lehrerin, die sie Miss Woolcraft nannten – ein Ausbund an plumper Hässlichkeit –, dass die Zöglinge dieses Pensionats wie graue Mäuse wirkten. Wieder musste er grinsen, und ihn überkam die Lust, einen Schabernack anzurichten.
Er suchte ein stattliches Wohngebäude in der Nähe von Eaton Place aus und warf das Kleiderbündel in einen der aufragenden gemauerten Schornsteine. Er hatte die Sachen letzte Nacht in einem Gasthaus in Soho mitgenommen – nun würde die Dienerschaft der adeligen Familie rätseln, wie dieses Zeug wohl in den Kamin gelangt war. Dann spürte er den Hauch eines anderen Nebelschattens vorübergleiten, und ihm wurde klar, dass er im Begriff war, leichtsinnig zu werden. Die Nacht war lau, und der Mond zeigte sich in nahezu voller Rundung – zu dieser Zeit waren allerlei Wesen unterwegs, und die Nachtschatten, zu denen er gehörte, lebten nicht mit allen verwandten Geistern in guter Freundschaft.
Er dehnte sich, bemüht, seinen grauen Nebelkörper durchsichtig werden zu lassen, und zog noch eine letzte Abschiedsrunde über dem Gewirr der Häuser und Straßen der großen Stadt, die in solch lebendig warmem Dunst unter ihm brodelte. Es war schade, diesen Ort verlassen zu müssen, denn er bot für seinesgleichen eine Menge köstlicher Vergnügungen – allen voran die Gaslaternen, die den braunen Flussnebel gelblich färbten, und die künstlichen Lichter in den Schaufenstern, bunte Schattenflecken von solcher Pracht, wie er sie noch nie zuvor gesehen hatte. Nur die Polarlichter waren damit zu vergleichen. Bedauernd warf er noch einen letzten Blick auf die Brücke mit den beiden Türmen, wo sich die Nebelfrauen aus dem Fluss ein Stelldichein gaben, dann stieg er mit großer Geschwindigkeit aufwärts und glitt in eine der grauen Wolken hinein, die nach Norden reiste.
Im Grunde konnte er zufrieden sein, denn er hatte seinen Auftrag erfolgreich ausgeführt, ja, er hatte das Soll sogar übererfüllt, indem er versucht hatte, seine Beobachtungen auch am Nachmittag weiterzuführen. Seine Schuld war es nicht gewesen, dass sie dem Garten fernblieb, dafür hatte er sie am Morgen in aller Ruhe betrachtet und konnte nun die Vermutung seines Herrn bestätigen. Zusätzlich hatte er noch zwei weitere Exemplare dieser verhassten und immer noch nicht endgültig ausgerotteten Todfeinde ausmachen können. Auch die hässliche Alte, die geglaubt hatte, ihn mit ihrem Räucherwerk vertreiben zu können, und ihr skurril ausschauender Ehemann waren Lichtelben. Ihre Tarnung war perfekt, aber er hatte sie dennoch erkannt. Schließlich machte er das nicht zum ersten Mal, er hatte Erfahrung, wusste durch die äußere menschliche Gestalt hindurch das elbische Wesen zu enttarnen. Tatsächlich – er war heute ungewöhnlich erfolgreich gewesen und konnte stolz auf sich sein!
Er war es jedoch nicht. Schlimmer noch: In der Tiefe seines Herzens schämte er sich dafür, diese Wesen ausgespäht zu haben und sie nun an seinen Herrn preiszugeben. Es würde ihre Vernichtung bedeuten, denn die Nachtschatten ließen keinen Lichtelben am Leben, so war es immer gewesen, solange er lebte. Die Lichtelben stellten gefährliche Feinde dar, die sich des Feuers der Sonne bedienen konnten, um den Nachtschatten das Nebelreich oben im Norden zu entreißen. So hatten es seine Lehrmeister ihm erklärt, aus diesem Grund war er von kleinauf zum Kämpfer ausgebildet worden. Klugheit, List und Kaltblütigkeit bildeten die Ideale, die er und seine Altersgenossen anstrebten, und unzählige Lichtelben waren schon von ihnen ausgespäht und getötet worden.
Sie hielten sich überall auf dem Erdenball verborgen, versteckten sich in den gleißenden Fluten der Wasserfälle, im schimmernden Silberlaub der Olivenbäume, lebten als Menschen verkleidet in den Dörfern und Städten. Inzwischen fand er es nicht mehr besonders heldenhaft, einen Lichtelben zu töten, denn kein einziger hatte sich je ernsthaft zur Wehr gesetzt, schon gar nicht das Feuer der Sonne auf ihn geschleudert. Vielleicht lag es daran, dass sein Erfolg ihm so wenig Befriedigung verschaffte. Vielleicht war aber auch das Gesicht des Mädchens daran schuld, das ihm so zart und unschuldig erschienen war, als er sich über sie beugte. Sie hatte ihn mit eisblauen Elbenaugen angesehen, und er hatte große Lust verspürt, sie zu berühren. Nicht um sie zu töten, damit war er nicht beauftragt. Noch nicht. Es missfiel ihm, dass man dieses Wesen auslöschen würde, das war es. Es war schade um sie, denn sie war schön und hatte niemandem, auch keinem Nachtschatten, etwas zuleide getan.
Die Nacht näherte sich ihrer Mitte, als er das Gebirge unter sich erblickte. Durch Wiesen und bewaldete Hügel wand sich eine kahle Bergkette gleich einem grauen Reptil bis hin zur Küste, wo sie als felsige Halbinsel ins Meer hineinragte. Dieses Eiland war ein öder Ort, den sogar die Meeresvögel mieden, kein Halm wuchs dort, nicht einmal Moose oder Flechten hielten sich an dem glatten Gestein. Wie eine natürliche Festung trotzten die steilen Felswände den Angriffen des Meeres, das sich immer wieder zornig gegen das harte Gestein warf, und an den vorgelagerten Klippen war schon so manches Fischerboot zerschellt. Mitten durch die Halbinsel zog sich eine Schlucht, die von oben gesehen einem zackig gerandeten schwarzen Spalt glich. Dort unten auf dem Grund der Schlucht, weitaus tiefer als auf dem Meeresboden und in vollkommener Sicherheit vor jedem Angreifer, befand sich der Wohnsitz seines Herrn.
Der Sturm, der unter ihm heulte, passte recht gut zu seiner Stimmung, es machte ihm Spaß, aus der Wolke herauszugleiten und den Kampf mit den Windbräuten aufzunehmen. Sie rissen seinen Körper mit sich fort, zerrten an ihm, stritten sich heulend um die Beute, jagten ihr Opfer so dicht über den aufgewühlten Wellen dahin, dass die eisigen Hände der Meeresfrauen lüstern nach ihm griffen. Eine Weile überließ er sich diesem Spiel, wiegte die Windbräute in dem Glauben, ihnen hilflos ausgeliefert zu sein. Dann jedoch, kurz bevor die boshaften Geister ihn gegen den steilen Fels geschleudert hätten, stemmte er sich machtvoll gegen ihren wilden Atem. Geschickt nutzte er ihre Kräfte für den eigenen Flug, warf sich ihnen mit ausgebreiteten Armen entgegen und ließ sich, einem großen Seevogel gleich, von ihrem Zorn emporblasen. Mit höhnischem Gelächter erreichte er die Spitze der steilen Klippen, rang dort mutig mit zwei Windfrauen – alten aufgeblasenen Vetteln, die schweren Gewitterwolken ähnelten – und entkam in kühnem Sturzflug hinab in die dunkle Tiefe der Schlucht. Über ihm zeterten und winselten die enttäuschten Luftgeister, schickten ihm ewige Verwünschungen nach und drohten, seinen Schattenleib beim nächsten Mal in tausend Fetzen zu reißen.
Er lachte über ihr Geschrei, während er immer tiefer in den düsteren Spalt hinabsank. Als er jedoch nach einer Weile die kühle Nähe des Palastes spürte, verließ die Heiterkeit ihn. Wächter hielten seinen Flug auf, fingen ihn ab, fragten nach seinem Namen und dem Zweck seines Besuches.
»Darion. Zurück von einem Auftrag des Herrn. Ich komme, um Meldung zu machen.«
Die Wächter gehörten nicht zu seinen Kameraden, so viel war sicher, obgleich er auch die Krieger, mit denen er ausgebildet worden war, immer mehr aus den Augen verlor. Diese Männer hier waren jünger als er, doch sie blieben gesichtslos. Niemals wusste er, ob es immer die gleichen oder jedes Mal andere waren, die den Dienst als Wächter versahen. Mehr als ihre dunkle Silhouette war nicht zu erkennen, denn sie materialisierten sich niemals.
»Du bist spät dran. Gorian hat schon nach dir gefragt.«
Die Bemerkung verblüffte ihn. War dieser Auftrag denn von solcher Wichtigkeit, dass der Herr der Nachtschatten mit Ungeduld auf seinen Bericht wartete? Nichts davon war in Gorians Miene zu lesen gewesen, als er ihn letzte Nacht nach London ausschickte. Er hatte seinen Befehl wie immer mit unbeweglichen Zügen und kühlem Gleichmut erteilt, eine reine Pflichtübung, die an seiner Stelle auch ein anderer Krieger hätte übernehmen können. Überhaupt hatte Darion bisher noch nie das Gefühl gehabt, von seinem Herrn geschätzt oder gar bevorzugt zu werden – ganz im Gegenteil.
Der Palast lag in vollkommener Finsternis, die düstere Pracht in seinem Inneren war nur für die Augen eines Nachtschattens erkennbar. Darion kannte bei Weitem nicht alle Gemächer des verwinkelten Baus, der sich über mehrere Etagen hinweg über den Grund der Schlucht erstreckte. Er wusste nur, dass die Räume sich um den hohen Thronsaal gruppierten. Dort, inmitten von Wänden aus blankem Onyx, fanden mehrmals im Jahr beeindruckende Zeremonien statt, außerdem wurde dort Gericht gehalten und der Toten gedacht.
Auch dieses Mal gelang es dem Wächter, Darion zu verwirren, denn schon nach kurzer Zeit hätte er nicht mehr sagen können, in welche Richtung sie sich bewegten. Entweder empfing Gorian ihn jedes Mal in einem anderen Gemach, oder man führte ihn auf immer neuen Wegen in den gleichen Raum. Es war schwer zu entscheiden, da die Felswände keinen Aufschluss darüber gaben und Mobiliar – so wie die Menschen es liebten – nicht vorhanden war.
Gorian, der Herr der Nachtschatten, befand sich in der Mitte des Felsgemachs, noch war er ein Teil der Dunkelheit und nur für seinesgleichen als schwarzer Schemen zu erkennen. Als man Darion jedoch hereinführte, begann die Schwärze sich zusammenzuziehen, und die hohe Gestalt des Herrschers hob sich von der umgebenden Finsternis ab. Er war als Krieger gekleidet, trug den Dolch im Gürtel, und der lange Mantel aus dunklem Samt hing von seinen Schultern bis auf den Boden herab. Sein Gesicht war schmal, und obgleich Darion seinen Herrn nicht zum ersten Mal erblickte, fielen ihm heute doch die beiden tiefen Kerben rechts und links des Mundes auf. Die Nachtschatten hatten zwar ein längeres Leben als die Menschen, doch auch sie waren sterblich. Darion hatte die Mitte seiner Lebenszeit ganz sicher längst überschritten.
»Du kommst spät! War es so schwierig, meinen Auftrag auszuführen?«
Darion verneigte sich tief, wie es einem Krieger vor dem Herrscher geziemte, und bat um Vergebung. Er wäre nur deshalb säumig, weil er seine Aufgabe besonders gut hätte ausführen wollen.
Gorian hörte seinem Bericht schweigend zu, nur als sein Späher von zwei weiteren Lichtelben berichtete, die er sozusagen per Zufall entdeckt hatte, hob der Herrscher kurz seine schwarzen Augenbrauen.
»Wie nachlässig wir sind!«, murmelte er unzufrieden. »Ein Elbenpaar lebt unbehelligt zwischen den Menschen und setzt neue Elbenwesen in die Welt!«
»Sie sind beide schon alt und werden wohl keine Kinder mehr haben«, wandte Darion vorsichtig ein.
Der Herrscher schien ihn nicht gehört zu haben, auf jeden Fall zeigte seine unbewegliche Miene, dass er ihn nicht zur Kenntnis nahm. Gorian streckte einen Arm aus, und ein Schwarm Nachtfalter löste sich von der Felswand, um sich auf seinem weiten Ärmel niederzulassen.
»Das Mädchen ist also mit Sicherheit eine Elbin?«
Darion nickte schweigend. Wozu diese Frage? Er hatte es doch gerade eben berichtet. Es war schwer, angesichts des mächtigen Herrn der Schattenelben auf Widerspruch zu sinnen, doch Darion war fest entschlossen, den nun fälligen Auftrag abzulehnen. Er würde eine Ausrede finden, und wenn das alles nicht half, würde er sich weigern. Selbst auf die Gefahr hin, bestraft zu werden, schlimmstenfalls seinen Status als Krieger zu verlieren. Aber er war nicht bereit, dieses Mädchen zu töten.
»Ich bin sehr zufrieden mit dir, Darion«, hörte er die leise Stimme des Herrschers.
Sie klang ungewöhnlich sanft in seinen Ohren, fast schmeichelnd, doch er spürte dahinter eine boshafte Tücke.
»Ich danke Euch, mein Herrscher!«
Er verneigte sich wieder und tat dabei zugleich mehrere Schritte rückwärts, um sich so aus dem Bereich des Herrn zu entfernen. Es war lächerlich genug, denn Gorian war auf diese Weise nicht zu übertölpeln.
»Du wirst noch heute Nacht an diesen Ort zurückkehren!«, erklang der gefürchtete Befehl.