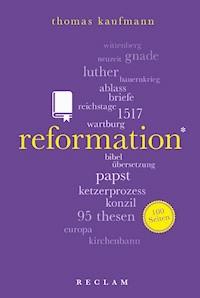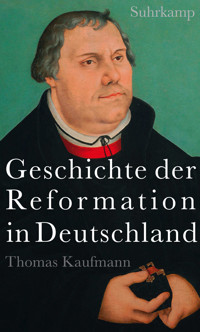
37,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die traditionelle, protestantisch geprägte Geschichtsauffassung sah in der »Tat Luthers« eine Befreiung von den »dunklen Mächten« der Papstkirche und ein »Ende des Mittelalters«. Doch weder war das Spätmittelalter »finster« noch Luther eine Lichtgestalt. Sein kirchlicher Reformimpuls steht im Kontext vielfältiger Umbrüche, die um 1500 im politischen, ökonomischen und kulturellen Leben einsetzten. Dass die Reformation viele Menschen mitriss und zuletzt in ein eigenes Kirchenwesen mündete, war nur möglich, weil verschiedene Akteure (Landesfürsten, städtische Magistrate, Bürger und Bauern) etwas mit ihr »anfangen« konnten. Dabei spielten auch die neuen Massenmedien der Zeit (Flugschriften, Predigten) eine große Rolle. Das zuerst 2009 im Verlag der Weltreligionen unter dem Titel Geschichte der Reformation erschienene Buch wurde für die Neuausgabe durchgesehen, aktualisiert und um einen Epilog erweitert, der unter anderem auf die Geschichte der Reformationsjubiläen zurück- und auf das Lutherjahr 2017 vorausblickt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1305
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Die traditionelle, protestantisch geprägte Geschichtsauffassung sah in der »Tat Luthers« eine Befreiung von den »dunklen Mächten« der Papstkirche und ein »Ende des Mittelalters«. Doch weder war das Spätmittelalter »finster« noch Luther eine Lichtgestalt. Sein kirchlicher Reformimpuls steht im Kontext vielfältiger Umbrüche, die um 1500 im politischen, ökonomischen und kulturellen Leben einsetzten. Daß die Reformation viele Menschen mitriß und zuletzt in ein eigenes Kirchenwesen mündete, war nur möglich, weil verschiedene Akteure (Landesfürsten, städtische Magistrate, Bürger und Bauern) etwas mit ihr ›anfangen‹ konnten. Dabei spielten auch die neuen Massenmedien der Zeit (Flugschriften, Predigten) eine große Rolle.
»Selbst wer meint, die Materie bereits zu kennen, wird durch die souveräne Beherrschung des Stoffs, die Vielfalt der wahrgenommenen Aspekte und die Kenntnis der alten wie der aktuellen Diskurse zur Sache angetan sein. Der Göttinger Kirchenhistoriker erweist sich auch hier als einer der derzeit kraftvollsten, ausdrucks- wie urteilsstärksten und synthesefähigsten Vertreter seines Faches.«
(Martin Brecht, Theologische Literaturzeitung)
THOMAS KAUFMANNGESCHICHTEDER REFORMATIONIN DEUTSCHLAND
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der ersten Auflage dieser Ausgabe im Suhrkamp Verlag 2016.
© Verlag der Weltreligionen im Insel Verlag Berlin 2009
Erste Auflage dieser Ausgabe Suhrkamp Verlag 2016
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagfoto: Lucas Cranach d. J., Porträt Martin Luther (Umschlagvorderseite), Porträt Philipp Melanchthon (Umschlagrückseite), 1546, Privatsammlung
GESCHICHTE DER REFORMATION IN DEUTSCHLAND
INHALT
Einleitung: Die Reformation und die Liebe zurKirche
Teil I: Die Voraussetzungen der Reformation
Teil II: Die Reformation im Reich
Teil III: Die Unwiderruflichkeit der Reformation
Resümee: Die Reformation und das lateineuropäischeChristentum
Epilog: Martin Luther und die Reformation in Deutschland – in der Erinnerungskultur und in der historischen Forschung
Anmerkungen
Ausgewählte Biogramme
Glossar
Zeittafel
Abkürzungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Zu den Abbildungen
Register
Inhaltsverzeichnis
»… dan die welt eilet, quia per hoc decennium fere novum saeculum fuit [weil während des letzten Jahrzehnts beinahe ein neues Zeitalter entstand].«
WA.TR 2, Nr. 2756b, S. 637,10f. (Herbst 1532)
»Ein weib ist bald genumen; aber stets lieb zu haben, das ist dan schwer, und es mag einer unserm Herrngott wol davor dancken, wer dasselbige hat.«
WA.TR 5, Nr. 5324, S. 214,27-29 (1542/43)
Antje gewidmet
EINLEITUNGDIE REFORMATION UND DIE LIEBE ZUR KIRCHE
Im Frühjahr 1413 schrieb ein Magister der Universität Prag am Anfang eines später berühmten Werkes über die Kirche (Tractatus de ecclesia): »Wie jeder [christliche] Wanderer treulich glauben soll, daß es eine heilige katholische Kirche gibt, so soll er den Herrn Jesus Christus als Bräutigam dieser Kirche und die Kirche als seine Braut lieben; aber er liebt seine geistliche Mutter nicht, wenn er sie nicht durch den Glauben erkennt; also muß er sie durch den Glauben erkennen und sie so wie eine hervorragende Mutter ehren.«1
Der theologische Lehrer, der dies schrieb, war Jan Hus (um 1370-1415), der zwei Jahre später durch das Konzil von Konstanz (1414-18) als Ketzer verurteilt und verbrannt wurde. Die Liebe zur Kirche, die Hus gefordert und beschworen hatte, bezog sich auf die eine, universale, umfassende, also die katholische Kirche des Glaubensbekenntnisses. Diese eine Kirche des Glaubens war für ihn nicht identisch mit der ›real-existierenden‹ römisch-katholischen Papstkirche; denn diese war damals in unterschiedliche Obödienzen konkurrierender Papstprätendenten gespalten, ein belastender Mißstand, den das Konstanzer Konzil zu überwinden antrat. In Hus' Vorstellungen von der Kirche als der geistlichen Braut Christi, nicht als Rechts-, Verwaltungs- und Machtapparat, wirkten Anregungen fort, die von dem Oxforder Theologieprofessor John Wyclif (um 1330-1384) ausgegangen waren. Dieser hatte, anknüpfend an den wichtigsten Kirchenvater des Abendlandes, Augustinus, der irdischen Gestalt der römischen Papstkirche die Idee einer wahrhaft umfassenden, universalen Kirche, deren einziges Haupt Christus sei, entgegengesetzt. Neben 30 Sätzen von Hus wurden auch 45 Artikel aus Schriften Wyclifs in Konstanz verurteilt.2
Luther und seine sogenannten Vorläufer
Das theologische Denken dieser beiden berühmtesten ›Ketzer‹ der abendländischen Kirchengeschichte vor Martin Luther (1483-1546) stellte nicht einfach eine Inspirationsquelle seiner eigenen Theologie dar. Vielmehr setzte seine Beschäftigung besonders mit Hus, später auch mit Wyclif, erst zu einem Zeitpunkt ein, als sich sein innerer und äußerer Ablösungsprozeß von der römischen Papstkirche schon deutlich abzuzeichnen begann, das heißt zwischen dem Frühjahr 1519 und dem Sommer 1520. Gleichwohl hat sich Luther dann gern in eine Traditionslinie mit diesen und anderen seines Erachtens zu Unrecht verketzerten Theologen und enttäuschten Liebhabern der Kirche gestellt und sie damit zu seinen ›Vorläufern‹, sich selbst zu ihrem Nachfolger und Vollender gemacht. In den historiographischen Selbstentwürfen des lutherischen Protestantismus ist dieser Faden weitergesponnen worden: Luther erschien nun als Höhe- und Schlußpunkt einer Schar aufrechter Wahrheitszeugen (testes veritatis), die der verkommenen Papstkirche ihrer Zeit entgegengetreten seien und sie zu reformieren versucht hätten. Mit Luther, so eine feste Überzeugung seiner Anhänger im späteren 16. Jahrhundert, habe Gott den größten und letzten Propheten gesandt, um seiner Kirche vor dem baldigen Ende der Zeiten Buße zu predigen und die widergöttlichen Mißstände zu überwinden.
Dieses protestantische Geschichtsbild, das in seinem ursprünglichen, an Luther anknüpfenden Kern ein Konzept heilsgeschichtlicher Selbstvergewisserung einer beanstandeten Ketzerei darstellt,3 ist zu einer der einflußreichsten ›Meistererzählungen‹ der Geschichtsschreibung überhaupt geworden. Es hat, angereichert mit zunächst humanistischer, später aufklärerischer Rhetorik, die Epoche Luthers als lichtvollen Aufstand der geistigen Freiheit, des christlichen oder bürgerlichen Gewissens, der deutschen Nation gegen die finstere Herrschaft der Päpste und ihrer klerikalen Heerscharen zu inszenieren erlaubt und so dazu beigetragen, jenes Zerrbild des finsteren Mittelalters zu erzeugen, das niederzuringen außerhalb der Wissenschaft noch immer nicht ganz gelungen ist. Indem Luther und seine ›Vorläufer‹, die sogenannten Vorreformatoren, im Verhältnis zu ihrer Gegenwart als große, gefährdete, unverstandene, verfolgte Außenseiter positioniert wurden, geriet häufig das aus dem Blick, was Luther und die Reformer des 15. Jahrhunderts jeweils mit ihrer Zeit verband. Je dunkler die ›mittelalterliche‹ Welt erschien, gegen die Luther und seine Vorkämpfer aufstanden und revoltierten, desto ›zeitloser‹ oder ›moderner‹ erschienen sie selbst. Daß die von Heroisierungen nicht freien Dekontextualisierungen insbesondere Luthers in der weiteren Forschung zu ihrerseits nicht selten angestrengten Bemühungen seiner ›Rekontextualisierung‹ im Mittelalter, ja zur Entdeckung eines mittelalterlichen Luther geführt haben, verwundert daher nicht. Aber wirklich gewonnen war damit wenig. Denn daß all jene Zuschreibungen – mittelalterlich, vormodern, zeitlos-evangelisch, modern usw. – künstliche Konstrukte sind, kann heutigentags wohl kaum ernsthaft strittig sein.
Luther und die sogenannten Vorreformatoren verbindet zunächst nicht sehr viel mehr, als daß sich der Wittenberger ab einem bestimmten Zeitpunkt der Konfliktgeschichte zwischen ihm und der kirchlichen Hierarchie mit ihnen zu beschäftigen und auf sie zu berufen begann. Im Rückblick, von seiner eigenen Verketzerung her, konstruierte er eine Genealogie der von der Papstkirche verfolgten wahren Kirche, die von den altgläubigen Gegnern ihrerseits reproduziert und bestätigt wurde. Denn diese ›häresiologische Genealogie‹ erwies doch schließlich, daß Luther eben wirklich jener Ketzer war, als den man ihn verurteilt hatte. Wer sich selbst öffentlich mit dem Ketzer Hus solidarisierte, durfte sich schließlich nicht wundern, als Hussit beschuldigt und verdammt zu werden. Die protestantisch-emphatische und die katholisch-häresiologische Geschichtsdarstellung erscheinen als zwei Seiten derselben Medaille.
Daß im Rückblick eine Verbindungslinie zwischen Luther und seinen sogenannten Vorläufern gezogen wurde, hat den Blick dafür verstellt, daß die Bemühung um eine Reform der Kirche, um eine lebendige Anpassung der Institution an die sich wandelnden Bedingungen ihrer Zeit, um eine geistliche Reorganisation von ihren heiligsten Ursprungsdokumenten in der Bibel und bei den Kirchenvätern her, kein primär von Außenseitern verfochtenes Nebenthema des Zeitalters um 1500 war, sondern ein Hauptthema, das viele Personen, Gruppen und geistliche Korporationen beschäftigte. In der Intensität, in der man an der Verbesserung der Kirche und ihrer Glaubwürdigkeit arbeitete, manifestierte sich, daß sie der weithin alternativlose Raum war, in dem Individuen, soziale Gruppen und Stände, Zünfte und Genossenschaften, bäuerliche ›Verbündnisse‹ oder Dynastien ihre Bedürfnisse nach Heilssicherung, Kontingenzbewältigung und soziokultureller Repräsentation inszenierten und artikulierten. Nicht zuletzt in der Kritik an der Kirche oder ihren klerikalen Repräsentanten zeigte sich, wie wenig man ihrer entbehren konnte oder wollte. Aus einer im Laufe des 15. Jahrhunderts zunehmenden Kirchenkritik zu folgern, man habe innerlich mit ihr gebrochen und gebe ihr keine Zukunft mehr, wäre ein Irrtum. Offener Widerspruch oder entschlossener Aufstand gegen die Kirche, ihre Praktiken und Lehren bildeten einen höchst marginalen Tatbestand. Eine Ableitung der Reformation aus einer vorreformatorischen feindseligen Haltung gegenüber der Kirche, sofern es diese überhaupt in nennenswertem Maße gab, greift deshalb zu kurz. Die durchaus verbreiteten kirchenkritischen und -reformerischen Stimmen gegenüber dem vorfindlichen Kirchentum sind hingegen als Ausdruck jener prinzipiellen Anerkenntnis ihrer Idee und ihres Wesens zu deuten, ja als Versuch, die Wirklichkeit der Kirche ihrem Ideal anzunähern, die Hus im einleitenden Zitat mit dem affektiven Verb diligere, »lieben«, bezeichnet hat. Da die Kirche immer zugleich real-existierende Institution welthafter Verfehlung und Gegenstand des Glaubens war, konnte jede Kritik an ihr als Erweis ihrer Unumgänglichkeit, Unverzichtbarkeit und Heiligkeit gelten. Ja, die Polemik konnte gegen ihre vornehmsten Repräsentanten im Namen Christi, des Herrn der Kirche, erfolgen und mit dem Anspruch auftreten, aus dem Innersten der wahren Kirche selbst zu stammen. Die schärfsten Kritiker der Kirche waren zumeist ihre glühendsten Liebhaber.
Hierin stimmte Luther mit Hus, mit Wyclif und mit vielen anderen überein, lange bevor er genauere Kenntnisse über ihre Lehren besaß. Diese in der Theologiegeschichte des Abendlandes, bei ihrem wichtigsten ›Vater‹ Augustinus, verwurzelten Selbstunterscheidungen der Kirche als sichtbarer und unsichtbarer, heiliger und sündhafter, welthaft-verstrickter und geistlicher Größe bildeten ein Ferment der Unruhe, der Infragestellung und der Reformbemühung während einzelner Etappen des Mittelalters, aber eben auch in der Zeit der Reformation.
Die selbstverständliche Allgegenwart von ›Kirche‹
Die Reformation und ihr Ringen mit der real-existierenden, ihr Kampf für die ›wahre‹, die ›evangeliumsgemäße‹ Kirche sind nur vor dem Hintergrund der unabweisbaren Allgegenwart der Kirche zu verstehen. Für jeden Europäer nichtjüdischen und nichtmuslimischen Glaubens war ›die Kirche‹ vor Luther, zu seiner Zeit und auch noch ein Jahrhundert nach ihm eine schlechterdings unausweichliche, unhintergehbare Wirklichkeit. Geändert hat sich durch die Reformation nicht der Anspruch der Kirche an die Menschen als solcher, sondern die Art und Weise, in der dieser Anspruch begegnete. Geändert hat sich allerlei an den sichtbaren Erscheinungsformen, am Autoritäts- und Institutionengefüge usw.; an der selbstverständlichen Gebundenheit jedes Menschen an eine der nun konkurrierenden und einander anathematisierenden, das heißt mit dem Bann belegenden Kirchen änderte sich nichts. Denn zur ›Kirche‹ gehörten vor wie nach der Reformation im Prinzip alle, außer den Juden, den Muslimen und den Exkommunizierten. Zur Kirche gehörte man ›von der Wiege bis zur Bahre‹; im Unterschied zu allen anderen soziokulturellen Bindungs- und Organisationszusammenhängen, vielleicht außer den familiären, umspannte die Zugehörigkeit zur Kirche jedes vollständige menschliche Leben. Die Kirche war für die weit überwiegende Mehrzahl der Menschen vor und nach der Reformation eine nähere, konkretere, erfahrbarere Wirklichkeit als das politische Ordnungssystem – der Staat. Die Kirche war zugleich die umfassendste Kategorie, in der sich die Menschen vieler Zeiten und Weltengegenden in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenfassen und aufeinander beziehen ließen. Die Kirche war nah und fern, umfassend und lokal, hatte mühelos zu besuchende, mit Mühen erreichbare, auch praktisch unerreichbare Orte und Räume, Zentren und Epizentren. Die Kirche war die einzige Ordnungsgröße des Zeitalters, die wirklich bei den Menschen aller Stände, Orte und Lebensalter war. Weil Kirche vor und nach der Reformation nie nur – und wohl für die meisten Europäer nicht einmal primär – ›Rom‹ war, konnte man über den Papst und seine Kurtisanen herziehen und sie als Teufelsbrut desavouieren, ohne an der Kirche als derjenigen Sozialform der Religion, zu der potentiell alle gehörten, irre zu werden. Weil die Kirche so unzählig viele Gesichter hatte und die Bindung an sie nicht auf freiwilligem, individuellem Entschluß basierte – weder vor noch nach der Reformation –, sie mithin eine selbstverständliche Lebensordnung darstellte, hat sie im Zuge der Reformation zwar Spaltungen erlebt, aber als Institutions- und Sozialtypus, eben als ›Kirche‹, überlebt. Freiwillige religiöse Vergemeinschaftungsformen galten der vorreformatorischen Kirche ebenso wie den nachreformatorischen Kirchen als sektiererisch und häretisch. Zur Kirche gehörte man vermittels der Taufe, nicht aber aufgrund eigener Entscheidung. Lediglich für die radikalen Randsiedler der europäischen Religionsgeschichte, die vorreformatorischen und vor allem die protestantischen Sekten, oder für Konvertiten aus Judentum und Islam spielte eine persönliche religiöse Entscheidung eine Rolle. Für alle anderen war die Zugehörigkeit zur Kirche eine unhintergehbare und zumeist unhinterfragte Selbstverständlichkeit.
Die Reformation als Aufstand der ›Kirche‹ gegen die ›Kirche‹
Da sie viele Gesichter hatte, nur wenige kultische oder moralische Verpflichtungen bindend auferlegte und in sich selbst Raum für vielfältige Alternativen ließ, gab es nur relativ wenig Anlaß, gegen die Kirche aufzubegehren. Darauf konnte man eigentlich nur verfallen, wenn man es mit dem, wofür die Kirche stand oder stehen sollte, ernster nehmen zu müssen meinte als die berufenen Vertreter der Kirche selbst. Die Reformation ist ein solcher Aufstand der ›Kirche‹ gegen die ›Kirche‹ gewesen. Und sie hat es mit dem Kirchesein der Kirche ernster genommen, als es ihres Erachtens jene Kirche beziehungsweise ihre Repräsentanten taten, gegen die sie aufbegehrte. Sie hat die religiösen Pflichten ihrer Gläubigen gesteigert, auf persönliche Aneignung gedrängt und insofern das Ideal eines alle Menschen umfassenden corpus christianum, einer christlichen Gesellschaft, konsequenter umzusetzen versucht als die vorreformatorische Kirche. Wenn es ein Ziel schon der mittelalterlichen Kirche gewesen sein sollte, eine christliche Gesellschaft zu formen, dann ist dieses Ziel im Zuge der Reformation und der durch diese provozierten Gegenreformation konsequenter und am Ende wohl auch erfolgreicher realisiert worden als je zuvor.
Die Reformation zielte darauf ab, daß die bestehende Kirche nach Maßgabe biblischer Verbindlichkeiten ›zurechtgebracht‹, re-formiert, werden sollte und daß die Glieder der Kirche, die Christen, Mitverantwortung für Lehre und Leben der Kirche übernahmen. Nur weil sich die Reformation an die Kirche als die alternativlose Form christlicher Lebens- und Sozialgestaltung gewiesen wußte und für die Bedingungen ihrer Zeit eine begriffliche Unterscheidung zwischen ›Kirche‹ und ›Gesellschaft‹ ganz unangemessen ist, konnten ihr Angriff auf die Kirche und ihr Neubau evangelischer Kirchen christentumsgeschichtlich epochale Wirkungen zeitigen. Ein Angriff auf die Kirche, der nicht wieder zur Kirche, zur religionskulturellen Sozial- und Integrationsgestalt aller Bürger und Bauern, aller Menschen sämtlicher Stände eines geopolitischen Raums geführt hätte, wäre nichts anderes als ein weiteres Kapitel der mittelalterlichen Sektengeschichte gewesen, aber kein epochales Phänomen.
Nach einer »gemein reformation <…> in der gantzen christenheit«4 zu rufen implizierte für Autoren vor Luther wie für diesen selbst nichts Geringeres, als einer grundstürzenden Umorientierung der gesamten christlichen Gesellschaft in allen Gliedern das Wort zu reden. Eine solche totale Reformation hatte entweder als menschliches Unterfangen ihre Ausweglosigkeit und ihr Scheitern bei sich oder war allein von Gott zu erwarten.5 Dies hielt jedoch nicht davon ab, im Rahmen kleinerer Gestaltungsräume und Handlungszusammenhänge nach Möglichkeiten zu suchen, Mißstände zu verändern. Schon der Straßburger Münsterprädikant Johann Geiler von Kaysersberg (1445-1510), einer der einflußreichsten Prediger und theologischen Schriftsteller vor der Reformation, hatte aus der Unmöglichkeit einer ›Generalreformation‹ nicht gefolgert, sich in die Mißstände zu schicken, sondern dafür plädiert, in überschaubaren Verantwortungsbereichen reformerisch tätig zu werden: »<…> in der sunderheit möchte jeglich wol sein stat und yeglicher oberer sein unterthon reformieren. Ein bischoff in sein bistumb. Ein apt in seinem closter. Ein rat sein stat. Ein bürg sein hauß, daz wer leicht. Aber ein gemein reformacion der gantzen cristenheit, das ist hart und schwer, und kein consilium hat es mögen betrachten und weg mögen finden.«6 Damit waren die Realisierungsbedingungen lokaler, regionaler, auch häuslicher Reformationen präzise erfaßt, die im großen und ganzen den Erfolg der Reformation ausmachen sollten. Nicht der durch ein Generalkonzil initiierten und strukturierten »gemein reformation«, sondern den städtischen, territorialen, häuslichen, in den überschaubaren soziokulturellen Lebens- und Organisationseinheiten der christianitas liegenden Partikularreformationen gehörte die Zukunft. Apostel einer ›Generalreformation‹, der ›großen Veränderung‹, der grundstürzenden ›Verwandlung‹ der Christengesellschaft, fanden sich im 16. Jahrhundert bald vorwiegend auf dem sogenannten linken Flügel der Reformation, bei den Radikalen. Ihre generalreformatorischen Programmtexte sind literarische und mentale Parallelerscheinungen der frühen Utopien. Der Erfolg der Reformatoren aber bestand in der Reduktion des Universalismus und in der pragmatischen Partikularisierung ihrer Gestaltungskontexte, mithin in der Addition der vielen größeren und kleineren Reformationen zu der einen, die man zusammenfassend ›die Reformation‹ zu nennen pflegt. Die Summe dieser Einzel- und Partikularreformationen jedenfalls veränderte das abendländische Kirchenwesen grundlegender als irgend etwas vorher oder nachher.
Der Erfolg der Reformation ergab sich freilich ganz wesentlich daraus, daß in den jeweiligen kleinen und partikularen Räumen so reformiert wurde, daß man alle Menschen einbezog, also Kirche baute, und daß man die Neuerungen in der Regel zügig und verbindlich für einen bestimmten sozialen und politischen Lebensraum durchsetzte. Duldsamkeit gegenüber abweichendem Verhalten einzelner Personen oder Gruppen, seien es nun Anhänger der alten Kirche, Täufer oder radikalreformatorische ›Schwärmer‹ und Einzelgänger, war der Reformation im ganzen nicht weniger fremd als jener Kirche, gegen die sie aufstand und deren Anspruch, die allgemeine Kirche zu sein, sie teilte. Die Reformation hatte also Erfolg, weil sie die Partikularität ihrer Gestaltungs- und Durchsetzungsräume mit einer generellen Verbindlichkeit, also: Kirchlichkeit ihres Anspruchs, verknüpfte. Wenn man die Auflösung der selbstverständlichen Geltung des in konstantinischer Zeit eingeführten religionssoziologischen Vergesellschaftungsmodells, dieses ›Sozialtypus Kirche‹, als entscheidenden religionsgeschichtlichen und kulturellen Indikator der Neuzeit versteht,7 dann kann es keinem Zweifel unterliegen, daß es historiographisch unsachgemäß wäre, Reformation und Mittelalter zwei unterschiedlichen historischen Epochen zuzuweisen. Die Vorstellung, daß alle Menschen eines Gemeinwesens zur ›Kirche‹ gehörten, teilten die Reformatoren mit jener Kirche, gegen die sie rebellierten.
Die Reformation als Epoche?
Ist es deshalb nicht naheliegend oder gar unausweichlich, die Bedeutung der Reformation als einer kirchen- und allgemeingeschichtlichen Zäsur zu nivellieren und die insbesondere seit Leopold von Ranke (1795-1886) als eigene Epoche stilisierte Reformationszeit (1517-55)8 in eine – Spätmittelalter und Frühe Neuzeit umspannende – Periode des Übergangs zwischen etwa 1400 und 1650 einzuordnen? Die Diskussion um die Zuordnung der Reformation zu Mittelalter oder Neuzeit, auch ihrer historiographischen Situierung ›zwischen den Zeiten‹, ist stets mit besonderer Leidenschaft geführt worden. Dies hängt wesentlich mit den – nur selten explizit gemachten – geltungspolitischen Ansprüchen, die sich mit dieser Frage verbinden, zusammen. Wer die Reformation tendenziell stärker dem Mittelalter zuschlägt, scheint ihre aktuellen Geltungsansprüche zurückhaltender zu beurteilen, sie konsequenter zu historisieren, Luther »ohne Goldgrund«9 in seine Zeit zu stellen. Wer hingegen Luther und die Reformation auf die Seite der Neuzeit herüberzieht, reklamiert den Wittenberger als eine Gestalt, die auch uns Heutigen noch Wesentliches zu sagen hat, ja, deren Leben und Werk, deren Theologie ganz entscheidend für kardinale religionskulturelle Prozesse wie Individualisierung oder Pluralisierung, die Bindung religiöser Letztverbindlichkeiten an das eigene Gewissen oder die Emanzipation von klerikaler Bevormundung, die Begründung beziehungsweise Ermöglichung persönlicher Menschenrechte usw. verantwortlich gemacht werden. In bestimmten Periodisierungskonzepten begegnen also nicht selten dogmatische Geltungsansprüche, denen nicht zuletzt im Horizont aktueller Auseinandersetzungen um religiöse Konkurrenz und Ökumene Wirkungskraft zugeschrieben wird.
In bezug auf die neuere allgemeinhistorische Epochendiskussion kann diese nicht selten bei protestantischen Autoren begegnende Aufgeregtheit in der Frage ›Reformation: Mittelalter oder Neuzeit?‹ inzwischen als entschärft gelten. Denn wohl kaum jemand wird heute noch ernsthaft die Vorstellung vertreten, unsere eigene Gegenwart sei mit der Zeit der Reformation in eine und dieselbe Epoche zu setzen. Die Fremdheit der Reformation, ihre Andersartigkeit, kann in historischer Perspektive nicht ernsthaft strittig sein. Wegen der allgemein üblich gewordenen Einführung des Epochenbegriffs der ›Frühen Neuzeit‹ kann die Diskussion über die ›Mittelalterlichkeit‹ oder ›Neuzeitaffinität‹ Luthers oder der Reformation also getrost jenen überlassen werden, die noch immer meinen, daraus Funken schlagen zu können.
Die Reformation als Veränderung des bestehenden Kirchenwesens
›Die Reformation‹ beginnt nicht an einem bestimmten kalendarischen Datum, etwa dem 31. 10. 1517, jenem Tag vor dem Allerheiligenfest, als der Wittenberger Theologieprofessor seine 95 Thesen über den Ablaß an den Erzbischof der Diözese Magdeburg und Primas der deutschen Reichskirche, Albrecht von Brandenburg, der für den Vertrieb des Petersablasses verantwortlich war, schickte, sich erstmals ›Luther‹ statt ›Luder‹ nannte und wahrscheinlich auch seine Thesen zum Zweck der Ankündigung einer freilich nie gehaltenen Disputation an die Kirchentüren Wittenbergs, die ›schwarzen Bretter‹ der Universität, anschlagen ließ. Sie endet auch nicht mit einem bestimmten Ereignis, etwa dem Augsburger Reichsabschied vom 25. 9. 1555, als den Anhängern der Confessio Augustana von 1530, des wichtigsten protestantischen Bekenntnisses, eine reichsrechtliche Duldung bis zur – schlußendlich erwarteten – kirchlichen Wiedervereinigung zuerkannt wurde. Die Reformation, wie sie in diesem Buch verstanden wird, stellt einen Prozeß der theologischen Infragestellung, der publizistischen Bekämpfung und der gestaltenden Veränderung des überkommenen Kirchentums dar. Aufgrund der untrennbaren Verbundenheit von Kirche und Gesellschaft betrafen diese mit unterschiedlichen Mitteln ins Werk gesetzten Veränderungen des Kirchenwesens viele Menschen in unterschiedlichster Weise. Unter Reformation verstehe ich die – in bewußter Abgrenzung von der Kirche Roms und im Bruch mit den in ihr geltenden Rechtsgrundlagen des kanonischen Rechts vollzogenen – Umgestaltungsprozesse des Kirchenwesens in städtischen und territorialen Zusammenhängen, die diese Prozesse zum Teil initiierenden, zum Teil begleitenden, teils privaten, zumeist aber öffentlichen Kommunikationsakte insbesondere der sogenannten Flugschriftenpublizistik und die mit diesen Prozessen untrennbar verbundenen politischen, rechtlichen und militärischen Auseinandersetzungen, die auf den unterschiedlichsten Ebenen und Bühnen der Städte, Territorien und Regionen, des Reichs und Europas stattfanden. Mit Reformation wird also nicht schon eine bestimmte theologische Erkenntnis Luthers im Zuge seiner prozessual zu deutenden theologischen Entwicklung bezeichnet; als ›reformatorische‹ ist Luthers Theologie im Sinne der hier verfolgten Perspektive nur insofern und ab jenem Zeitpunkt von Interesse, als sie auf eine Veränderung des bestehenden Kirchenwesens oder einzelner seiner Erscheinungen abzielte und sich kommunikativer und medialer Praktiken bediente, um diese zu erreichen. Den Auftakt jener Ereignissequenzen, die zur Reformation wurden, stellt der Ablaßstreit dar.
Die Frage nach dem Zusammenhang dieser so verstandenen Reformation mit bestimmten Einsichten ihrer führenden Theologen, die man Reformatoren zu nennen pflegt,10 kann nicht in dem Sinn als ein für allemal beantwortet gelten, daß man voraussetzt, bestimmte reformatorisch-theologische Erkenntnisse hätten unmittelbar ›reformatorische‹ Wirkungen gezeitigt. Dies setzte ein wohl zu naives Modell dessen voraus, wie theologische Gedanken wirksam geworden sind. Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen reformatorischer Theologie und Reformation wird also in bezug auf die jeweiligen Beobachtungsfelder, Gegenstände und Themen der kirchlichen Veränderungen gesondert zu stellen sein.
Reformation und Frühe Neuzeit
Der Prozeß der Umgestaltung des bestehenden Kirchenwesens, der die deutsche Geschichte seit dem dritten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts nachhaltig prägte, brachte Wirkungen hervor, die auch dann als epochal oder jedenfalls zentral bedeutsam einzuschätzen sind, wenn man einen Epochenbegriff der Reformation verabschiedet und sie als hochwichtige Etappe innerhalb einer Epoche der Frühen Neuzeit verortet.11 Daran freilich, daß die Reformation einen tiefgreifenden Einschnitt oder »Umbruch«12 in der Kirchen- und Christentumsgeschichte darstellt und insofern, angesichts der untrennbaren Verquickung von Kirche und Staat, Christentum und Gesellschaft, religiöser Mentalität und Kultur, zugleich einen solchen der ›allgemeinen Geschichte‹, wird man auch dann festhalten können, wenn man der gesellschaftsgeschichtlichen Dynamik der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, die in der neueren Forschung gemeinhin mit dem Begriff der Konfessionalisierung bezeichnet wird,13 eine besondere Bedeutung für die historische Entwicklung auf dem Weg in die Neuzeit zuerkennt. Denn in der zweiten Jahrhunderthälfte lebten ja Tendenzen und Überzeugungen auf, kamen zum Erfolg oder verfestigten sich, die durch die zum Teil eruptiven Aufbrüche der Reformation hervorgerufen oder indirekt ermöglicht worden waren. Der kulturelle Zusammenhang zwischen der Reformation und der Konfessionalisierung läßt es wenig sinnvoll erscheinen, sie zwei unterschiedlichen historischen Epochen zuzuweisen. Die Katechismen etwa, die man in der zweiten Jahrhunderthälfte durch verstärkte disziplinatorische Strategien dem ›gemeinen Mann‹ nahebrachte, entstammten ganz überwiegend der ersten Jahrhunderthälfte. Die innerprotestantischen Großgruppen, die sich in der zweiten Jahrhunderthälfte zu eigenen Konfessionen verfestigten und sich als konkurrierende Kirchentümer gegenüberstanden – die Lutheraner und die Reformierten, in gewissem Sinne auch die römischen Katholiken –, waren in der ersten Jahrhunderthälfte, in der Reformationszeit, entstanden. Die Rechtsformen, die den politischen und juristischen Rahmen für das Zusammenleben der Konfessionen im späten 16. und im frühen 17. Jahrhundert bilden sollten, waren in der ersten Jahrhunderthälfte vorläufig erprobt worden oder umkämpft gewesen, ehe sie sich als auf Dauer gestellte Interimslösung in der zweiten Jahrhunderthälfte mehr oder weniger überzeugend bewähren konnten. Die Gesichtspunkte ließen sich vermehren – allenthalben griffen Reformation und Konfessionalisierung ineinander, gab es die eine nicht ohne die andere. Das läßt es berechtigt erscheinen, die Konfessionalisierung als zweite, der Reformation folgende Etappe innerhalb der Epoche der Frühen Neuzeit zu verstehen.
Reformation und Spätmittelalter – Kontinuitäten
In der Reformationszeit lebte freilich vieles dessen fort, was dem späten Mittelalter sein spezifisches Gepräge gegeben hatte. Einige wesentliche Aspekte und Erscheinungsformen der Reformation sind ohne die religiösen, mentalen, sozialen und politischen Voraussetzungen des späten 15. Jahrhunderts nicht zu verstehen. Ohne das deutlich vor der Reformation einsetzende Interesse an volkssprachlichen Bibeln in Deutschland etwa (s. u. S. 90) bliebe unverständlich, warum die in der Reformation erhobene Forderung nach der Bibellektüre der Laien und der normativen Vorrangstellung der Heiligen Schrift gegenüber jeder anderen Wahrheitsinstanz so rasante Verbreitung finden und so zündende Plausibilität entfalten konnte.14 Ohne das deutlich gewachsene Interesse an volkssprachlicher Predigt und ihre Konzentration auf Fragen der Buße und Rechtfertigung,15 ohne die explosionsartige Zunahme in der Produktion von primär für städtische Leser aus dem Laienstand bestimmte Frömmigkeits- und Erbauungsliteratur16 und ohne die Etablierung städtischer Prädikaturen für überdurchschnittlich gebildete Prediger, die die Kanzelrede in einer den gewachsenen Bildungsbedürfnissen des städtischen Bürgertums entsprechenden Form zu praktizieren vermochten, wären die raschen Erfolge reformatorischer Predigt und Publizistik kaum verständlich. Ohne die gezielte agitatorische Aufnahme vorreformatorischer antirömischer und antipäpstlicher Kirchenkritik und die Aneignung konziliaristischer Theorien und Konzepte durch reformatorische Akteure wäre die Durchschlagskraft, die Luther etwa mit seiner Schrift An den christlichen Adel deutscher Nation (1520; s. u. S. 271-274) erreichte, kaum nachvollziehbar. Ohne die bereits im 15. Jahrhundert zum Teil weit fortgeschrittenen Versuche deutscher Territorialfürsten, das Kirchenwesen in ihren Herrschaftsgebieten unter ihre Kontrolle zu bringen und ein ›landesherrliches Kirchenregiment‹ aufzurichten,17 oder der städtischen Magistrate, die Einflüsse der bischöflichen Ordinarien und ihrer Fiskale, das heißt ihrer Rechtsvertreter, zurückzudrängen, deren Gerichtsbarkeit zu domestizieren und ihrer kommunalen Sozialgemeinschaft zu integrieren,18 blieben die zügig einsetzenden territorialen Reformationsprozesse weitestgehend unverständlich. In bezug auf die massenmedialen Kommunikationsmittel in Gestalt von Druckschriften, Flugblättern, didaktischen Bildmedien usw. konnten die Akteure der frühreformatorischen Publizistik an logistische, infrastrukturelle und künstlerische Erfahrungen und Strategien anknüpfen oder sich diese zunutze machen, ohne die die enorme Medienmaschinerie, die die frühe Reformationsbewegung begleitete und auch ermöglichte, nicht denkbar gewesen wäre. Nicht zuletzt in bezug auf die theologische Deutung und religionspraktische Behandlung der jüdischen wie der ›türkischen‹ Religion lassen sich gezielte Rückgriffe reformatorischer Autoren auf vorreformatorische Deutungstraditionen und Revitalisierungen mittelalterlicher Textbestände nachweisen.19
So lebte die Reformation von – und entstand unter – Voraussetzungen, die sie nicht selber geschaffen hatte. Dies dürfte nicht zuletzt von den religiösen Dispositionen gelten; ohne die Heilsfragen, -sehnsüchte und -ängste, ohne die eingeprägten religiösen Praktiken des Bußinstituts, des Stiftungswesens, der geistlichen Spiele, der Wallfahrten, des lebensregulierenden Ethos, der Sterbefürsorge usw. wären die Antworten, Anfragen und Angriffe der Reformatoren unverständlich und wirkungslos geblieben. Läßt es die hier nur angedeutete, im weiteren Fortgang der Darstellung (siehe Teil I, Kapitel 1) gründlich aufzuweisende rückwärtige Bezogenheit der Reformation auf das Spätmittelalter nicht geraten erscheinen, die Kontinuitätslinien deutlich herauszustreichen und gegenüber den Vorstellungen eines Umbruchs oder eines ›Systembruchs‹,20 einer historischen ›Wetterscheide‹ zwischen Spätmittelalter und Reformation also, zurückhaltend zu sein oder sie gar zurückzuweisen?
Reformation und Spätmittelalter – Diskontinuitäten
Diese Frage kann nur behutsam abwägend beantwortet werden. Auch wer die Kontinuitätslinien akzentuiert, wird die Momente der Diskontinuität nicht bestreiten können – und umgekehrt. Für die in diesem Buch vorgenommene Gewichtung zugunsten der Diskontinuität – sie allein rechtfertigt es, den historiographischen Begriff der Reformation auch weiterhin zu verwenden und das mit ihr Bezeichnete nicht einer spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Ära der Reform zuzuschreiben! – sind nicht allein Bindungen des evangelischen Kirchenhistorikers an die historiographischen Traditionen seines Faches und der Umstand, daß ›die Reformation‹ nun einmal ein ›Erinnerungsort‹ der deutschen Geschichte ist,21 verantwortlich, obschon dies zu leugnen töricht oder unaufrichtig wäre. Für die Diskontinuitätsperspektive spricht meines Erachtens ganz entschieden, daß sowohl die Protagonisten der Reformation als auch ihre altgläubigen Gegner, die Agenten der ›Gegenreformation‹,22 darin übereinstimmten, daß die Trennung zwischen der ›Papst-‹ und der ›Ketzerkirche‹ in ihrer Wahrnehmung von einer Tiefe und Abgründigkeit und die wechselseitigen Verwerfungen von einer Unversöhnlichkeit waren, daß sie eine einheitliche Geschichte der einen lateineuropäischen Kirche an ihr vorläufiges oder endgültiges Ende gekommen sahen. Zwar hatte es auch in der böhmischen ›Reformation‹ die Verselbständigung eines nationalen partikularen Kirchentums gegeben, dessen man sich seitens der Reformatoren erinnerte und das wohl sogar zeitweilig als Vorbild für eigene programmatische Vorstellungen einer deutschen Nationalkirche fungiert hatte. Doch das quantitative Ausmaß der Abweichung von Rom, die Entschiedenheit und die Konsistenz des theologischen Widerspruchs und die Stabilität des politischen Rückhaltes, der die deutsche Reformation kennzeichnete, schließlich die Intensität der europäischen Ausstrahlung wiesen über alle Verselbständigungstendenzen der vorangehenden abendländischen Ketzergeschichte hinaus. Mit der Reformation gingen weite europäische Landschaften in papstfreie, von der Bindungskraft des kanonischen Rechts und der römischen Rechtsprechung unabhängige Kirchentümer über. Einen vergleichbaren institutions-, organisations- und kirchenrechtsgeschichtlichen Auflösungsprozeß hatte die lateineuropäische christianitas bisher nicht gekannt.
Auch noch andere Aspekte lassen es gerechtfertigt erscheinen, die Diskontinuität der Reformation gegenüber dem späten Mittelalter, das ›Nicht-mehr-Mittelalterliche‹ der Reformation, zu betonen. Mit und durch die Reformation kamen eine Theologie und eine mit dieser korrespondierende Frömmigkeitspraxis zur Vorherrschaft, die das Heil des Menschen auf das persönliche Gottesverhältnis, auf den Glauben, gründete. Auch wenn diese Position ihre Wurzeln in Tendenzen spätmittelalterlicher Frömmigkeitstheologie gehabt haben mag – die Radikalität, die Allgemeinheit und die Ausschließlichkeit, mit der sie in der Reformation in den Vordergrund trat, veränderten das Verhältnis des frommen Menschen zur Kirche grundlegend. Die Kirche diente nicht mehr als institutionelles Unterpfand des Heilserwerbs, sondern als Raum der persönlichen Begegnung mit dem Wort Gottes und der Gemeinschaft der Glaubenden. In der Reformationszeit vollzog sich sodann ein durch die Druckproduktion des späten Mittelalters mannigfach vorbereiteter, doch erst seit 1519/20 in seinen Möglichkeiten und seiner Brisanz schlagartig hervortretender kommunikationsgeschichtlicher Umbruch, der in der Forschung mit Formeln wie der von der »Entstehung der reformatorischen Öffentlichkeit«, dem reformatorischen »Kommunikationsprozeß« oder dem »Medienereignis« Reformation bezeichnet worden ist.23 Niemals zuvor jedenfalls waren in so kurzer Zeit so viele verschiedene Schriften geschrieben und gedruckt, so unterschiedliche Autoren, bald auch aus dem Laienstand, zur Parteinahme für die ›Sache Luthers‹ und seiner Anhänger mobilisiert und in so rascher Zeit relativ homogene Meinungen und Überzeugungen über so weit gestreute Regionen vor allem des deutschen Sprachgebietes transportiert worden wie in der frühen Reformationszeit.
Mit der theologischen Bestreitung der für die ältere Kirchengeschichte in rechtlicher, sozialer und mentalitätsgeschichtlicher Hinsicht grundlegenden Unterscheidung zweier genera christianorum,24 zweier »Arten von Christen«, der Kleriker und der Laien, ging schließlich seit der Frühzeit der Reformation ein historisch analogieloser Aktivitätsschub der Laien einher, der in unterschiedlichen Zusammenhängen zu einem wichtigen Faktor der kirchlichen Veränderungsprozesse wurde. Dadurch, daß die Laien aufgrund des Priestertums aller Gläubigen zu eigener theologischer Urteilsbildung ermächtigt und mittels volkssprachlicher Bibelausgaben befähigt wurden oder doch werden sollten, wuchs ihnen prinzipiell ein Maß an kirchlicher Mitgestaltung zu, wie es vor der Reformation weithin undenkbar gewesen war. Freilich divergierten die Partizipationsmöglichkeiten der Laien faktisch zwischen den verschiedenen Ständen erheblich, ja wurden nach dem Bauernkrieg auch von den protestantischen Obrigkeiten eingeschränkt oder doch mit Argwohn betrachtet. Damit aber, daß den politisch führenden Laien, den städtischen Magistraten und den Reichsfürsten, im Zuge der Reformation das Recht zufiel, als »hervorragende Glieder der Kirche« (praecipua membra ecclesiae) selbst über die Lehre zu urteilen und zu entscheiden, schuf die Reformation reguläre, rechtlich verbürgte laikale Einflußmöglichkeiten, die die mittelalterliche Kirche nicht gekannt hatte.
Die drastische Reduktion des geistlichen Personals, die mit der Abschaffung des Mönchtums, der Auflösung des Stiftungswesens und des damit zusammenhängenden Pfründensystems verbunden war, und die Einrichtung des vollständig in die bürgerliche Lebenswelt integrierten Pfarramtes als des einzigen geistlichen Amtes stellen gleichfalls einen sozial- und mentalitätsgeschichtlich tiefgreifenden Umbruch dar. Der verheiratete evangelische Pfarrer übte ein funktional definiertes Gemeindeamt aus und verfügte als Person über keinen theologisch definierten und durch die Priesterweihe verbürgten sakralen Status mehr. Seine Amtsbeziehung zur Gemeinde war primär über Schriftauslegung und Sakramentsverwaltung vermittelt und sollte stärker lehrhafte Züge tragen als die seines vorreformatorischen Vorgängers. Auch wenn aus der Sicht der Gläubigen die Unterschiede vielfach als weniger gravierend empfunden worden sein mögen, da in nicht wenigen Fällen die schon vorhandenen Priester in ihrem Amt verblieben – freilich häufig, nachdem sie geheiratet beziehungsweise ihre Konkubinate nun legitimiert hatten –: Aus der Sicht der Theologen war der ordinierte evangelische Pastor etwas ganz anderes als ein geweihter Priester.
Auch in bezug auf den religiös-haptischen Umgang mit sakralen Gegenständen, etwa Reliquien, Hostien, Bildern, Amuletten usw., markierte die Reformation einen mehr oder weniger vollständigen Bruch mit dem Herkommen. Wallfahrten, heilige Stätten und auratische Objekte im traditionellen Sinne, auch die so unendlich wichtig gewordenen Heiligen, kannte sie nicht mehr und löste insofern einen immensen Entsakralisierungs-, vielleicht gar Rationalisierungsschub aus. Die Zentrierung reformatorischer Theologie und Frömmigkeit auf die Bibel, das in ihr und in der Predigt begegnende Wort und auf den versöhnenden Christus, der nun seine Mutter Maria gänzlich überstrahlte und ihrer Verehrung klare Grenzen setzte, bedeutete doch einen so tiefen Einschnitt, daß die Rückverweise auf einzelne parallele Phänomene und Vorformen oder vergleichbare Tendenzen der Frömmigkeit des späten Mittelalters demgegenüber nicht wirklich ins Gewicht fallen. Mit einer Schärfe, Brutalität und Selbstverständlichkeit, wie es in der Reformation üblich wurde, waren jedenfalls bisher weder der Heiligenhimmel gestürmt und geplündert noch Maria degradiert oder die heiligen Objekte entsakralisiert worden. Da, wo die Reformation siegreich wurde, starben wesentliche Elemente und Erscheinungsweisen mittelalterlicher Frömmigkeitskultur und Kirchlichkeit mehr oder weniger zügig ab, und was in bescheidenen Überbleibseln als volksfrommes Brauchtum oder evangelisches Klosterwesen25 überlebte, war weniger als der Hauch ehemaligen Sinns. Wo die Reformation vordrang, kam die Kirchengeschichte des Mittelalters in wesentlichen ihrer Erscheinungen an ein Ende.
Die Reformation als deutsches und europäisches Ereignis
Seit Leopold von Ranke ist die Reformationsgeschichte ein klassisches Thema der nationalen deutschen Geschichtsschreibung. Die tiefe Verwurzelung in nationalen Selbstbeschreibungen geht freilich bereits in die Geschichte des frühneuzeitlichen Luthertums zurück, wie überhaupt der nationale Diskurs in Deutschland zunächst ganz wesentlich von protestantischen Autoren bestimmt worden ist.26 Die ideologischen Instrumentalisierungen der Reformation im Kontext nationalprotestantischer Geschichtspolitik sind in ihrer Fragwürdigkeit so evident,27 daß jede nationalistische Emphase bei der Beschreibung eines ›deutschen Ereignisses‹ Reformation problematisch erscheinen muß. Wäre es deshalb nicht geradezu überfällig, ja zwingend, die Sicht auf das Phänomen Reformation konsequent zu europäisieren und damit jedem deutschen Provinzialismus den im Horizont postnationaler und postkolonialer Historiographie geschichtspolitisch korrekten ›Laufpaß‹ zu geben?
Die vorliegende Darstellung wird in der Tat immer dann, aber auch nur dann, wenn die europäischen Bezüge zum Verständnis der historischen Zusammenhänge unverzichtbar sind, auf diese eingehen. Angesichts dessen, daß das Oberhaupt des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation in den entscheidenden Phasen der Reformationsgeschichte, Kaiser Karl V. (reg. 1520-56), ein Monarch von europäischem, ja weltpolitischem Format war und außenpolitische Belange auf seine Religionspolitik im Reich notorisch einwirkten, sind die internationalen Zusammenhänge selbstverständlich von zentraler Bedeutung. Auch die vielen direkten oder indirekten Kontakte, die die führenden Reformatoren des deutschsprachigen Raums zu Gelehrten und zu religiösen Gruppen der europäischen Nachbarländer unterhielten, wirkten zeitweilig bestimmend auf die Reformationsprozesse im Alten Reich und in der Eidgenossenschaft ein. Gleichwohl ist es meines Erachtens sachgerecht, die Reformationsgeschichte Deutschlands ins Zentrum einer eigenen Darstellung zu rücken, zum einen, weil die Reformation hier begann, unter den spezifischen politischen und verfassungsrechtlichen Gegebenheiten des Alten Reichs ein spezifisches Profil erhielt und einen gegenüber anderen europäischen Ländern charakteristisch verschiedenen Verlauf nahm, und zum anderen, weil sie nicht zuletzt aufgrund der zentralen Rolle der volkssprachlichen Publizistik einen spezifischen kulturellen Zusammenhang bildete und einige der führenden Protagonisten der Reformation der Kirche im politischen und kulturellen Raum der ›deutschen Nation‹ eine besondere, jedenfalls eine prioritäre Bedeutung beimaßen.
Manche gegenüber bisherigen Gesamtdarstellungen der Reformationsgeschichte Deutschlands eigenwillig anmutende Gewichtung ergibt sich aus meinem Interesse an geschichtlichen Akteuren, Individuen, kleineren und größeren, öffentlichen und heimlichen Gruppen und politischen Ordnungsmächten. Was bedeutete ihnen, wie deuteten sie die christliche Religion im Kontext ihrer sozialen und mentalen Welt? Wie verhielten sich reflexive Interpretationsgestalten der Religion – also Theologien – zur kulturellen und politischen Praxis? Wo immer es möglich und mit Rücksicht auf ein Gesamtbild vertretbar oder gar unverzichtbar schien, wurde der Nähe zu den Quellen gegenüber makrohistorischen Perspektiven der Vorzug gegeben.
Freilich hat die Darstellung selbst plausibel zu machen, inwiefern dieser Weg sinnvoll ist. Auch wenn sich die Reformansprüche und kirchenkritischen Impulse der Reformatoren auf die universale Kirche Roms bezogen und insofern an der Katholizität jenes Kirchentums, gegen das sie sich wandten, partizipierten – ihre historisch primäre Verwirklichung fand die Reformation in einzelnen Städten oder Territorien des Alten Reichs, denen es gelang, ihre Eingriffe in das bestehende Kirchentum politisch hinreichend abzusichern. Die Reformation gibt es insofern nur als den Zusammenhang diverser städtischer und territorialer Reformationen. Als diesen aber gibt es sie.
TEIL IDIE VORAUSSETZUNGEN DER REFORMATION
Grund und Anlaß, Verlauf und Struktur der Reformation sind nicht unmittelbar aus ihrer Vorgeschichte ableitbar. Nachdrückliche Vorbehalte sind gegenüber einem wirkungsreichen protestantischen Interpretationsmuster anzumelden, das in einem ›krisenhaften Verfall‹ von Kirche und Gesellschaft am ›Vorabend‹ der Reformation die entscheidende Ursache dafür sah, daß es mehr oder weniger zwangsläufig zu einem ›Aufstand des Gewissens‹ gegen die allgegenwärtige Dekadenz eines von lüsternen Mordbuben auf dem renaissance-verschönten Thron Petri geleiteten Kirchentums kommen mußte. Durch die intensiven Forschungsarbeiten nunmehr dreier Generationen muß die nach dem Zusammenhang von Ursache und Wirkung strukturierte Verhältnisbestimmung von zwielichtig-verkommenem Spätmittelalter dort und lichtvoller Reformation hier als wissenschaftlich obsolet gelten. Denn zum einen sind formalistische Schematisierungen nach dem Ursache-Wirkungs-Muster im allgemeinen schwerlich imstande, historische Veränderungsschübe und die ihnen innewohnenden Eigendynamiken zu beschreiben. Zum anderen widerspricht die letztlich in Wertungen der zeitgenössischen Protagonisten der Reformation wurzelnde vereinfachende Gegenüberstellung von Verfall und Reform, Niedergang und Aufstieg den differenzierten Beobachtungen, die sich einem um Unvoreingenommenheit bemühten Blick auf das 15. und frühe 16. Jahrhundert aufdrängen, in vielfältiger Weise.
Die dekadenztheoretische Sicht auf das Spätmittelalter ist als Folge apologetisch-polemischer Selbstbehauptungsstrategien der Reformatoren und ihrer Nachfolger zu verstehen; wie viele Reformer vor oder nach ihnen auch begründeten die Reformatoren ihre am Maßstab des Alten, Ehrwürdigen und Ursprünglichen ausgewiesenen Neuerungen und Veränderungen mit dem Verfall, der sie notwendig gemacht habe. Doch theologisch-politische Programmtexte vom Schlage der Schrift Luthers An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung (1520) taugen als Rekonstruktionsgrundlage der kirchlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse ihrer Zeit nur, wenn man ihren polemisch-agitatorischen Charakter wahrnimmt. ›Neuerer‹ müssen sich üblicherweise verteidigen, und sie pflegen dies damit zu tun, daß sie die Kriterien ihrer ›Reformen‹ im Bereich des normativ Unbestreitbaren, für alle Beteiligten Gültigen verankern und die Notwendigkeit ihrer Neuerungen daraus begründen, daß es einfach nicht mehr so weitergehen konnte. Nach »Ursachen der Reformation«1 zu fragen bedeutet also implizit, den Kampf der Reformatoren um die Legitimität und die Notwendigkeit der Reformation mit historiographiepolitischen Mitteln fortzusetzen.
Dieser Weg soll hier nicht beschritten werden. Vielmehr gilt es, nach Bedingungen und Voraussetzungen zu fragen, die die Reformation möglich und ihren Verlauf und ihre Struktur in ihrer Zeit plausibel gemacht haben. Manchen dieser Bedingungen und Voraussetzungen kam eine zentrale, dauerhaft prägende Bedeutung zu; anderen ist eine eher begleitende oder phasenweise begünstigende Rolle zuzuschreiben. Da die Reformation ein das gesamte Kirchen- und Gesellschaftswesen des 16. Jahrhunderts mehr oder weniger intensiv berührender Sachverhalt war, sind auch ihre Bedingungen und Voraussetzungen auf allen relevanten Ebenen zu identifizieren: auf den gesellschaftlichen und politischen, den kirchen-, frömmigkeits- und theologiegeschichtlichen, den kultur-, bildungs- und kommunikationsgeschichtlichen Feldern der Zeit.
KAPITEL 1GESELLSCHAFTLICHE UND POLITISCHE VORAUSSETZUNGEN DER REFORMATION
das reich zur zeit kaiser maximilians i.
Der Regierungszeit Kaiser Maximilians I. (1493-1519), der seit 1486 als römischer König (rex populorum romanorum) Mitregent seines Vaters Friedrich III. war, kommt für die Reformationsgeschichte Deutschlands eine zentrale Bedeutung zu, und zwar in doppelter Hinsicht: Zum einen begründete Maximilian durch seine Heirats- und Hausmachtpolitik jenes Universalreich der Habsburger, das sein Enkel Karl V. regieren sollte (siehe Abb. 1); die Geschicke des Reichs bestimmten das Verhalten der Habsburger als Gegenspieler der Reformation. Zum anderen betrieb und erreichte Maximilian eine Konsolidierung seiner Herrschaft und des politisch-rechtlichen Institutionengefüges im Reich; sie bildeten die Voraussetzung für die politische Regulierung der Religionsfrage auf Reichsebene.
Heiratspolitik und internationale Verflechtungen
Durch seine Heirat mit Maria (gest. 1482), der Tochter Karls des Kühnen und Erbin von Burgund (1477), erwarb Maximilian Herrschaftsansprüche in der Freigrafschaft, die langwierige Konflikte mit der konkurrierenden französischen Krone begründeten und ihm schließlich die Anbindung der städtereichen und ökonomisch florierenden niederländischen Territorien eintrugen. In Tirol und den Vorlanden sicherte Maximilian dem Hause Habsburg Besitzungen, denen wegen der Edelmetallvorkommen eine wichtige Bedeutung bei der Stabilisierung seiner notorisch leeren Kassen zukam. Durch seine zweite Ehe mit der Tochter des Mailänder Herzogs Ludovico Sforza (1494) suchte Maximilian, freilich mit mäßigem Erfolg, die Bindung Oberitaliens an das Reich zu festigen. Aus der antifranzösischen Interessenkoalition mit Spanien heraus, die insbesondere der Abwehr beziehungsweise Zurückdrängung französischer Einflüsse in Italien galt, fädelte Maximilian eine Doppelheirat seiner Kinder Philipp und Margarethe mit den spanischen Infanten Juana und Juan ein. Aus der 1479 geschlossenen Ehe Philipps mit Juana, der Tochter Ferdinands von Aragon und Isabellas von Kastilien, ging Karl V., seit 1519 deutscher Kaiser, hervor. Nach dem Tod möglicher spanischer Thronfolger, die vor Juana erbberechtigt gewesen wären, und nach dem Ableben Philipps (1506), der das niederländische Erbe des Hauses Habsburg regiert hatte, fiel Karl V. auch das spanische Erbe zu; denn seine Mutter war mehr und mehr dem Wahnsinn verfallen. Die noch unter Maximilians Regie geschlossene habsburgisch-jagiellonische Doppelehe zwischen Ferdinand und Maria auf der Habsburger Seite und Anna und Ludwig aus dem böhmisch-ungarischen Königsgeschlecht führte später zum Erwerb Böhmens und eines Teils Ungarns (1526) durch seine Dynastie.
Abb. 1: Europa und die habsburgischen Monarchien im 16. Jahrhundert
Einige Strukturachsen der internationalen Beziehungen in der europäischen Staatenwelt des 16. Jahrhunderts, die die Reformation im Reich direkt oder indirekt beeinflußten, waren in der Regierungszeit Maximilians I. grundgelegt: der französisch-habsburgische beziehungsweise französisch-spanische Dauerkonflikt, der bis zum Frieden von Crépy (1544) immer wieder militärisch ausgetragen wurde und die Entscheidungsspielräume des Reichsoberhaupts mehr oder weniger entscheidend definierte. Die antihabsburgische Gesinnung der französischen Krone begründete Allianzen, die Karl V. regelmäßig zur Belastung wurden, unter anderem mit dem Osmanischen Reich. Auch die englische Politik war vom französisch-habsburgischen Antagonismus mitbestimmt; nachdem Heinrich VIII. (reg. 1509-47) Karl V. anfänglich unterstützt hatte, agierte er nach dem Bruch mit Rom, der zur Errichtung der anglikanischen Staatskirche (1531-34) führte, zugunsten Frankreichs.
Die internationalen Konstellationen nötigten Karl V. je und je zu Kompromissen mit den ›protestierenden‹, sich der Reformation öffnenden deutschen Reichsständen, die eine sukzessive Konsolidierung der Reformation mit sich brachten. Immer wieder belasteten habsburgische Ansprüche in Italien, die seit Maximilians Tagen ungesichert waren, das Verhältnis zum Papsttum, das seine Interessen als italienische Territorialmacht zu wahren hatte. Um den Zusammenhalt zwischen den auseinanderstrebenden Linien des Hauses Habsburg, der spanischen und der österreichischen, zu erhalten, waren Kompromisse und Abstimmungen mit den Geschwistern und der übrigen Dynastie unvermeidlich. Die gewaltige Macht, die in Karls V. Händen konzentriert schien, nährte auf vielen Seiten Befürchtungen vor seinem Übergewicht, und nicht zuletzt die Eroberungen der spanischen Krone in Übersee und der Zustrom amerikanischen Goldes bildeten agitatorisch mühelos verwertbare Anlässe, diesem mächtigsten Herrscher, den das Abendland je gesehen hatte, notorisch zu mißtrauen. Die sich aus der Überspanntheit der Maximilianeischen Ambitionen ergebenden strukturellen politischen Bedingungen, unter denen die Regierung dieses wichtigsten Herrschers der Reformationszeit stand, begünstigten am Ende den Erfolg der Reformation entscheidend.
Die Maximilianeische Reichsreform
Mit Kaiser Maximilians Namen verbindet sich sodann der Versuch einer Reform des politisch-rechtlichen Systems des Alten Reichs, kurz: die sogenannte Reichsreform, die mit dem ersten Reichstag seiner Regierungszeit in Worms (1495) einsetzte. Die die Forschung seit geraumer Zeit bewegenden Fragen, ob man es bei der Maximilianeischen Reichsreform mit einem verfassungspolitisch konservierenden oder einem die frühmoderne Staatlichkeit des Reiches ›verdichtenden‹ und befördernden, insofern modernisierenden Sachverhalt zu tun habe1 und ob sie durch formale Organisationsmomente oder durch personale, kommunikative und symbolische Interaktionen zur Wirkung gelangte, sind nur außerhalb des engeren historischen Rahmens der Reformationsgeschichte zu beantworten. Freilich zeigte sich, daß die soeben erst etablierten Institutionen des Reiches im Zuge der Reformation einer enormen Bewährungsprobe ausgesetzt wurden. Insofern trug die Reformation indirekt erheblich dazu bei, daß sich das Reich als System der Friedenswahrung und der rechtlichen Austragung von Konflikten über den Spannungen, die es zu bewältigen hatte, konsolidierte. Einem umfassenden konzeptionellen Plan freilich folgte die sogenannte Reichsreform nicht. Vielmehr galt es, pragmatisch tragfähige Lösungen angesichts bestehender Probleme zu finden beziehungsweise zwischen den beteiligten Ständen auszuhandeln.
›Das Reich‹ – das war seinem geschichtstheologischen Anspruch nach die maßgebliche politische Organisationsgestalt der christianitas in der Nachfolge des Imperium Romanum und insofern das letzte der vier Weltreiche des Danielbuches (Dan 2; 7). Im sakralen Glanz der Reichsrituale, der festlichen Belehnungen durch den Kaiser, der Eröffnungsmessen, der Präsentation der Reichskleinodien, der Aufzüge und streng hierarchisch geordneten Inszenierungen seiner Repräsentanten blieb die heilsgeschichtliche Bedeutung des Reiches präsent. ›Das Reich‹ – das war seiner politischen Wirklichkeit im 15. Jahrhundert nach ein Zusammenschluß unterschiedlicher Glieder unter einem Oberhaupt, dem Kaiser, dem sie durch ein Treueverhältnis verbunden waren. Die räumliche und politische Nähe zum Kaiser, der seit Maximilians Vater Friedrich III. (1439-42) durchweg aus dem Hause Habsburg stammte, war gleichbedeutend mit der Nähe zum Reich; insofern waren Nord- und Mitteldeutschland ›reichsferner‹ als Oberdeutschland und blieben es auch während der Reformationszeit.
Den personellen und institutionellen Kristallisationskern des Reiches bildeten nach Maßgabe der Goldenen Bulle Kaiser Karls IV. (reg. 1346-78) von 1356 die sieben mit dem Recht der Kur, das heißt der Wahl des Kaisers, ausgestatteten Kurfürsten. Sie galten als die ›Säulen des Reiches‹ und bildeten neben dem Kaiser seine körperschaftliche Repräsentation. Das Kurkollegium bestand aus den drei geistlichen Kurfürsten, den Erzbischöfen von Mainz, Trier und Köln, und den vier weltlichen Kurfürsten, dem König von Böhmen, dem Pfalzgrafen bei Rhein, dem Herzog von Sachsen und dem Markgrafen von Brandenburg. Das politische Gewicht, das Luthers Landesherr, der Herzog des ernestinischen Sachsens, als Kurfürst auf der Ebene des Reiches besaß, war für den Erfolg der Reformation von einer schwerlich zu überschätzenden Bedeutung.
Die forcierte institutionelle »Verdichtung«,2 die das Reich in der Regierungszeit Kaiser Maximilians erfuhr, suchte eine Reihe struktureller und politischer Krisen und Konflikte zu lösen. Die vor allem vom oberdeutschen Städtewesen des späten Mittelalters ausgehende ökonomische Dynamik, die mit technischen Fortschritten im Bergbau, im Metall- und Textilgewerbe elementar verbunden war, beflügelte die Ausbreitung der Geldwirtschaft und schuf handelskapitalistisch vernetzte Marktstrukturen. Militärtechnische und fortifikatorische Entwicklungen trugen dazu bei, das Militärwesen zu ökonomisieren, also Söldnerheere zu verpflichten und damit dem Rittertum des rüstungsbewehrten niederen Adels seine Existenzberechtigung zu rauben. Die im 15. Jahrhundert einsetzende und während des 16. Jahrhunderts dynamisierte Rezeption des spätantiken römischen Kaiserrechts trug zur sukzessiven Vereinheitlichung der Rechtsverhältnisse im Reich bei, brachte aber zugleich eine Professionalisierung des Rechts mit sich. Die gelehrten Juristen wurden nun unverzichtbar und verdrängten den nicht durch gelehrtes Wissen, sondern durch Herkunft ausgezeichneten Adel aus seinen höfischen Positionen. Die Abstiegs- und Verelendungsängste des niederen Adels, der Ritterschaft, die ein verklärend-rückwärtsgewandtes Bild eigener Größe konservierte, bildeten ein Ferment der Unruhe im Reich und begründeten spätere Affinitäten zur Reformation. Im ausgehenden 15. Jahrhundert aber äußerten sich die sozio-ökonomischen und politischen Gewichtsverschiebungen zugunsten der florierenden Handelsstädte und der großen Landschaften, die Bergwerke besaßen und Juristen in ihre Dienste nahmen, in einer wachsenden Gewaltbereitschaft des niederen Adels; denn er bediente sich des Fehdewesens, um eigene Interessen durchzusetzen, und er konnte daran nicht gehindert werden, da es ein System der Kontrolle und der Friedenswahrung zunächst nicht gab.
Die Wormser Reichsversammlung von 1495
Sowohl der Begriff ›Heiliges Römisches Reich deutscher Nation‹ als auch der Terminus ›Reichstag‹ sind erstmals belegt im Zusammenhang der ungemein großen, mit neuartiger medialer Intensität, durch Flugblätter und Flugschriften vorbereiteten Wormser Reichsversammlung von 1495, der ersten nach dem Regierungsantritt Maximilians I. Dieser semantische Befund verdeutlicht, daß von ihr ein prägender politischer Institutionalisierungsschub der sich zusehends als eigene ›Nation‹ empfindenden Reichsstände unter dem einen kaiserlichen Oberhaupt ausging. Der Kaiser brauchte von den Ständen Geld für die Finanzierung diverser militärischer Unternehmungen, insbesondere der Abwehr der immer weiter nach Südosteuropa vordringenden Osmanen (s. u. S. 365-367) und der Zurückdrängung des französischen Königs aus Reichsitalien. Den Ständen lag an einer dauerhaften Lösung struktureller Probleme, insbesondere auf dem Gebiet der ›inneren Sicherheit‹ und der verstetigten Beteiligung an der Herrschaft im Reich. Der sich 1495 abzeichnende Ausgleich ständischer und kaiserlicher Interessen mittels institutioneller und verfahrensrechtlicher Kompromißlösungen sollte die spezifische Gestalt deutscher Staatlichkeit der Vormoderne fortan prägen: Gemeinsame Belange der Reichsstände fanden im Kaiser und in den Institutionen des Reiches ihre staatliche Gestalt; die primäre Ausbildung von Staatlichkeit im Sinne eines verwaltungstechnischen und rechtlich-politisch integrierten Zusammenhangs hatte in den Territorialstaaten ihren Ort. Die Komplementarität und Simultaneität nationaler und regionaler beziehungsweise lokaler Identitäten prägte die kulturelle und die politische Wirklichkeit in Deutschland tiefgreifend und nachhaltig. Im Zuge der Reformation verbanden sich diese Identitäten auf komplexe Weise mit dem Religiösen beziehungsweise Konfessionellen.
Eine der grundlegenden Entscheidungen des Wormser Reichstags von 1495 betraf die Aufrichtung eines »Ewigen Landfriedens«, das heißt eines dauerhaften, nicht, wie bisher üblich, befristeten Fehdeverbots für das gesamte Reichsgebiet. Damit war es fortan untersagt, eigenes Recht durch Gewaltanwendung durchzusetzen – ein elementarer Schritt auf dem Weg zur Etablierung eines staatlichen Gewaltmonopols, das seine Realisierung freilich primär im Rahmen der Territorialstaaten fand; denn eine starke Reichsexekutive gab es nicht, sie hätte auch den Interessen der Landesherren widersprochen.
Die zweite Neuerung, die sich aus der ersten beinahe zwangsläufig ergab, war der Aufbau einer Rechtsinstitution, die die Möglichkeit bot, in einem geregelten Verfahren Recht zu suchen: das Reichskammergericht. Dabei handelte es sich um eine ständisch dominierte Gerichtsbehörde, die zunächst an wechselnden Orten, seit 1527 dann dauerhaft in Speyer eingerichtet wurde und als erste Instanz für die reichsunmittelbaren Stände fungierte; auch für Fragen des Landfriedensbruchs in den mittelbaren Städten und Territorien sowie als oberste Appellationsinstanz des gesamten Rechtswesens war diese neuartige Institution zuständig. Durch das Reichskammergericht und dessen Rezeption des gelehrten römischen Rechts wurde nach und nach ein Professionalisierungs- und Vereinheitlichungsschub des Rechtswesens in Deutschland ausgelöst. Neben dem Reichskammergericht bildete der Kaiser in seiner traditionellen Funktion als oberster Richter des Reiches eine eigene Rechtsinstitution, den Reichshofrat, aus. Beide Gerichte bestanden nebeneinander, ohne daß ihre Kompetenzen klar voneinander abgegrenzt gewesen wären. Die Dualität dieser Rechtsinstitutionen spiegelt die duale Struktur der deutschen Staatlichkeit der Vormoderne wider und trug wesentlich dazu bei, rechtsförmige Verfahren der Austragung von Konflikten durchzusetzen. Dieser Verrechtlichungsschub, der in den Jahrzehnten vor der Reformation einsetzte, schuf die Möglichkeiten dazu, daß auch zahlreiche Konflikte, die während der Reformation aufbrachen, rechtlich kanalisiert und insofern entschärft werden konnten. Daß die enorme Eskalation religiöser Emotionen, die mit der Reformation verbunden war, zunächst nicht in einen katastrophalen Religionskrieg einmündete, wie ihn Frankreich jahrzehntelang erleben und erleiden sollte, dürfte auch den friedenstiftenden Potentialen der in der Maximilianeischen Zeit etablierten Rechtsinstitutionen geschuldet sein. Als Faktoren der Stabilisierung des Zusammenhalts des Reiches ist die Bedeutung der beiden Gerichte hoch zu veranschlagen.
Die dritte institutionelle Entscheidung des Reichstags von 1495 betraf die zunächst auf vier Jahre befristete Einführung einer allgemeinen Reichssteuer, des sogenannten ›Gemeinen Pfennigs‹. Er sollte der Finanzierung des Reichskammergerichts und der Türkenabwehr dienen und von jedem Einwohner des Reiches, der das 15. Lebensjahr vollendet hatte, erhoben werden. Die individuelle Höhe der – Männer und Frauen gleichermaßen betreffenden – Steuerlast war an dem jeweiligen Vermögen orientiert. Die Einsammlung der Steuern sollte über die Pfarreien erfolgen; ein mit diesem vergleichbares Netz landesherrlicher Administration gab es nicht. Faktisch scheiterte dieses Reformvorhaben an den Landesherren, die sich durch Reichsabgaben in ihren eigenen fiskalischen Interessen behindert sahen und danach trachteten, den Fluß der Reichssteuern zu kontrollieren. Ähnlich erging es dem Reichsregiment, einem von den Ständen besetzten Regierungsausschuß unter der Leitung des Reichserzkanzlers, des Mainzer Erzbischofs. Es existierte nur kurze Zeit (1500-1502) und scheiterte daran, daß die Reichsstände sich weigerten, eigene Regierungskompetenzen abzutreten.
Eine weitere Vereinbarung zwischen Kaiser und Reichsständen betraf die jährliche Zusammenkunft zu den Reichstagen. Diese wurden damit als wichtigste Bühne und Entscheidungsplattform der politischen Kommunikation im Reich etabliert und legitimiert. Als Austragungsorte der Reichstage, zu denen der Kaiser einlud, waren die etwa 65 Reichsstädte (s. u. S. 55f.) vorgesehen. Die Stände berieten die vom Kaiser in einer Proposition festgesetzten Gegenstände in drei unterschiedlichen Kurien: der Kurfürsten-, der Fürsten- und der Städtekurie. Der Kaiser war von den Beratungen ausgeschlossen. Die Kurien trafen ihre Entscheidungen je für sich, in der Regel nach einem auf Konsensbildung abzielenden Verfahren. Zwischen Kurfürsten- und Fürstenkurie wurden die Beratungsergebnisse ausgetauscht und abgestimmt und der Städtekurie, in der die Reichsstädte vertreten waren, mitgeteilt. Die Fürstenkurien betrachteten die Entschließungen der Städtekurie in der Regel als unverbindliches Beratungsvotum. Das reichspolitische Gewicht der Städte, die zu den wichtigsten Kommunikations- und Aktionszentren der frühen Reformation werden sollten, stand in einem krassen Mißverhältnis zu ihren finanziellen Leistungen für das Reich und zu ihrer ökonomischen und kulturellen Bedeutung. In gemeinsamen interkurialen Ausschüssen wurden Entscheidungsgrundlagen erarbeitet, die der Verständigung mit dem Kaiser dienten. Beschlüsse des Reiches wurden als Reichsabschiede der Kaiser öffentlich verlesen, ratifiziert und im Druck verbreitet. Die Institutionalisierung der Verfahrensregelungen des Reiches bildete eine wesentliche Grundlage dafür, daß Reichsabschiede als verbindliches Reichsrecht angesehen wurden. Ihre Durchsetzung hing freilich entscheidend von der Exekutivgewalt der Landesherren ab. Für die Reformation wurde dies erstmals maßgeblich insofern, als sich einige Landesherren einer Durchsetzung beziehungsweise Veröffentlichung des antireformatorischen Reichsabschiedes von 1521, des Wormser Edikts gegen Luther und seine Anhänger (s. u. S. 298f.), versagten. Mit den Reichskreisen – zunächst, seit 1500, sechs an der Zahl (fränkischer, schwäbischer, bayerischer, oberrheinischer, niederrheinisch-westfälischer und sächsischer), 1512 kamen vier weitere hinzu (österreichischer, burgundischer, kurrheinischer und obersächsischer) – wurde eine im Verlauf des 16. Jahrhunderts organisatorisch immer stärker verdichtete politische Substruktur des Reiches geschaffen, die zum Teil wichtige Aufgaben der Landesverteidigung, der Einwerbung von Reichssteuern und der Durchsetzung von Reichsabschieden und Urteilen der Reichsgerichtsbarkeit übernahm.
Die spezifische Gestalt, die die politischen Verhältnisse in der Kindheit und Jugendzeit der späteren Reformatoren erhielten, die Verbindung von zentralisierenden und föderativen Elementen, von allgemeinen Grundsätzen oder Rechtsformen und partikularen Umsetzungen beziehungsweise Rezeptionen, stellen eine elementare Voraussetzung der Reformationsgeschichte dar. Die Bühne der Reichstage wurde zur wichtigsten Plattform der religionspolitischen Absicherung der Reformation und der überterritorialen Kommunikation zwischen reformatorischen Theologen, Fürsten und städtischen Politikern aus unterschiedlichen deutschen Landschaften. Die Schwäche der Reichsexekutive und die Stärke der Territorialstaaten und Städte, die begrenzte Macht des Kaisers und die schier unbegrenzte Vielfalt der Konflikte, in denen er sich zu bewegen hatte, bilden zentrale Voraussetzungen für den Erfolg der Reformation.
Maximilians I. Verhältnis zum Papsttum
Maximilians I. Verhältnis zum Papsttum war unstet, jedenfalls historisch bewegt und in mancher Hinsicht besonders charakteristisch für das Agieren des notorisch »sprunghafte[n] Pläneschmied[s]«.3 Zum einen war er von der religiösen Dignität seiner kaiserlichen Machtstellung tief überzeugt und von antirömischen Aversionen gegen den päpstlich-kurialen Fiskalismus und die auch aus italienischer Arroganz gegen die ›barbarischen Deutschen‹ gespeisten geringen Einflußmöglichkeiten deutscher Prälaten an der Kurie erfüllt. Die ständige Geldnot, die seine Regierung bestimmte, trug dazu bei, daß er in der finanziellen ›Aussaugung‹ durch Rom ein Schlüsselproblem seiner Herrschaft sah. Als Förderer der Künste und der humanistischen Literaten trug er zum anderen wesentlich dazu bei, daß nationale, antirömische Gesinnungen öffentlichkeitswirksam verbreitet werden konnten und in ihm einen Rückhalt gewannen. Die antirömischen Akzente dürften die populären Wirkungen der Propaganda um seine Person, die er mit großem Aufwand betreiben ließ, durchaus begünstigt haben. Im Zusammenhang mit akuten Spannungen zu Papst Julius II. (reg. 1503-13), die sich aus gegensätzlichen Interessen im Machtkampf um Italien ergaben, trieb er 1510 Vorstellungen voran, die auf eine nationalkirchliche deutsche Kirchenreform mit einem eigenen Primas hinausliefen, und seit 1507 hatte der inzwischen verwitwete Monarch sogar phantastisch anmutende Pläne gehegt, sich selbst zum Papst wählen zu lassen, um so die Italienpolitik in seinem Sinne abschließen zu können. Maximilian I. setzte dabei auch auf die Unterstützung schismatischer französischer Kardinäle, die sich 1511 in Pisa versammelt hatten. Sein Plan eines Romzugs zum Zweck der Kaiserkrönung durch den Papst war 1508 am Widerstand Frankreichs, Venedigs und des Papsttums gescheitert. Anstelle der ihm dauerhaft versagt gebliebenen päpstlichen Krönung ließ er sich dann in Trient zum ›Erwählten Römischen Kaiser‹ ausrufen, ohne daß verfassungsrechtlich eindeutig gewesen wäre, was dies bedeutete. Faktisch stellte sich der Trienter Proklamationsakt als Alternative zur Papstkrönung dar, zumal Julius II. schließlich seine Zustimmung gegeben hatte. Insofern begründete der erzwungene Verzicht auf die päpstliche Krönung die Distanzierung von Kaisertum und Papsttum, ja eine national konnotierte Verselbständigung der Kaiserwürde gegenüber Rom. Bei der Besetzung von Bischofssitzen, Erzstühlen (Trier und Salzburg) oder Domkapiteln mit Personen seines Vertrauens konnte Maximilian erhebliche Erfolge verbuchen, die der Konsolidierung seiner Macht im Reich zugute kamen.
Auf seinem letzten, dem Augsburger Reichstag von 1518 agierte Maximilian unter den Kurfürsten zugunsten der Wahl seines Enkels Karl zum Kaiser. Von dem am Rande des Reichstags fortgehenden Konflikt um den Wittenberger Mönch Martin Luther hatte er Kenntnis. In einem späteren Rückblick berichtete Luther davon, daß der sächsische Rat Degenhardt Pfeffinger (1471-1519) den Kaiser bei einer Audienz in Innsbruck getroffen habe und von ihm gefragt worden sei, was denn jener Mönch mache, der die nicht verachtenswerten Thesen über den Ablaß verfaßt habe.4 Im Zusammenhang mit den Augsburger Verhandlungen trat Maximilian, wohl veranlaßt durch die Weigerung des sächsischen Kurfürsten, der Kaiserwahl Karls zuzustimmen und die Türkenzugspläne Leos X. (reg. 1513-21) zu unterstützen, und beeinflußt von dem Kardinallegaten Cajetan (s. u. S. 228-232) in einem Brief an den Papst dafür ein, daß der Prozeß gegen den hartnäckigen Ketzer beschleunigt werde.5 Doch wahrscheinlich war das nicht die letzte Äußerung des Kaisers zu Luther;6 als der Mönch für seinen Gang zum Kardinallegaten um kaiserlichen Geleitschutz bat, wurde ihm dieser schließlich gewährt.7 Nach einer historisch unwahrscheinlichen späteren legendarischen Überlieferung soll Luther in Augsburg dem Kaiser vorgeführt worden sein; dieser habe ihm eine »große Zukunft vorausgesagt«.8 In einer lutherkritischen Variante der Geschichte hat das alternde Reichsoberhaupt auf der Schulter des Mönchs einen Raben sitzen sehen. Raben galten als Unheilsboten. Die Folgen von ›Luthers Sache‹ und die propagandistischen Erfolge, die der reformatorischen Bewegung nicht zuletzt deshalb zufielen, weil sie es verstand, sich die antirömischen Stimmungen der Maximilianeischen Ära zunutze zu machen, setzten erst nach dem Tod des Kaisers ein.
Maximilian selbst lebte in einer ungebrochen vorreformatorischen Frömmigkeit, von der der Bericht seines Endes ein eindrückliches Zeugnis ablegt. Schon auf der Rückreise vom Augsburger Reichstag, auf dem ihm eine definitive Lösung der Nachfolgeregelung im Reich versagt blieb, war er zu schwach, um zu Pferde zu reiten. Der ›letzte Ritter‹ – so pflegte er sich zu inszenieren – mußte nun in einer Sänfte getragen werden. Das Ziel seiner letzten Reise war die Burg Wels in Österreich. Nachdem er seinen Enkeln Karl und Ferdinand testamentarisch seine Länder übertragen hatte, legte er Schritt um Schritt die Insignien und Attribute seiner kaiserlichen Rolle ab. Nach dem Empfang der Letzten Ölung übergab er das kaiserliche Siegel einem Abt und verbat sich fortan, mit seinen Titeln angeredet zu werden. Vor seinen Schöpfer wollte er als sündiger Mensch treten. Nachdem er gestorben war, wurde er seinem Wunsch gemäß nicht einbalsamiert, sondern gegeißelt, seine Haare wurden geschoren, die Zähne ausgebrochen – ein Büßer vor dem Herrn. Sein Leichnam wurde sodann in einen groben Sack gehüllt und mit Asche und Kalk überschüttet. Seine letzte Ruhestätte war ein schlichter Eichensarg, mit dem er schon einige Jahre herumgereist war – ein Mahnmal der Vergänglichkeit, das zugleich der Verwahrung von Büchern und Akten gedient hatte. Das Totenbildnis, das von ihm erhalten ist, ist ein in seiner Realistik erschütterndes Dokument: ein fahlgelbes Gesicht mit tief eingefallenen Wangen, der zahnlose Mund leicht geöffnet; ein halb zugedrücktes Augenlid gibt den Blick auf eine verdrehte Pupille frei. Daß er nicht in Innsbruck, wo er sich im Jahre 1500 ein prächtiges Grabmal hatte bauen lassen, sondern in der Wiener Neustadt beigesetzt wurde, paßt zu seinem schillernden Wesen. Für die Generation der Reformatoren, die in seiner Regierungszeit herangewachsen waren, repräsentierte Maximilian das Leitbild eines deutschen, christlich-antirömischen Kaisertums schlechthin. Mit dem ›jungen spanischen Blut‹ wurde manches anders.
Territoriale Staatlichkeit
Während sich der Prozeß der Ausweitung und Intensivierung von Staatlichkeit im Sinne einer flächendeckenden Integration eines bestimmten Herrschaftsgebietes mittels einheitlicher Rechts- und Verwaltungsstrukturen und einer Konzentration der politischen und militärischen Gewalt in den westeuropäischen Monarchien, in England, Spanien und Frankreich, auf der Ebene der Nationen vollzog, bildeten im Alten Reich die Territorien deren primären Realisierungsrahmen. Das Reich und seine Institutionen behinderten diesen seit dem späten 15. Jahrhundert dynamisierten Prozeß vor- beziehungsweise frühmoderner Territorialstaatsbildung nicht wesentlich, ja, sie begünstigten ihn eher. Denn das Reich schuf durch den Landfrieden und seine Rechtsinstitutionen Entlastungen und Sicherheiten, die dem Ausbau der Fürstenherrschaft zugute kommen konnten. Freilich sollte man das bis in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts erreichte Maß an Herrschaftsintegration in der Hand der Fürsten auch nicht überschätzen; die in den Landtagen repräsentierten Landstände, meist in einzelnen Kurien der Städte, des Hochklerus und des Adels organisiert, besaßen, insbesondere wenn es um die Finanzen ging, erheblichen Einfluß und nötigten den Landesherrn regelmäßig dazu, sich mit ihnen zu arrangieren.