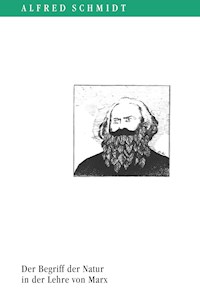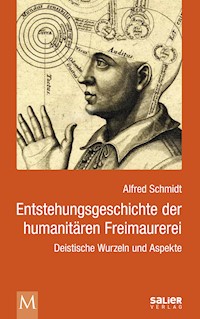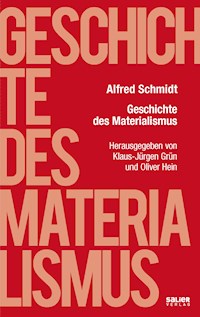
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Salier Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alfred Schmidt (1931–2012) hat sich als Schüler Max Horkheimers und Theodor W. Adornos ein akademisches Leben lang mit der Frage befasst, was wir unter »Materialismus« sinnvollerweise verstehen dürfen. Seine Studien derjenigen europäischen Denker, die als Materialisten bezichtigt wurden oder sich selbst dafür erkannten, bildeten für Schmidt die Quellen zu einem vorläufigen Begriff des Materialismus. Die Herausgeber stellen diese unvollendet gebliebene Geschichte des Materialismus auch denjenigen zur Verfügung, die bereit sind, eine bessere Welt nicht aus der Überschätzung der Vernunft und den philosophischen Dogmen eines intelligenten Weltlaufs abzuleiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichte des Materialismus
Alfred Schmidt
eBook EPUB: ISBN 978-3-96285-136-1
Print: ISBN 978-3-943539-73-8
1. Auflage 2017
Copyright © 2017 /2020 by Salier Verlag, Leipzig
Alle Rechte vorbehalten.
Kapitel »Begriff« (S. 53–73) aus »Theologische Realenzyklopädie« Bd. 22, Berlin 1992, Stichwort »Materialismus«, mit freundlicher Genehmigung des Verlages Walter de Gruyter.
Herausgeber: Prof. Dr. Klaus-Jürgen Grün, Prof. Dr. Oliver Hein
Umschlaggestaltung: Christine Friedrich-Leye
Satz und Herstellung: Salier Verlag, Bosestr. 5, 04109 Leipzig
www.salierverlag.de
Inhalt
Einführung: Humanistischer Materialismus
Entstehung
Die Angst vor dem Materialismus
Das Gehirn denkt
Vom metaphysischen Materialismus zum kritisch-humanistischen Materialismus
Materialismus als Ideologie und als Ideologiekritik
Materialismus und Positivismus
Literatur zur Einleitung und zu den Anmerkungen der Herausgeber
Geschichte des Materialismus
Begriff
Wortgebrauch
Grundzüge
Geschichte
Antiker Materialismus
Der Schritt vom Mythos zum Logos
Die Atomistik
Materialistische Aspekte der stoischen Philosophie
Naturalistisch-pantheistische Strömungen im Mittelalter
Allgemeine Problemlage
Heterodoxer Aristotelismus
Neuansätze materialistischen Denkens im 16. und 17. Jahrhundert
Naturbeherrschung und NaturenthusiasmusNaturbeherrschung und Naturenthusiasmus
Materialismus als totalisierte Mechanik
Metaphysik und mechanische Naturerklärung im Werk Spinozas
Zur Wirkungsgeschichte des Spinozismus
Der französische Materialismus des 18. Jahrhunderts
Englische Einflüsse
Aufklärung und Materialismus in Frankreich
Die französischen Materialisten im Urteil der Philosophiegeschichte
Voraussetzungen des materialistischen Diskurses
Von Locke zu Condillac: Der erkenntnistheoretische Sensualismus
Vom Sensualismus zum gesellschaftstheoretisch gewendeten Materialismus
Materialisten der ersten Jahrhunderthälfte
Materialisten am Vorabend der Französischen Revolution
Helvétius
Quellen/Literatur
Anmerkungen
Einführung: Humanistischer Materialismus
von Klaus-Jürgen Grün und Oliver Hein
Entstehung
Die philosophische Biografie Alfred Schmidts (1931−2012) ist maßgeblich geprägt von seiner Mitarbeit im Institut für Sozialforschung und im früheren philosophischen Seminar an der Frankfurter Goethe-Universität, wo seine Dissertation Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx zwischen 1956 und 1960 bei Adorno entstand. Schmidt wurde dadurch zum Marx-Experten der Frankfurter Schule und trug sowohl zur Popularität als auch zum Verständnis von Karl Marx in der 68er-Generation bei. Diese Wirkung wurde nicht zuletzt verstärkt durch seine ausgezeichneten Übersetzungen – schließlich war Alfred Schmidt auch Anglist – einiger Standardwerke der Kritischen Theorie aus dem Amerikanischen. Hier sind vor allem Max Horkheimers Kritik der instrumentellen Vernunft, Herbert Marcuses Vernunft und Revolution sowie Marcuses Eindimensionaler Mensch zu nennen.
In der ersten Hälfte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts befasste sich Alfred Schmidt vertieft mit der Geschichte des Materialismus, nachdem er in den 80er Jahren insbesondere Studien zu Feuerbachs Sensualismus, Goethes Pantheismus, Schopenhauers Willensmetaphysik und der Bedeutung Hegels für den späten Idealismus abgeschlossen hatte. Auch die seinerzeit zusammen mit Gunzelin Schmid-Noerr für den S. Fischer Verlag begonnene Edition der Gesammelten Schriften Max Horkheimers bewirkte eine Neuaufnahme der Fragen zur Geschichte des Materialismus.
Seit der Zeit der Arbeit an seiner Dissertation über den Begriff der Natur in der Lehre von Marx waren in den 70er Jahren verschiedene Studien über Materialismus entstanden, unter ihnen Drei Studien über Materialismus sowie die Einleitung zu der von ihm neu edierten Geschichte des Materialismus Friedrich Albert Langes. Angeregt durch das Erscheinen der zu seinem 60. Geburtstag am 31. Mai 1991 von Matthias Lutz-Bachmann und Gunzelin Schmid-Noerr herausgegebenen voluminösen Festschrift Kritischer Materialismus überarbeitete Schmidt während einiger Semester ältere Vorlesungsmanuskripte zur Geschichte des Materialismus. Sie bewirkten bei ihm eine Bestandsaufnahme und zugleich eine Neubewertung der Bedeutung des Materialismus für die Entwicklung der Geschichte der Philosophie. So waren es nicht zuletzt seine Schüler und die näher stehenden Kollegen, die durch ihre eigenen Orientierungsversuche zwischen Anpassung an den akademischen Zeitgeist und den stets quer zum schulbildenden Lehrgehalt der Philosophie stehenden Fragen des Materialismus für Schmidt zum Anlass wurden, selbst eine Geschichte des Materialismus zu entwerfen. Wenngleich Schmidts Engagement für dieses Thema in den ersten Jahren des letzten Jahrzehnts im 20. Jahrhundert unter seinen Assistenten und Hiwis keinen Zweifel daran ließ, dass dieses Buch bald fertig sein würde, endete die Beschäftigung damit abrupt in der Mitte der 90er Jahre. Nur das einleitende Kapitel erschien unter dem Stichwort Materialismus in der Theologischen Realenzyklopädie.1
Die Bestandsaufnahme der Fragen zur Geschichte des Materialismus trat in der Folge des Zusammenbruchs des Sowjetmarxismus und des realexistierenden Sozialismus nach 1989 auf. Die Ereignisse verstärkten bei Alfred Schmidt eine Enttäuschung hinsichtlich der Hoffnung, dass es einen Sozialismus (Marxismus) mit menschlichem Angesicht auf absehbare Zukunft werde geben können. Die zu Beginn der 90er Jahre vorbereitete Neuauflage seiner Dissertation Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx brachte eine veränderte Perspektive zutage. Die Rolle der Dominanz der determinierenden Naturfaktoren gegenüber der sekundären Kraft humaner Absichten rückte dabei stärker in den Vordergrund. »Daß ›gesellschaftliche Vermittlung der Natur‹ die ›naturhafte Vermittlung der Gesellschaft‹ voraussetzt, ist vielleicht erst heute im vollen Bewußtsein der Implikationen aussprechbar.«2 Hier ist ein eindeutiger Vorrang definiert: Bevor Natur ihr von der Gesellschaft geprägtes zweites Gesicht erhält, gibt es eine ursprüngliche Einbindung aller gesellschaftlicher Vorgänge in Naturverhältnisse. Schmidt folgte dabei dem Gedanken Engels’: »Bei ›jedem Schritt‹, so Engels in der Dialektik der Natur, ›werden wir ... daran erinnert, daß wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht – sondern daß wir mit Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehn, und daß unsre ganze Herrschaft über sie darin besteht, ... ihre Gesetze erkennen und richtig anwenden zu können‹«3. Schmidt legte schließlich Wert darauf, dass wir in unserer sozialen Wirklichkeit, niemals abgehoben von der unpersönlichen Natur unabhängige Entscheidungen treffen. »Deshalb sollten wir uns vor der Illusion hüten«, fährt Schmidt im Anschluss an das Engels-Zitat fort, »im Sozialismus werde die Menschheit sich souverän über die Natur erheben. Deren noch so große Beherrschung, bemerkt hierzu Max Adler, beseitigt nicht ›die Naturabhängigkeit ... der gesellschaftlichen Erscheinungen‹; sie ändert bloß die Form, worin sie sich durchsetzt.«4
Die Angst vor dem Materialismus
Wenn Matthias Lutz-Bachmann und Gunzelin Schmid-Noerr in ihrem Vorwort zu Kritischer Materialismus hervorheben, dass es Alfred Schmidt um einen »kritischen Materialismus der historischen Praxis«1 gegangen sei, dann stellen sie auch seine stets gegen den Sowjetmarxismus gerichteten politischen Ansprüche materialistischer Philosophie heraus. Historische Praxis bezieht sich stets auf das Handeln der Menschen innerhalb der historisch erreichten technischen und rationalen Möglichkeiten, wobei der Mensch sich als das Subjekt der Praxis und nicht als das Objekt eines Geschehens verstehen sollte. Die aus dem sowjetischen Dialektischen Materialismus (DIAMAT) erwachsenen Enttäuschungen des West-Marxismus – Unterdrückung kritischen Bewusstseins; Staatskapitalismus; Zensur; Staatsterror; ausgebliebene Entnazifizierung; metaphysische Realdialektik – führten ihn zu einer Konzentration auf die weltverändernde Praxis, die aufgrund politischer Interessen aus dem Begriff des Materialismus nicht willkürlich ausgeklammert werden dürfe. Während im Sowjetmarxismus die Gesetze der Marx’schen Dialektik als eine Objektivität, wie von einem Standpunkt von nirgendwo eindeutig und absolut gültig formuliert, gelehrt wurden, hatte der Westmarxismus der Kritischen Theorie von vornherein das Verhältnis der menschlichen Praxis zur Natur anders bestimmt. »Nach Marx«, fasst Schmidt die Thesen seiner Dissertation zusammen, »ist auszugehen nicht von der Materie, sondern von dem, was menschliche Produktion im Lauf der Geschichte mit ihr anzufangen vermag.«2 Diese Position steht in klarem Gegensatz zu Lenins Metaphysik der Dialektik der Materie, wie sie in Materialismus und Empiriokritizismus zur Erscheinung kommt.3 Nicht die vermeintlich objektive Eigendynamik dialektischer Gesetze der Geschichte, sondern die – wie sich später erst zeigen wird – aus Schopenhauers Negativität des Weltlaufs4 gewonnene Hoffnung, dass es eine andere Ordnung der Dinge gäbe als die der physisch-materiellen Welt, galt Alfred Schmidt ebenso wie Max Horkheimer als Anstoß zu einer weltverändernden Praxis.
So wenig die Definition von Materie sich an einer absoluten Objektivität orientieren kann, so wenig kann die Struktur der Veränderung eine ewig sich gleichbleibende sein. Verändernde Praxis bleibt so stets auch gehemmt, durch die Inhalte des Bewusstseins, die einer Welt angehören, die bereits vergangen ist. Nach wie vor »wälzt« sich der juristische und philosophische Überbau langsam hinter der Veränderung der realen Welt her. Wenn wir in der Gegenwart erleben, dass im Zeitalter einer kaum mehr rückgängig zu machenden Globalisierung starre Muster nationalistischer Identitätssuche aufkeimen, ist deren Existenz zum Großteil dem unvollständigen Verständnis gesellschaftlicher Entwicklung geschuldet. Alte Muster geistern als metaphysische Wahrheiten über der realen Gesellschaft weiter fort. Sie erscheinen fest wie Naturgesetze und beziehen aus diesem Schein ihre Legitimität. Ein kritischer Materialismus der Praxis sollte der Auflösung solcher Erstarrungen dienlich sein.
Auch die Beschäftigung mit Langes Geschichte des Materialismus führte Schmidt nicht weiter als bis zur Einsicht, dass sich dort ebenfalls Geschichte des Materialismus weitestgehend erschöpfte in der jeweils wechselnden Metaphysik des Materiellen. Der Begriff der »Praxis« dagegen schien geeignet, eine Tür zu öffnen zur Offenheit des Weltganzen und zur Kritik der kryptotheologischen Restbestände in der Gegenwartsphilosophie. Die Hartnäckigkeit, mit der sich längst widerlegte Denkformen sowohl im akademisch-philosophischen Klima als auch im Alltagsverstand fortpflanzten – Marx nannte sie zuweilen »Gespenster« –, schien Marx darin Recht zu geben, dass die von ihm als Überbauphänomene charakterisierten Denkformen nicht Schritt halten können mit dem Fortschritt der technischen und ökonomischen Entwicklung. Philosophische Lehren orientieren sich daher fast immer noch an einer Theorie der Naturwissenschaften wie sie im Zeitalter des mechanistischen Materialismus Newtons einmal Wirklichkeit gewesen ist.
Auf jener früheren Linie der Metaphysik des Materiellen bewegen sich heute noch beispielsweise die Hauptströmungen der Materialismusforschung. Vor allem die durch moderne Hirnforschung auf der Gegenseite inspirierte Erneuerung des vermeintlichen Leib-Seele-Problems zeigt, dass die Hauptströmungen der Philosophie sich kaum entfernt haben von vorindustriellen Denkformen einer Metaphysik der Natur. Denn auch diese Hauptströmungen artikulieren sich in der altertümlichen Vorstellung von Materialismus, worin der Geist »in Wirklichkeit ein Aspekt (oder eine Funktion) der Materie« sei.5 Vergeblich hatte Schmidt von Anfang an versucht klarzustellen, dass sich schon im 19. Jahrhundert »die Reduktion des Wirklichen auf körperliches Sein, gerade in Deutschland, … als rückständig« erwies, und es werde »damit ›vulgär‹, auf seiner absoluten Gültigkeit zu beharren«.6
Das Gesicht des Materialismus, das Schmidt im Blick hatte, lässt sich am ehesten erkennen aus den Positionen der Verächter dieser Denkhaltung. Dort nämlich wird Materialismus als eine philosophische Fratze gezeichnet. Reihum erweist sie sich als fundamental für die Stabilität traditioneller philosophischer Positionen und ihrer kryptotheologischen Restbestände. Denn die Verächter des Materialismus bestimmen, dass dieser stets bloß als Metaphysik der Materie aufzutreten habe.
Die gegenwärtige Rolle der Neurowissenschaften bei der Beantwortung philosophischer Fragestellungen bietet reichlich Gelegenheit, dieses Phänomen zu beobachten. Während es beispielsweise weder in der naturwissenschaftlichen Forschung noch im philosophischen Materialismus ein Leib-Seele-Problem gibt – das weltanschauliche Postulat, einer vom Leib wesentlich verschiedenen Seele spielt in den Erfahrungswissenschaften keine Rolle –, halten traditionsbewusste Philosophen daran fest, dass »der Materialismus gegenwärtig wieder eine Renaissance« erlebe, weil es beispielsweise kein Leib-Seele-Problem darin gibt.7 Denn »beflügelt durch Fortschritte in der Neurobiologie glaubt man, in naher Zukunft das Bewußtsein naturwissenschaftlich erklären zu können.«8 Freilich glauben die Autoren nicht, dass eine solche Erklärung jemals möglich sei. Ihnen dient das Argument bloß zur Beruhigung der erahnten Gefahr für ihren Glauben an die Existenz geistiger Entitäten. Sie sprechen daher Naturforschern die Zuständigkeit ab, über geistige Entitäten ein Urteil abzugeben. Ihnen ist es nicht erlaubt, über das Bewusstsein und seine rein geistige Daseinsweise zu spekulieren.9 Materialismus befinde sich deswegen auf Abwegen, weil nur Geisteswissenschaftler Bewusstsein erklären dürften. Naturwissenschaftler, die Urteile über Bewusstsein, Seele oder Geist äußern, gelten als Metaphysiker und Spekulanten. Weil reine Naturforschung nicht zuständig sei für geisteswissenschaftliche Domänen, weisen ihr vor allem Philosophen die Aufgabe zu, Materie als ein mechanistisch-atomistisches Gebilde zu behandeln. Diese Denkhaltung aber, deren Fortwirken sie nahezu ausschließlich selbst pflegen, verachten Geisteswissenschaftler seit Jahrtausenden als Materialismus. Wer Funktionen der Willensbildung aus diesem Mechanismus schließlich erklären will, gilt freilich als ein Reduktionist, dessen Mühen niemals vom Erfolg gekrönt sein könnten. So gesehen, gelten Materialisten noch heute als Metaphysiker der Natur. Schließlich sei die Welt komplexer als es Naturwissenschaftler – in der Funktion, die ihnen zahlreiche Philosophen zuschreiben – zu erklären vermögen.
Die Rolle, die Geisteswissenschaftler dem Materialismus verordnen, ist notwendig, um den Gegensatz zwischen Geist und Materie aufrechtzuerhalten. Dieser Gegensatz soll ein unauflöslicher bleiben. Hierzu ist es freilich nötig, Naturwissenschaftlern zu unterstellen, sie lehrten einen bestimmten Begriff von Materie, der dieser Forderung entspricht. Schon deswegen löste es keinerlei Widerspruch in den Geisteswissenschaften aus, als Robert Spaemann 2008 – hochmodern – auf dem Philosophie-Festival in Hannover seine schon zwei Jahre früher publizierte Behauptung wiederholte: »Leben ist nicht eine Eigenschaft des dem Lebewesen zugrunde liegenden Materials, sondern es ist eine Weise zu sein. Ja, es ist die exemplarische Weise zu sein.«10 Dadurch setzte Spaemann die Lehre der Entelechie des Aristoteles unbeschadet der seit Jahrhunderten vorgebrachten Widerlegungen der Plausibilität dieser Spekulation fort: »Leben ist das Sein des Lebendigen.«
Während Materialismus sich stets damit begnügte festzuhalten, dass Leben nichts Anderes zu sein braucht als ein besonderes Resultat der Funktionsweise organischer Materie, wollen die Verächter dieser Sparsamkeit mit Voraussetzungen eine zusätzliche Seinsweise einführen: Die Seinsweise des Lebens. Sie glauben dabei, dass diese zusätzliche Einführung weder spekulativ noch metaphysisch sei, sondern im höchsten Sinne wahr und unwiderleglich. (Bloß der Verzicht auf die Annahme der Existenz dieser Seinsweise, wie er im Materialismus gepflegt werde, sei spekulativ und metaphysisch.) Das »Prinzip« des Lebens, »was wir Entelechie, Seele nennen können, nämlich ein Prinzip der Spontaneität, der Eigentätigkeit«, sei der Grund, warum »das Lebendige selbst darüber entscheidet, was für es Ursache sein soll und was nicht. Und diese Entscheidung ist eine Funktion der Tendenz des Lebendigen, sich zu verwirklichen und sich zu erhalten.«11 Die Verteidigung des Leib-Seele-Problems beruht also offensichtlich auf der Angst vor dem Verlust der Möglichkeit, Naturkausalität außer Kraft setzen zu können, die Geisteswissenschaftler der geistigen Willenskraft zuschreiben. Dass dieser Verlust weitestreichende Konsequenzen für die soziale und rechtliche Struktur der Gesellschaft hätte, versteht sich von selbst, wenn wir diese Überlegungen auf die gegenwärtig immer noch anhaltende Diskussion um Präimplantationsdiagnostik und Sterbehilfe anwenden.12
Das Gesicht des Materialismus unterscheidet sich deutlich von der Fratze, die seine Verächter darin sehen wollen. Ein kritischer Materialismus kann nicht mit dem Argument abgewehrt werden, er befasse sich bloß mit einer Metaphysik der Materie. Vielmehr gilt, dass Materialismus erklären möchte, warum es in vorherrschenden Rechts- und Moralsystemen bereitwillig zur Anerkennung von Widersprüchen und Ungereimtheiten kommen kann, wenn massiv Herrschaftsinteressen bedroht sind. Materialismus erschöpft sich nicht darin, eine Theorie der Materie zu sein. Er hat stets auch politische Bedeutung.
Das Gehirn denkt
Die von Neurobiologen angestoßene Debatte um den freien Willen in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts zeigte einmal mehr die Bedeutung des metaphysischen Materialismus zum Selbstverständnis der Hauptströmung der Philosophie. Materialismus fungiert auch dort als Bezichtigungsbegriff, dem eine beschränkte und unhaltbare Annahme zugewiesen wird. Vor dieser Schablone sollen sich die Konturen einer Philosophie hervorheben, die dem Menschen als einem freien, wollenden und würdigen Subjekt gerecht wird, und die sein Denken nicht aus Hirnfunktionen zu erklären versucht. – Aber warum sollten traditionelle Spekulationen über das »Ich denke«, das »alle meine Vorstellungen [muss] begleiten können«1, das Bewusstsein besser erklären als naturwissenschaftliche Forschung? Warum soll es mit der Würde des Menschen leichter zu vereinbaren sein, wenn denunzierende Behauptungen über Materialisten verbreitet werden?
Ein Materialismus der Kritik sucht die Gründe für die Abwehr dieser Fragestellungen auch in der Angst- und Triebstruktur des philosophischen Forschers selbst aufzuspüren. Er fragt nicht nach unwiderleglichen Wahrheiten, sondern nach den Gründen, eine solche besitzen zu wollen. Er fragt danach, warum offensichtliche Implausibilitäten hingenommen werden, während gleichzeitig dem Anschein nach mit schärfster Präzision argumentiert wird. Die traditionelle Philosophie hatte ihre Daseinsberechtigung offenbar derart stark aus der idealistischen Auffassung von Subjekt, Willensfreiheit, Seele und Geist generiert, dass sie mit dem Wiedererstarken naturalistischer Positionen in der Philosophie um ihre Zuständigkeit für mentale Ereignisse fürchten musste.
Der Vorwurf einer unhaltbaren Metaphysik der Materie verbündet sich daher auch in der Gegenwart wieder leicht mit der Wahrnehmung des Alltagsverstandes, der sein Denken und Handeln nicht als determiniert erlebt und in dieser vermeintlichen Indeterminiertheit seine Personalität sowie seine Würde verortet. Im philosophischen Diskurs verwandelt sich diese Alltags-Intuition in eine Selbstauflösung des Materialismus (im Sinne seiner metaphysischen Spielart), die zu befördern sich auch Habermas nicht zu schade ist: »Aber ist die deterministische Auffassung überhaupt eine naturwissenschaftlich begründete These, oder ist sie nur Bestandteil eines naturalistischen Weltbildes, das sich einer spekulativen Deutung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse verdankt?«2 Freilich zweifelt Habermas so wenig wie andere Funktionäre der philosophischen Forschergemeinschaft daran, dass der Materialismus der Hirnforscher nichts anderes als eine spekulative Weltanschauung darstelle. Ebenso zweifelt Habermas nicht daran, dass Naturwissenschaftler nicht den Verstand besitzen, ohne Zuhilfenahme philosophischer und soziologischer Vormünder, ihre eigenen Forschungsergebnisse zu interpretieren. Doch statt sich der Herausforderung zu stellen, wird die Kritik am traditionellen Selbstverständnis der Philosophie in zwei Schritten abgewehrt: Erstens seien alle deterministischen Naturanschauungen spekulative Deutungen, und zweitens gehören sie automatisch in die Schublade des Naturalismus und Materialismus, der aufgrund seiner metaphysischen Prämissen längst widerlegt sei. Allerdings reflektiert die Forschergemeinde nicht darüber, dass sie selbst zuvor den Materialismus zu einer spekulativen metaphysischen Weltanschauung erklärt hatte, um davon abzulenken, dass Dialektik, Phänomenologie, Philosophie des Geistes und des Bewusstseins, sprachanalytischer Positivismus, deontologische Ethik und vieles mehr in noch höherem Maße auf weltanschaulicher Spekulation beruhen könnten. Die Positionen der Forschergemeinde können jedoch auf diese Weise gegen empfindliche Kritik immunisiert werden.
Diese in den Hauptströmungen der Geschichte der Philosophie stets vorherrschende Abwehr des Materialismus als einer unhaltbaren Metaphysik der Natur führte Schmidt auf die Fährte, dass die materialistische Position allererst durch die intellektuelle Unredlichkeit seiner Abwehr ihre Plausibilität gewann. Hierdurch schien ihm eine Geschichte des Materialismus möglich zu sein, die auf verschiedene Konzepte geisteswissenschaftlicher Strömungen eine je spezifische Kritik hervorbrachte. Materialismus, wie Schmidt ihn verstand, ist dennoch selbst zumeist keine autonome oder alternative Lehre oder gar Philosophie. Er tritt fast ausschließlich als Kritik auf und entlarvt die Implausibilitäten der Schulphilosophie, ohne eine solche werden zu müssen. Die Funktion des Materialismus, die Alfred Schmidt in der Literatur vollkommen vernachlässigt sah, erkannte er genau darin, jene weltanschaulichen Implikationen der Traditionslinien der Philosophie freizulegen. Materialismus erscheint hierbei als eine Denkhaltung, die die unglaubwürdigen, aber zählebigen Prämissen akademischer Diskurse zu entlarven hatte, die uns immer wieder versichern wollen, dass Materialismus als einer Reduktion des Lebens und seiner Würde auf die Materie, die Seele, den Geist und das Bewusstsein niemals werde erfassen können. Doch – wie wir gesehen haben – beanspruchte der Materialismus zumeist gar nicht, diese Aufgabe zu erfüllen, sondern erwies sich oft nur als fähig, die Frage offen zu lassen und abzuwarten, bis sich vielleicht bessere Erklärungen böten. Somit konnte Materialismus nicht selbst wieder eine Schulphilosophie werden. Er erwies sich als die Position der Systemkritiker, die nicht selber wieder ein System zu begründen beabsichtigten.
Frühe Auseinandersetzungen mit Psychoanalyse und Hirnforschung zeigen Alfred Schmidt kämpferisch gegen den akademischen Zeitgeist der philosophischen Forschergemeinde eingestellt. In seiner Rezension der 1984 auf Deutsch erschienenen Ouvertüre der modernen Hirnforschung, dem Neuronalen Menschen von Jean-Pierre Changeux stimmte er der Diagnose Changeuxs uneingeschränkt zu, dass »die heutigen Humanwissenschaften sich – sehr zu ihrem Nachteil – von ›ihrem Mutterboden‹, der Biologie«, entfernt haben. Sie kümmern sich, abgesehen von Ausnahmen, nicht um die Methoden und Ergebnisse der neuen Gehirnforschung.«3 Schmidts Empfehlung jener Jahre lautete: »Angesichts des Fortschritts auf neurobiologischem Gebiet in den letzten zwanzig Jahren, der sich allenfalls mit der Entwicklung der Physik zu Beginn des Jahrhunderts oder der Molekularbiologie während der fünfziger Jahre vergleichen läßt, scheint es geboten, das neue Wissen über die triviale Tatsache, daß der Mensch mit seinem Gehirn denkt, über den Kreis der Fachleute hinaus einem breiteren Publikum zu erschließen. Diesem Bedürfnis kommt das materialreiche, gescheite Buch von Changeux nach, das freilich (trotz beigefügten Glossars) schon terminologisch dem interessierten Laien manches Rätsel aufgibt. Hinzu kommt, daß sich Changeux keineswegs damit begnügt, einige Ergebnisse neuerer Forschung mitzuteilen. In Wahrheit transportiert seine Schrift, ohne das philosophisch-bekenntnishaft auszusprechen, einen materialistischen Monismus von eiserner Konsequenz, der gegenüber Anhänger Lenins sich wie vorsichtige Leute mit idealistischen Skrupeln ausnehmen. Wenn Changeux – rhetorisch – fragt, ob nicht die Gegner einer rein ›biologischen Erklärung des Seelenlebens oder der geistigen Prozesse‹ befürchten, ›einem allzu einfachen Reduktionismus aufzusitzen‹, so trägt sein Buch jedenfalls nicht dazu bei, solche Bedenken zu zerstreuen.«4
Vom metaphysischen Materialismus zum kritisch-humanistischen Materialismus
In ähnlichem Sinne, aber stärker an Schopenhauer orientiert, vertrat Schmidt auch die materialistische Position in einem 1986 in der katholisch-philosophischen Hochschule St. Georgen bei Frankfurt aufgezeichneten Streitgespräch mit Jörg Splett über die Frage Wie frei ist der Mensch? 1 Während die konservative philosophische Denkgewohnheit Willensfreiheit nach dem Prinzip der moralischen Freiheit eines Christian Wolff definiert – »Wer aus deutlicher Erkenntnis des Guten dasselbe thut, hingegen aus deutlicher Erkenntnis des Bösen dasselbe unterlässet, der vollbringt das Gute und unterlässet das Böse aus völliger Freyheit«2 –, stellt Schmidt diese Auffassung als »übernatürliche« Freiheit der »natürlichen« gegenüber. Letztere sei jedoch nichts Anderes als die selbstverständliche, wenngleich von Naturverhältnissen beschränkte Handlungsfreiheit, die wir Menschen besitzen, und die unsere Wahl aus verschiedenen Optionen aufgrund natürlicher Motive zur Entscheidung bringt.
Die Ausführungen Schmidts zeigen deutlich, dass die Annahme einer übernatürlichen Freiheit – verstanden als Willensfreiheit – korrekterweise einer spekulativen Weltanschauung zuzurechnen ist, in der die natürliche Daseinsweise des Menschen überschritten werde, um ihn in einer »intelligiblen« Welt aufgehoben zu wähnen. Dagegen übernimmt die materialistische Position die Rolle der Kritik an der Notwendigkeit der Annahme des Übernatürlichen. Für Schmidt sind es auch die vielen Spielarten einer Lehre, die seit der Stoa, das Moralische aus der Natürlichkeit des Menschen erklären zu können beanspruchten. Darunter vor allem die pantheistischen Lehren. In Abkehr von ihnen verortete er diejenigen Lehren, die – wie Schmidt es mit den Worten Schopenhauers zusammenfasst – in der natürlichen Ordnung der Dinge nicht die einzige und absolute Ordnung der Welt erkennen wollen. Für sie gilt, was Schopenhauer als »das notwendige Credo aller Gerechten und Guten« bezeichnete: »Ich glaube an eine Metaphysik«3; das heißt, an eine übersinnliche Daseinsweise der Welt, aus welcher sich normative Kraft ableiten lasse. Schmidt war sich dessen bewusst, dass es sich hierbei ebenfalls um eine spekulative Annahme, ja um ein metaphysisches Bekenntnis handelte, das gleichwohl – und dies bildet den Unterschied zu herrschenden Ideologien – eine nichtmetaphysische Ursache haben kann. Wie Schmidt mit Schopenhauer bekennt, beruht diese Annahme nämlich auf einem »metaphysischen Bedürfnis« des Menschen und nicht auf der Existenz einer geistigen oder seelischen Substanz.4
Dass es zu einer solchen Vergeistigung des Normativen überhaupt gekommen sei, erklärte Schmidt in jenem Streitgespräch aus der Jahrtausende alten menschlichen Erfahrung mit der Ananké, der unerbittlichen Naturnotwendigkeit, von der wir vor allem aus der Mythenforschung wissen, dass sie aus dem Drang zur Verniedlichung des Gefürchteten stammt. Religiöse Vergeistigung und metaphysische Übersinnlichkeit – so die materialistische Antwort auf den Glauben an die Metaphysik – hat ihrerseits den Ursprung in der natürlichen Triebstruktur des Menschen und nicht in einer primären übernatürlichen Seinsweise oder einer Seelensubstanz: »Die Furcht hat zuerst in der Welt Götter geschaffen.«5 Während die Erklärungen religiöser Gottesvorstellungen zumeist platonisch sind und Gott aus der Vernunft oder einem Schöpfungsmythos ableiten, bevorzugt die materialistische Erklärung eine psychische Not – Sigmund Freud spricht sogar von einer Zwangsneurose –, deren Linderung das göttliche Heilsversprechen sein kann.
In der Position Schopenhauers, dass die moralische Ordnung eine andere als die physische Weltordnung bedeute und hierdurch der Hoffnung auf eine bessere Welt Genüge geleistet werde, sah Alfred Schmidt stets die vertretbare Position, in der die Marx’sche weltverändernde Praxis mit der materialistischen Negation des prästabilierten moralischen Weltlaufs auf moderne Weise in Einklang zu bringen sei. In dem Maße, wie das metaphysische Bedürfnis nach einer ganz anderen Welt im Leib des Menschen als Angst oder Hoffnung verortet ist, handelt es sich auch bei dieser Bestimmung von Transzendenz um eine materialistische Position. Sie verzichtet nämlich auf die Annahme einer zweiten Seinsordnung über der Leibnatur des Menschen, sondern setzt voraus, dass sich Hoffnung vollkommen in die physische Welt einfügt. Allerdings war Schmidt der Auffassung, dass die alleinige Anerkennung einer materiellen Natur, ohne die Hoffnung auf eine andere – moralische – Seinsweise als »Positivismus« abzulehnen sei. Hierauf wird weiter unten noch einzugehen sein.
Schon die Tatsache, dass viele pantheistische Konstrukte einen versteckten Materialismus enthalten, ist für Schmidt Grund genug, die materialistische Denkhaltung sehr viel differenzierter als die verbreiteten Studien zum Materialismus zu betrachten. So beinhaltet beispielsweise der Pantheismus Giordano Brunos nicht nur spekulative Aussagen über die Chemie des Universums, sondern vor allem die Opposition gegen die Methode der Scholastiker, die die Gültigkeit einer vermeintlichen Wahrheit aus Behauptungen von Autoritäten – namentlich des Aristoteles und der Konzilsbeschlüsse – ableiteten. Indem Bruno weiterhin die Natur vergöttlicht, naturalisiert er den Gott und macht ihn zu einem Bestandteil der diesseitigen Welt. Ja, der schöpferischen Materie und ihrer Bildegesetze bleibt selbst der pantheistische Gott unterworfen. Schmidt spricht von ihm als dem »enthusiastischen Verkünder einer weltfrommen, daseinstrunkenen Philosophie«6. Der sensualistische Gehalt dieses Materialismus äußert sich dadurch, dass Bruno dem metaphysischen Bedürfnis nach Transzendenz folgt, ohne dabei dem Anspruch der Sinnlichkeit zu widersprechen. Eine übernatürliche Gottheit wird Bruno zum Unding.
Wenige Darstellungen des Materialismus bauen auf der Einsicht auf, die beispielsweise auch die Grundlage der Habilitationsschrift von Annette Wittkau-Horgby bildete, nämlich dass »die naturwissenschaftliche Erkenntnis … im Rahmen der Konzeption des historischen Materialismus zwar eine wichtige, gleichwohl letztlich untergeordnete Rolle«7 spielt. Diese Position vertrat stets auch Alfred Schmidt, wenngleich er in der Übertreibung naturwissenschaftlicher Positionen früh schon ihre Stoßkraft gegen den Idealismus aufspürte. So ergreift Schmidt stets Partei für den physiologischen Materialismus der »philosophischen Medizin«, wenn dieser sich etwa gegen den theologischen Hintergrund cartesianischer Erwägungen richtet, also gegen die Behauptung, »›daß die vernünftige Seele durch eine unmittelbare Schöpfung Gottes hervorgebracht wird‹«8. John Lockes anthropologisches Denken wertete Schmidt dagegen als einen »Durchbruch im Frankreich des achtzehnten Jahrhunderts«, wenn er, wie Schmidt mit Voltaire unterstreicht, »›vom Menschen her den menschlichen Verstand ableitet, so wie ein hervorragender Anatom die Triebkräfte des menschlichen Körpers.‹«9
Dennoch ist auch die Warnung vor der Gefahr naturwissenschaftlicher Ignoranz im philosophischen Materialismus nicht unberechtigt.10 Von anderer Seite wurde mit Recht ausdrücklicher kritisiert, dass die »Anti-Naturdialektiker der Traditionslinie Lukâcs – Merleau-Ponty – Alfred Schmidt, … die sich für besonders gute Marxisten oder Marxkenner halten, im Hinblick auf die Naturwissenschaften aber mit ungenügenden Kenntnissen ausgerüstet sind«11. Schließlich war auch Schmidts Verständnis naturwissenschaftlicher Methoden – insbesondere die Bedeutung des Experiments und der Mathematik – nur schwach ausgebildet.
Fehlendes Detailverständnis naturwissenschaftlicher Theorie und Praxis begünstigte immer schon die Auffassung, Naturwissenschaft sei bloß eine Metaphysik der Natur und könne niemals Ansprüche eines kritischen Materialismus in sich vereinen. Tatsächlich war auch Alfred Schmidt mit Arthur Schopenhauer einer Meinung, dass die »Leute ..., welche vermeinen, Tiegel und Retorte seien die wahre und einzige Quelle aller Weisheit, … in ihrer Art ebenso verkehrt, wie es weiland ihre Antipoden, die Scholastiker«12 sind. Schopenhauer sah sich einer auf naturwissenschaftlichen Methoden der Mechanik aufbauenden sozialen Wirklichkeit seiner Gegenwart ausgesetzt. Er bemängelt darin die zur Farce gewordene humanistische Bildung und bezieht einen Standpunkt der Kritik zum naturwissenschaftlichen Paradigma. Alfred Schmidt folgt dieser kritischen Haltung, indem er das Paradigma unter dem Bezichtigungsbegriff »Positivismus« abwertet.
Schopenhauers Diktum: »Die Welt ist meine Vorstellung«, wird zur begründeten Basis dieser Abwehr, weil gemäß seiner Lehre Naturwissenschaften ebenso wie Mathematik und alle anderen Wissenschaften der Welt als Vorstellung zuzurechnen seien.13 Doch mit der für Schopenhauer ebenso notwendigen – allerdings bloß postulierten – Annahme, dass die Welt nicht nur meine Vorstellung sei, sondern überdies noch metaphysischer Wille, eröffnete sich für Alfred Schmidt eine materialistische Position jenseits der naturwissenschaftlichen Prämissen. Während allerdings Schopenhauer ausdrücklich versicherte, dass dieses Andere der metaphysische Wille sein müsse, legte sich Alfred Schmidt nicht fest in der Beantwortung der Frage, was die Welt außerdem, dass sie Vorstellung ist, noch sei. Aber dieses nicht Genannte möge der Träger des materialistischen Denkens sein, der sich aus Praxis bilde. »›Allerdings‹, fügen Marx und Engels hinzu, ›bleibt dabei die Priorität der äußeren Natur bestehen‹ – gesellschaftliche Arbeit ist stets auf ein Material verwiesen. Aber jene ›Priorität‹ bedeutet kein Absolutum, sondern ist, innerhalb der praktisch vermittelten Einheit von Gegenständlichkeit und Tätigkeit, jeweils anders zu bewerten.«14
Materialismus als Ideologie und als Ideologiekritik
Wer sich mit Materialismus befasst, der fühlt sich in der Pflicht, eine Rechtfertigung abzulegen. Dies zeigt nicht nur die verdienstvolle Studie von Annette Wittkau-Horgby. Nicht ohne die Rituale der Verbeugung vor der materialismusfeindlichen akademischen Hauptströmung versucht sie, mit ihrer Habilitationsschrift Materialismus1 eine sachliche Betrachtung der Problemgeschichte des Materialismus abzuliefern. Ihr steht daher eine Art Glaubensbekenntnis voran: »Ich halte den im 19. Jahrhundert explizit oder implizit formulierten Anspruch der Materialisten, daß die materialistische Weltdeutung die logisch notwendige Konsequenz aus den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen sei, für unhaltbar und erkenntnistheoretisch unbegründet.«2