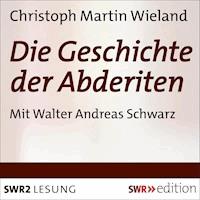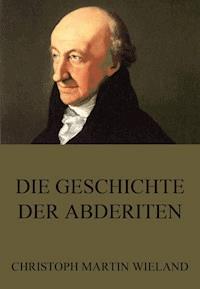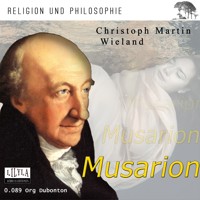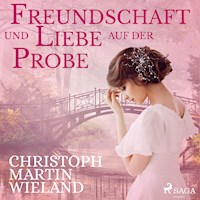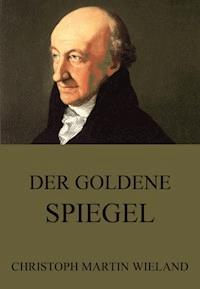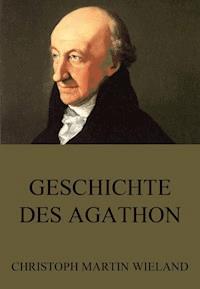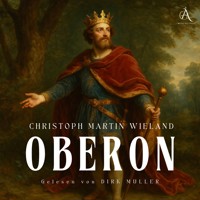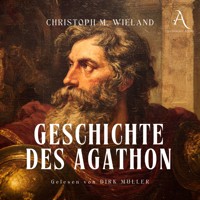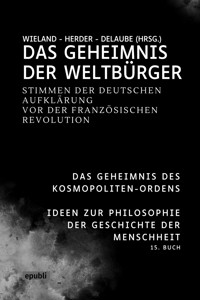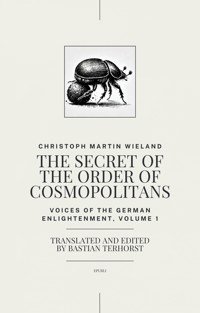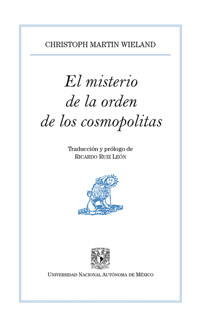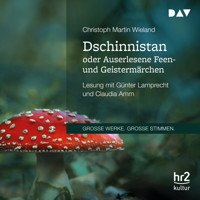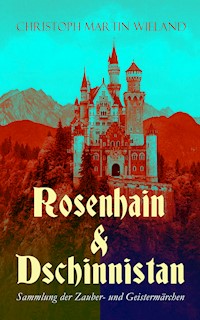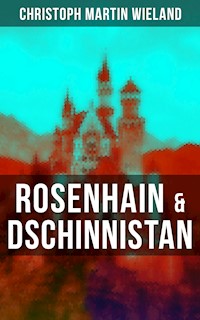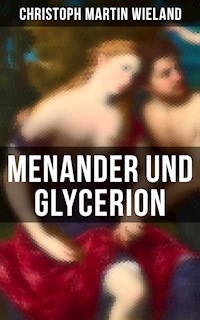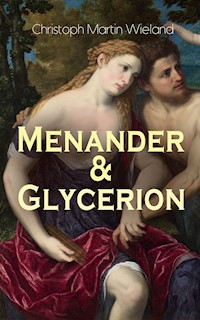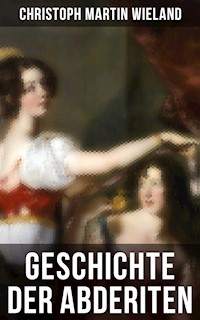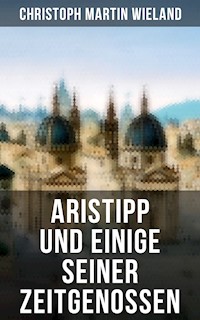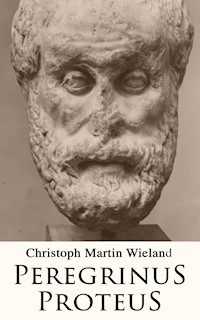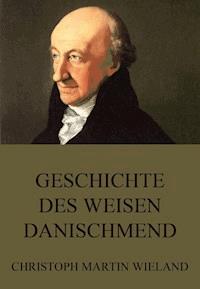
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im "Goldenen Spiegel" (1772) und seiner Fortführung in der "Geschichte des Weisen Danischmend" (1775), dessen Namen Wieland selbst bei seinen Freunden führte, fügte er der Gattung der Staatsromane, wie sie Albrecht v. Haller in seinem "Usong" wieder hatte aufleben lassen, ein neues Glied ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichte des Weisen Danischmend und der drei Kalender
Christoph Martin Wieland
Inhalt:
Christoph Martin Wieland – Biografie und Bibliografie
Geschichte des Weisen Danischmend und der drei Kalender
Keine Vorrede
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
Geschichte des Weisen Danischmend und der drei Kalender, C. M. Wieland
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849639921
www.jazzybee-verlag.de
Christoph Martin Wieland – Biografie und Bibliografie
Hervorragender deutscher Dichter, geb. 5. Sept. 1733 zu Oberholzheim im Gebiete der ehemaligen Reichsstadt Biberach, gest. 20. Jan. 1813 in Weimar, genoss bei seinem Vater, der 1736 als Pfarrer nach Biberach versetzt wurde, sowie in der dortigen Stadtschule trefflichen Unterricht. Noch vor dem 14. Jahr auf die Schule zu Klosterberge bei Magdeburg geschickt, gab der sehr fromm erzogene, leseeifrige Knabe sich anfangs ganz dem dort herrschenden Geiste hin und warf sich in eine ausschließliche Bewunderung Klopstocks. Nachdem er seit Ostern 1749 sich ein Jahr lang bei einem Verwandten in Erfurt aufgehalten, verbrachte er den Sommer 1750 im Vaterhause. Hier traf er mit seiner Verwandten Sophie Gutermann (nachmals Sophie v. Laroche, s. d.) zusammen (vgl. Ridderhoff, Sophie von Laroche und W., Programm, Hamb. 1907). Die schwärmerische Neigung, die er zu ihr faßte, entwickelte rasch sein poetisches Talent. Durch sie empfing W. die Anregung zu seinem ersten der Öffentlichkeit übergebenen Gedicht: »Die Natur der Dinge. Ein Lehrgedicht in sechs Büchern« (anonym erschienen 1752). Im Herbst 1750 hatte W. die Universität Tübingen bezogen, angeblich um die Rechte zu studieren, welches Studium er jedoch über der Beschäftigung mit der neuern schönen Literatur und eigner poetischer Produktion ziemlich vernachlässigte. Ein Heldengedicht: »Hermann«, von dem er fünf Gesänge (hrsg. von Muncker, Heilbr. 1886) ausarbeitete und an Bodmer sandte, brachte ihn mit diesem in einen sehr intimen Briefwechsel. Seine übrigen Erstlingsdichtungen. »Zwölf moralische Briefe in Versen« (Heilbr. 1752), »Anti-Ovid« (Amsterd. 1752) u. a., kennzeichneten ihn als ausschließlichen und leidenschaftlichen Klopstockianer und strebten auf eine spezifisch seraphisch-christliche Dichtung hin. Im Sommer 1752 folgte er einer Einladung Bodmers nach Zürich. Auf das herzlichste empfangen, wohnte er im traulichsten Verkehr eine Weile bei Bodmer, den er sich durch eine Abhandlung über die Schönheiten in dessen Gedicht »Noah« und durch die neue Herausgabe der 1741–1744 erschienenen »Züricherischen Streitschriften« (gegen Gottsched) verpflichtete, und in dessen Sinn er ein episches Gedicht in drei Gesängen: »Der geprüfte Abraham« (Zürich 1753), verfasste. In anregendem Verkehr mit Breitinger, Hirzel, Sal. Geßner, Füßli, Heß u. a. schrieb W. in Zürich um jene Zeit noch die »Briefe von Verstorbenen an hinterlassene Freunde« (Zür. 1753). Die plötzliche Nachricht, dass seine Geliebte sich verehelicht, sowie ein längerer Aufenthalt in dem pietistisch gestimmten Grebelschen Hause in Zürich hielten ihn eine Weile länger, als es sonst geschehen sein würde, bei der seiner innersten Natur ganz entgegengesetzten frommen Richtung. In den »Empfindungen eines Christen« (Zürich 1757) sprach er zum letzten mal die Sprache, die er seit Klosterberge geredet, und erklärte sich mit besonderer Heftigkeit gegen die erotischen Dichter, besonders gegen Uz (s. d.). Aber bald genug vollzog sich in W., besonders unter dem Einfluss der Schriften des Lukian, Horaz, Cervantes, Shaftesbury, d'Alembert, Voltaire u. a., eine vollständige Umkehr von den eben bezeichneten Bahnen. Schon das mit starker Benutzung einer englischen Tragödie von Rowe gedichtete Trauerspiel »Lady Johanna Gray« (Zürich 1758) konnte Lessing mit der Bemerkung begrüßen, W. habe »die ätherischen Sphären verlassen und wandle wieder unter den Menschenkindern«. In demselben Jahr entstand das epische Fragment »Cyrus« (Zürich 1759), zu dem die Taten Friedrichs d. Gr. die Inspiration gegeben hatten, ferner das in Bern, wo W. 1759 eine Hauslehrerstelle angetreten hatte, geschriebene Trauerspiel »Clementina von Porretta« (nach Richardsons Roman »Grandison«, das. 1760) und die dialogisierte Episode aus der Kyropädie des Xenophon: »Araspes und Panthea«, welche Dichtungen sämtlich nach Wielands späteren eignen Worten die »Wiederherstellung seiner Seele in ihre natürliche Lage« ankündigen oder geschehen zeigen. In Bern trat der Dichter in sehr nahe Beziehungen zu der Freundin Rousseaus, Julie Bondeli (s. d.). 1760 nach Biberach zurückgekehrt, erhielt er eine amtliche Stellung in seiner Vaterstadt, deren kleinbürgerliche Verhältnisse ihm minder drückend wurden, nachdem er auf dem Schlosse des Grafen Stadion, der sich nach dem Biberach benachbarten Warthausen zurückgezogen, eine Stätte feinster weltmännischer Bildung, mannigfachste persönliche Anregung und eine vortreffliche Bibliothek gefunden hatte. In Warthausen traf W. auch Sophie v. Laroche, seine ehemalige Geliebte, die mit ihrem Gatten bei Stadion lebte, wieder. Der Verkehr mit den genannten und andern Personen, die sich in jenem Kreise bewegten, vollendete Wielands Bekehrung ins »Weltliche«. Jetzt erst trat seine schriftstellerische Tätigkeit in die Epoche, die seinen Ruhm und seine Bedeutung für die nationale Literatur umfasst. Um 1761 wurde der Roman »Agathon« (Frankf. 1766–67; vgl. Scheidl, Persönliche Verhältnisse und Beziehung zu den antiken Quellen in Wielands ›Agathon‹, Berl. 1904; F. W. Schröder, Wielands. Agathon' und die Anfänge des modernen Bildungsromans, Dissertation, Königsb. 1905) begonnen, nach Lessings Urteil der erste deutsche Roman »für den denkenden Kopf von klassischem Geschmack«, 1764 »Don Silvio von Rosalva, oder der Sieg der Natur über die Schwärmerei« (Ulm 1764; vgl. Martens, Untersuchungen über Wielands, Don Sylvio', Dissertation, Halle 1901) vollendet. Daneben vertiefte sich W. in das Studium Shakespeares und ließ dessen Stücke zu einer Zeit, wo sie sonst in Deutschland noch nirgends ausgeführt wurden, in Biberach von einer Liebhabergesellschaft ausführen. Auch ließ er zuerst eine Sammlung von Shakespeareschen Dramen in deutscher Sprache erscheinen (22 Stücke, Zürich 1762–66, 8 Bde.). Die Übersetzung (in Prosa) wird ebenso wenig wie die Anmerkungen dem Dichter immer gerecht, die Versmaße des Originals sind nur in dem vortrefflich übertragenen und W. besonders kongenialen »Sommernachtstraum« beibehalten (vgl. Wurth, Zu Wielands, Eschenburgs und A. W. Schlegels Übersetzungen des, Sommernachtstraums', Programm, Budweis 1897; Simpson, Eine Vergleichung der Wielandschen Shakespeare-Übersetzung mit dem Originale, Dissertation, Berl. 1898).
Mit den beiden oben genannten Romanen und den Dichtungen: »Musarion, oder die Philosophie der Grazien« (Leipz. 1768) und »Idris und Zenide« (das. 1768), in den nächsten Jahren den Erzählungen: »Nadine« (das. 1769), »Combabus« (das. 1770), »Die Grazien« (das. 1770) und »Der neue Amadis« (das. 1771) verfolgte W. seinen neuen Weg und verkündete eine Philosophie der heitern Sinnlichkeit, der Weltfreude, der leichten Anmut, die im vollen Gegensatz zu den Anschauungen seiner Jugend stand. Inzwischen hatte W., der seit 1765 mit einer Augsburgerin verheiratet war, einem durch Riedel in Erfurt vermittelten Ruf an die dortige Universität im Sommer 1769 Folge gegeben. Seine Lehrtätigkeit, dse er mit Eifer betrieb, tat seiner dichterischen Produktivität wenig Abbruch. In Erfurt verfaßte er, außer einigen der oben genannten Schriften, noch das Singspiel »Aurora«, die »Dialoge des Diogenes« und den lehrhaften Roman »Der goldene Spiegel, oder die Könige von Scheschian« (Leipz. 1772; vgl. O. Vogt, ›Der goldene Spiegel‹ und Wielands politische Ansichten, Berl. 1904), der ihm den Weg nach Weimar bahnte. 1772 berief ihn die Herzogin Anna Amalie von Sachsen-Weimar zur literarischen Erziehung ihrer beiden Söhne nach Weimar. Hier trat W. in den geistig bedeutendsten Lebenskreis des damaligen Deutschland, der schon bei seiner Ankunft Männer wie Musäus, v. Knebel, Einsiedel, Bertuch u. a. in sich schloss, aber bald darauf durch Goethe und Herder erst seine höchste Weihe und Belebung erhielt. W. bezog unter dem Titel eines herzoglichen Hofrates einen Gehalt von 1000 Tlr., der ihm auch nach Karl Augusts Regierungsantritt als Pension verblieb. In behaglichen, ihn beglückenden Lebensverhältnissen entfaltete er eine frische und sich immer liebenswürdiger gestaltende poetische und allgemein literarische Tätigkeit. Mit dem Singspiel »Die Wahl des Herkules« und dem lyrischen Drama »Alceste« (1773) errang er reiche Anerkennung. In der Zeitschrift »Der teutsche Merkur«, deren Redaktion er von 1773 bis 1789 führte, ließ er fortan die eignen dichterischen Arbeiten zunächst erscheinen, neben denen er auch eine ausgebreitete kritische Tätigkeit übte (vgl. Burkhardt, Repertorium zu Wielands deutschem Merkur, Jena 1873). Wielands im »Merkur« abgedruckte »Briefe über Alceste« (September 1773) gaben Goethe und Herder Ärgernis und riefen des ersteren Farce »Götter, Helden und W.« (1774) hervor, auf welchen Angriff W. mit der ihm in der zweiten Hälfte seines Lebens fast unverbrüchlich eignen heitern Milde antwortete. Als Goethe bald darauf nach Weimar übersiedelte, bildete sich zwischen ihm und W. ein dauerndes Freundschaftsverhältnis, dem der überlebende Altmeister nach Wielands Tod in seiner schönen Denkrede auf W. ein unvergängliches Denkmal gesetzt hat. Goethe gewann auch den stärksten Einfluss auf Wielands Bestrebungen in der dritten Periode, in deren Werken sich die besten und rühmlichsten Eigenschaften unsers Dichters gleichsam konzentrieren, während seine Neigung zur ermüdenden Breite und zur sinnlichen Lüsternheit bis auf einen gewissen Punkt überwunden wurde. Die »Geschichte der Abderiten« (Leipz. 1781; vgl. Seuffert, Wielands ›Abderiten‹ Berl. 1878), das romantische, farbenreiche epische Gedicht »Oberon« (Weim. 1781; vgl. M. Koch, Das Quellenverhältnis von Wielands ›Oberon‹, Marb. 1880; Lindner, Zur Geschichte der Oberonsage, Rostock 1902), Wielands Meisterwerk, die prächtigen poetischen Erzählungen: »Das Wintermärchen«, »Geron der Adelige«, »Schach Lolo«, »Pervonte« (vgl. F. Muncker, Wielands ›Pervonte‹, Münch. 1904) u. a., gesammelt in den »Auserlesenen Gedichten« (Jena 1784–87), entstanden in den ersten Jahrzehnten in Weimar. Dazu gesellten sich die trefflichen Bearbeitungen von »Horazens Satiren« (Leipz. 1786), »Lukians sämtlichen Werken« (das. 1788–89; vgl. Kersten, Wielands Verhältnis zu Lucian, Programm, Kuxhav. 1900; Steinberger, Lucians Einfluss auf W., Dissertation, Götting. 1903) und zahlreiche kleinere Schriften. Eine Gesamtausgabe seiner bis 1802 erschienenen Werke (1794–1802 in 36 Bänden und 6 Supplementbänden), die Göschen in Leipzig verlegte, hatte W. in den Stand gesetzt, das Gut Osmannstedt bei Weimar anzukaufen. Dort lebte der Dichter seit 1798 im Kreise seiner großen Familie (seine Gattin hatte ihm in 20 Jahren 14 Kinder geboren) glückliche Tage, bis ihn der 1801 erfolgte Tod seiner Gattin veranlasste, seinen Landsitz zu veräußern und wieder in Weimar zu wohnen (1803), wo er dem Kreise der Herzogin Anna Amalie bis an deren Tod (1807) angehörte. Die Zeitschrift »Attisches Museum«, die W. allein 1796–1801, und das »Neue attische Museum«, das er mit Hottinger und Fr. Jacobs 1802 bis 1810 herausgab, dienten dem Zweck, die deutsche Nation mit den Meisterwerken der griechischen Poesie, Philosophie und Redekunst vertraut zu machen. W. blieb bis in sein höchstes Alter in seltener Weise lebensfrisch (noch aus seinen letzten Lebensjahren stammt seine schöne Übersetzung von »Ciceros Briefen«, Zür. 1808–21). 1808 wurde er von Napoleon mit großer Auszeichnung behandelt. Seine Überreste ruhen seinem Wunsche gemäß zu Osmannstedt in Einem Grabe mit denen seiner Gattin und einer Enkelin seiner Jugendfreundin Laroche, Sophie Brentano. In Wielands Gartenhaus in Biberach wurde 1907 ein Wieland-Museum errichtet (vgl. »Vorträge, gehalten bei der Wielandfeier in Biberach a. Riß am 3. September 1907«, Biberach 1907). Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Klassiker des 18. Jahrhunderts« (im 11. Bd.).
Indem W. bei Beginn seiner zweiten Periode zur Vorbildlichkeit der französischen Literatur zurückkehrte und den Ehrgeiz hegte, die der deutschen Literatur völlig gleichgültig gegenüberstehenden höheren Stände durch eine der französischen ähnliche graziöse Leichtigkeit und lebendige Anmut für die deutsche Literatur zu gewinnen, leistete er ebendieser Literatur einen großen und entscheidenden, aber auch einen etwas bedenklichen Dienst. Er nahm einen guten Teil der Leichtfertigkeit, der Üppigkeit und Oberflächlichkeit jener Musterliteratur in die Produktionen seiner mittleren Zeit herüber. Freilich verband sich diese herausfordernde Frivolität und spöttische Weltklugheit mit dem kräftigen Behagen und dem unverwüstlichen Kern in seiner Natur, der selbst Schiller in einem Brief an Körner Wielands »Deutschheit« trotz alledem und alledem betonen ließ. Und die außerordentliche Entwickelungsfähigkeit seines reichen Talentes, der eigentümliche Aufschwung, den seine Dichtung noch in der zweiten Hälfte seines Lebens nahm, hätten die stutzig machen sollen, die, wie dies im Kreise der Romantiker Mode war, von W. immer und überall nur als von einem guten Kopf, ohne eigenstes poetisches Verdienst und tiefere Bedeutung, sprachen. Die mittelbare Nachwirkung Wielands brachte der deutschen Literatur eine Fülle seither nicht gekannter Anmut und Heiterkeit, die lebendigste Beweglichkeit und gesteigerte Fähigkeit für alle Arten der Darstellung. Die sämtlichen Werke Wielands erschienen im Göschenschen Verlag, herausgegeben von Gruber (Leipz. 1818–28, 53 Bde., mit der unten angeführten Biographie), dann ebenda in 36 Bänden 1839–40 (wiederholt Stuttg. 1853) und bei Hempel (Berl. 1879, 40 Bde.); »Ausgewählte Werke« gaben H. Kurz (Hildburgh. 1870, 3 Bde.), G. Klee (Leipz. 1900, 4 Bde., mit Biographie), W. Bölsche (das., 4 Bde.), H. Pröhle (in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur«, Stuttg. 1887, 6 Bde.) und Muncker (in Cottas »Bibliothek der Weltliteratur«, 1889, 6 Bde.) heraus; eine große kritische Ausgabe wird von der Deutschen Kommission der Berliner Akademie vorbereitet; vgl. Seuffert, Prolegomena zu einer Wieland-Ausgabe (Berl. 1904). Von Briefen Wielands erschienen: »Ausgewählte Briefe an verschiedene Freunde« (Zürich 1815–16, 4 Tle.); »Auswahl denkwürdiger Briefe« (hrsg. von Ludwig W., Wien 1815, 2 Bde.); »Briefe an Sophie von La Roche« (hrsg. von Fr. Horn, Berl. 1820); »Briefe an Merck« (hrsg. von Wagner, Darmst. 1835; hauptsächlich auf den »Deutschen Merkur« bezüglich); »Neue Briefe, vornehmlich an Sophie von La Roche« (hrsg. von Hassencamp, Stuttg. 1893). Eine Biographie des Dichters schrieb Gruber (»Christ. Martin W.«, Altenb. 1815–16, 2 Bde.; neue Bearbeitung u. d. T.: »Chr. M. Wielands Leben«, als Bd. 50–53 der Werke, Leipz. 1827–28). Vgl. Ofterdinger, Chr. M. Wielands Leben und Wirken in Schwaben und der Schweiz (Heilbr. 1877); Buchner, W. und die Weidmannsche Buchhandlung (Berl. 1871); R. Keil, W. und Reinhold (Leipz. 1885); L. Hirzel, W. und Martin und Regula Künzli (das. 1891; behandelt eine Episode aus Wielands Züricher Jahren); P. Weizsäcker, Die Bildnisse Wielands (Stuttg. 1893); Wukadinovié, Prior in Deutschland (Graz 1895); Pomezny, Grazie und Grazien in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts (Hamb. 1900); B. Seuffert, Der Dichter des ›Oberon‹ (Vortrag, Prag 1900); F. Bauer, Über den Einfluß L. Sternes auf W. (Programm, Karlsbad 1898 u. 1900, 2 Hefte); Behmer, L. Sterne und W. (Berl. 1899); Doell, W. und die Antike (Programm, Münch. 1896); L. Hirzel, Wielands Beziehungen zu den deutschen Romantikern (Bern 1904); Ermatinger, Die Weltanschauung des jungen W. (Frauens. 1907); Kuhn, ›Idris und Zenide‹. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Sprache Wielands (Würzb. 1903); Calvör, Der metaphorische Ausdruck des jungen W. (Dissertation, Götting. 1906); Schlüter, Studien über die Reimtechnik Wielands (Dissertation, Marb. 1900). Eine Reihe vorzüglicher Arbeiten über W. hat B.Seuffert, der beste Kenner des Dichters, in Zeitschriften veröffentlicht.
Geschichte des Weisen Danischmend und der drei Kalender
Keine Vorrede
Eine Vorrede vor ein Werk, wie die Geschichte des Philosophen Danischmend?
Nein, bei allem was gut ist, ich werde keine Vorrede dazu machen, es erfolge auch daraus was will!
Für den verständigen Leser würde die kürzeste zu lang sein: und dem unverständigen hilft keine Vorrede, und wenn sie dreimal länger wäre als das Werk selbst.
»Es gibt Leute«, sagte mir einer meiner Freunde (in der weitern Bedeutung des Wortes), »die hinter Ihren Sultanen und Bonzen ganz was andres suchen« –
»Als Sultanen und Bonzen? – Da haben die Leute unrecht, Freund!«
»Aber es gibt nun einmal solche Leser, gegen die man sich sehr kategorisch erklären muß, wenn man Unheil verhüten will. Ich dächte, Sie wären's sich selbst schuldig, diesen Leuten ein für allemal so deutlich, als nur immer möglich ist, zu sagen, wie Sie verstanden sein wollen.«
»Dies ist längst geschehen erwiderte ich. »Wie kann ich mich deutlicher erklären, als ich's im Goldnen Spiegel getan habe? Wer nun nicht versteht, will nicht, – oder befindet sich im Falle des ehrlichen Mannes, der alle Brillen eines ganzen Ladens probierte, ohne einen Buchstaben dadurch lesen zu können; am Ende zeigte sich, daß der Mann weder mit noch ohne Brille lesen konnte.«
»Schaffe mir Kinder, oder ich sterbe«, sagte Rahel zu Jakob ihrem Manne. »Bin ich denn Gott?« antwortete der Erzvater. – Dies ist gerade der Fall eines ehrlichen Autors, den unverständige Leser zwingen wollen, ihnen Verstand zu geben.
Licht ist nur Licht für den Sehenden: der Blinde wandelt im Sonnenschein, und dünkt sich im Finstern.
Also keine Vorrede!
1. Kapitel
Wie der Sultan Gebal und Danischmend aus einander kommen
Schach-Gebal, ein durch gute und böse Gerüchte bekannter Sultan, hatte, neben manchen gleichgültigern Eigenschaften, die Schwachheit – wie es seine Tadler nannten – daß er über niemand, dem er einmal hold gewesen war, lange zürnen konnte. Wahr ist's, in dem Augenblicke, wo man in seine Ungnade fiel – welches leicht begegnete – waren zwei- oder dreihundert Prügel auf die Fußsohlen das wenigste, womit er den Unglücklichen, den dieser Zufall traf, bedrohte. Aber seit die Sultanin Nurmahal von ihm erhielt, daß dergleichen Züchtigungen nie anders als in seiner Gegenwart vollzogen werden durften, hat man kein Beispiel, daß er's bis zum zehnten Streiche hätte kommen lassen.
Er ließ sich, nach der Weise der Sultanen seiner Brüder, bei solchen Anlässen große Komplimente über seine Mildherzigkeit machen. Allein das Wahre an der Sache war, daß er, trotz seiner Sultanschaft, sich nicht erwehren konnte, bei jedem Streich ein unangenehmes Zucken in seinen Nerven zu fühlen. Der Gedanke, ich bin auch ein Mensch, denkt ihr – aber dies war es nicht. Armer Schach-Gebal! du warst zu sehr und zu lange Sultan, um so etwas aus dir selbst zu denken. Aber die Natur, die Natur! die treibt ihr Werk ohne Ansehen der Person, im Monarchen wie im Bettler. Die mitzitternde Nerve wird beim Anblick des Leidens eines Menschen an dem vermeinten Halbgotte zum Verräter; er fühlt, daß er auch Fußsohlen hat. Um es eiligst wieder zu vergessen, übt er eine seiner hohen Vorzüglichkeiten aus, und ruft: Gnade!
Wie dem auch war, gewiß ist, daß der Philosoph Danischmend, als er, ohne recht zu wissen wie ihm geschah, in des Sultans Ungnade fiel, weit leichter davon kam, als es seine guten Freunde, die Fakirn, gehofft hatten. Diese gutherzigen Seelen würden mit den dreihundert Prügeln auf die Fußsohlen, die ihm Schach-Gebal in der ersten Hitze seines Zorns versprach, als einer noch ganz leidlichen Vergütung aller Unbilden, die sie von ihm erlitten zu haben vorgaben, allenfalls zufrieden gewesen sein. Aber der Sultan fand nach kälterer Überlegung diese Strafe für ein Verbrechen, welches sein ehmaliger Itimadulet nur erst in Gedanken begangen hatte, doch ein wenig zu hart, und besann sich so lange auf eine gelindere, bis ihm die Lust zu strafen gar verging.
Danischmend lag indessen in einem Gefängnisse, wo etliche Spannen Himmel seine ganze Aussicht, und ein paar Fliegen seine ganze Gesellschaft ausmachten. Er fing bereits an zu glauben, daß nun weiter nicht mehr die Rede von ihm sein würde, als ihn der Sultan, in einer von seinen guten Launen, holen ließ.
»Danischmend«, sagte der Sultan, als er ihn mit seinem langen Barte (der inzwischen gute Zeit zum Wachsen gehabt hatte) ansichtig wurde: »– wenn einem Menschen wie du zu raten wäre, so würd ich dir raten, wie du hier stehst, die Philosophie abzuschwören und – ein Santonzu werden. Den Bart dazu hättest du schon, wie ich sehe; und an Entbehrungen solltest du, denk ich, auch gewöhnt worden sein, seitdem sie dich zwischen vier Mauern eingekuffert haben. Ich sehe wenigstens kein andres Mittel, dich mit den Derwischen und Fakirn auszusöhnen, die dir, wie ich höre, so herzlich gram sind, daß ich eine Empörung besorgen müßte, wenn ich darauf bestehen wollte, dich gegen sie in Schutz zu nehmen. Ein Santon, ich habe der Sache oft nachgedacht, ein Santon ist das glücklichste Wesen in der Welt. Wenn ich nicht mein Wort gegeben hätte Sultan zu sein, ich wüßte nicht was mich hindern sollte heute noch Santon zu werden.«
»Santon?« – versetzte Danischmend. »Die Sache mag ihr Gutes haben; aber – ich wollte darauf schwören, daß ich niemals einen erträglichen Santon machen würde. Ich habe gewisse Bedürfnisse, von denen ich mich unmöglich los machen kann« –
»Bedürfnisse, Bedürfnisse«, fiel Schach-Gebal ein – »die sind immer das dritte Wort bei euch Philosophen. Ich habe keine Bedürfnisse und bin Sultan! Es ist ein häßliches, verächtliches Ding, so viele Bedürfnisse zu haben. Unter uns, was für Bedürfnisse wären es denn, von denen du nicht Lust hättest dich los zu machen?«
»Sire, Sie werden über mich lachen«, versetzte Danischmend: »aber wer kann sich helfen? Es gibt gewisse Dinge, ohne die ich weder leben noch weben kann; als da ist – die gute Mutter Natur jedes Stückchen auf mir spielen zu lassen, das sie auf mir spielen will, immer auszusehen, wie mir ums Herz ist; nichts zu reden, als was ich denke; nichts zu tun, als was ich mit Freuden tue; mich mitzuteilen, wenn ich glücklich bin, und flugs in meine Schale zurück zu kriechen, so bald ich eine Fliege, die mir um die Nase summst, durch einen Wolkenbruch ertränken möchte; ferner, alles was Menschen angeht, als meine Privatsache anzusehen, und mich über ein Unrecht schrecklich zu ereifern, das vor dreitausend Jahren einem Betteljungen zu Babylon geschehen ist; allen harmlosen ehrlichen Gesichtern gut zu sein, und allen Schurken, wo ich nur an sie kommen kann, auf den Fuß zu treten; und, während daß ich die Welt gehen lasse – wie sie kann, mich (so oft ich nichts Angenehmers zu empfinden oder nicht Bessers zu tun habe) auf meinen Sofa zu lagern und Entwürfe zu machen, was ich tun wollte, wenn ich der große Lama, oder die Favoritin des Königs von Serendib, oder der Dairi von Japan wäre. Mit Einem Worte« –
»Mit Einem Worte, Herr Danischmend«, fiel ihm der Sultan lachend ins Wort, »ich sehe, daß du ein Grillenfänger bleiben wirst so lange du lebst. Aber betrüge dich nicht, mein Freund. Ich habe dir schon gesagt, daß ich nichts für dich tun kann. Es steht bei dir, ob du ein Santon oder ein Kalender, oder was du werden willst; aber aus Indostan muß ich dich verbannen, dafür hilft nichts. Die Fakirn! die Bonzen! – Um dein selbst willen muß ich's tun. Suche dir in den Wildnissen des Imaus einen Wohnort aus, wo dir's am besten gefällt; näher kann ich, wenn ich Ruhe haben will, keinen Philosophen bei mir leiden.«
»Sultan von Indien«, sagte Danischmend, »es gibt sehr anmutige Gegenden in den Wildnissen, wohin Ihre Hoheit mich zu verbannen die Gnade haben. Ich habe mir schon lange eine Vorstellung gemacht, daß sich dort eine ganz artige kleine Kolonie von glücklichen Menschen anlegen ließe.«
»Von glücklichen Menschen?« – rief Schach-Gebal: »Feenmärchen, Zauberschlösser, Freund Danischmend! Wolltest du nicht, da du mein Itimadulet warst, alle meine Untertanen zwischen dem Oxus und Ganges glücklich machen? Und wie viel fehlte noch, daß du mit dieser einzigen Grille ganz Indostan zu Grunde gerichtet hättest? Ich dächte, von dieser Narrheit wenigstens solltest du geheilt sein, Danischmend!«
»Was bei hundert Millionen verdorbener Menschen unmöglich gewesen wäre, gelänge mir vielleicht bei einem kleinen Häufchen roher aber noch unangesteckter Söhne und Töchter der Natur«, erwiderte der Philosoph.
Der Sultan schwieg eine Weile, wie er zu tun pflegte wenn ihm ein Einfall in den Wurf kam, mit dem er etliche Augenblicke spielen konnte. Endlich sagte er: »Weißt du wohl, Danischmend, daß ich beinahe Lust hätte dich eine Probe machen zu lassen? nur um zu sehen was heraus käme. Gut! ich gebe dir einen Befehl an meinen Schatzmeister zu Kabul: denn ohne Geld legt man keine Kolonien an; zumal wenn du sie, um eine schöne Zucht von Menschen zu bekommen, mit hübschen Tschirkassierinnen versehen wolltest. Aber nimm dich in acht, daß der Bramine der Sultanin nichts davon erfährt. Ich mag keine Fehde mehr mit diesen wackern Leuten; ich will Ruhe haben!«
»Herr«, antwortete Danischmend, »wenn mir zum letzten Mal noch erlaubt ist so freimütig wie sonst mit Ihrer Hoheit zu reden, ich habe keine Lust mich in die Wildnisse des Imaus verbannen zu lassen. Ich bin nicht selbständig genug um ohne Gesellschaft leben zu können, und schon zu alt um Waldmenschen zahm zu machen. Gern will ich für die Nachwelt pflanzen; aber dann müssen auch die Bäume schon gewachsen sein, in deren Schatten ich selbst ausruhen soll. Dem Braminen der Sultanin und allen Fakirn und Bonzen in der Welt wird es gleichgültig sein können, wo ich lebe, wenn sie nur nichts weiter von mir hören. Und hören sollen sie nichts mehr von mir, oder es müßte gar kein bewohnbarer Ort mehr auf Gottes Boden sein, wo man sicher vor ihnen atmen könnte. Ich kenne in den Gebirgen von Kischmir einen solchen Ort; ein einsames Tal, fruchtbar und anmutig wie die Gärten Schedads, und von einem harmlosen Völkchen bewohnt, das keinen Begriff davon hat, wie man ein Fakir oder Santon sein kann. Wenn mir Ihre Hoheit so viel geben wollen, daß ich mir unter diesen guten Leutchen eine Hütte bauen kann, so sind alle meine Wünsche erfüllt. Fürs übrige, was man noch um glücklich zu sein haben muß, will ich schon sorgen.«
»Es sei darum«, sagte Schach-Gebal. »Wenn man einem Gutes tun will, muß man's ihm nach seiner eigenen Weise tun. Lebe wohl, Danischmend. Möchtest du in deiner Einsamkeit glücklich genug sein, zu vergessen, daß du einst der Freund eines Sultans warst!«
Danischmend war im Begriff, auf dieses gnädige Kompliment eine Antwort zu geben, die dem Sultan notwendig hätte mißfallen müssen. Aber er konnt es nicht über sein Herz bringen, den guten Herrn durch eine Wahrheit zu kränken, die am Ende doch zu nichts helfen konnte. Es gibt Wahrheiten, die ein Mann (Sultan oder nicht Sultan) sich selbst sagen muß. Tut er's nicht, oder kann er's nicht tun, so ist's Menschlichkeit, ihn damit zu verschonen. In solchen Fällen kann die Wahrheit nur demütigen, nie besser machen.
Danischmend verschwand noch an dem nämlichen Tage aus Dehly, und weder der Bramine der Sultanin, noch die Sultanin selbst, konnten jemals von Schach-Gebal erhalten, daß er ihnen gestanden hätte, was in dieser letzten Unterredung zwischen ihm und seinem ehmaligen Günstling vorgegangen. Dieses eigensinnige Stillschweigen des Sultans, und die Unmöglichkeit vom Aufenthalte des verschwundenen Philosophen etwas zu erfahren, brachte die schöne Nurmahal und alle, denen daran gelegen war, auf die Vermutung, daß ihn Schach-Gebal heimlich habe aus dem Wege schaffen lassen. »Auch dies ist so übel nicht«, sagten die Bonzen.
2. Kapitel
Danischmend läßt sich in Kischmir nieder. Sein Hauswesen. Ein neues Bedürfnis
Unterdessen hatte Danischmend, nachdem er auf Befehl des Sultans von dem Schatzmeister zu Lahor zehentausend Bahamd'or empfangen, in den Gebirgen, welche Kischmir von Tibet absondern, sich einen Wohnplatz ersehen, wo er, fern von Sultanen und Fakirn, nach seinem Geschmack und nach seinem Herzen glücklich zu leben hoffte. Es war ein langes, zwischen fruchtbaren Hügeln und waldigen Bergen sich hinziehendes Tal, Jemal genannt, von tausend Bächen und Quellen aus dem Gebirge bewässert, und von den glücklichsten Menschen bewohnt, die vielleicht damals auf dem ganzen Erdboden anzutreffen waren.
Hier war ihm vor allen Dingen nötig, sich ein kleines Hauswesen einzurichten. Denn (nach seiner Philosophie) setzt ein weiser Mann sich zuerst in seinem Mittelpunkte so waagerecht als immer möglich fest, und sorgt – für sich selbst. Dann zieht er einen Kreis mitfühlender Zuneigung und wohltätiger Wirksamkeit um sich her, schießt seine Strahlen gegen alle Punkte dieses Kreises aus, und macht, so viel an ihm ist, alles glücklich, was er erreichen kann.
Diesem Plane gemäß kaufte sich Danischmend ein kleines Gut, ungefähr so groß wie Plinius meint, daß ein gelehrter Müßiggänger eines nötig habe; das heißt, »gerade so viel Grund und Boden, als er brauchte, um den Kopf an einen Baum zurück zu lehnen, seine kurzsichtigen Augen an einer Aussicht ins Grüne zu laben, auf dem nämlichen Fußpfade zwischen seinem Kohlgarten und Kornfelde hin und her zu kriechen, alle seine Weinstöcke auswendig zu wissen, und über alle seine Bäumchen ein Register zu halten.«
Danischmend, der ein wenig mehr Bedürfnisse hatte als Suetonius, legte sich noch überdies ein Wäldchen an, wo er in dunkeln kunstlosen Irrgängen herum schlendern konnte, und vergaß nicht, hier und da eine Bank hinsetzen zu lassen, damit zwei oder drei Personen im Frieden neben einander Platz nehmen könnten, wenn sie des Gehens müde wären. Auch leitete er eine Felsenquelle, die seine Wohnung mit Wasser versah, durch eine Wiese, die er seinen Blumengarten nannte, pflanzte da und dort auf die Wiese und längs seines Kornfeldes Obstbäume, unter deren Schatten seine Mäher und Schnitter ausruhen konnten, und ließ in den Felsen, aus dem die Quelle kam, eine Grotte hauen (die Natur hatte schon das meiste dabei getan) wo man in der Sommerhitze, hinter einem Vordach von Eppich und Weinreben, auf einer Bank von Moos, beim Gemurmel der Quelle schlummern, oder dem Gesang der Grillen zuhören konnte so lange man wollte.
Danischmend, wiewohl er eine Art von Philosophen war, verstand wenig oder nichts von der Landwirtschaft. Kraft dieser seiner Unwissenheit wollte er nichts besser wissen als die Natur; bepflanzte seine Felder nicht mit Disteln, um eine Manufaktur von ihrer Wolle anzulegen; pflügte mit dem Pfluge seiner Voreltern, und machte keine Versuche die ihm mehr kosteten als sie wert waren. Kurz, seine Unwissenheit ersparte ihm vielleicht mehr als manchem hochgelehrten landwirtschaftlichen Metaphysiker seine Wissenschaft einträgt. Aber dafür ließ er sein Feld mit dem alten Pfluge so lange ackern bis es locker war; wo er einen leeren Platz sah, da pflanzte er einen Baum hin, oder etwas andres das besser war als nichts; und wo sich nach einem starken Regen kleine Pfützen und Sümpfe zeigten, da ließ er so lange Sand und Erde hinführen bis sie ausgefüllt waren. Die Sperlinge und die Raubvögel hatten alle Ruhe vor ihm: »denn« (sagte er) »jene tun mir gute Dienste gegen das Ungeziefer, und diese gegen die Sperlinge.« Überhaupt war er ein großer Freund von der Maxime, nichts ausrotten zu wollen was Gott erschaffen hat. »Der Urheber der Natur« (pflegte er zu sagen) »versteht gewiß die Ökonomie besser als man glaubt. Er hat durch den einzigen kleinen Umstand, daß immer eine Gattung die andre frißt, hinlänglich dafür gesorgt, daß sie einander so ziemlich die Waage halten. Ich lebe beinahe auf aller andern Gattungen Unkosten; und ich sollte so unbillig sein, nicht leiden zu wollen daß sie sich helfen wie sie können?«
Der gute Philosoph, der (wie wir schon wissen) einer von den empfindsamen war, hatte sich schon lange eine sehr einladende Vorstellung von einem in der großen Welt wenig bekannten Zustande gemacht, den er häusliche Glückseligkeit nannte. Um sich in seinem vorerwähnten Mittelpunkt in das gehörige Gleichgewicht zu setzen, schien ihm eine Gesellin, an deren Busen er ruhen könnte, unentbehrlich zu sein. Was ihm, da er noch in der Welt lebte, höchstens – und nur in gewissen Augenblicken – eine ganz behagliche Sache schien, ward in seiner jetzigen Lage zum Bedürfnis. Er dachte anfangs alle Tage beim Erwachen und alle Nächte beim Einschlafen daran. Bald darauf dacht er des Tages etlichemal und des Nachts auf seiner Matratze ganze Stunden lang daran, bis er zuletzt gar nicht mehr davor schlafen konnte; oder wenn er ja einschlief, so träumte ihm von nichts als Hochzeiten und Wochenstuben, Puppen und Steckenpferden; und wenn er des Morgens vor Sonnenaufgang ans Fenster ging frische Luft zu schöpfen, sah er aus den Wölkchen, die wie kleine Inseln im Morgenhimmel herum schwammen, lauter gelblockige und schwarzlockige, blauaugige und braunaugige Mädchenköpfe heraus gucken. Je mehr er über die Sache philosophierte, je völliger überzeugte sich der gute Mann, das schönste und beste aller Geschöpfe, der Auszug und Inbegriff alles dessen was in der Natur Reizendes ist, das lieblichste, begehrenswürdigste und unentbehrlichste aller Dinge sei – ein Weib. Kurz, er hörte nicht auf darüber zu philosophieren, bis er's endlich so weit brachte, mit ich weiß nicht welchen alten Weisen, sich selbst für die bloße Hälfte eines Menschen zu halten, die unmöglich anders als unvollkommen, dürftig, kröpelhaft und höchst unglückselig sein könne, bis sie ihre andre Hälfte gefunden, und mit ihr in Einen wahren, ganzen, vollständigen Menschen zusammen gewachsen sei. Man sieht daß es nun hohe Zeit mit ihm war.
Zwar hätte er, als ein Musulmann, sich wenigstens zwei bis drei Weiber, und allenfalls, nach alter morgenländischer Sitte, noch eben so viel Kebsweiber zulegen mögen, ohne daß weder der Imam von Mekka, noch der große Lama in Tibet, noch der Bramine der Sultanin Nurmahal sich sehr daran geärgert hätten. Denn jeder dieser würdigen Herren hatte ihrer noch viel mehr in seinem Weiberstalle. Aber Danischmenden war es nicht um Weiber, sondern um seine Hälfte zu tun: und da zwei Hälften nach dem allgemeinen Geständnis aller Menschen hinlänglich sind ein Ganzes zu machen; so wäre die dritte, vierte, fünfte usw. wie liebenswürdig sie an sich selbst hätte sein mögen, im Grunde doch nichts anders als ein Auswuchs, eine Art von Höker, Kropf oder Überbein gewesen, der, anstatt die Vollkommenheit des Ganzen zu befördern, demselben nur überlästig gefallen wäre, und die schöne Eintracht beider Hälften gestört hätte. Vernünftiger Weise blieb ihm also nichts übrig, als diese nämliche gleichartige, genau einpassende, und, mit Einem Worte, geflissentlich für ihn allein gemachte Hälfte seines Ichs je eher je lieber ausfündig zu machen.
Wer ernstlich sucht, findet immer etwas das des Auflesens wert ist; entweder das Gesuchte, oder auch wohl zuweilen etwas Besseres. Danischmend, den das edelste unter allen menschlichen Bedürfnissen – zu lieben und geliebt zu werden – plagte, suchte sich ein Weib für sein Herz und nach seinem Herzen, und fand sie, wie man einen Schatz findet, oder den Schnupfen aufliest, unversehens und ohne zu wissen wie.
3. Kapitel
Mysterien – Procul este Profani!
Unsre ehrlichen Altvordern mögen wohl nicht so unrecht gehabt haben, wenn sie glaubten, daß ein guter Genius (ob sie ihn so oder so malten tut nichts zur Sache) sich damit abgebe, einem ehrlichen Kerl in Danischmends Umständen auf die Spur zu helfen. Es ist wenigstens ein so tröstlicher und harmloser Glaube, daß ich dem Manne nicht gut sein könnte, der mir ihn abräsonieren wollte.
Eines Morgens früh, als Danischmend ausging seine Träumereien auszulüften, begegnete ihm, auf dem Wege zu seiner Grotte, ein Mädchen, das mit einem großen Wasserkrug auf dem Kopf in der Einfalt und Unschuld seines Herzens daher schritt.
Ob es eine Grille oder was es war, weiß ich nicht; aber alle Weisen aus Morgenland und Abendland hätten unserm Manne nicht aus dem Kopfe gebracht, daß er seinen Genius habe, so gut als Sokrates der Athener. »Alles was ich vor andern Leuten voraus habe«, pflegte er zu sagen, »ist lediglich, daß ich mir angewöhnt habe, bei allen Gelegenheiten auf die Stimme meines Genius zu lauschen, und daß mich die Natur dazu mit einem Seelenohre von der feinsten Art begabt hat.«
»Rede sie an«, rief ihm der Genius in seinem ihm allein vernehmlichen Rotwälsch zu. – Danischmend gehorchte.
»Woher so früh, schönes Mädchen?« sagte er mit einer so sanften Stimme, daß es unmöglich war seine Frage übel zu nehmen.
»Von jener Grotte«, antwortete das Mädchen, indem sie mit dem Zeigefinger der linken Hand nach dem Orte wies. Danischmend bemerkte, wiewohl nur obenhin, daß es eine kleine niedliche Hand war.
»Ich hole dort alle Morgen Wasser in diesem Kruge«, fuhr das Mädchen fort, »denn es soll das beste in der ganzen Gegend sein,«
»Und wozu brauchst du das Wasser?« fragte Danischmend. Es war eine alberne Frage; aber er wollte und mußte nun einmal etwas fragen, und in der Eile fiel ihm nichts Klügeres ein.
»Ich begieße morgens und abends einen Rosenstock damit, den ich auf das Grab meiner Mutter gepflanzt habe«, antwortete das Mädchen, mit einem Tone der Stimme, der alle empfindsam Saiten in seinem Herzen mit ertönen machte.
Er sah ihr ins Auge, oder, welches einerlei war, er sah in den Grund ihrer Seele; und in dem nämlichen Nu fühlt' er mit Gewißheit, daß dies Mädchen die Hälfte sei die er suchte.
»Sie ist's«, rief im nämlichen Nu sein Genius.
Das Mädchen war von feiner Gestalt. Alle Züge ihres Gesichts drückten die Unschuld, das zarte Gefühl und die Ruhe ihrer Seele aus. Ihr Herz war in ihren Augen und auf ihren Lippen. Man sah ihr ins Gesicht, und von Stund an war man ihr Freund, Vater, Bruder und Oheim, vertraute ihr alle seine Geheimnisse, sein Leben, seine Ehre, seine Seele und Seligkeit, wünschte sich keine andre Frau, Tochter, Enkelin, Schwester, Nichte usw. und würde lieber zehentausendmal den Tod gelitten als zugegeben haben, daß ihr ein Leid widerfahre. – Übrigens eine bloße Tochter der Natur; ohne Verzierung, ohne Ansprüche, ohne List, und so unwissend, daß sie von Danischmenden sogar küssen lernen mußte.
Dies werden wenig Mädchen glauben wollen; aber wir können sie mit Gewißheit versichern, daß es wahr ist.
»Sie ist's, sie ist's«, flüsterte der Genius noch einmal.
»Beim Himmel, ist sie's!« antwortete Danischmend!
Acht Tage darauf – die ganze Geschichte ihrer Liebe in diesen acht Tagen erlaß ich euch: sie beträgt sieben starke Oktavbände, und würde für Liebende, wie Amandus und Amanda, Herkules und Valiska, Seladon und Asträa, Aruns und Klelia, usf. höchst unterhaltend sein, wenn Liebende – Zeit zum Lesen hätten.
Acht Tage darauf vermählte sich Danischmend mit ihr, führte sie in sein Haus, und zeugte mit ihr Söhne und Töchter.
Weil dies jedermann kann – die Ausnahmen sind zu selten um in Anschlag zu kommen –, so haben sich die Leute angewöhnt, es für eine gemeine, alltägliche, verächtliche Sache zu halten, die man, ohne lächerlich zu werden, niemanden zum Verdienst anrechnen könne. Viele gehen so weit, daß sie uns gar bereden wollen, man könne mit Anständigkeit nicht einmal davon sprechen.
Man sieht wohl, daß solche Leute nie bedacht haben müssen, welch ein herrliches Geschöpf der Mensch ist! – Ja, solche Karikaturen und Grotesken zu machen, wie man sie alle Werkeltage in Menge sieht, – dabei ist freilich wenig Verdienst. Aber dies war Danischmends Sache nicht. Seine Söhne und Töchter waren die wohlgestaltesten, artigsten, seelevollsten kleinen Geschöpfe, die man mit Augen sehen konnte. Alle Mädchen in der Gegend verliebten sich in seine Buben, alle kleine Jungen waren in seine Mädchen vernarrt; und wer zu alt zum Verlieben und Vernarren war, hatte die Kinder kaum etliche Stunden um sich, so war's ihm schon als ob er ihnen Vater und Mutter sei.
Dies mochte wohl Ausnahmen leiden; denn es gibt (wie ihr wißt) Leute, die nichts lieben können als sich selbst und was sie selbst gemacht haben. Allein von solchen Selbstlern ist auch hier die Rede nicht.
Viele Leute, die nicht begreifen konnten, warum Danischmends Kinder alle so liebenswürdig waren, bildeten sich ein, er müsse ein besonderes Geheimnis besitzen.
»Es ist etwas an der Sache«, sprach er: »ich wollt es euch wohl sagen, aber unter zwanzigen würde vielleicht kaum Einer sein, dem es nützen könnte.«
»Sei's darum«, sagten sie, »und wenn unter hunderten nur Einer wäre.«
»Gut«, sagte Danischmend: »so findet mir erst einen Mann und ein Weib, deren Liebe mit jedem Jahre ihrer Verbindung wächst, immer herzlicher und zärtlicher wird, dergestalt, daß es zuweilen ein Wunder in ihren eigenen Augen ist, wie es zugehe, daß sie sich nach einer Reihe zusammen gelebter Jahre oft verliebter in einander fühlen als an ihrem Hochzeitstage. Wer die Probe machen will, dem wollt ich wohl raten« (fuhr er fort), »sich von seinem Genius eine Frau wählen zu lassen: es möchte nicht bei allen angehen. Oft sind unser Herz und unser Genius verschiedener Meinung, und seit die Welt steht ist noch nichts gut gegangen, was ein Mann wider Willen seines Genius getan hat. Ich, meines Orts, hörte den meinigen drei- oder viermal so deutlich sagen, › sie ist's‹, daß ich meiner Sache gewiß war. Auch seht ihr ob er mich betrogen hat.«
»Aber«, sagten die Leute, »es muß außerdem noch etwas andres dahinter stecken, eine Art von geheimen – eine Art von – kurz, etwas, das ihr uns wohl entdecken könntet wenn ihr wolltet.«
»Ich will's euch ins Ohr sagen«, antwortete Danischmend.
4. Kapitel
Was Danischmend den Leuten ins Ohr sagte
Ich – der Erzähler dieser gegenwärtigen Geschichte – kenne einen Arzt, dem ich – auf der Stelle eine Lobrede zu halten versucht werde, und auch sogleich eine Lobrede halten würde, wenn ich so schön reden könnte wie Isokrates und Plinius; – einen Arzt, auf dem die Erfahrungskunst, die Weisheit und die Menschenliebe des göttlichen Hippokrates ruhen; – kurz, einen Arzt, wie ich aus herzlicher Wohlmeinung mit Bösen und Guten, Gerechten und Ungerechten, wünschen möchte, daß an jedem Orte, wo ein paar tausend Menschen beisammen wohnen, einer leben und so lange leben möchte, bis er der Nachwelt einen Mann wie er an seinen Platz gestellt hätte: – und eine von den Ursachen, warum ich diesen meinen Hippokrates ehre und liebe, ist, daß er weiß, was für ein Ding das Herz des Menschen ist, und welche Wunder derjenige zuweilen tun kann – er sei nun Arzt, oder Gesetzgeber, oder Pfarrer, oder Feldherr, oder Tragödienschreiber oder was ihr wollt – der auf das Herz und auf die Einbildung (in deren Gewalt jenes fast immer ist) zu rechter Zeit den gehörigen Eindruck zu machen weiß.
Was sind Jalappa und Senesblätter und Rhabarber und Fieberrinde und Genseng und Asa Fötida gegen Mittel, die geradezu auf die Phantasie und die Leidenschaften eines Kranken wirken! Von wie viel mehr Krankheiten als man gemeiniglich glaubt, liegt die wahre Ursache in einem verwundeten oder gepreßten oder entgeisterten Herzen! Wie viele körperliche Übel zeugt, nährt und verschlimmert eine kranke Phantasie! Wie oft würde eine rührende Musik, eine scherzhafte Erzählung, eine Szene aus dem Shakspeare, ein Kapitel aus dem Don Quichotte oder Tristram Shandy, das gestörte Gleichgewicht in unsrer Maschine eher wieder herstellen, Verdauung und Schlaf besser befördern, niedergeschlagene Lebensgeister kräftiger ermuntern, Milzsucht, Mutterbeschwerungen, Hypochondrie, Schwermut, Muckerei, Intoleranz und andre böse Geister schneller vertreiben, als irgend ein Rezept im Neu verbesserten Dispensatorium!
Ein fröhliches Herz und eine rosenfarbne oder himmelblaue Phantasie sind in tausend Verrichtungen des menschlichen Lebens unentbehrlich, wenn sie uns wohl vonstatten gehen sollen. – Grau in grau mag zuweilen hingehen, wiewohl ich kein Liebhaber davon bin.– Feuerfarben, pomeranzengelb und violet sind Farben, mit denen man sich wenigstens sehr in Acht nehmen muß. – Strohgelb, apfelgrün, lilas, pompadour, sind ungefähr, was des alten Herrn Shandy neutrale Namen; ich rate niemand seine Einbildung darein zu kleiden, wenn er was Kluges beginnen will: aber in Grüngelb und Schwarzbraun geht der Teufel, darauf kann man sich verlassen.
Wenn ihr euch für zehn, oder zwanzig, oder dreißig Tomans, mehr oder weniger, eine persische Tänzerin kommen laßt, so macht's wie ihr wollt: aber mit dem Weibe, das die Mutter eurer Kinder sein soll, wollt ich dienstlich gebeten haben ein wenig behutsam umzugehen.
Bei allem dem macht die Farbe der Einbildung allein noch nicht alles aus. –
Ich will es euch kurz und gut sagen, weil ihr's doch wissen wollt!