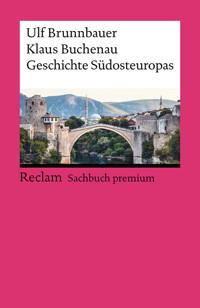
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: 2., aktual. und erw. Auflage 2023
- Sprache: Deutsch
Wohl keine europäische Region ist so in sich unterschiedlich wie Südosteuropa, das erst zu Byzanz, dann zum Osmanischen Reich, zur österreichisch-ungarischen Monarchie und schließlich in großen Teilen zum Einflussbereich der Sowjetunion gehörte. Das Zusammenleben von Muslimen und Christen verschiedener Konfessionen wie auch die schwierigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen führten dort immer wieder zu blutigen Konflikten; alle Länder haben bis heute mit Armut und Korruption zu kämpfen. Dieses Buch legt die Wurzeln vieler Probleme frei und gibt Einblicke in die Aktualität einer ganzen Region – von Albanien über Griechenland, Kroatien und die Türkei bis Zypern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ulf Brunnbauer / Klaus Buchenau
Geschichte Südosteuropas
Mit 7 Karten
Reclam
2., aktualisierte und erweiterte Ausgabe
2018, 2023 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Coverabbildung: Stadt Mostar © shutterstock / EshanaPhoto
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2023
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961306-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014403-9
www.reclam.de
Inhalt
Vorwort
Südosteuropa und seine Geschichte: Einführende Bemerkungen
Regionale Geschichte als Beziehungsgeschichte
Bilder über und Wissen von Südosteuropa
Terminologie
Grundlagen der südosteuropäischen Geschichte
Das vormoderne Erbe (bis ca. 1800)
Antikes Erbe, mittelalterliche Neuanfänge
Die osmanische Herrschaft in Südosteuropa
Die Habsburger in Südosteuropa
Das ›lange‹ 19. Jahrhundert: Staatsbildungen und neue Konfliktkonstellationen
Staatswerdung
Nationale Identitäten
Kämpfe um die innere Ordnung
Expansion und Irredenta
Gesellschaftliche Entwicklungen: Stagnation, Erosion, Transformation
Das Glas halbvoll, halbleer
Erster Weltkrieg und Zwischenkriegszeit: Der lange Schatten des Krieges
Der Erste Weltkrieg und sein Ausgang
Die Siegerstaaten
Die Verliererstaaten
Türkei und Albanien
Zerrissene Gesellschaften
Diktaturen und Faschismen
Enttäuschte Hoffnungen
Brüchige Modernen: Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit und Kalter Krieg
Südosteuropa im Zweiten Weltkrieg
Die Epoche des Kalten Krieges
Griechenland und die Türkei
Nationalismus und Kommunismus
Das Ende der kommunistischen Herrschaft
Gesellschaftliche Transformationen
Kein Ende der Geschichte. Die Transformation seit 1989
Der Zerfall Jugoslawiens
Rumänien und Bulgarien auf dem Weg in die EU
Eine neue Region wird erfunden – der ›Westbalkan‹
Strauchelnde Vorbilder: Griechenland und die Türkei
Ambivalente Resultate des sozialen und kulturellen Wandels
Literaturhinweise
[7]Vorwort
Im Oktober 2019, kurz vor einer Sitzung des Europäischen Rates, überraschte die Regierung Bulgariens ihre EU-Partner mit dem Beschluss einer ›Rahmenposition‹ zu den geplanten Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien. Das bulgarische Positionspapier, das einem Veto gegen die Aufnahme von Verhandlungen mit Nordmazedonien gleichkam, bezog sich nicht etwa auf die Erfüllung der formellen Beitrittskriterien durch das kleine Nachbarland im Westen, wie die Qualität seiner demokratischen Institutionen oder des Rechtsstaates. Vielmehr formulierte es eine Reihe von geschichts- und identitätspolitischen Forderungen. Nordmazedonien müsse, so eine Forderung, Aufschriften auf Denkmälern und Gedenktafeln entfernen, in denen »offener Hass gegen Bulgarien« gesät werde, etwa weil sie von der »bulgarischen faschistischen Besetzung« während des Zweiten Weltkriegs sprechen. Nordmazedonien müsse die »gemeinsame Geschichte bis 1944« anerkennen, insbesondere bei der Deutung von Persönlichkeiten und Ereignissen, die aus der Sicht Bulgariens Teil der bulgarischen Geschichte seien. Eine bilaterale Expertenkommission, die 2017 eingerichtet wurde und vor allem Historiker umfasst, solle Empfehlungen für den Geschichts-, Geografie- und Literaturunterricht machen, an denen sich Nordmazedonien orientieren müsse. Eine Prämisse der Deutung formulierte die bulgarische Regierung gleich mit: Die mazedonische Sprache firmiert in dem Dokument nur unter Anführungszeichen und als »sogenannte«, denn gemäß offizieller bulgarischer Lesart ist sie bloß eine Variante des Bulgarischen, künstlich vom jugoslawischen [8]Kommunismus geschaffen, um die Mazedonier von den Bulgaren zu trennen. Bis 1944 jedenfalls wären die Mazedonier eigentlich Bulgaren gewesen und daher auch Teil der bulgarischen Geschichte.
Es dauerte zwei Jahre, bis ein Kompromiss gefunden wurde, damit Bulgarien endlich der Aufnahme der Beitrittsverhandlungen zustimmte – auf die Nordmazedonien seit 2000 gewartet hatte, als es seinen EU-Beitrittsantrag stellte. Zuerst hatte Griechenland jahrelang den Beitrittsprozess blockiert, da es hinter dem Staatsnamen Mazedonien einen Anspruch auf die griechische Provinz desselben Namens vermutete und sich an der Vereinnahmung der antiken Makedonen (vor allem von Alexander dem Großen) durch die Geschichtspolitik Mazedoniens rieb. Die Republik Mazedonien änderte daher 2019 ihren Staatsnamen in Nordmazedonien, und der Flughafen Skopjes verlor seinen Beinamen ›Alexander der Große‹ (unter diesem Namen wurde er selbstverständlich von griechischen Fluglinien nicht angeflogen). Nun kam Bulgarien und forderte nicht weniger als die Übernahme der national-bulgarischen Sichtweise auf Geschichte und Sprache des Landes, dessen Territorium von der bulgarischen Nationalbewegung seit dem 19. Jahrhundert gefordert und während beider Weltkriege von Bulgarien besetzt worden war.
Wir beginnen unsere Geschichte mit dieser Kontroverse zwischen Bulgarien und Nordmazedonien, weil sie aktuelle Problemlagen Südosteuropas sowie die Bürde der Geschichte verdeutlicht. Zum einen sind zwischen einigen Ländern und teilweise innerhalb einzelner Staaten grundlegende Fragen des bilateralen Zusammenlebens und der staatlichen Organisation noch nicht geklärt, weshalb sich Regierungen [9]zu nationalistischen Übersprungshandlungen hinreißen lassen. Nicht alle politischen Akteure in der Region haben die bestehenden Grenzen verinnerlicht. Darunter leidet die Vollendung der europäischen Integration der Region, obwohl gerade diese dazu angetan wäre, Grenzen zu überwinden.
Zum anderen zeigt sich in der Episode die doppelte Bedeutung von Geschichte: Sie dient einerseits den politischen Akteuren als Argument, um konkurrierende Ansprüche auf – buchstäblich – Land und Leute, d. h. Territorium und Bevölkerung zu begründen. Die Ereignisse und Persönlichkeiten eines Gebietes werden in ein einheitliches nationales Narrativ integriert, das alternative Sichtweisen ausblendet und die enorme Vielfalt der Geschichte auf einen einzigen Handlungsstrang verengt. Andererseits markiert die Kontroverse die Bedeutung des historischen Erbes: Die Region hat die Auflösung der einstigen multinationalen Reiche sowie der ebenso multinationalen jugoslawischen Föderation noch nicht verdaut, denn in einer multiethnischen Region ließen sich nicht einfach nationale Grenzen ziehen – und wenn doch, so war das mit physischer oder symbolischer Gewalt gegen jene verbunden, die nicht in die Nation passten und sich daher als Opfer der Geschichte sehen. So wurde aus dem Potential der Geschichte in der Region – dass mehreren Nationen bzw. Gesellschaften dieselben Orte und Personen als Anker einer gemeinsamen Erinnerung dienen könnten – eine Bürde, da diese geteilte Geschichte durch die nationalistische Verengung nicht eint, sondern trennt.
Damit sind wir bei einem weiteren wichtigen Anliegen dieses Buches gelandet: Wir finden zwar die Geschichte [10]Südosteuropas besonders interessant, aber nicht besonders. Vieles von dem, was wir in Südosteuropa beobachten können, hat sich in ähnlicher Form anderswo in Europa (oder der Welt) abgespielt, wenn auch manchmal zu anderen Zeiten und natürlich immer in unterschiedlichen Ausprägungen und Verlaufsformen. Die mazedonische Nationsbildung etwa mag uns sehr spezifisch vorkommen, aber sie baute nicht weniger auf historische Mythen und klotzige Denkmäler, auf Sprachpolitik und Minderheitenexklusion, auf gemeinsame Institutionen und Infrastrukturen als die deutsche – nur fand sie eben nach 1944 statt, unter gänzlich anderen Rahmenbedingungen. Wir wenden uns also gegen die Vorstellung, dass das südöstliche Europa gewissermaßen aus der europäischen Norm herausfalle – eine Vorstellung, die sich spätestens mit dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren verfestigt hat. Doch im Gegenteil bietet die Beschäftigung mit der Geschichte Südosteuropas die Möglichkeit, sich mit zentralen Themen der Entwicklung Europas auseinanderzusetzen und sich der regionalen Vielfalt dessen, was wir heute als Europa verstehen, bewusst zu werden. Die Geschichte der Region unterscheidet sich nicht stärker vom Rest Europas als die jeder anderen Region innerhalb Europas, denn nicht nur Europa, sondern auch seine Geschichte schöpft ihre Einheit aus der Vielfalt.
Natürlich weist die Geschichte Südosteuropas, wie jene jeder Region, viele Besonderheiten auf, die wir in den nun folgenden Kapiteln erläutern wollen. Aber sie ist nicht exotisch, sondern ein integraler Bestandteil der europäischen Geschichte. Diese muss auch von ihren jeweiligen Rändern her betrachtet werden, denn gerade dort sehen wir, wie wichtig die Beziehungen zu anderen Regionen für die [11]spezifische Entwicklung Europas waren. Ist etwa die Geschichte der britischen Inseln nicht ohne deren koloniales Ausgreifen und die Interaktion mit Nordamerika verstehbar, jene der iberischen Halbinsel nicht ohne ihre südamerikanischen und afrikanischen Dimensionen, oder jene Russlands nicht ohne den eurasischen Kontext, so muss Südosteuropa in seinem Bezug zum Nahen Osten und der weiteren Mittelmeerregion ebenso gedacht werden wie in Hinblick auf seine Verbindungen mit Mittel- und Osteuropa. Südosteuropa kann exemplarisch verdeutlichen, wie stark verflochten europäische Geschichten sind, und zwar schon lange, bevor das Wort Globalisierung in aller Munde war. Die Richtung dieser Verflechtungen ist wesentlich durch die geografische Lage einer Region bestimmt.
Und schließlich werfen die zentralen Probleme der Geschichte Südosteuropas, die wir in diesem Buch diskutieren – wie nachholende wirtschaftliche Entwicklung, der Umgang mit Multikonfessionalität und -ethnizität, Staatsbildung und die Folgen von Nationalismus, das Verhältnis zwischen Eliten und ›einfacher‹ Bevölkerung, die Dynamiken von Konflikt und Krieg –, Fragen auf, über die wir nachdenken müssen, um heutige gesellschaftliche Herausforderungen in Europa meistern zu können. Unsere Darstellung fokussiert dabei vor allem die Zeit seit etwa 1800, aber auch die vormodernen Grundlagen der südosteuropäischen Geschichte werden erörtert, denn diese hinterließen nicht nur bis heute weiterwirkende Erbschaften, sondern spielen auch in den kollektiven Erinnerungen und nationalen Selbstbildern eine große Rolle.
Der vorliegende Band ist das Werk von zwei Autoren, die ihre jeweils spezifischen Expertisen und methodischen [12]Zugänge zusammengeführt haben. Darin sehen wir einen Vorteil, weil Geschichte immer in einem Diskussionsprozess unterschiedlicher Ansätze geschrieben wird. Wie gut es uns gelungen ist, unsere Ansichten in eine kohärente Erzählung zu überführen, müssen die Leserinnen und Leser dieses Buches entscheiden. Jene, die uns bei der Abfassung und Revision des Manuskriptes zu Hilfe gekommen sind, haben jedenfalls getan, was sie konnten, um das Buch lesbar zu machen. Für Hinweise zu einzelnen Themen sowie die kritische Lektüre des Buches bzw. von Teilen des Manuskripts danken wir ganz herzlich Andreas Becker, Timo Brunnbauer, Marija Đokić, Luminiţa Gatejel, Nicole Immig, Heidrun Hamersky, Heike Karge, Peter Kreuter, Hans-Christian Maner, Stefano Petrungaro, Natali Stegmann, Maria Todorova, Stefan Troebst und Ioannis Zelepos. Ermöglicht wurde dieses Werk auch durch das vorzügliche institutionelle Umfeld in Regensburg, wo die Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien sowie das Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) nicht nur eine intellektuell anregende Atmosphäre schaffen, sondern durch die zahlreichen Gäste aus dem Aus- und Inland die Chance bieten, aktuelle Forschungstrends zu debattieren. Schließlich ist dem Verlag für die Betreuung des Bandes und die Möglichkeit einer zweiten, überarbeiteten Auflage zu danken. Unterstützung gab es somit ausreichend für ein Buch, das hoffentlich nicht nur Interesse für die spannende und komplexe Geschichte Südosteuropas erweckt, sondern auch zum Nachdenken darüber einlädt, was Europa zu Europa macht.
Bevor wir zur Darstellung schreiten, noch eine technische Vorbemerkung zur Schreibweise: Die dynamische [13]Geschichte Südosteuropas schlägt sich auch in den Ortsnamen nieder, die vielfach wechselten. Für viele Orte existierten parallele Namensformen, je nach Sprache: So kennen Deutschsprachige die heute rumänische Stadt Cluj-Napoca (bis 1974 einfach nur Cluj) als Klausenburg und Ungarn als Kolozsvár, und Türken reisen nicht nach Bitola, sondern Manastir usw. usf. Im Sinne der Lesefreundlichkeit verwenden wir in diesem Buch zumeist die heute gebräuchlichen Namensformen, auch wenn das für den Zeitraum, für den von einem Ort die Rede sein wird, nicht üblich war. So bezeichnen wir die Stadt Plovdiv in Bulgarien mit diesem Namen auch für die osmanische Periode, obwohl der offizielle Name der Stadt damals Filibe war und sie von der in ihr dominanten griechischen Kaufmannschaft Philippopolis genannt wurde. Nur wo die aktuell gebräuchliche Namensform arg irreführend wäre, verwenden wir die historische (etwa Fiume statt Rijeka, wobei im Italienischen die Stadt natürlich auch heute noch Fiume heißt). In der Transliteration von Namen aus den kyrillischen Alphabeten folgen wir im Übrigen der wissenschaftlichen Norm.
[15]Südosteuropa und seine Geschichte: Einführende Bemerkungen
Was ist die Geschichte Südosteuropas, wo findet sie statt? Diese Frage ist alles andere als banal und wurde in den letzten Jahrzehnten unterschiedlich beantwortet. Das Problem liegt in der Unklarheit des Begriffs ›Südosteuropa‹. Schon ein Blick auf den einschlägigen Wikipedia-Eintrag verdeutlicht die Schwierigkeiten, die Grenzen der Region abzustecken, denn – so Wikipedia – die »Abgrenzung ist je nach Kontext unterschiedlich«. Doch hindert diese Uneindeutigkeit wirklich daran, die Geschichte der Region zu schreiben? Oder ist sie nicht eher ein Vorteil, weil sich Geschichte nie in starren Grenzen abspielt? Nur scheinbar lässt sich die Vergangenheit eines Landes leichter fassen als jene einer Region, die nicht durch eine gemeinsame Staatsgrenze oder durch gemeinsame Institutionen zusammengehalten wird. Wer glaubt, die Geschichte eines bestimmten Staates im Rahmen von dessen Grenzen schreiben zu können, geht einer nationalistischen Schimäre auf den Leim. Vielmehr ist die moderne Welt derart stark von Beziehungsgeflechten geprägt, die über Staatsgrenzen hinweggehen, dass der Historiker immer einen Blick auf das Ganze haben muss, um das Besondere zu verstehen. Südosteuropa ist ebenfalls ein Beziehungsraum, dessen Geschichte geschrieben werden kann, auch wenn die Region politisch niemals eine Einheit gebildet hat und das auch heute nicht tut.
Die Tatsache, dass es eigene Professuren für die Geschichte Südosteuropas ebenso wie den Fachverband der Südosteuropa-Gesellschaft gibt, deutet bereits auf die [16]Existenz von Gemeinsamkeiten hin, welche die Länder und Kulturen der Region verbinden. Der 2015 verstorbene Südosteuropahistoriker Holm Sundhaussen, zeit seines Lebens Doyen des Faches in Deutschland, sprach von Südosteuropa als Geschichtsregion. Was ist damit gemeint? Zum einen gibt es lange zurückreichende historische Prägungen, welche die Geschicke eines großen Teils der Region bestimmten. Weite Teile Südosteuropas gehörten zum oströmischen und dann byzantinischen Reich, weshalb sie eine teilweise andere Entwicklung als das durch Völkerwanderung und germanische Staatsgründungen gekennzeichnete westliche Europa nahmen. Mit dem Ausgreifen der islamischen Dynastie der Osmanen auf den Balkan seit dem 14. Jahrhundert wurde die Region – zeitweise bis nach Ungarn im Norden – in ein Imperium eingegliedert, das neben der Balkanhalbinsel die heutige Türkei, die arabische Halbinsel und Nordafrika umfasste. Die Kerngebiete Südosteuropas befanden sich ein halbes Jahrtausend unter osmanischer Herrschaft, deren Spuren bis heute sichtbar sind, etwa in der Präsenz großer muslimischer Bevölkerungsgruppen und orientalischer Architektur. Wie prägend die osmanische Periode war, lässt sich auch daran bemessen, dass in Ländern wie Griechenland, Serbien und Bulgarien Korruption und bürokratische Ineffizienz heute noch gerne mit Verweis auf die osmanische Herrschaft erklärt (und entschuldigt) werden – obwohl diese nun schon eine geraume Zeit zurückliegt.
Nicht ganz Südosteuropa war Teil des Osmanischen Reiches, Ungarn ›nur‹ für etwas mehr als eineinhalb Jahrhunderte, die Gebiete des heutigen Rumäniens immer lediglich in einer mehr oder wenigen losen Verbindung mit dem [17]Sultan, das Territorium des heutigen Sloweniens und Istriens sogar nie. Aber dennoch sollte eine umfassende Geschichte Südosteuropas auch diese Regionen und Länder inkludieren, weil es immer wieder längere und folgenschwere Perioden gab, in denen diese Gebiete zu Staatsgebilden gehörten, die in den Kern der Balkanhalbinsel hineinreichten. Slowenien und Kroatien etwa waren im 20. Jahrhundert Teil Jugoslawiens, eines Staates, der auch einst osmanische Territorien umfasste. Das Königreich Ungarn – sowohl im Mittelalter als auch als Teil des Habsburgerreiches – bestimmte ganz wesentlich die Geschicke der Region; die südlichen Gebiete der Habsburgermonarchie waren in großem Ausmaß durch ihre Grenzlage zum Osmanischen Reich bestimmt, nicht zuletzt, weil dort auch Bevölkerungsgruppen siedelten, welche die gleiche Sprache sprachen wie die Menschen jenseits der Grenze. Als Beispiel könnten die Serben und Rumänen genannt werden, die in beiden Reichen lebten, im 19. Jahrhundert aber nach und nach ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entwickelten. Zudem bezogen sich Habsburgermonarchie und Osmanisches Reich stark aufeinander, bei all den großen Unterschieden, die ihre innere Entwicklung auszeichnete. Beispielsweise stießen angesichts zahlreicher Kriege und Scharmützel ihre Herrscher Reformen an, um gegen das jeweils andere Reich militärisch bestehen zu können. Also haben Südösterreich und der südliche Balkan doch etwas miteinander zu tun: Ohne die osmanische Bedrohung wäre die steirische Landeshauptstadt Graz jedenfalls um eine ihrer größten Attraktionen ärmer, nämlich das mit mehr als 30 000 Waffen gefüllte, in den 1640er Jahren im Zuge der Türkenabwehr erbaute Zeughaus.
[18]Schließlich erlaubt der Blick auf die gesamte Region, die Entwicklung einzelner Staaten zu vergleichen, nachdem die Reiche untergegangen sind. Es zeigt sich dabei, dass etwa die Republik Türkei als ein osmanischer Nachfolgestaat nach 1918 vor ähnlichen Herausforderungen stand wie Griechenland ein knappes Jahrhundert zuvor. Auch die Entwicklung Ungarns nach dem Ende der Habsburgermonarchie ist nur zu verstehen, wenn sie mit jener in anderen ex-habsburgischen Gebieten verglichen und vor dem Hintergrund der Bedeutung der 1918/1919 verlorenen Gebiete dargestellt wird. Daher wird in diesem Buch die Geschichte der Türkei, als eines post-osmanischen Nationalstaats, als integraler Bestandteil der südosteuropäischen Geschichte behandelt, nicht zuletzt aufgrund ihrer weiterhin engen Beziehungen zu den anderen Balkanstaaten. Heute ist die Republik Türkei auf dem Balkan wieder stark präsent – politisch, ökonomisch, kulturell. Griechenland und die Türkei bilden beispielsweise eine echte Schicksalsgemeinschaft, wenn auch meistens, aber nicht immer, im Sinne eines Konfliktes – nicht nur aufgrund der Geografie, sondern auch wegen der gemeinsamen Vergangenheit. Ähnliches ließe sich für Ungarn und Rumänien behaupten.
Wie erwähnt gehörten die Länder und Regionen Südosteuropas in ihrer Geschichte niemals alle zum selben Staatswesen. Dennoch entwarfen regionale ebenso wie externe Akteure wiederholt Projekte der Vereinigung und regionalen Zusammenarbeit. Der griechische Aufklärer Rigas Velestinlis (1757–1798) träumte von einem Bund aller Balkanvölker, nachdem sie sich einmal von osmanischer Herrschaft befreit hätten. Er entwarf sogar eine Flagge für die zukünftige Föderation. Diese Idee tauchte regelmäßig im [19]19. und 20. Jahrhundert auf, wobei zwar die Vorstellungen variierten, welche Regionen und Völker sich föderieren sollten, die Autoren dieser Programme aber davon ausgingen, dass es ausreichend kulturelle und politische Gemeinsamkeiten gäbe, um einen solchen Verbund zu bilden. Solche Vorhaben zielten letztlich darauf, Südosteuropa im Inneren zu einen, damit die Region nicht mehr als Spielball äußerer Mächte fungieren könne. Einen letzten ernst gemeinten Versuch in diese Richtung machten die Anführer der kommunistischen Parteien Jugoslawiens und Bulgariens, Josip Broz Tito und Georgi Dimitrov, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als in beiden Ländern die Kommunisten die Macht übernahmen. Tito visierte eine Föderation an, die von den Alpen im Norden bis an die Ägäis im Süden, von der Adria im Westen bis an das Schwarze Meer im Osten reichen sollte, also tatsächlich die gesamte Region des südöstlichen Europa umfasst hätte.
Wie wir wissen, ist es dazu nicht gekommen, aber selbst in jüngster Zeit gab es politische Versuche, die Kooperation innerhalb der Region zu stärken. Bedeutung erlangte dabei vor allem der nach dem Kosovokrieg 1999 von der internationalen Staatengemeinschaft aus der Taufe gehobene Stabilitätspakt für Südosteuropa, der die dauerhafte Befriedung Ex-Jugoslawiens sowie die Stabilisierung der Gesamtregion bezweckte. Darüber hinaus gibt es heute unterschiedliche Anlässe, zu denen sich die Staats- und Regierungschefs der Region regelmäßig treffen. Diese Formen der Zusammenarbeit sind zwar nicht besonderer gegenseitiger Sympathie geschuldet, aber zumindest der Einsicht, dass die Länder der Region vor ähnlichen Herausforderungen stehen, die sie gemeinsam besser bewältigen können als im Alleingang.
[20]Regionale Geschichte als Beziehungsgeschichte
In den letzten Jahren wurde eine intensive Debatte über die Grundlagen sowie den geografischen Rahmen der südosteuropäischen Geschichte geführt, die wir weder ignorieren wollen noch dürfen. Eine wichtige Erkenntnis dieser Diskussionen ist, dass die Region nicht als eine Art Container zu betrachten ist, in dem sich Geschichte unberührt von anderen Geschichten abspielt. Vielmehr ist es wichtig, die Beziehungen zwischen Regionen – von der lokalen bis zur globalen Ebene – und die mannigfaltigen Transfers zu berücksichtigen, welche die jeweils betrachteten historischen Phänomene beeinflussen. Südosteuropa, als Gebiet, das über Jahrhunderte eine Grenzregion von Imperien war und eine natürliche Brücke zwischen Europa und Asien darstellt, kann die Bedeutung von überregionalen Beziehungen, Verflechtungen und Transfers für die Geschichte einzelner Länder, Orte und Bevölkerungsgruppen versinnbildlichen.
Schon der oberflächliche Blick etwa auf die urbane Architektur oder die Dorfformen in Südosteuropa macht deutlich, dass die einzelnen Teile der Region von engen kulturellen Beziehungen mit jeweils anderen Regionen geprägt waren: Die Städte Istriens, Dalmatiens und Montenegros erinnern an Italien, die Altstadt von Skopje könnte auch in Anatolien liegen, die siebenbürgischen Städte wiederum gut und gerne in Mitteleuropa, die moldauischen in der Ukraine. Über weite Strecken seiner Geschichte seit der Antike war Südosteuropa Teil von großen Reichen, die über die Balkanhalbinsel hinausreichten. Natürlich hingen daher die Entwicklungen in Südosteuropa eng mit den anderen [21]Reichsteilen zusammen. Die für die Region ausschlaggebenden politischen, aber auch kulturellen Zentren lagen bis in das 19., teilweise 20. Jahrhundert hinein außerhalb oder am Rande der Region: Konstantinopel/Istanbul, Wien und Venedig, im 19. Jahrhundert auch Sankt Petersburg und Budapest, in den Zeiten des Kalten Kriegs dann Moskau als Zentrum des Ostblocks. In Südosteuropa amalgamieren sich also unterschiedliche kulturelle Einflüsse, und zwar sowohl synchron als auch diachron: Hier treffen – in jeweils unterschiedlichen Mischungen – mediterrane, zentraleuropäische, osteuropäische und orientalische Muster genauso zusammen wie die Prägungen durch die byzantinische, osmanische, venezianische, habsburgische und sozialistische Epoche, von den seit dem Zweiten Weltkrieg so wichtigen US-amerikanischen Einflüssen einmal ganz zu schweigen.
Seit dem 19. Jahrhundert intensivierten sich zudem die internationalen Verflechtungen: Passenderweise ist eine der jüngsten wissenschaftlichen Darstellungen der Geschichte Südosteuropas (aus der Feder der Münchner Historikerin Marie-Janine Calic) mit Weltgeschichte einer Region untertitelt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde Südosteuropa in den Weltmarkt für Güter, Kapital und Arbeitskräfte integriert, internationale Verträge sowie Großmachtpolitik schufen engere politische Verbindungen zwischen einzelnen Ländern, der Telegraph, die Eisenbahn und andere moderne Verkehrsmittel sorgten für einen viel dichteren und schnelleren Fluss von Informationen, Ideen und Menschen über Grenzen hinweg als jemals zuvor. Südosteuropa war von diesen Entwicklungen nicht weniger betroffen als andere Regionen Europas, aufgrund seiner politischen und ökonomischen Schwäche vielleicht sogar stärker, da die [22]Region immer wieder in die Abhängigkeit von Großmächten geriet. Man denke etwa an die neuen Eliten der jungen Nationalstaaten, die ihre Ausbildung zum guten Teil in West- und Mitteleuropa oder auch in Russland erfahren hatten, oder an die finanzpolitische Abhängigkeit von den damaligen Finanzzentren Europas, von denen die neuen Staaten Geld borgten.
Schließlich geht es in jeder Geschichte um Menschen, denn diese machen die Geschichte (auch wenn sie sich dessen nicht immer bewusst sind, so das Bonmot von Karl Marx). Je nachdem, wo diese Menschen in Südosteuropa lebten, in welche Familien sie geboren wurden, und womit sie sich beschäftigten, waren sie in unterschiedliche Kommunikationsräume integriert, die für ihr Leben bedeutungsvoll waren. Für die Bewohner eines Dorfes in den Tiefen der Herzegowina, aus dem viele Einwohner nach Amerika ausgewandert waren, waren um 1900 Ereignisse in den USA wahrscheinlich wichtiger als das, was einige Dutzend Kilometer weiter entfernt passierte. Für einen Beamten in der nächstgelegenen Stadt bildeten zur selben Zeit hingegen Sarajevo und Wien – die Orte, aus denen er Anweisungen erhielt – die wichtigsten Bezugspunkte. Da die historischen Akteure, also die Menschen, mobil sind, verändern sich auch die Zusammenhänge, in denen sie ihr Leben gestalten. Heute kann man aufgrund der starken Auswanderung Südosteuropa überall in der Welt finden.
Südosteuropa hat nicht nur Geschichte – Winston Churchill sagte angeblich sogar, mehr als es verdauen kann –, die Region besitzt auch ein Image. Es gibt in und außerhalb der Region bestimmte Vorstellungen von ihrem Wesen, die sich in dem Begriff ›Balkan‹, der häufig synonym mit [23]Südosteuropa verwendet wird, kristallisieren. Diese Bilder beruhen oftmals auf Stereotypen, welche eine verzerrte Sicht der Dinge wiedergeben, aber nichtsdestotrotz (oder gerade deswegen) weitverbreitet sind. So wird der Balkan seit dem 19. Jahrhundert immer wieder mit Gewalt, Chaos und Unkultiviertheit assoziiert. In den Forschungsdebatten über den Charakter Südosteuropas haben Autoren gerade solche klischeehaften Vorstellungen problematisiert, da sich falsche Wahrnehmungen zu irreführenden Ansichten verfestigen können, die wiederum zu uninformierten Entscheidungen führen. Manche gingen so weit zu sagen, es gebe eigentlich nur Bilder vom Balkan, nicht aber die Region selbst. Viel interessanter erscheint uns aber die Tatsache, dass in Beschreibungen des Balkans zwar immer wieder die Vorurteile der Autoren zum Vorschein kommen, gleichzeitig aber vielfach eine echte Neugierde auf eine Welt, die Reisenden, Journalisten, Wissenschaftlern und Diplomaten als fremd und andersartig vorkam. Darin spiegelt sich die fundamentale Tatsache wider, dass die historische Entwicklung der Region sich in vielerlei Hinsicht von jener des Westens – die den Referenzhintergrund dieser Beobachter darstellte – unterscheidet, was sie zum einen so interessant macht und womit zum anderen keinerlei Werturteil verbunden ist.
Bilder über und Wissen von Südosteuropa
Es war mir ein wahres Vergnügen, mich wieder heimisch zu fühlen im Orient, in diesem Gegensatz des milden, ruhigen, gelehrigen Daseins des Hauswesens und der stürmischen Bewegung des Hofes und Feldlagers, in [24]dieser bequemen und zierlichen Tracht, in diesen geschmackvollen Zimmern und behaglichen Divans, in diesem himmlischen Klima und dem in beständiger Gemeinschaft mit der Natur verbrachten Dasein. Welche Erholung überdies von europäischer Langweile, Politik, Theorien, Systemen, Beweisführungen und Gelehrsamkeit! Der Orient verdankt vieles von seinem Reiz den Gegensätzen, die verschwinden, wenn sie nicht mehr neu und ungewohnt sind. Aber er besitzt auch wirkliche Vorzüge, die mit Erfahrung und Gewohnheit immer mehr zunehmen und die in meinen Augen niemals so anziehend zu sein schienen wie gerade in diesem Augenblick. […] Ich kam geradewegs aus Europa, ich war im Süden Italiens durch Szenen beispiellosen Elends gekommen, ich hatte England unmittelbar nach dem wilden Tumult von Bristol verlassen, ich war auf meiner schnellen Reise der Erste gewesen, der in Lyon eintraf, nach dem mehr systematischen, aber auch blutigen Aufstand in dieser Stadt.1
So beschrieb der Schotte David Urquhart seine Gefühle bei seiner zweiten Reise in die europäische Türkei, die er 1831 im Auftrag der britischen Regierung unternahm. Urquhart kam, um die Situation in den Gebieten der aufständischen Griechen zu untersuchen, als es darum ging, die Grenzen des neuen griechischen Staates festzulegen. Er war bereits 1827 in Griechenland gewesen und sollte 1836 Botschaftssekretär in Konstantinopel werden. Im weiteren Verlauf [25]seiner Laufbahn entwickelte er sich zum Fürsprecher des Osmanischen Reiches, unter anderem als Parlamentsabgeordneter in Westminster, und zum vehementen Gegner Russlands und dessen Ansprüchen am Balkan.
Einen etwas anderen ersten Eindruck vom ›Orient‹ gewann ein Zeitgenosse Urquharts, der preußische Offizier Helmuth von Moltke, der 1835 von König Friedrich Wilhelm III. als Militärberater zum osmanischen Sultan geschickt wurde. Er betrat osmanisches Territorium auf der Donauinsel Ada-Kaleh an der österreichisch-osmanischen Donaugrenze, östlich von Belgrad (die Insel versank 1972 in der Donau, nachdem die Talsperre am Eisernen Tor fertiggestellt wurde). Dort wurden er und sein Mitreisender von dem auf der Insel residierenden osmanischen Gouverneur empfangen:
Osman Pascha empfing mit viel Freundlichkeit zwei Fremde, die aus dem fernen Lande ›Trandenburg‹ [so des Paschas Bezeichnung für Brandenburg] kamen: Er ließ uns Kaffee reichen und Pfeifen und gestattete uns, seine Festung zu besehen. Der Pascha ist ein stattlicher Herr mit einem dicken roten Bart, aber so unbeschreiblich schlecht logiert wie bei uns ein Dorfschulze. Sein Palast ist ein Bretterschuppen, der an ein detachiertes Bastion angeklebt ist. Trotz der empfindlichsten Kälte saßen wir in einem halboffenen Gemach ohne Fensterscheiben. Sehr unnötigerweise hatten wir uns in Frack gesetzt, während Se. Excellenz in zwei bis drei Pelzen, einer größer und weiter, ganz à son aise erschienen. In der Stadt überraschte uns die Unreinlichkeit der engen Straßen. Die Anzüge der Menschen waren rot, gelb, blau, kurz [26]von den schreiendsten Farben, aber alle zerlumpt. Alle Wohnungen trugen Spuren des Verfalls, und an der Festung ist, glaub’ ich, seit der Besitznahme kein Ziegel ausgebessert.2
Bei beiden Autoren wird deutlich, dass sie die Einreise in das Osmanische Reich als Verlassen Europas empfinden. Sie beschreiben den Balkan als von Europa gänzlich unterschiedliche Kultur, wobei Motive auftauchen, die in den folgenden Jahrzehnten zu festen Vorstellungen über den Balkan gerannen: Der Balkan war bunt und ursprünglich, gastfreundlich, aber ungeordnet. Moltke betonte den Schmutz und die Armut, die ihm auf der weiteren Reise durch Südosteuropa gen Konstantinopel ins Auge stachen – dies sollte ein festes Motiv in den Südosteuropaschilderungen von europäischen Reisenden im 19. und auch 20. Jahrhundert werden. Der Konservative Urquhart hingegen entdeckte im Orient, zu dem er den Balkan zählte, noch jene Unverdorbenheit und Natürlichkeit sowie Freundlichkeit im Umgang miteinander, die er im vermeintlich zivilisierten, aber von Revolutionen erschütterten und durch enorme Klassengegensätze gekennzeichneten Europa seiner Zeit vermisste.
Im Laufe der Jahre sollte nicht das positive, von Urquhart gezeichnete Bild dominant werden, sondern ein negatives, in dem der Balkan synonym wurde für Gewalt, Rohheit, Verlogenheit, Unvorhersehbarkeit, Fanatismus, Ignoranz, Schmutz und Verfall – mit einem Wort, für den Mangel an Zivilisation. Es ist bezeichnend für diesen Wandel, dass [27]Urquhart noch von der Badekultur der Osmanen begeistert war, die ihm als viel reinlicher erschienen als seine Landsleute, die zu jener Zeit das Wasser scheuten (Urquhart richtete sogar in London ein türkisches Bad ein); bei Karl May hingegen sind die Menschen des Balkans notorisch ungepflegt. In In den Schluchten des Balkan schreibt May:
Mir wurde bereits jetzt übel. Der Orientale schläft in seinen Kleidern, die er also äußerst selten ablegt. Von einem regelmäßigen Wechsel der Leibwäsche hat er gar keine Ahnung; darum ist es kein Wunder, daß seine Nähe nicht nur durch das Auge, sondern auch durch die Nase bemerklich ist. Und nun diese fürchterlich zusammengedrängten Menschen! Der Dichter des Inferno hat eine wunderbare Phantasie entwickelt, aber eine der entsetzlichsten Strafen hat er doch übersehen – eine arme Seele, zwischen Orientalen eingepreßt, um ein chinesisches Schattenspiel zu erwarten, unfähig, die Arme zu rühren und sich die Nase zuzuhalten. Ein Glück, daß ich damals von dem Dasein des Komma-Bazillus und anderer ähnlicher Ungeheuer noch keine Ahnung hatte! Welch ein Weltmeer von Bazillen mußte uns hier umfluten!3
Für das deutschsprachige Publikum hat wohl kaum ein Autor das Bild vom Balkan so geprägt wie ebendieser Karl May, der die Region zwar nie bereiste, aber sie zum Schauplatz von zwei Büchern seines Orientalischen Zyklus machte (In den Schluchten des Balkan und Durch das Land der Skipetaren, beide 1892). Die Albaner (›Skipetaren‹ nach [28]der albanischen Selbstbezeichnung) sind bei May hinterhältige, rachsüchtige Halunken in einem Land, in dem das Recht nichts gilt:
Die türkische Rechtspflege hat bekanntlich ihre Eigentümlichkeiten, sagen wir geradezu ihre Schattenseiten, die um so deutlicher hervortreten, je entlegener die Gegend ist, um die es sich handelt. Unter den dortigen Verhältnissen ist es nicht zu verwundern, daß da, wo die verschiedenen zuchtlosen, sich ewig befehdenden Stämme der Arnauten ihre Wohnsitze haben, von einem wirklichen ›Rechte‹ fast gar nicht gesprochen werden kann. Bei Ostromdscha beginnt das Gebiet dieser Skipetaren, welche nur das eine Gesetz kennen, daß der Schwächere dem Stärkeren zu weichen hat.4
Das Motiv der Gewaltneigung und Rechtlosigkeit der Völker des Balkans erwies sich als besonders wirkmächtige Vorstellung. Die regelmäßigen Massaker der Osmanen bei der Niederschlagung von christlichen Aufständen im 19. Jahrhundert, die im 19. Jahrhundert noch verbreitete Praxis, abgeschlagene Köpfe von Feinden zur Schau zu stellen, die blutrünstige Ermordung des serbischen Königs und seiner Gattin 1903, die international untersuchten Brutalitäten der Balkankriege von 1912/13, das Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo im Juni 1914 – alle diese Ereignisse verstärkten das Bild einer unzivilisierten und wilden Region (über die von ›zivilisierten‹ Europäern angestellten [29]Brutalitäten, etwa in den Kolonialkriegen, sahen europäische Beobachter zumeist ebenso großzügig hinweg wie über die Tatsache, dass die europäischen Mächte in vielerlei Hinsicht in die Ereignisse und damit auch Gewaltakte am Balkan involviert waren). In der Berichterstattung über die Jugoslawienkriege der 1990er Jahre fanden sich häufig Verweise auf die vermeintlich lange Tradition der besonders grausamen Kriegführung in Südosteuropa. Gleichzeitig verfestigten diese Kriege das Bild des Balkans als Pulverfass erneut, denn selbst in akademischen Publikationen über die Jugoslawienkriege findet sich die falsche Bezeichnung ›Balkankriege‹. Auch der Begriff ›Balkanisierung‹, mit dem die oftmals gewaltsame Auflösung einer größeren politischen Ordnung in kleinere, wenig überlebensfähige Bestandteile bezeichnet wird, enthält eine klar negative Konnotation (die durch das von Wikipedia vorgeschlagene Synonym ›Libanonisierung‹ noch deutlicher wird).
Die Historikerin Maria Todorova hat den Prozess der Ausbildung und Verfestigung solcher stereotyper Sichtweisen auf Südosteuropa als Erfindung des Balkans (so die deutsche Übersetzung ihres 1997 auf Englisch erschienenen Buches Imagining the Balkans) bezeichnet. Der »Balkanismus« diene als »Europas bequemes Vorurteil«, so der Untertitel ihres Werks: Dem Balkan wurden jene Eigenschaften zugeschrieben, von denen sich die aufgeklärten Europäer abgrenzen wollten, wenn nicht umgekehrt zivilisationsmüde Westeuropäer glaubten, am Balkan noch von der Moderne unverdorbene ›edle Wilde‹ und ein Museum noch lebendiger Traditionen vorfinden zu können. Ein besonders häufiges Motiv in diesen mentalen Landkarten war die Platzierung des Balkans als Übergangszone zwischen [30]Europa und Asien; der Balkan gehörte in der Ansicht vieler Betrachter weder richtig zum Okzident noch zum Orient, sondern lag irgendwo dazwischen. In Reisebeschreibungen trat diese Ambivalenz häufig zum Vorschein, wenn etwa die als europäisch wahrgenommenen Repräsentationsbauten in den Zentren der südosteuropäischen Hauptstädte mit den im Schlamm versinkenden, von armseligen Häusern gesäumten chaotischen Straßen der Randbezirke kontrastiert wurden.
In diesen Bildern vom Balkan kamen alteingesessene Vorurteile zusammen mit Unwissen und geopolitischen Ambitionen, aber eben auch mit durchaus zutreffenden Beobachtungen – wie so oft enthielten Stereotype ein Körnchen Wahrheit. Zumal kritische Stimmen in der Region selbst oft von einer nur oberflächlichen Modernisierung sprachen, von einer vermeintlich dünnen Schicht europäischer Zivilisation, unter der sich altertümliche Praktiken verbargen, die den erhofften Fortschritt verhinderten. Die großartige Kunstfigur des mindestens ebenso selbstbewussten und kaltschnäuzigen wie ›ungehobelten‹ und geizigen Rosenölhändlers Bai Ganju, die der bulgarische Autor Aleko Konstantinov (1863–1897) schuf, verkörpert wie kein anderes Beispiel die ambivalente Haltung von Intellektuellen der Region zu den Herausforderungen der Moderne, denen sie viele ihrer Landsleute für nicht gewachsen hielten.
Für die reale (und auch imaginierte) Besonderheit des Balkans war im 19. Jahrhundert die noch immer gegebene Präsenz des Osmanischen Reiches zentral: Als islamisch geprägtes Staatswesen wurde es von den europäischen Zeitgenossen als Fremdkörper wahrgenommen, wobei sich die im 16. Jahrhundert noch festzustellende Ehrfurcht vor [31]seiner militärischen Überlegenheit in das Bild des ›kranken Manns am Bosporus‹ umgekehrt hatte. Die Darstellung der Massaker, die osmanische Truppen an christlichen Bevölkerungen im Zuge der nationalrevolutionären Aufstände im 19. Jahrhundert begingen, schloss an die während der Türkenkriege des 16. und 17. Jahrhunderts in Europa weitverbreiteten sogenannten Türkenbilder an. Beschrieb man Gesellschaften des Balkans als unzivilisiert und uneuropäisch, konnte man wiederum im 19. und 20. Jahrhundert europäische Eingriffe rechtfertigen – die Habsburger etwa gaben ihre Okkupation Bosnien-Herzegowinas im Jahr 1878 als Zivilisationsmission aus; Russland verstand sich als Schutzmacht der Orthodoxen im Osmanischen Reich, zu deren Wohle es ein Interventionsrecht beanspruchte; das Osmanische Reich durfte nicht am Tisch der europäischen Großmächte Platz nehmen.
Darüber hinaus bot das bis ins 19. Jahrhundert in Europa ausgesprochen geringe Wissen über den Balkan einen fruchtbaren Boden für Missverständnisse, die – wenn sie sich einmal zu wieder und wieder geäußerten Ansichten verfestigten – auch durch wissenschaftliche Erkenntnisse nur mehr schwer aus der Welt zu schaffen waren. Dieser geringe Kenntnisstand beruhte nicht nur auf Desinteresse, sondern auch den Schwierigkeiten, die Region zu bereisen. Im Osmanischen Reich durften sich bis zu dieser Zeit Fremde nicht frei bewegen, und die Quarantänevorschriften zur Pestprävention machten den Grenzübertritt von Österreich-Ungarn ins Osmanische Reich zu einer zeitraubenden, unangenehmen Angelegenheit. Die Osmanen selbst produzierten wenig Wissen über das von ihnen in Europa beherrschte Gebiet, zumal die weitreichende Anarchie in [32]der Europäischen Türkei im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert einer Beforschung und Landvermessung entgegenstand; moderne Wissenschaften konnten sich im Osmanischen Reich erst im späten 19. Jahrhundert etablieren, und dann auch nur sporadisch.
Viel besser Bescheid wusste man über die habsburgischen Gebiete, da dort der Staat für sein Verwaltungshandeln notwendige Informationen systematisch zusammentrug. Der erste regelrechte Zensus der Walachei (im heutigen Rumänien) stammt beispielsweise aus der Zeit der kurzen österreichischen Kontrolle (1718–1739) über die Region, und auch in Albanien wurde die erste Volkszählung durch Österreich-Ungarn durchgeführt (während der Besetzung im Ersten Weltkrieg). Die habsburgischen Herrscher selbst trugen zur Wissensproduktion bei: Der österreichische Kaiser Franz I. (1804–1835) etwa informierte sich bei ausgedehnten Reisen in die Provinzen seines Reiches aus erster Hand und verfasste detaillierte Beschreibungen; Kronprinz Rudolf initiierte 1883 eine umfangreiche Beschreibung der unterschiedlichen Reichsteile (das sogenannte Kronprinzenwerk). In Wien tätige slawische Philologen wie der Slowene Jernej Kopitar und der Serbe Vuk Stefanović Karadžić legten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Grundsteine für die wissenschaftliche Slawistik, beschäftigten sich aber auch mit der Volkskunde und Geschichte der slawischen Völker Südosteuropas.
Im Zuge des verstärkten politischen Interesses der europäischen Großmächte für die Region und der Öffnung des Osmanischen Reiches intensivierte sich in den 1830er Jahren die Reisetätigkeit in die osmanischen Gebiete. Diplomaten, Geschäftsleute, Journalisten, Wissenschaftler und [33]Abenteurer beiderlei Geschlechts erkundeten nicht nur die sie fremd anmutende Welt der europäischen Türkei, sondern verfassten teilweise vielgelesene Reisedarstellungen. Diese wiesen zwar viele Defizite und so manche irrige Annahme auf, aber sie enthielten auch nützliche und zutreffende Informationen, etwa über die natürlichen und verkehrsgeografischen Gegebenheiten. Reiseberichte wie jener des französischen Naturkundlers Ami Boué (veröffentlicht in Wien 1840 in vier Bänden) sind heute noch wichtige Quellen für die Rekonstruktion der damaligen Verhältnisse am Balkan.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts verwissenschaftlichte sich das Schrifttum über die geografischen, kulturellen und sprachlichen Gegebenheiten sowie die Geschichte der Region mehr und mehr. So verfasste einer der Ahnherren der modernen Geschichtsschreibung, Leopold von Ranke, im Jahr 1829 auch eine Geschichte der serbischen Aufstände. In der Geografie wurde Ende des 19. Jahrhunderts eine Region in Südosteuropa sogar namensgebend für ein geologisches Phänomen: Der Terminus für besonders verwitterte Kalksteinformationen leitet sich von dem Landschaftsnamen für das Hinterland von Triest (slowen. kras, it. carso, dt. Karst) ab. Die im 19. Jahrhundert entstehenden Nationalstaaten etablierten – allerdings mit einiger Zeitverzögerung – wissenschaftliche Einrichtungen, welche die Kenntnisse über die Länder der Region deutlich mehrten. Die Serbische Akademie der Wissenschaften und Künste wurde beispielsweise 1886 aus der Taufe gehoben. Wichtige Zentren der Erforschung Südosteuropas waren zudem Wien und Sankt Petersburg – in beiden Fällen war die Beschäftigung mit Südosteuropa auch strategisch motiviert. So ist die [34]Genese der Albanologie in Österreich-Ungarn am Ende des 19. Jahrhunderts nicht von den politischen Zielen der Doppelmonarchie zu trennen, welche die Albaner als Vertreter österreichisch-ungarischer Interessen am Balkan sah und als Gegengewicht zu den Serben unterstützte.
Wissen über Südosteuropa und (Geo-)Politik gehören also eng zusammen; Politik bediente sich gerne wissenschaftlicher Argumente zur Untermauerung ihrer Ansprüche, während wiederum Wissenschaftler mit dem Verweis auf die politische Bedeutung ihres Gegenstandes leichter an Geld für ihre Forschung gelangten. Der bekannte serbische Geograf Jovan Cvijić (1865–1927) lieferte beispielsweise bei den Versailler Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg wissenschaftliche Begründungen für die Grenzansprüche des neuen jugoslawischen Staates, gleichzeitig half ihm seine politische Bedeutung, umfangreiche Forschungsarbeiten finanziert zu bekommen. Mit seinen Arbeiten trug er, wie andere Wissenschaftler jener Zeit, zur Ausformulierung der nationalen Idee und Begründung der nationalen Identität bei – aber gleichzeitig auch zur Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten über die nationalen Grenzen hinweg, die Grundlage für die Kooperation zwischen den Balkanländern sein sollten (so erlebte die Balkanforschung in den Ländern Südosteuropas in den 1930er Jahren im Zusammenhang mit der sogenannten Balkanentente, einem militärischen und politischen Bündnis zwischen der Türkei, Rumänien, Jugoslawien und Griechenland, einen Boom). Balkanbilder wurden also nicht nur von außen an die Region herangetragen, sondern auch in ihr produziert – dort aber zum Zwecke der politischen Emanzipation.
Auch außerhalb der Region politisierte sich Forschung [35]über Südosteuropa, wie am Beispiel der ältesten einschlägigen Forschungseinrichtung in Deutschland gezeigt werden kann: Das 1930 in München gegründete Südost-Institut – Ulf Brunnbauer ist heute Direktor seines Nachfolgeinstituts in Regensburg – entstand im Kontext revisionistischer Bestrebungen Deutschlands. Als »Institut zur Erforschung des deutschen Volkstums im Süden und Südosten« beschäftigte es sich anfangs vor allem mit den deutschen Minderheiten im »Südosten«, wozu man auch die Tschechoslowakei zählte. In der Zeit des Nationalsozialismus verschob sich der Fokus des Instituts auf die Länder Südosteuropas, verbunden mit dem Bekenntnis zu einer »kämpfenden Wissenschaft«, welche die politischen Ziele des Nationalsozialismus befördern sollte. Insgesamt diente die Südostforschung im Schatten des Dritten Reiches – so der Titel eines 2004 erschienenen Sammelbandes, der eine kritische Aufarbeitung der Geschichte der deutschen Südosteuropaforschung vornimmt – der Beförderung der Pläne NS-Deutschlands, die Region als »Ergänzungsraum Südosteuropa« zu beherrschen.
Die politische Instrumentalisierung der Forschung zu Südosteuropa (ebenso wie zu Osteuropa) setzte sich nach 1945 unter geänderten Vorzeichen fort: Im Kalten Krieg konnte sich das Südost-Institut als eine jener Einrichtungen etablieren, die Wissen über die Gesellschaften ›jenseits‹ des Eisernen Vorhangs produzierten. Der Kalte Krieg war überhaupt der Rehabilitierung von NS-belasteten Ost- und Südosteuropaexperten sehr förderlich, die sich nun der Verteidigung der ›freien Welt‹ verpflichten konnten. Diesem politisch motivierten Erkenntnisinteresse verdankte die Südosteuropaforschung in Deutschland eine leidlich gute [36]Ausstattung, etwa mit Professuren für die Geschichte und die Sprachen der Region an einigen Universitäten sowie einem eigenen Fachverband (Südosteuropa-Gesellschaft, gegründet 1952). Gleichzeitig entstand aber auch unbestritten der Forschung dienendes Wissen über die Region, das sich politischer Indienstnahme entzog und heute noch wertvoll ist, zumal fruchtbare akademische Kontakte mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Region über die ideologischen Gräben hinweg gepflegt wurden.
Es war unter anderem die enge Verbindung von Forschung und Politik, welche die massive Kritik an der Südosteuropaforschung in den 1990er Jahren provozierte. Viele warfen die Frage auf, ob es jenseits des politischen Begründungszusammenhanges, der mit dem Ende des Kalten Krieges und der europäischen Integration der Region wegfiel, überhaupt eine fachlich-inhaltliche Rechtfertigung für die Existenz einer eigenen Südosteuropakunde gebe. Wenn man all die Vorannahmen und Stereotypen über Südosteuropa abzieht, bleibt dann überhaupt noch ein Gegenstand, der untersucht werden kann? Diese Debatte führte in den 1990er und 2000er Jahren zu einer intensiven Reflexion über die Grundlagen der Südosteuropaforschung, die in deren Modernisierung und einem neuen Selbstbewusstsein mündete. Nicht zuletzt machten die Entwicklungen der letzten Jahre deutlich, dass auch ein Beitritt zur Europäischen Union nicht bedeutet, dass sich ein Land von seiner Geschichte und damit auch seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Region völlig befreien kann (bzw. soll). Vielmehr ist Südosteuropa ein großartiges Beispiel für die Diskussion jener Faktoren, die nachhaltig über alle politischen Brüche hinweg als sogenannte Pfadabhängigkeiten wirken. [37]Noch heute zeigen etwa Studien markante Unterschiede in Werthaltungen dies- und jenseits der einstigen Grenze des Habsburgerreiches, mehr als hundert Jahre nach seinem Untergang.
Terminologie
Ein wichtiges Element der Debatten über die Grundlagen der Südosteuropaforschung war die Frage, wie die Region am besten bezeichnet werden sollte: als ›Balkan‹ oder ›Südosteuropa‹? Der 2022 verstorbene österreichische Südosteuropahistoriker Karl Kaser schlug die Bezeichnung ›südöstliches Europa‹ vor, die die Unschärfe der geografischen Abgrenzung besser zum Ausdruck bringe. Historisch war ›Balkan‹ der lange Zeit dominierende Name für die Halbinsel im Südosten des Kontinents. Das Wort balkan stammt aus dem Türkischen, wo es einen bewaldeten Berg bezeichnet. Als Bezeichnung für die Region wurde dieses Wort im Jahr 1808 vom deutschen Geographen August Zeune (1778–1853) in der irrigen Annahme vorgeschlagen, das im heutigen Bulgarien gelegene Balkangebirge (griechisch Haemus, bulgarisch Stara planina) reiche vom Schwarzen Meer bis an die Adria. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass es kein die gesamte Halbinsel durchziehendes Zentralgebirge gab, wurden Namensalternativen wie ›Südosteuropäische Halbinsel‹ (Johann Georg von Hahn, 1811–1869) oder ›Südosteuropa‹ (Theobald Fischer, 1846–1910) formuliert. Am gebräuchlichsten waren bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts aber Bezeichnungen wie ›europäische Türkei‹, die auf die Zugehörigkeit des Balkans zum Osmanischen Reich abstellten.
[38]Die Diskussion über die richtige Benennung der Region entzündete sich im 20. Jahrhundert an zwei Faktoren: Zum einen schlugen vor allem im deutschsprachigen Raum Autoren ›Südosteuropa‹ als vermeintlich neutrale Alternative zu dem negativ konnotierten ›Balkan‹ vor. Insbesondere das nach dem Ersten Weltkrieg geläufige Schlagwort der ›Balkanisierung‹ schien das Wort ›Balkan‹ als Bezeichnung für eine geografisch gefasste Region unbrauchbar zu machen. Allerdings wurde während des Nationalsozialismus dann auch der Begriff ›Südosteuropa‹ desavouiert. In der englischsprachigen Forschung führten nach 1945 Überblicksdarstellungen der Geschichte der Region üblicherweise den Plural ›Balkans‹ im Titel, wie Leften Stavrianos’ The Balkans since 1453 (veröffentlicht 1953) oder Barbara Jelavichs zweibändige History of the Balkans (1983), die jeweils sowohl die osmanischen als auch habsburgischen Gebiete behandelten. Mit der häufigen Bezeichnung der jugoslawischen Nachfolgekriege als ›Balkan Wars‹ erhielt Balkan jedoch auch im angloamerikanischen Sprachraum einen so schlechten Beiklang, dass neuere Arbeiten ihn durch ›Southeastern Europe‹ ersetzten. So nennt sich eine der aktuellsten englischsprachigen Gesamtdarstellungen der Geschichte der Region im 20. Jahrhundert, geschrieben vom US-amerikanischen Historiker John Lampe, Balkans into Southeastern Europe: Damit spielt der Autor auf den Weg der Region nach ›Europa‹, verstanden als die Europäische Union, an.
In Südosteuropa selbst pflegten die politischen Eliten seit dem Ende des Kommunismus ebenfalls eine Rhetorik der ›Rückkehr nach Europa‹, was mitunter mit vehementer Abwehr der Verortung ihrer Länder in ›Südosteuropa‹ oder gar auf dem Balkan einherging, im Bewusstsein des negativen [39]Beiklangs dieser Begriffe (auf Busbahnhöfen konnte man Fahrkarten »nach Europa« erstehen). Das unabhängige Kroatien weigerte sich etwa eine Zeit lang, sich an Initiativen mit der Bezeichnung ›Südosteuropa‹ zu beteiligen, da es sich nun als Teil des Westens bzw. Mitteleuropas verstand. Insgesamt lässt sich in der Region ein analoger Prozess der ›Balkanisierung‹ beobachten, bei dem die jeweils südlichen Nachbarn, auf die man herabblickt, als Teil des Orients dargestellt werden, während man sich selbst zu Europa zählt. Für viele Kroaten sind die Serben Teil des Balkans, in Rumänien sind es die Bulgaren; in Serbien verläuft diese kulturelle Scheidelinie quer durch das Land, da viele Bewohner der Provinz Vojvodina, die bis 1918 zu Österreich-Ungarn gehört hat, die Serben südlich der Save und Donau (also aus den einst osmanischen Gebieten) als ›balkanisch‹ und damit weniger zivilisiert erachten. Häufig soll die Verunglimpfung als ›balkanisch‹ auch selbstironisch zum Ausdruck bringen, dass man es trotz aller Anstrengungen nicht schafft, europäisch zu werden – und es vielleicht auch gar nicht so recht will.
In der deutschsprachigen Forschung dominiert heute jedenfalls die Bezeichnung ›Südosteuropa‹ für die Gesamtregion, während ›Balkan‹ als ein Teil von ihr angesehen wird. Holm Sundhaussen etwa betonte, dass ›Balkan‹ und ›Südosteuropa‹ nicht deckungsgleich seien. Als Balkan gelten mithin vor allem jene Gebiete, die für rund ein halbes Jahrtausend direkt in das Osmanische Reich eingebunden waren, also eine besonders tiefgehende osmanische Prägung erfuhren, und zuvor zum byzantinischen Herrschafts- und Einflussbereich gehört hatten, mit dem orthodoxen Erbe als sichtbarster Folge. Demzufolge habe der Balkan im Norden eine relativ klare Abgrenzung (entlang der Flüsse Save [40]und Donau). ›Südosteuropa‹ greift im Norden weiter aus und umfasst neben den rumänischen Gebieten auch einst zum Habsburgerreich gehörende Regionen (in manchen Definitionen zählt selbst die Slowakei zu Südosteuropa, aufgrund der langen ungarischen Herrschaft über dieses Gebiet). ›Südosteuropa‹ erweist sich also als die flexiblere und – heute wenigstens – kulturell weniger aufgeladene Bezeichnung. Sie bringt die historische Variabilität der Grenzen der Region besser zum Ausdruck als der Name ›Balkan‹. Länder wie Ungarn können, je nach Betrachtungswinkel, sowohl als Teil Mittel- als auch Südosteuropas betrachtet werden. Aufgrund der langen Zugehörigkeit von südosteuropäischen Gebieten und Ländern wie Kroatien, Siebenbürgen und Nordserbien zu Ungarn würde eine Nichtberücksichtigung Ungarns allerdings eine große Lücke in eine Geschichte Südosteuropas reißen.
Grundlagen der südosteuropäischen Geschichte
Was macht nun die Geschichte dieser heterogenen, aber gleichzeitig in sich eng verwobenen Region aus? Zuallererst ist sie interessant, gerade weil sie sich von anderen Teilen Europas unterscheidet. So ist Südosteuropa die einzige Region Europas (neben den Wolgagebieten Russlands), in der seit Jahrhunderten Muslime in großer Zahl leben. In Südosteuropa begegnen sich auch die katholische und die orthodoxe Christenheit; vom 15. Jahrhundert bis zum Holocaust war die Region zudem die Heimat einer lebendigen jüdisch-sephardischen Kultur. Migrationen, Konversionen, Grenzverschiebungen, aber auch Krieg hinterließen eine [41]intensive kulturelle Durchmischung, die Südosteuropa trotz aller Homogenisierungsbestrebungen der Nationalstaaten seit dem 19. Jahrhundert bis in die jüngste Vergangenheit auszeichnete. Es ist erst die intensive Einwanderung der letzten Jahrzehnte, die westeuropäische Gesellschaften heute als heterogener erscheinen lässt als südosteuropäische, wenigstens in den Großstädten.
Die kulturelle Vielfalt der Region verdankte sich wesentlich ihrer langen imperialen Prägung. Reiche wie das Osmanische, jenes der Habsburger und Venedig betrieben typischerweise keine Politik der Vereinheitlichung (aber die längste Zeit auch keine der Gleichbehandlung). Sie stellten einen großen Raum für intensive kulturelle Austauschprozesse zwischen ihren einzelnen Bestandteilen dar und reichten jeweils über Südosteuropa hinaus. Für die Sprösslinge albanischer Elitenfamilien war es in osmanischer Zeit nichts Besonderes, in ihrer Berufslaufbahn als Amtsträger des Sultans auch einmal in Damaskus oder Ägypten stationiert zu werden; südslawische Intellektuelle befruchteten das kulturelle Leben der Hauptstadt der Habsburgermonarchie.
Die Imperien waren somit für Südosteuropa wichtig, aber umgekehrt auch Südosteuropa für die Imperien. Bis in das 18. Jahrhundert kam der Balkan als Zentralregion des Osmanischen Reiches zum Beispiel für den Großteil von dessen Steuereinnahmen auf. Für die Habsburger war wiederum Südosteuropa im späten 19. Jahrhundert die einzige Region, in der sie glaubhaft als Großmacht auftreten konnten. Das Venezianische Reich brachte die ostadriatischen Küstengebiete und die ionischen Inseln mit Venedig und seinem Hinterland im Handelsimperium des Stato da Mar zusammen. Gerade die Einbindung in geografisch ausgreifende Reiche [42]sorgte dafür, dass unterschiedliche Teile Südosteuropas mit jeweils anderen Regionen eng interagierten. Die Adria stellte weniger eine Abgrenzung denn eine Brücke für Kulturtransfers dar, wie das Stadtbild dalmatinischer Küstenstädte oder die Präsenz albanischer Minderheiten in Süditalien verdeutlicht; für Bosporus und Schwarzes Meer gilt Analoges. Die griechische Welt war bis zur Vertreibung der Griechen aus der Türkei 1923 eine, die Griechenland genauso umfasste wie Kleinasien und Ägypten, und bis zur Hauptstadtwerdung Athens waren Konstantinopel und Smyrna (Izmir) deutlich wichtigere Zentren für die griechische Kultur als diese Provinzstadt am Südzipfel Südosteuropas.
Neben den unterschiedlichen Verbindungen Südosteuropas zu anderen Regionen war die Mannigfaltigkeit des Naturraums ein weiterer Grund für kulturelle Vielfalt, da weder die topografischen noch die klimatischen Bedingungen in der Region einheitlich sind. Zudem sorgte die Natur dafür, dass manche Gebiete kaum für die Außenwelt zugänglich waren und sich somit althergebrachte Muster lange halten konnten. Der Naturraum bildete insgesamt einen wichtigen Faktor in der Geschichte Südosteuropas. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts stellte Landwirtschaft den wichtigsten Erwerbszweig in Südosteuropa dar, wobei das Niveau der technischen Ausstattung bescheiden war. Deshalb hatten die Eigenschaften des Terrains und des Klimas bedeutende Folgen für das Wohlergehen der Menschen. Die Landwirte waren bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark von den Unbilden der Natur abhängig und entwickelten diverse Strategien, um sich an die lokal jeweils gegebenen Bedingungen anzupassen. Wesentlich durch den Naturraum bestimmt waren auch die [43]Siedlungsmuster, etwa weil Wasservorkommen oder der Schutz durch Berge Ansiedlungen begünstigten, Sumpfländer wiederum solche verhinderten.
Der Blick auf die Landkarte verrät, dass Südosteuropa stark von Gebirgslandschaften geprägt ist, welche die Region von den Alpen im Nordwesten über das langgezogene Dinarische Gebirge und die Karpaten im Zentrum bis zu den Gebirgszügen nördlich der Ägäis fragmentieren. Die Gebirge nehmen vielerorts hochalpine Formen an und erreichen am zentralen Balkan Höhen von beinahe 3000 Metern (der höchste Berg der Balkanhalbinsel, der Gipfel Musala im bulgarischen Rila-Gebirge, ist 2925 Meter hoch). Die größten zusammenhängenden Ebenen erstrecken sich entlang der Donau, mit der pannonischen Tiefebene im Norden und der walachischen im heutigen Rumänien. Ein weiteres topografisches Charakteristikum sind die stark zergliederten Küstenabschnitte der Adria, des Ionischen Meeres und der Ägäis mit ihren zahlreichen Inseln, wobei die Inseln selbst in der Regel relativ gebirgig sind. Zerklüftete Küstenabschnitte dienten beispielsweise als Rückzugsgebiete für Piraten, wie auf der Halbinsel Mani auf der Peloponnes, deren Bewohner als furchtlose Seeräuber galten; und die Uskoken der Stadt Senj im oberen Dalmatien waren bis ins 17. Jahrhundert hinein der Schrecken der Schifffahrt auf der Adria. Die Küste des Schwarzen Meers ist weniger unregelmäßig; bis in das späte 18. Jahrhundert war das Schwarze Meer ohnehin ein regelrechter Binnensee der Osmanen, deren Monopol erst mit dem Verlust der Krim an Russland und der Schaffung russischer Häfen am Schwarzen Meer (Odessa, 1794) endete.
Die Gebirge erwiesen sich naturgemäß als schwieriger [44]Untergrund für den Ackerbau: Die Winter sind lang und im Inneren der Region schneereich (bzw. waren sie das bis zum Klimawandel der letzten Jahre), die Abhänge steil, und in den großen Karstgebieten entlang der Adria sowie auf den Inselbergen sind fruchtbare Böden ohnehin besonders knapp. Ebenso ist dort die Wasserversorgung schwierig, da Regenwasser im Kalkstein des Karst schnell unterirdisch abfließt. Weite Teile der küstennahen Gebirgsregionen wurden zudem schon in der Antike entwaldet, was Erosion und damit den Verlust von fruchtbarem Erdreich beförderte. An Gebirgsabhängen hin zum Meer konnten wenigstens Wein, Zitrusfrüchte und Oliven angebaut werden, aus deren Einkünften die Bewohner Getreide und andere Produkte hinzukaufen konnten (und dank derer sie länger als viele Kontinentaleuropäer lebten, wie noch heute festzustellen ist). Die Ebenen wiesen zwar prinzipiell bessere Voraussetzungen für den Ackerbau auf, einige Flachlandregionen waren aber bis in das frühe 20. Jahrhundert sumpfig und derart von Malaria geplagt, dass sie nur dünn besiedelt waren. In einer medizinischen Studie über Malaria in Bulgarien aus den 1930er Jahren heißt es über das Umland der Hafenstadt Burgas am Schwarzen Meer:
Infolge der schweren Malariadurchseuchung wird nur 1/15 des Bodens bebaut, obwohl gerade in diesem Gebiet der Boden sehr ergiebig und fruchtbar ist. Die Durchschnittszahl der Bewohner beträgt 28–32 auf 1 qkm, wohingegen sie in ganz Bulgarien 50–55 beträgt […] So schreibt Manoloff, daß man in Burgas von einem gesunden Bauerntypus nicht sprechen kann, sondern von einem ›Malariatypus‹. Das ganze Gebiet von Burgas ist im [45]Sommer wegen seiner vielen Sümpfe und der damit verbundenen Mückenplage berüchtigt.5
Angesichts dieser ökologischen Bedingungen dominierte bis in das 19. Jahrhundert hinein in vielen Teilen Südosteuropas die Viehzucht. In den Gebirgen wurde typischerweise Kleinvieh (Schafe und Ziegen) gehalten, das im Sommer in den Bergen, im Winter in den schneefreien Tallagen bzw. Tiefebenen weidete (im Winter ruht die Mücke, die Malaria überträgt). Viele Dörfer des Balkans liegen in Gebirgstälern oder an Bergflanken und damit zwischen den Winter- und Sommerweidegebieten. Zudem boten die Berge besseren Schutz vor aufdringlichen Steuereintreibern, ausbeuterischen Feudalherren und marodierenden Soldaten. Es ist bezeichnend, dass sich dort, wo der Getreideanbau eine dominante Rolle spielte (wie in den rumänischen Fürstentümern und in der pannonischen Tiefebene) oder wo Baumwolle und Reis angebaut wurden (Makedonien und Thrakien), feudale Strukturen am stärksten ausbilden konnten. Hier mussten die Menschen das Land von Großgrundbesitzern bearbeiten, während sie selbst nur wenig oder gar kein Land besaßen. Die in der südosteuropäischen Volkskultur gepflegte Vorstellung von den Gebirgen als Ort der Freiheit und Unabhängigkeit ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Auch das verbindet die Region von den Alpen bis an die Ägäis.
Südosteuropa ist also letztlich ein Beziehungs- und Handlungsraum, dessen Grenzen sich je nach historischer [46]Epoche verschoben, in dem sich aber dennoch über Jahrhunderte hinweg das Geschehen verdichtete. Dementsprechend nimmt unsere Darstellung eine umfassende Perspektive ein, die in unterschiedlicher Intensität auch die Türkei und Ungarn berücksichtigt, da beide Länder eng mit dem Kern der Region interagierten, ja wesentliche Entwicklungen dort bestimmten und zumal aus vergleichender Perspektive interessant sind. Im Mittelpunkt des Interesses steht jenes Gebiet, das heute die Staaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Kosovo, Kroatien, Nordmazedonien, Montenegro, Rumänien, Serbien und Slowenien umfasst. Chronologisch setzen wir in jener Periode ein, die im europäischen Sprachgebrauch Frühmittelalter heißt und in Südosteuropa durch das byzantinische Reich geprägt wurde, wiewohl der Fokus unserer Darstellung auf den letzten beiden Jahrhunderten liegt, also der Moderne in ihren spezifischen südosteuropäischen Ausprägungen. Thematisch berücksichtigen wir neben der politischen Geschichte auch die sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen, denn nicht zuletzt diese konstituieren die Spezifika der Geschichte Südosteuropas. Eine Gesamtdarstellung kann natürlich den sicherlich wichtigen Eigenheiten der einzelnen Länder nur ungenügend gerecht werden, zumal diese Staaten mehrfach ihre Grenzen verändert haben. Aber sie hilft zu verstehen, wie gemeinsame Erbschaften und Erfahrungen in verschiedenen Entwicklungen mündeten, obwohl sich trotz aller Unterschiede noch immer Gemeinsamkeiten finden lassen – und sei es nur die quer über die Region geteilte Vorliebe für gegrilltes Hackfleisch und selbstgebrannten Schnaps.
[47]Das vormoderne Erbe (bis ca. 1800)
1997 erfuhr eine Touristengruppe im Kloster Studenica vom örtlichen Reisebegleiter, im mittelalterlichen Serbien hätten die Menschen schon mit Gabeln gegessen, als sich Westeuropäer noch ganz unästhetisch mit den Fingern behalfen. Dieses hohe kulturelle Niveau habe ihnen Byzanz gebracht. Der serbische Politiker und Jurist Dejan Mirović entwickelte aus dieser Vorstellung 2004 ein Argument gegen die EU-Integration seines Landes:
Unser wirklicher Lehrer ist Byzanz, darauf müssen wir stolz sein, denn Byzanz war ein Staat und eine Kultur von Weltrang. Wir aber begeben uns freiwillig noch einmal auf die Schülerbank, obwohl wir den besten Lehrer hatten […] und werden zu Schülern eines ungebildeten, korrumpierten und böswilligen Lehrers.6
Auf der anderen Seite gibt es Intellektuelle in der Region, die von Byzanz nichts hören wollen. In Serbien können Letztere sich auf den berühmten Literaturkritiker Jovan Skerlić berufen, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts verkündete, das stark byzantinisch geprägte, zum großen Teil aus Hagiografien bestehende literarische Erbe des mittelalterlichen Serbien sei wertlos. Vormoderne und insbesondere mittelalterliche Themen lösen also in Südosteuropa immer noch erhebliche Emotionen aus.
Für eine Geschichte Südosteuropas ist die Vormoderne in zweierlei Hinsicht wichtig – einerseits als historisches [48]Erbe, das teils bis heute fortwirkt, andererseits als Erinnerung, die man aufruft, um bestimmte Ansprüche anzumelden. Die Nationalbewegungen seit dem 19. Jahrhundert beriefen sich in aller Regel auf mittelalterliche bzw. antike Vorgänger und betonten die frühe Blüte der eigenen Kultur, die dann von den Osmanen bzw. den Habsburgern unterdrückt worden sei. Dabei ging es in aller Regel nicht um gesellschaftspolitische Modelle der Vormoderne (von denen man entweder wenig hielt oder wenig wusste), sondern um den schieren Nachweis einer uralten eigenen Existenz, Größe und Würde. Aus einer glanzvoll imaginierten Vergangenheit, die nur durch äußere Gewalteinwirkung abgebrochen worden sei, leitete man im 19. und 20. Jahrhundert das Recht auf eine ebenso glanzvolle nationale Gegenwart ab. Dass dabei die historische Wirklichkeit der vergangenen Jahrhunderte zweitrangig war, versteht sich von selbst.
Zwischen der Spätantike und dem 19. Jahrhundert waren in Südosteuropa übernationale Reiche prägend – im östlichen Teil das Oströmische bzw. Byzantinische Reich (4.–15. Jahrhundert), dessen Einflussgebiet später im Wesentlichen an die Osmanen fiel (15.–19. Jahrhundert), im westlichen das Habsburgerreich (16. Jahrhundert bis 1918) sowie in einigen Küstenregionen und der Inselwelt des östlichen Mittelmeers die Republik Venedig (13.–18. Jahrhundert). Hinzu kamen mittelalterliche Königreiche mit lokalen Eliten, als deren Fortsetzung sich einige Staaten Südosteuropas heute sehen – die aber de facto ebenfalls multiethnisch waren, zeitweise imperiale Züge aufwiesen und nicht als Staaten im modernen Sinne verstanden werden sollten. In erster Linie zu nennen sind das Bulgarische Reich, das [49]zweimal existierte (7.–11. Jahrhundert und 12.–14. Jahrhundert), das ungarische Reich (11.–16. Jahrhundert) und das serbische Reich (12.–15. Jahrhundert). Eine weitere Gruppe bilden Staaten wie das mittelalterliche Kroatien (10.–12. Jahrhundert), das bosnische Königreich (14.–15. Jahrhundert) oder die rumänischen Fürstentümer Walachei und Moldau (14.–15. Jahrhundert), die nur über einen relativ kurzen Zeitraum unabhängig blieben und weniger expansiv waren. Die Jahrhundertangaben sind nur von geringer Bedeutung, denn sie verbergen Wichtiges: Das Byzantinische Reich etwa war seit dem Vierten Kreuzzug 1204 nur noch ein Schatten seiner selbst, während Kroatien nach der Personalunion mit Ungarn (1102) zwar kein eigenständiger Staat mehr war, aber als Königreich mit eigenem Landtag weiterbestand – eine für die spätere kroatische Nationalbewegung in ihrer Suche nach historischer Kontinuität wichtige Tatsache. Auch die Donaufürstentümer existierten unter osmanischer Oberherrschaft weiter als tributpflichtige Gebiete mit innerer Autonomie und – für die längste Zeit – Fürsten aus der heimischen Aristokratie (den sogenannten Bojaren).
Südosteuropa in der Vormoderne war selbstverständlich mehr als die Summe seiner Staatswesen – wichtig ist auch die Gesamtkonstellation, die sich aus der Präsenz dieser verschiedenen Imperien ergab. Schon im mittelalterlichen Südosteuropa konkurrierten, ähnlich wie in der Neuzeit, relativ viele Mächte um Einfluss und Territorien – eine Folge waren Kriege und sich immer wieder verschiebende Grenzen, mit denen die Nationalbewegungen des 19. Jahrhunderts einander oft ausschließende Ansprüche auf Land und Leute begründeten. Aus historischer Sicht sind und [50]waren diese Ansprüche wenig überzeugend, weil erstens den meisten Grenzverläufen im Mittelalter die Stabilität fehlte und zweitens die Grenzen keine ethnische Bedeutung hatten. Im Gegenteil – die südosteuropäische Vormoderne war geprägt durch intensive Migrationsbewegungen und Kulturtransfers, die sich in der Regel nicht an staatliche Grenzen hielten. Mehrsprachigkeit und Assimilationsprozesse waren allgegenwärtig. Auch wenn im Folgenden von Staaten und Gruppen die Rede ist, die denselben Namen tragen wie heutige Nationen, bedeuteten diese Namen in der Vormoderne nicht dasselbe – hinter ihnen standen zwar durchaus politische und gesellschaftliche Profile, nicht aber homogene ethnische Gruppen, die man als Nationen im heutigen Sinne verstehen darf. Insbesondere bestand eine tiefe Spaltung zwischen den oberen und unteren gesellschaftlichen Schichten, während das moderne Nationsprinzip auf der Idee der Gemeinschaft über alle sozialen Grenzen hinweg beruht.
Antikes Erbe, mittelalterliche Neuanfänge
Als besonders nachhaltig erwiesen sich drei kontinentale Reiche, welche die Geschichte der Region über lange Zeiträume prägten – das Byzantinische, das Osmanische und das Habsburgische. Byzanz bzw. Ostrom, das den beiden anderen Reichen voranging, hinterließ nicht nur eine spezifische Variante des Christentums (die Orthodoxie), sondern auch bestimmte Sprachkulturen (Griechisch bzw. in kyrillischen Buchstaben geschriebenes Slawisch), und formte das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft. Die [51]byzantinische Gesellschaft wirkt, im Vergleich zum westlichen Mittelalter, deutlich konfliktärmer, denn sie kannte weniger Reibungen zwischen Kirche und Staat, zwischen gesellschaftlichen Gruppen, zwischen religiösen Autoritäten, Minderheiten und Abweichlern. Dem Reich wie teilweise auch seinen Nachfolgestaaten lagen auch jene spezifischen Lösungen fern, die aus der westlichen Konfliktgeschichte hervorgingen – es entwickelte kein Ständesystem, keine Schiedsrichterfunktion des Rechts und wenig Religionskritik. Damit fehlten ihm manche Grundlagen für repräsentative Demokratie, Rechtsstaat und Säkularisierung. Die osmanische Herrschaft änderte vieles, schrieb allerdings die Differenz fort und ließ wenig Raum für Diskussionen über ›eigene Wege‹.
Schließlich wurde das westliche Modell, das aus einer ganz eigenen Konfliktgeschichte entstanden war, sekundär in den (post-)byzantinischen Raum exportiert. Dies geschah seit dem 18. Jahrhundert im Rahmen der Aufklärung und des Nationalismus. Weil sich die Region zu diesem Zeitpunkt bereits in tiefer Abhängigkeit von Westeuropa befand, blieben ihren Entscheidungsträgern in diesem Prozess weder wirkliche Alternativen noch lange Zeit zum Überlegen. Seitdem wird der Balkanraum an einem Maßstab gemessen, der zu großen Teilen außerhalb der Region entwickelt wurde – und er misst sich auch selbst daran. Der neue Maßstab gilt als konstitutiv für die kulturelle Zuordnung zu Europa, verursacht aber auch Anpassungsstress. Innerhalb Südosteuropas führte diese Lage zu unterschiedlichen intellektuellen Reaktionen: Die einen verneinen jegliche grundlegende Differenz und behaupten, die Region habe sich stets auf einem Weg befunden, der mit dem des [52]





























