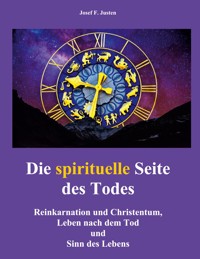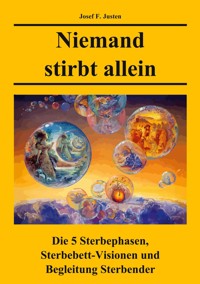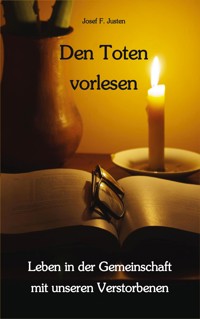Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die Geschichten, die in diesem Buch erzählt werden, handeln von Gott, von Engeln und von Menschen, von ganz gewöhnlichen, von besonderen und von höchst außergewöhnlichen Menschen. Alle Geschichten weisen unter der Oberfläche der Erzählung einen tiefen spirituellen Gehalt auf, der zum Nachdenken anregt und die Frage aufwirft: »Was ist die Moral von der Geschichte?« Sie sind für Groß und Klein gleichermaßen geeignet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Es ist egal, ob ein Kind ein Buch liest oder einen Film sieht.
Wichtig ist nur, dass Kinder mit Geschichten groß werden.
nach Cornelia Funke
Inhaltsverzeichnis
Der Wahrtraum
Die fromme Berta, die unbedingt den lieben
Gott sehen wollte
Die drei Räuber und die drei Richter
Die Heimkehr zum vergessenen Palast
Der ungläubige Onkel
Der weise Regenwurm
Das ganz besondere Weihnachtsfest
Der »grüne Gerd«
Wie sieht der »liebe Gott« aus?
Die selbst gebauten Gefängnisse
Der Apfelkrieg
Das Leben »danach«
Maskenball der Seele
Der Grenzfluss
Der reiche Mann und der arme Jobst
Das »Kreuz« des Menschen
Das Kind, das ein großes Opfer brachte
Der Wahrtraum
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebte ein Medizin-Professor mit seiner Frau in einer Berliner Villa. Er forschte und lehrte schon seit Jahren an der dortigen Universität.
Eines Nachts – der Morgen graute schon – schrak er aus dem Schlaf auf, weil er einen lauten Knall zu hören glaubte. Noch bevor er dazu kam, der Sache auf den Grund zu gehen, fiel ihm ein, dass er soeben einen beängstigenden Traum hatte, an den er sich noch einigermaßen zu erinnern vermochte.
Er saß in diesem Traum am Schreibtisch seines geräumigen Arbeitszimmers. Sein Blick fiel auf den Kalender an der gegenüberliegenden Wand. Dieser zeigte an: Donnerstag, 14. Juni. An die nächsten Sequenzen des Traumes konnte er sich nicht so recht erinnern. So wusste er auch nicht mehr genau, wo er sich gerade in seinem Traum aufhielt. Dann setzte die Erinnerung wieder ein. Er sah, wie jemand ein Gewehr in der Hand hielt und auf ihn zielte. Ein Schuss löste sich mit ohrenbetäubendem Knall und traf ihn tödlich.
Noch ganz schlaftrunken stand er auf, obwohl es noch recht früh war. Während des Frühstücks las er wie üblich in der Zeitung. Sein Blick fiel auf das Datum: 13. Juni. »Heute ist ja erst der 13.! Da kann mir wohl noch nichts passieren«, dachte er, leicht vor sich hin schmunzelnd. Der Professor war ein rational denkender Mann, der nur an das glaubte, was wissenschaftlich fundiert und nachweisbar ist. Wahrträume hielt er für einen Unsinn, so dass sein Traum ihn auch nicht sonderlich beunruhigte. Seiner Frau erzählte er nichts davon.
An diesem Tag ging er wie an den meisten Tagen zur Universität, wo er an seinen medizinischen Forschungen arbeitete. Am Nachmittag hielt er noch ein Seminar für seine Studenten.
Am Abend musste er dann doch wieder einige Male an seinen Alptraum denken. Große Sorgen machte er sich jedoch nicht. Trotzdem entschloss er sich beim Abendessen dann doch, seiner Frau davon zu erzählen. Seine Frau, die ein wenig zum Aberglauben neigte, war ganz entsetzt und sagte mit aufgeregter Stimme: »Um Gottes Willen! Solche Träume darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen! Du darfst morgen auf gar keinen Fall das Haus verlassen! Hier kann dir nichts passieren.« Der Professor lächelte nur und versuchte, sie zu beruhigen.
»Hätte ich ihr nur nichts gesagt! Jetzt kann die Gute vermutlich die ganze Nacht nicht schlafen«, dachte er.
Der nächste Tag begann. Es war Donnerstag, der 14. Juni. Als der Blick des Professors beim Frühstück auf das Datum in der Zeitung fiel, wurde ihm schon ein wenig mulmig zumute. Seine Frau flehte ihn an: »Du darfst heute auf keinen Fall das Haus verlassen! Schließe dich bitte den ganzen Tag in deinem Arbeitszimmer ein und sperre die Tür zu und verriegele das Fenster! Ach ja, und verschiebe deinen Schreibtisch etwas, so dass dich kein Schuss, der womöglich vom Dach des gegenüberliegenden Hauses durchs Fenster abgefeuert werden könnte, treffen kann!«
Der Professor, der jetzt doch eine gewisse Unruhe nicht verleugnen konnte, hätte an diesem Tag eigentlich eine Vorlesung an der Universität halten müssen. Da aber auch er sich ein wenig sorgte und seine Frau beruhigen wollte, befolgte er ihren Rat. Er sagte die Vorlesung telefonisch ab und beschloss, den ganzen Tag in seinem Arbeitszimmer zu verbringen, um an seinem neuen Fachbuch weiterzuschreiben. Schon seit Monaten saß er an nahezu allen Tagen, an denen er nicht in der Universität erscheinen musste, fast den ganzen Tag an seinem Schreibtisch, um an diesem Buch zu arbeiten. Oft saß er da stundenlang fast regungslos, ohne sich auch nur einmal die Füße zu vertreten oder eine Mahlzeit einzunehmen.
So ging er also nach dem Frühstück ans Werk. Als er sein Arbeitszimmer betrat, fiel sein Blick gleich auf den Kalender, den er im Traum gesehen hatte. Er riss ein Blatt ab. Das neue Blatt zeigte an: Donnerstag, 14. Juni. Seine Besorgnis nahm drastisch zu. Er verschloss die Tür, verriegele das Fenster und versetzte auch den Schreibtisch um etwa einen Meter, um nicht in der von seiner Frau erwähnten Schusslinie zu sitzen.
Nun wollte er sich an die Arbeit machen. Aber irgendwie konnte er sich nicht darauf konzentrieren. Er konnte jetzt nur noch an seinen Traum denken. Er wurde in zunehmendem Maße immer unruhiger und hoffte, dass der Tag bald vorübergehen möge. Aber es war erst 9 Uhr morgens. Der Professor lief die ganze Zeit getrieben und nervös in seinem Zimmer auf und ab, hin und her, einem gehetzten Tier gleich. Dabei achtete er streng darauf, dem Fenster nicht zu nahe zu kommen.
Es wurde 10 Uhr. Da klopfte es an seiner Tür. Er fragte: »Wer ist da?« Eine leise Stimme antwortete: »Ich bin es, Frau Gebert, Ihre Putzfrau! Heute ist doch Donnerstag, da ist Ihr Arbeitszimmer an der Reihe.« Der Professor erinnerte sich, dass Frau Gebert sein Arbeitszimmer jeden Donnerstag gründlich säuberte. Er ließ sie herein und sperrte das Zimmer wieder von innen ab. »Die wird mir schon nichts tun!«, dachte der Professor.
Auch während die Putzfrau ihre Arbeit verrichtete, kam der Professor nicht zur Ruhe. Er tigerte weiterhin auf und ab. Die Putzfrau nahm er gar nicht wahr. Ihm ging es nur darum, dass dieser schlimme Tag bald ein Ende nehmen möge. Er konnte sich auf nichts anderes mehr einlassen.
Es wurde 11 Uhr. Die Putzfrau war mit ihrer Arbeit im Grunde schon fertig, als sie den Professor fragte: »Herr Professor, ich könnte heute mal wieder Ihre Gewehre putzen. Das habe ich schon seit Monaten nicht mehr gemacht.« Der Professor hörte gar nicht richtig hin und murmelte nur: »Ja, ja, machen Sie das!«
Frau Gebert öffnete den Waffenschrank, in dem sich sieben Gewehre befanden, die der Professor für seine Jagdleidenschaft benötigte. Sie nahm Waffe für Waffe heraus und putzte sie sorgfältig. Als sie die siebte Waffe in den Händen hielt, um sie zu reinigen, hantierte sie ungeschickt am Abzug. Da dieses Gewehr aus unerfindlichen Gründen geladen war, löste sich mit lautem Knall ein Schuss.
Hätte der Professor seinen Schreibtisch nicht verschoben und – wie sonst üblich – an ihm gesessen, hätte die Kugel ihn getroffen!
Die fromme Berta, die unbedingt den lieben Gott sehen wollte
Die alte Berta lebte ganz allein in einem kleinen Holzhäuschen in der herrlichen Schweizer Bergwelt, direkt am Fuße eines majestätischen Gipfels. Gemessen an ihrem hohen Alter – sie hatte die neunzig längst überschritten – war sie noch recht rüstig. Sie war von einer Frömmigkeit, die in der heutigen Zeit nur noch äußerst selten vorkommt. Es dürften wohl nur wenige Tage vergangen sein, an denen sie sich nicht aufgemacht hätte, um am Gottesdienst in der Dorfkirche teilzunehmen. Jeden Abend las sie mindestens eine halbe Stunde in der Heiligen Schrift.
Eines Morgens suchte sie nach der Heiligen Messe den Pfarrer in der Sakristei auf. »Hochwürden, es ist so weit«, sprach sie. »Jetzt will der liebe Gott mich endlich bei sich haben. Ich bitte Sie, mir das Sakrament der Letzten Ölung zu spenden.« Der Pfarrer war etwas verdutzt, zumal die alte Berta noch einen recht gesunden und agilen Eindruck vermittelte. »Aber liebe Berta! Das hat doch noch ein wenig Zeit. Sie sind doch noch recht gut beieinander«, wollte er sie vertrösten. Schon recht bald merkte er aber, dass es der guten Frau ernst mit ihrer Bitte war. So kamen die beiden überein, das Ritual noch am gleichen Abend in ihrem Häuschen durchzuführen.
Nachdem der Pfarrer ihr das Sakrament gespendet hatte, sprach sie: »Ich freue mich schon so sehr darauf, endlich den lieben Gott sehen zu können.« Der Pfarrer lächelte und meinte: »Ich glaube, der kann sie jetzt noch gar nicht brauchen. Sie werden sehen, sie überleben uns noch alle.«
Am nächsten Morgen wunderte sich der Pfarrer, dass die alte Berta nicht zur Morgenmesse erschienen war. Die fromme Berta war wenige Stunden, nachdem sie die Letzte Ölung empfangen hatte, sanft und friedlich entschlafen.
Als sie durch die Pforte des Todes schritt, war sie zunächst ein wenig verwirrt. »Wo bin ich denn hier?«, dachte sie. »Ach ja, ich bin ja gestorben. – So sieht also der Himmel aus! Irgendwie habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Aber egal, Hauptsache ich kann endlich bald den lieben Gott sehen.«
Kaum hatte sie den Gedanken zu Ende gedacht, erschien vor ihr ein Wesen, das noch viel heller leuchtete und strahlte als die Sonne. Berta war ganz geblendet von der Lichtesfülle, so dass sie geraume Zeit benötigte, um den Anblick dieses Wesens ertragen zu können. Sie warf sich dem Wesen zu Füßen und sprach mit zitternder Stimme: »Mein Herr und Gott! Endlich bin ich bei dir! Endlich kann ich dich sehen!« Das Wesen lächelte und sprach: »Mein liebes Kind! Ich bin nicht der, für den du mich hältst.« Berta schaute auf und sah, wie anmutig und schön sein Gesicht war. Sie konnte gar nicht glauben, dass es nicht der liebe Gott sein sollte. Eine noch schönere Gestalt schien ihr eigentlich nicht vorstellbar. Dann entdeckte sie zwei große goldene Flügel. »Ja bist du etwa ein Engel?«, stammelte sie. »Ja, ich bin dein Schutzengel«, entgegnete der Engel. »Ich weiß, dass es dich gibt. Ich habe immer an dich geglaubt«, sprach Berta. Der Schutzengel sprach weiter: »Solange es dich gibt, war ich immer bei dir. Und ich werde auch jetzt immer bei dir sein.« »Warum habe ich nur nie gemerkt, dass du immer bei mir warst?«, fragte die fromme Berta. »Ja weißt du, das ist nicht so einfach. Ihr Menschen könnt uns mit euren Augen nicht sehen. Aber ihr könntet unsere Anwesenheit und unser Wirken spüren, wenn ihr nur genügend aufmerksam wäret«, antwortete der Engel um sogleich fortzufahren: »Ich habe dir in deinem Leben so oft geholfen. Du hast es gar nicht wahrgenommen.« Berta überlegte und musste dem Engel Recht geben. Sie hatte sein Wirken in der Tat nie wahrgenommen. Der Engel sprach weiter: »Erinnerst du dich an den Frühling des Jahres 1936? Du wolltest unbedingt zu deiner Schwester nach Deutschland übersiedeln. Du warst fest entschlossen. Mir aber war bewusst, dass du dann ein paar Jahre später in den dortigen Kriegswirren viel zu früh ums Leben kommen würdest. Da musste ich eingreifen. Ich brachte dich mit der jungen Witwe im Dorf zusammen, die, um ihre Kinder durchbringen zu können, täglich beim Bauern arbeiten musste und kaum Zeit hatte, sich um ihre kleinen Kinder zu kümmern. Diese Aufgabe hast du ja dann für viele Jahre mit großer Begeisterung und Liebe übernommen. Gern gabst du dafür dein Vorhaben auf, nach Deutschland zu emigrieren. Oder du erinnerst dich doch sicher auch an die Adventszeit des Jahres 1988, als du plötzlich schwer krank wurdest. Lange Zeit warst du viel zu schwach, um das Haus verlassen zu können. Du hattest schließlich kaum noch Lebensmut und Hoffnung. Ich war es, der dir wieder Mut gab, aus dem die Kraft zur Genesung fließen konnte.« Berta war ganz still geworden. Nur zu gut erinnerte sie sich noch an diese Zeiten. Ihr Vertrauen und ihre Liebe zu dem Schutzengel wuchsen sehr schnell. Nur zu gern hätte sie ihm noch unzählige Fragen gestellt. Der Schutzengel merkte das natürlich und sprach: »Du musst dich gedulden. Wir haben jetzt sehr viel Zeit. Du musst noch so vieles lernen.« »Aber gestatte mir bitte noch eine Frage, lieber Engel!«, bat Berta. »Nur zu, mein liebes Kind!«, ermutigte sie der Engel, der natürlich längst wusste, was ihr auf dem Herzen lag. »Wann kann ich denn endlich den lieben Gott sehen?«, fragte sie ganz unbefangen. Der Engel antwortete mit einem mitleidigen Lächeln: »Da musst du noch unendlich viel Geduld haben. Nicht einmal wir Engel können ihn sehen.« Berta wurde etwas traurig. Aber dann fasste sie sich wieder. Schließlich war ihr Schutzengel ja fast noch schöner und weiser, als sie sich immer den lieben Gott vorgestellt hatte. Der Engel führte die fromme Berta durch die Himmelswelt und zeigte ihr vieles, was sie langsam auch zu verstehen lernte.
Nach einiger Zeit begegnete sie einem anderen Wesen, das noch größer, heller und strahlender als ihr Schutzengel war. Sie warf sich ihm vor die Füße und rief ganz erregt: »Mein Herr und Gott! Endlich bin ich bei dir! Endlich kann ich dich sehen!« Das Wesen entgegnete: »Stehe auf, mein liebes Kind! Ich bin nicht der, für den du mich hältst.« »Ja aber, wer bist du dann? Bist du etwa auch ein Engel?«, wollte sie wissen. »In gewisser Weise schon«, antwortete das Wesen. »Ich bin ein Engel der zweiten Stufe. Die Christen nennen