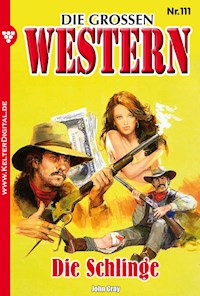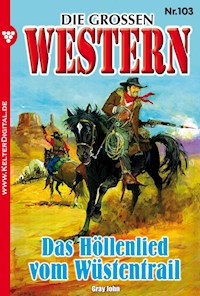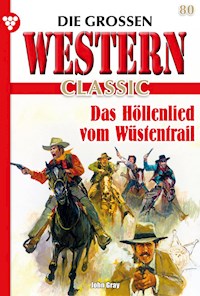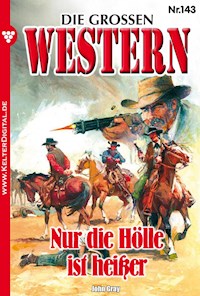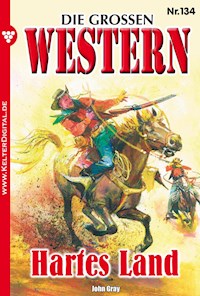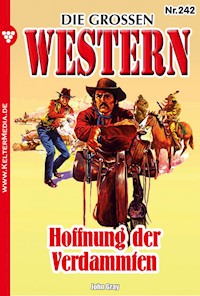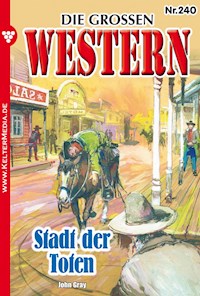Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western Classic
- Sprache: Deutsch
Nun gibt es eine exklusive Sonderausgabe – Die großen Western Classic Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Dieser Traditionstitel ist bis heute die "Heimat" erfolgreicher Westernautoren wie G.F. Barner, H.C. Nagel, U.H. Wilken, R.S. Stone und viele mehr. Der vierschrötige Mann mit dem kantigen Kopf und den stahlblauen Augen erhob sich von dem rohgezimmerten Tisch und trat an eines der kleinen Fenster des Raumes. Seine breitschultrige, stämmige Gestalt bewegte sich bedächtig und ruhig. Er legte seine schwieligen Fäuste auf die rissige Fensterbank und blickte durch die blinden Scheiben. »Dieser Wind draußen …«, murmelte er, ohne sich umzuwenden. Die verhärmte Frau mit dem Strickzeug nickte schweigend, und ein hochgewachsener, breitschultriger Mann mit langen, bis auf die Schultern fallenden blauschwarzen Haaren hob den Kopf. Seiner bronzefarbenen Haut verlieh der Schein der Petroleumlampe die Tönung von glänzendem Kupfer. Der Indianer blickte stumm auf den breiten Rücken des Mannes, und nur das junge Mädchen am Kamin sagte: »Die Pferde sind noch im Korral. Wenn das Wetter stärker wird, sollten wir sie in den Stall bringen, Vater.« Der Mann am Fenster nickte. Er öffnete, und ein Windstoß fuhr ihm entgegen. Sand wirbelte ihm ins Gesicht. Seine kräftigen Arme langten hinaus und schlossen die Läden. »Du wirst hierbleiben müssen, bis das Wetter vorbei ist«, sagte er zu dem Indianer, und der zuckte mit den Schultern. »Wir sollten lieber die Pferde in den Stall bringen«, sagte er dann in etwas hartem Englisch. Er schritt zur Tür, und der Mann nickte. »Gehen wir.« Als die schwere Bohlentür geöffnet wurde, drang das Heulen des Sturms in den Raum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western Classic – 58 –
Gesetzlos
...und auf dem Weg zum Galgen
John Gray
Der vierschrötige Mann mit dem kantigen Kopf und den stahlblauen Augen erhob sich von dem rohgezimmerten Tisch und trat an eines der kleinen Fenster des Raumes.
Seine breitschultrige, stämmige Gestalt bewegte sich bedächtig und ruhig. Er legte seine schwieligen Fäuste auf die rissige Fensterbank und blickte durch die blinden Scheiben.
»Dieser Wind draußen …«, murmelte er, ohne sich umzuwenden. Die verhärmte Frau mit dem Strickzeug nickte schweigend, und ein hochgewachsener, breitschultriger Mann mit langen, bis auf die Schultern fallenden blauschwarzen Haaren hob den Kopf. Seiner bronzefarbenen Haut verlieh der Schein der Petroleumlampe die Tönung von glänzendem Kupfer.
Der Indianer blickte stumm auf den breiten Rücken des Mannes, und nur das junge Mädchen am Kamin sagte: »Die Pferde sind noch im Korral. Wenn das Wetter stärker wird, sollten wir sie in den Stall bringen, Vater.«
Der Mann am Fenster nickte. Er öffnete, und ein Windstoß fuhr ihm entgegen. Sand wirbelte ihm ins Gesicht. Seine kräftigen Arme langten hinaus und schlossen die Läden.
»Du wirst hierbleiben müssen, bis das Wetter vorbei ist«, sagte er zu dem Indianer, und der zuckte mit den Schultern.
»Wir sollten lieber die Pferde in den Stall bringen«, sagte er dann in etwas hartem Englisch. Er schritt zur Tür, und der Mann nickte. »Gehen wir.«
Als die schwere Bohlentür geöffnet wurde, drang das Heulen des Sturms in den Raum. Die beiden Männer verließen das Haus und stemmten sich gegen den Wind, um zum Korral zu kommen.
Die Pferde hatten sich in einer Ecke zusammengedrängt und wieherten angstvoll.
Die Männer führten sie in den Stall. Als sie das große Tor hinter sich geschlossen hatten, jagte der Sturm Wolken feinkörnigen Sandes vor sich her auf den Red River zu, der etwa fünfzig Yards entfernt von der Station dahinfloss. Der heftige Wind peitschte die sonst träge dahinfließenden Wellen des mächtigen Stromes, sodass sie gurgelnd und klatschend an die Ufer schlugen. Weiße Schaumkronen tanzten auf dem sonst schlammig gelben Wasser.
»Hoffentlich fängt es nicht noch zu regnen an. Da überschwemmt er wieder«, sagte der Stationer.
Der Indianer nickte schweigend.
»Kommt noch eine Postkutsche?«, fragte er, während sie durch den Sturm zum Haus zurückeilten.
»Erst morgen Abend.«
Sie erreichten das Haus und schlossen die Fensterläden.
Dann betraten sie wieder den Raum und schlossen die Tür hinter sich, und das Heulen des Wetters drang nur noch gedämpft durch die dicken Bohlen herein.
»Kannst du Kaffee kochen, Martha?« Der Stationer trat an den Kamin und legte einige würzig nach Harz riechenden Kiefernkloben in die Glut. Er beobachtete, wie die Flammen sich in das Holz fraßen und wie Funken aufstoben, wenn knackend Harzknoten in der Glut zersprangen. Der Feuerschein fiel warm auf sein faltiges Gesicht. Seine Haut wirkte wie weichgegerbtes Leder. Die flackernden Flammen spiegelten sich in seinen glänzenden Augen und ließen sein schlohweißes Haar silbrig schimmern.
Als er seine Frau im Hintergrund des Raumes hantieren hörte, sagte er: »Ich muss noch Holz holen. Vielleicht können wir in den nächsten Stunden nicht vor die Tür.«
Er erhob sich und verließ das Haus, und der Himmel verdunkelte sich. In der Ferne rollte leise der Donner. Der Himmel wurde schwarz, als habe das Universum seinen Schlund geöffnet, um die Erde mit allem Leben darauf zu verschlingen.
Als er gerade mit den Holzkloben im Arm wieder die Station betrat, setzte das Unwetter in seiner ganzen elementaren Kraft und Wildheit ein.
*
Die vier Männer blickten mit starren Gesichtern zum Himmel und traten dann in den Schutz der Bäume zurück, als Wogen von Sand vom Sturm über die Ebenen gefegt wurden.
Ihre Pferde schnaubten unruhig, und ein kleiner, krummbeiniger Bursche klopfte seinem Tier beruhigend auf den Hals.
»Was nun, Shannon?« Der Mann, der die Frage gestellt hatte, war schlank und mittelgroß. Er hatte ein schmales blasses Gesicht und stechende Augen.
Der Angesprochene wandte sich um. Er war groß, breitschultrig und geschmeidig wie ein Wolf. An seiner Hüfte baumelte ein schwerer 44er Colt in der Halfter.
»Wir werden weiterreiten. Bevor der Sturm richtig einsetzt, werden wir die Station erreichen.«
»Das schaffen wir nicht, Buck. Verdammt, der Wind bläst uns von den Gäulen!«
»Dann bleibt doch hier. Ich reite und hole mir die Dollars.« Der große Mann musste schreien, da der Wind in diesem Moment durch das Dickicht heulte wie ein gefangenes Tier.
Er schritt zu seinem Pferd und nahm die Zügel. Er schwang sich in den Sattel und beugte sich weit vor. Seine Augen richteten sich hart auf die drei anderen.
»Wir haben nicht mit dem Sturm gerechnet. Aber umso besser. In diesem Wetter wird sich bestimmt niemand sehen lassen, der nicht erwünscht ist. Also kommt!«
Die drei Männer nickten und stiegen auf ihre Tiere. Sie schlangen sich die Halstücher vor die Gesichter, um sich gegen den aufwirbelnden Sand zu schützen, und schoben sich die Hüte fest in die Stirn.
Dann trieben sie die Pferde an und ritten hinaus in den Sand.
*
Die Läden an den Fenstern klapperten, und vom Dach löste sich eine Schindel. Krachend schleuderte der Wind sie auf den Hof.
Die Menschen zuckten zusammen. Dann erhob sich die Frau und legte ihr Strickzeug nieder.
»Ich schaue mal nach Johnny, Owen.«
Der Mann nickte kurz. Der Indianer schlürfte an seinem Kaffee und sagte: »Verdammte Sache, so ein Klapperschlangenbiss.«
»Er hat Glück gehabt.« Der Stationer stand auf und schritt zum Ofen.
Er füllte seine Tasse noch einmal. »Er hat sich sofort das Bein abgebunden, den Schenkel aufgeschnitten und den Biss ausbluten lassen. Nach dem Fieber ist die Sache schnell vergessen.«
Er trat wieder an den Tisch. »In diesem verdammten Land ist eben alles ein Feind.«
»Ich auch?« Der Indianer grinste leicht.
»Das ist vorbei.« Der Stationer blickte auf seine Tochter, die in einem Buch blätterte. Er maß forschend ihre glatten jungen Züge. Ihr kastanienbraunes Haar hatte im Schein der Petroleumlampe einen faszinierenden Glanz.
Wie hübsch sie ist, dachte der Mann. Sein Blick glitt ins Leere. Wenn sie einmal erwachsen ist, dachte er, wird das Land hier nicht mehr wild sein, dann wird sie besser leben können als wir.
Nachdenklich ließ er sich wieder auf seinen Stuhl fallen und stellte die Tasse auf die blankgescheuerte Tischplatte.
»Dieser Sturm draußen …«
Er schüttelte den kantigen weißhaarigen Kopf und summte leise vor sich hin.
Der Indianer richtete sich auf. In dem Moment klopfte es an die Tür.
Sie schauten sich betroffen an. Wer konnte jetzt während des Wetters unterwegs sein? Es blieb einen Moment still im Raum, und deutlich war das Heulen des Sturms zu hören.
»Draußen ist jemand!« Das Mädchen hatte die Worte gesprochen.
»Wer, zum Teufel, kann in diesem Wetter herkommen?«
Der Stationer stand auf und schritt zur Tür. Seine kräftigen, behaarten Hände hoben den Sperrbalken aus den Halterungen, und er öffnete.
Seine Blicke fielen auf die vier Männer, die ihn forschend anblickten. Ihre Gesichter waren rau und hart, ihre Augen klein und tückisch. Der Stationer spürte beinahe körperlich die Gefahr, die von diesen Männern ausging.
»Wir sind in den Sturm geraten. Können wir hier warten, bis er vorbei ist? Unsere Pferde haben wir schon in den Stall gebracht. Ich hoffe, das war richtig?«
Der Stationer blickte auf den Sprecher, einen großen, breitschultrigen Mann, dessen Augen kalt wie Eiskristalle glitzerten.
Der Mann hatte einen breiten, büffelledernen Revolvergurt über die schwere Jacke geschnallt.
Der Stationer nickte.
»Sicher, sicher, kommen Sie nur herein!«
Ihn erfasste eine unerklärliche Unsicherheit, als er die Männer an sich vorbei eintreten sah.
Ihre schweren Stiefel klangen hohl und dumpf auf den Holzdielen, hell klirrten die Sporen.
Sie sehen wie Cowboys aus, dachte der Stationer und schloss die Tür wieder. Wahrscheinlich stimmt es, was sie sagen.
»Wollen Sie einen Kaffee?«, fragte er und ging zum Ofen.
Die Männer blickten sich um, und der große Bursche sagte: »Wer ist noch in der Station?«
Die Frage kam zu plötzlich für den Mann, sodass er erst ihren Sinn begriff, als er sie beantwortet hatte. Doch dann war es zu spät, denn in den Fäusten der Männer blinkten plötzlich matt die langen, brünierten Läufe der schweren Revolver, und der Anführer trat dicht auf den Stationer zu.
»Luke, hol die Alte aus dem Schlafzimmer. Und ihr hier, ihr versucht keinen Unsinn! Wie heißt du, Alter?«
»Sinclair, Owen Sinclair.«
Der Stationer fühlte, wie sich seine Nackenhärchen sträubten. Seine Fäuste öffneten und schlossen sich, und auf seiner Stirn erschienen einige Schweißperlen. Er sah die grauen abgeflachten Geschosse in der Revolvertrommel seines Gegenübers schimmern.
»Um Himmels willen – bitte – tun Sie uns nichts. Wir – wir haben nichts, bitte …«
»Nichts passiert euch, solange ihr vernünftig seid!« Buck Shannon winkte mit dem Revolverlauf, als die verhärmte Frau von seinem Bruder in den Raum getrieben wurde.
»Hinten liegt der Junge!« Luke Shannon schloss die Tür zum Schlafzimmer. Sein junges Gesicht mit dem hellblonden Bartflaum auf der Oberlippe wirkte verschlossen. »Er ist bewusstlos, hat Fieber. Klapperschlangenbiss.«
Buck nickte. »Lanse, nimm ihnen die Waffen ab.«
Das junge Mädchen hatte sich erhoben. Ihr Gesicht war schreckensbleich, und in ihren jungen Augen flackerte die Angst.
»Was – was wollen Sie denn von uns, was – Vater …?«
Sie schluchzte auf, und ihre Stimme klang schrill und schnappte in der Erregung über.
»Bleib ruhig, Eve«, sagte Owen Sinclair. Ihm war, als lege sich ein ehernes Band um seine Brust und zöge sich immer mehr zusammen.
Der blassgesichtige Mann trat auf den Indianer zu und streckte die Hand aus.
»Komm, roter Bruder, deinen Revolver.«
Der Indianer blickte ihn mit starrem, ausdruckslosem Gesicht an und antwortete nicht.
Der Mann trat langsam näher und grinste tückisch. Seine schlanke Hand mit den langen knochigen Fingern griff nach dem abgewetzten Kolben des Colts, der sich wie ein Geierschnabel aus der fettglänzenden Halfter bog.
Seine Fingerspitzen berührten das kühle Holz des Kolben – dann traf ihn der Schlag.
Das Gesicht des Indianers war unbeweglich geblieben. Seine Faust schoss ohne Ansatz vor und grub sich in den Magen des hageren Mannes.
Der stöhnte auf, seine Augen verdrehten sich. Er beugte sich ächzend vor. Dann schleuderte ihn ein Fausthieb zu Boden.
Er stürzte schwer auf die ausgetretenen Dielen, und tropfenweise rann Blut aus seiner Nase. Auf dem Holz des Bodens bildeten sich einige dunkle Flecke. Schweigend stützte er sich auf. Seine Zähne hatten sich in die Unterlippe gegraben. Sein glattes Gesicht war vom Hass verzerrt.
Der Indianer stand leicht geduckt, und in seinen dunklen Augen glomm ein gefährliches, wildes Feuer.
»Leg die Waffe ab, Rothaut!«
Buck Shannon sprach es leise, fast sanft.
Der Indianer rührte sich nicht.
»Clint!« Das Wort klang scharf und befehlend wie ein Peitschenhieb aus dem schmallippigen Mund des Bandenführers.
Der krummbeinige, drahtige Mann, der bisher nicht gesprochen hatte, trat auf den Indianer zu. Sein Gesicht war kalt, und als sein Fuß hochstieß, geschah es ohne Vorwarnung.
Der Stiefel traf den Indianer.
Der Indianer bewegte sich schnell und geschmeidig. Seine Fäuste flogen vor, doch der kleine Mann tauchte unter ihnen weg und traf den Indianer am Kinn.
Der rote Mann stürzte zu Boden.
Als er sich schwer atmend, mit verzerrtem Gesicht, wieder aufrichtete, war seine Halfter leer.
*
Der Wind jagte über die Ebenen und strich durch die Straßen der kleinen Stadt, die sich Wardville nannte.
Er wirbelte den Staub der Gassen auf und schleuderte ihn auf die Vorbauten.
Im schwachen Licht einer Petroleumlampe, die an einem Vorbaupfosten hing und leicht hin und her schaukelte, blitzte ab und zu grell der fünfzackige Metallstern an der Jacke des hageren grauhaarigen Mannes auf, der außer dem schweren Colt an der Hüfte noch eine Winchester in der Rechten hielt.
Sein Blick war nach Norden gerichtet, doch die Dunkelheit war schon zu weit fortgeschritten, als dass er hätte weiter sehen können, als der Lichtschein der roten Laterne vor dem benachbarten Saloon reichte.
Er wandte sich schwerfällig um und schritt zu der Bank vor dem Postoffice, auf der fünf hartgesichtige Männer mit Gewehren über den Knien saßen.
»Sie müssten gleich kommen«, sagte der Sheriff, und sein dünnlippiger Mund presste sich energisch zusammen. »Verdammt, ich gäbe alles dafür, wenn der Tipp gut war und ich Buck Shannon erwische!«
»Ich wette zehn Dollar dagegen«, sagte ein vollbärtiger Mann und grinste breit. »Weißt du, Sheriff, ich wette, jemand will sich über dich lustig machen. Warum hast du den Mann denn nicht festgenommen, der den Tipp gegeben hat? Wo er doch sogar gesagt hat, Buck Shannons Bruder zu sein.«
»Es ist eine Chance, Jack.« In der Stimme des Sheriffs klang leichte Unsicherheit mit. »Es ist immerhin eine Chance, ihn zu stellen. Ich hätte sie mir verdorben, wenn ich Luke Shannon festgehalten hätte. Außerdem, wer ist schon Luke Shannon? Ein Junge von höchstens achtzehn Jahren. Er ist das unwichtigste Glied der Bande. Nein, ich brauche den Boss. Buck Shannon ist der Einzige, der garantiert, dass die Bande erledigt ist. Ohne ihn sind die anderen hilflos.«
Der Sheriff blickte in die Nacht hinaus und schob sich den breitkrempigen Hut fest in die Stirn. »Ich habe die Unterlagen über Shannons Bande noch einmal durchgesehen. Es ist gut möglich, dass der Junge tatsächlich Luke Shannon war. Luke ist nur ein Stiefbruder von Buck. Es gibt da auch noch eine üble Sache: Buck Shannon soll den richtigen Vater des Jungen erschossen haben, als der eines Nachts besoffen nach Hause kam und durch ein Fenster einstieg. Buck hat ihn angeblich für einen Einbrecher gehalten. Die Farm der Shannons wurde dann von der Eisenbahn geschluckt. Ihr wisst ja, wie das gemacht wird. Seitdem schleppt Buck den Jungen mit sich herum. Ich glaube, der Junge will einfach nicht mehr, er hat die Nase voll. Ich kann ihn verstehen.«
»Bates hat dich aber gar nicht verstanden«, sagte ein anderer. »Er war verdammt wütend, dass er das Geld erst zwei Tage später nach Austin schicken kann.«
»Wenn er Wert darauf legt, dass es geraubt wird, soll er es ruhig mitgeben.« Der Sheriff blickte wieder die Straße hinunter. Sein hartgeschnittenes Profil wurde vom Schein der Laterne konturenscharf angestrahlt.
»Die werden sich verdammt wundern, die Schurken, wenn statt der dreißigtausend Dollar ein Aufgebot in der Kutsche sitzt.«
Sheriff Blake trat in den Schatten des Vorbaus zurück, und seine Stiefelabsätze dröhnten dumpf auf den Dielen.
Es blieb einen Augenblick still. Dann klang durch den Sturm das helle Klappern von Pferdehufen.
Die Männer horchten auf. Das Geräusch kam näher, und schließlich tauchte am nördlichen Eingang des Ortes die Kutsche auf.
Die vier Gespannpferde stemmten sich hart gegen den Wind, die Kutsche schleuderte leicht, als sie zum Stehen kam.
Der Kutscher, ein riesiger Bursche mit mächtigen Schultern, erhob sich und zog das Halstuch vom Gesicht. Er spuckte aus und fluchte laut und vernehmlich.
Als die Gestalt des Sheriffs vor der Stage auftauchte, verstummte er.
»Was würden Sie sagen, wenn Sie diese Kutsche in die Hölle fahren müssten?«
Das Gesicht des Sheriffs war völlig ernst. Der Kutscher schwieg deshalb erstaunt und kratzte sich am Kopf.
»Ich – ich verstehe nicht ganz.«
»Irgendwo auf dieser Strecke, vermutlich in Sinclairs Station, wartet die Shannonbande, um aus dieser Kutsche dreißigtausend Dollar zu rauben. Sie wird aber kein Geld bekommen, sondern solides Blei. Wie ist es nun?«
Der Kutscher blieb stumm. Sein breitflächiges Gesicht zuckte leicht Dann spuckte er grimmig aus und nickte.
»In Ordnung! Ich wollte schon lange mal den Teufel am Schwanz ziehen.«
»Kommt!« Der Sheriff winkte. Er öffnete den Schlag. Die Kutsche war leer, wie immer bei einem Geldtransport. Die Männer stiegen ein und drängten sich auf die Plätze. Sie hörten draußen den Kutscher mit seiner rauen Stimme singen. Wenig später knallte die Peitsche hell und scharf. Das Geräusch brach sich an den hohen Häuserwänden und wurde vom Sturm verweht.
Die Räder der Kutsche quietschten leise auf den Achsen, und der Wagen schaukelte, als er sich in Bewegung setzte. Sie hörten das Schnauben der Pferde, und dumpf klang das Stampfen ihrer Hufe.
Die Fahrt wurde schneller. Die Lichter der Stadt flogen an ihnen vorbei. Bald hatten sie die weite Prärie um sich. Der Sturm schleuderte Wogen von Sand durch die offenen Fenster ins Innere des Wagens.
*
Der Indianer sagte kein Wort. In seinen dunklen Augen flackerte es leicht, als er sich stumm auf seinen Platz zurückgleiten ließ. Der kleine krummbeinige Mann wich grinsend zurück und warf den Revolver des Indianers in die Wasserschüssel auf der Kommode neben der Tür. Es schepperte blechern, und einige Spritzer trafen auf den starr stehenden Stationer. Der zuckte leicht zusammen.
»Wir sollten den roten Hund totschlagen, Buck!« Der kleine Mann wandte sich um. »Diese Schufte sind alle gleich. Er wird sich rächen wollen!«
»Er wird es nicht wagen. Nicht wahr, roter Bruder?« Buck Shannon lächelte schmal. »Und jetzt, Alter, setz dich! Solange ihr vernünftig seid, geht es euch gut.«