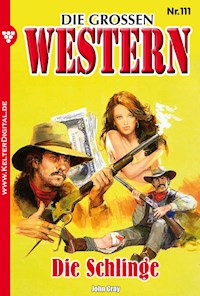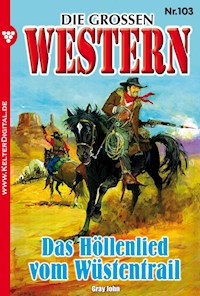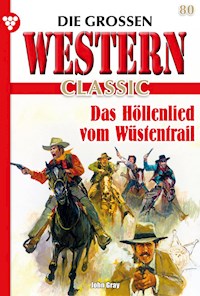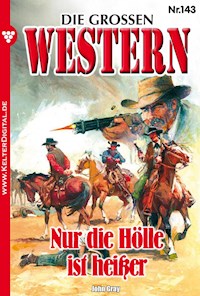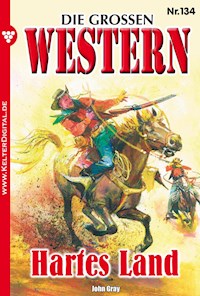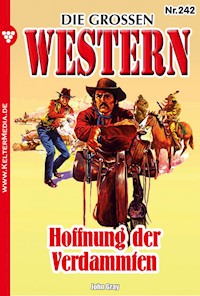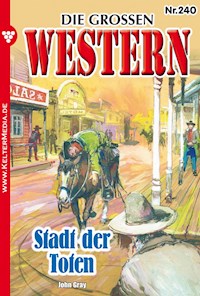Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Der Wind von Südwesten umfächelte ihn schon seit Stunden. Mit jeder Meile, die der Mann weiterritt, war es heißer geworden. Jetzt trug der Wind feinkörnigen Staub mit sich, der sich mit dem leichten Schweißfilm auf dem Gesicht des Reiters vereinigte und eine dünne Kruste bildete. Er hatte einen langen Ritt hinter sich, aber er wirkte nicht ein bißchen müde. Ohne das Land ringsum unbeobachtet zu lassen, waren seine Blicke meist auf den Boden gerichtet. Er folgte der Wagenspur seit zwei Tagen. Die Furchen, die die breiten, eisenbeschlagenen Räder auf dem harten Boden hinterlassen hatten, waren deutlicher als am Vortage. Er wußte, daß er aufgeholt hatte. Das Land um ihn her war karg und öde. Hier und da wucherten Kreosotsträucher, im Norden erstreckte sich ein dicht verfilzter Brasadagürtel, im Süden buckelten sich sandige Hügel. Es gab kein Wasser. Seit gestern hatte er sein Pferd nicht mehr getränkt. Er veränderte seine Haltung viele Stunden nicht. Als er den Kopf hob und zum Himmel schaute, war die Sonne weit nach Westen gerückt. Er warf einen langen Schatten, als er die nächsten Hügelkämme erreichte. Der Wind wehte noch immer, er brachte den scharfen Geruch eines niedergebrannten, kaum erloschenen Feuers mit sich. Don Banteen stieg ab. Er führte den braunen Morgan am Zügel hinter sich her. In einer Bodenfalte ließ er den Hengst stehen, zog den Spencer-Karabiner aus dem Scabbard am Sattel und ging allein weiter. Er war über mittlerer Größe, hatte breite Schultern und schmale Hüften.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 291 –
Straße der Toten
Sie sagen, dass sie Frieden mit den Indianern wollen – aber sie denken nur an ihr Gold
John Gray
Der Wind von Südwesten umfächelte ihn schon seit Stunden. Mit jeder Meile, die der Mann weiterritt, war es heißer geworden. Jetzt trug der Wind feinkörnigen Staub mit sich, der sich mit dem leichten Schweißfilm auf dem Gesicht des Reiters vereinigte und eine dünne Kruste bildete.
Er hatte einen langen Ritt hinter sich, aber er wirkte nicht ein bißchen müde. Ohne das Land ringsum unbeobachtet zu lassen, waren seine Blicke meist auf den Boden gerichtet.
Er folgte der Wagenspur seit zwei Tagen. Die Furchen, die die breiten, eisenbeschlagenen Räder auf dem harten Boden hinterlassen hatten, waren deutlicher als am Vortage. Er wußte, daß er aufgeholt hatte.
Das Land um ihn her war karg und öde. Hier und da wucherten Kreosotsträucher, im Norden erstreckte sich ein dicht verfilzter Brasadagürtel, im Süden buckelten sich sandige Hügel. Es gab kein Wasser. Seit gestern hatte er sein Pferd nicht mehr getränkt.
Er veränderte seine Haltung viele Stunden nicht. Als er den Kopf hob und zum Himmel schaute, war die Sonne weit nach Westen gerückt.
Er warf einen langen Schatten, als er die nächsten Hügelkämme erreichte. Der Wind wehte noch immer, er brachte den scharfen Geruch eines niedergebrannten, kaum erloschenen Feuers mit sich.
Don Banteen stieg ab. Er führte den braunen Morgan am Zügel hinter sich her. In einer Bodenfalte ließ er den Hengst stehen, zog den Spencer-Karabiner aus dem Scabbard am Sattel und ging allein weiter.
Er war über mittlerer Größe, hatte breite Schultern und schmale Hüften. Seine Bewegungen waren geschmeidig. Er trug ein ausgeblichenes Kattunhemd, abgewetzte Körperhosen und fast kniehohe Mokassins. Um seine Hüften wand sich ein breiter Gürtel, an dem rechts ein Halfter mit einem langläufigen Army-Colt Kaliber 44 und links eine Schneide mit einem großen Bowiemesser hingen.
Banteen ging gut zweihundert Yards zu Fuß, bis er den Wagen, dem er so lange gefolgt war, in einer Senke sehen konnte. Er stand neben einer Feuerstelle, in der die Scheite noch ein wenig glommen. Es war ein großer Studebaker-Schoner ohne Plane, der von einem Vierergespann gezogen wurde.
Banteen zählte neun Männer, zwei Mexikaner und sieben Indianer. Er konnte nicht eindeutig bestimmen, welchem Stamm sie angehörten, dafür war er zu weit entfernt, und es war nicht mehr hell genug. Aber er hatte den Eindruck, daß sie verschiedener Herkunft waren. Es überraschte ihn nicht.
Einer der Mexikaner saß auf dem Bock des Wagens. Er hatte einen wagenradgroßen Sombrero auf dem Kopf. Der andere stand vorn neben dem Gespann, zusammen mit einem hochgewachsenen, schlanken Indianer. Der Indianer trug ausgebeulte Kalikohosen und eine hüftkurze Leinenweste. Das Haar hatte er zu zwei Zöpfen geflochten, die unter einem Tuch hervorquollen, das er wie einen flachen Turban um den Kopf gewunden hatte.
Hinter dem Wagen waren die übrigen sechs Indianer damit beschäftigt, flache, längliche Kisten und kleine Fässer abzuladen. Ein Dutzend Maultiere mit primitiven Packsätteln standen bereit, die Last aufzunehmen.
Banteen beobachtete, daß der Indianer mit den Zöpfen dem Mexikaner vor ihm mehrere kleine Leinenbeutel gab, als der Wagen entladen war. Der Mexikaner steckte die Beutel weg und stieg sofort auf den Bock. Der Indianer mit den Zöpfen rief den anderen offenbar einige Anweisungen zu. Sie schwangen sich auf ihre Pferde und ritten westwärts auf die Wüste zu, ohne sich noch einmal umzuwenden.
Der Wagen setzte sich in Bewegung. Er fuhr einen leichten Bogen. Das rechte Hinterrad rollte durch die Feuerstelle und zermalmte die letzte, schwach glimmende Glut.
*
Der Mexikaner mit dem Sombrero hatte eine dünne schwarze Zigarre im Mund und rauchte. Der andere redete und lachte.
Der Wagen rollte an dem Weidengehölz vorbei. Banteen hob den Spencer-Karabiner ein wenig an. Die Männer hatten ihn nicht gesehen, die Schatten waren zu dicht. »Buenas noches, ihr beiden«, sagte er.
Dem Mann mit dem Sombrero fiel die Zigarre aus dem Mund. Er zerrte an den Zügeln. Der Wagen blieb stehen. Der andere hob langsam die Hände. Er grinste unsicher.
»Sie haben uns erschreckt, Señor.«
»Ich bedauere das zutiefst«, sagte Banteen. »Behalt die Hände oben, Freundchen.«
»Was wollen Sie von uns, Señor? Wir sind zwei arme Peonen, von uns ist nichts zu holen.«
Der Mann mit dem Sombrero sagte kein Wort.
»Ich bin ein Wohltäter«, sagte Banteen. »Ich hab sofort gesehen, was ihr für arme Schweine seid. Ich dachte mir, ich lasse mein Herz sprechen und verschaffe euch eine warme Unterkunft mit einem weichen Strohsack und regelmäßigen, kräftigen Mahlzeiten.«
»Sie machen sich über uns lustig, Señor.« Der andere lachte. »Warum sollten Sie so etwas tun? Und wo wollen Sie uns das geben?«
»In Fort Chadbourne«, sagte Don Banteen.
»Fort Chadbourne?«
»Genug geredet«, sagte Banteen. »Wir haben einen langen Weg vor uns. Werft eure Waffen hinten in den Wagen.«
»Wir haben gar keine Waffen, Señor. Das alles muß eine entsetzliche Verwechslung sein.«
Der schweigsame Mann mit dem Sombrero bückte sich plötzlich nach seiner Zigarre. Als sein Oberkörper sich wieder aufrichtete, hielt er eine schmale Stiefelpistole in der rechten Faust.
Banteen hörte das Krachen des Schusses und blickte direkt in den Mündungsblitz, als er abdrückte. Die Kugel des Mexikaners zupfte an seinem Hemdkragen. Der Mexikaner wurde von dem Schuß aus dem Spencer-Karabiner getroffen. Der Aufprall des Geschosses riß ihn hoch und schleuderte ihn rücklings über die Bocklehne in den Wagenkasten. Der große Sombrero rollte bis zum Heck des Wagens.
»Aber – Señor…« Der andere Mexikaner war aufgesprungen. Er reckte die Arme so hoch, als wolle er damit den Himmel stützen.
Banteen drängte den Morgan dicht an den Wagen heran und stieg vom Sattel auf den Bock. Er stand jetzt keine zwei Schritt von dem anderen entfernt und konnte dessen Angst geradezu riechen. Der Mexikaner zitterte am ganzen Körper. Er starrte auf den Spencer-Karabiner. Die Mündung zeigte auf seine Brust. »Bleib genauso stehen«, sagte Banteen. »Rühr dich nicht!«
Er kletterte über die Bocklehne in den Wagenkasten. Er bückte sich und fuhr mit dem Zeigefinger der Linken über die rauhen Wagenbohlen. Als er sich aufrichtete, blickte er den Mexikaner wieder an und zielte weiter mit dem Gewehr auf ihn.
»Waffenfett«, sagte er. »Pulverkrümel. Hast du etwa auch eine Pistole im Stiefel, du armer Peon?«
»Nein, Señor, bestimmt nicht!«
»Dafür hast du eine Menge Gold in den Taschen, wie?«
»Sie kriegen alles, Señor. Schießen Sie nicht! Lassen Sie mich laufen!«
»Für wen waren die Waffen und das Pulver, Mann?«
»Für eine Indianerbande. Lassen Sie mich laufen, Señor!«
»Für Niowa, nicht wahr?«
»Ich kenne keinen Niowa, Señor.«
»Die Armee ist sehr nervös«, sagte Banteen. »Vielleicht hängen sie dich in Fort Chadbourne auf, wenn dir bis dahin keine besseren Antworten einfallen. Ich bin sogar ziemlich sicher, daß sie das tun. Waffenhandel mit Indianern ist ein Verbrechen. Leg die Beutel auf den Bock, die du für die Ladung gekriegt hast!«
Der Mexikaner gehorchte. Er hantierte mit der linken Hand. Die Rechte ließ er oben.
Er legte drei Leinenbeutel auf die Bank des Bockes. Seine Hand zitterte dabei.
»Mir kann niemand etwas tun, Señor«, sagte er. »Ich handle immer nur im Auftrag.«
»Ich auch«, sagte Banteen. »Ist das nicht schön? Wir alle tun immer nur das, was man uns sagt. Ich arbeite im Auftrag von General James Henry Dexter, und der arbeitet nur im Auftrag, genau wie du, genau wie dein Freund. Aber der ist tot. Ich wäre an deiner Stelle nicht so sicher, daß dir nicht das gleiche passiert.«
Er trat von hinten an ihn heran, beugte sich über die Bocklehne und tastete ihn ab. Außer einem Messer trug der Mexikaner keine Waffe.
»Setz dich und nimm die Zügel.« Banteen kletterte wieder über die Bocklehne und blieb neben dem Mexikaner stehen. Er hob mit der Linken die Beutel an und wog sie in der Hand.
»Wie oft habt ihr schon geliefert? Wieviel war es diesmal genau?«
»Das dritte Mal, Señor«, sagte der Mexikaner. »Es sind jedesmal hundert Gewehre und hundert Pfund Pulver, dazu fünftausend Papierpatronen.«
»Was für Gewehre?«
»Sharps, die Modelle aus dem Krieg. Ausgemusterte Armeewaffen, aber tadellos in Ordnung.«
»Davon bin ich überzeugt.«
Banteen schwang sich vom Bock zurück in den Sattel und verstaute die Beutel in den Satteltaschen.
»Fahr los«, sagte er. »Der Weg ist weit, und ich bin müde. Aber bilde dir nicht ein, daß du eine Chance hast, abzuhauen. Ich will dich lebend nach Fort Chadbourne bringen, aber ich kann auch zwei Tote hinschaffen.«
»Jawohl, Señor. Schießen Sie bitte nicht, Señor.«
Der Mexikaner bückte sich nach den Zügeln. Als der Wagen anrollte, hielt Banteen dicht neben dem Bock, während er den Wagen in Richtung Osten dirigierte. Ein fast voller Mond stand am Himmel, milchiges Licht lag über dem Land. Aus der Wüste im Westen klang noch immer das Heulen von Kojoten.
*
Die Bodendielen waren frisch gescheuert und glänzten, die Wände waren schneeweiß gekalkt. Die Kommandantur in Fort Chadbourne war der sauberste Raum im ganzen Fort.
General James Henry Dexter blickte Don Banteen entgegen. Er war kein sehr großer Mann und von eher zierlicher Statur, aber er strahlte die Energie von drei starken Männern aus, obwohl er hinter seinem wuchtigen Schreibtisch noch kleiner als sonst wirkte.
Er trug eine einfache blaue Felduniform. Auf den Schultern der Bluse waren die Generalssterne angebracht.
»Setzen Sie sich«, sagte er. »Sie sehen müde aus.«
»Ich bin längst nicht mehr wach«, sagte Banteen. »Ich tue nur so.«
Er setzte sich auf einen Stuhl neben dem Schreibtisch.
»Der Mexikaner, den Sie mitgebracht haben, hat uns einiges erzählt«, sagte General Dexter. »Die Waffen waren für Niowa.«
»Das war klar.«
»Niowa zahlt immer mit Gold.«
»Comancheros sind niemals billig«, sagte Banteen. »Ich habe einen geschnappt, aber das bedeutet nicht viel. Schon nächste Woche beliefert ihn ein anderer. Bald hat er genug Waffen, um eine Armee auszurüsten, eine Indianerarmee. Zumindest soviel wissen wir. Wahrscheinlich hat er auch die Krieger für die Waffen.«
Dexter richtete sich auf. Er trommelte nervös mit den Fingern der Linken auf die Schreibtischplatte, dann legte er die Hände auf dem Rücken zusammen und trat ans Fenster. »Ich frage mich, was das für ein Mann ist.«
»Die Indianer sagen, er sei ein Prophet.« Banteen lehnte sich zurück. »Es gibt nur wenige, die ihn gesehen haben. Vor einem Jahr ist er in einigen Dörfern aufgetaucht, bei Apachen, bei Kiowas, bei Comanchen. Danach ist er in den Staked Plains verschwunden. Seitdem wird mehr über ihn geredet, als daß er selbst redet.«
»Er redet nicht nur, er kauft Waffen.«
»Er predigt die Auferstehung des Großen Geistes, seine Ankunft auf Erden«, sagte Banteen. »Die Rückkehr der großen Büffelherden, den Zusammenschluß aller roten Stämme zu einem einzigen Volk, die Vertreibung der Weißen in einem großen, gemeinsamen Krieg. Er muß ein besonderer Mann sein, denn die Indianer glauben ihm. In den letzten Monaten sind viele Krieger zu ihm in die Wüste gezogen. Ich bin sicher, es gibt heute bereits einige tausend Krieger, die sich erheben würden, wenn er den Befehl dazu geben würde. Er sitzt im Llano, wo niemand an ihn rankommt, und jedem Krieger, der zu ihm stößt, kann er ein Gewehr in die Hand drücken. Da er auf einer Goldader zu hocken scheint, wird er sich nie den Kopf darüber zerbrechen müssen, wo er weitere Waffen herkriegt. Irgendwann wird er den Befehl geben, die Gewehre zu gebrauchen, dann wird dieses Land einiges erleben.«
»Nur weil ein verrückter Schwätzer Hirngespinste verkündigt?«
»Er ist alles andere als verrückt, General.« Banteen blickte versonnen zu Boden. »Jeder, dem Unrecht geschieht, träumt von Gerechtigkeit. Er wird jedem folgen, der ihm den Weg zur Gerechtigkeit zu zeigen verspricht.«
Dexter blickte Banteen seltsam an: »Ich will keinen Krieg hier. Ich glaube, daß die Zeit des Kämpfens vorbei ist. Die Indianer haben keine Chance mehr. Ein neuer Krieg bedeutet nur sinnloses Sterben. An den Verhältnissen ändert sich nichts.«
»Sie haben recht, Sir. Die Indianer haben keine Chance mehr«, sagte Banteen. »Auch mit Niowa nicht. Er ist gut fünfzig Jahre zu spät gekommen.«
»Glauben Sie, daß man mit ihm reden kann?«
»Ich weiß nicht.«
»Man muß es versuchen«, sagte Dexter. »Reden ist besser als Schießen.«
»An diese Regel hätte man sich früher halten sollen«, sagte Banteen. »Die meisten Indianer sind des Kämpfens müde, aber auch des Redens. Viele sind mittlerweile so weit, daß sie sich lieber totschlagen lassen, als ständig belogen zu werden. Das ist immerhin eine klare Entscheidung.«
»Sie kennen den Llano Estacado«, sagte Dexter. »Wissen Sie, wo Niowa stecken könnte?«
»Ich habe eine Vorstellung.«
»Ich kann Sie zu nichts zwingen«, sagte Dexter. »Aber ich bitte Sie, hinzureiten und zu versuchen, mit Niowa zu sprechen. Ich will mit ihm reden. Sagen Sie ihm das. Ich biete ihm Frieden, ich will mit ihm verhandeln. Er soll auch wissen, daß ich keine Angst vor ihm habe. Vielleicht hat er schon mehr Krieger um sich gesammelt, als ich Soldaten, aber er muß eines wissen: Wenn er tausend Krieger hat, werden von Norden fünftausend Soldaten gegen ihn marschieren. Wenn er fünftausend Krieger hat, werden zwanzigtausend Soldaten kommen, oder noch mehr. Auch wenn es ihm gelingen sollte, alle Indianerstämme des Landes zu vereinigen, er hätte keine Chance. Trotzdem: Mir liegt nichts daran, Indianer auszurotten.«
»Ich stimme Ihnen zu, Sir«, sagte Banteen. »Aber ich weiß nicht, ob ich lebend zu Niowa vordringe, geschweige denn, ob ich zurückkehren kann.«
»Reiten Sie?«
»Ich versuche es. Versprechen kann ich nichts.«
»Wenn es einer schafft, dann Sie.«
»Wenn ich nicht zurückkehre, sollten Sie schleunigst Verstärkung und ein paar Geschütze anfordern.«
»Ich befürchte, wenn Sie nicht zurückkehren, wird Washington anordnen, daß ich mit meinen Leuten in die Wüste marschieren und den Kampf von mir aus eröffnen muß.«
»Das wäre das Schlechteste, was Sie tun könnten.«
»Ich weiß.«
Banteen erhob sich. Er nahm die Hand, die der General ihm hinhielt.
Dexter war gut einen Kopf kleiner, viel schmaler, aber sein Händedruck war fest, und sein Gesicht strahlte Entschlossenheit aus.
»Angenommen, es klappt«, sagte Banteen. »Angenommen, ich schaffe es, Niowa zu finden, und er will mit Ihnen sprechen. Vielleicht lockt er Sie dann nur in eine Falle und entledigt sich damit des ranghöchsten Offiziers in dieser Gegend. Wenn er dann losschlägt, wird die Armee in den ersten zwei oder drei Wochen ziemlich kopflos reagieren, bis ein Nachfolger für Sie hier ist.«
»Vielleicht«, sagte Dexter. »Aber vielleicht lasse ich mich auch lieber totschlagen, als lebend sinnlose Kriege zu führen.«
Banteen blickte Dexter in die schmalen, staubgrauen Augen. Er fing an, den General zu bewundern, obwohl er für Männer in Uniform nie viel übrig gehabt hatte. »Ich denke fast, es könnte klappen«, sagte er langsam.
»Ich wußte, daß Sie mich unterstützen werden«, sagte Dexter. »Ein Mann, der meine Überzeugung nicht teilt, kann diese Sache nicht richtig vertreten. Sie können es.«
»Das ist es nicht allein, Sir. Ein Mann, wie Niowa, weiß genau, mit wem er spricht. Es hat zu viele Männer in schönen Uniformen gegeben, die mit den Indianern verhandelt und danach ihr Wort gebrochen haben. Ich, an seiner Stelle, würde Ihnen glauben.«
»Danke.« Dexter lächelte dünn. »Ich glaube nicht, daß Sie das zu jedem sagen würden.«
»Sie sind der erste.« Banteen nickte Dexter zu. »Ich reite noch heute.«
Banteen ging hinaus. Er bewegte sich mit müden Schritten über den sandigen Platz vor der Kommandantur. Er ging an dem Fahnenmast vorbei, an dem das Sternenbanner aufgezogen war, hinüber zu den Ställen.
Fort Chadbourne bestand aus einem Dutzend Lehmziegelhütten. Es lag auf einem Hügel oberhalb einer Furt des Oak Creek. Von Nordosten nach Südwesten vorbei führte ein breiter Overlandtrail, für den Fort Chadbourne eine gewisse Schutzfunktion ausübte.
Seit drei Wochen waren Soldaten damit beschäftigt, eine Palisade zu bauen. Die Südfront war bereits fertig, der erste Geschützturm befand sich im Bau.
»Hallo«, sagte jemand.
Banteen hob den Kopf.
Der Mann sagte: »Wenn ich dich so ansehe… So, wie dich, habe ich mir als kleiner Junge einen Wüstenfloh vorgestellt, vielleicht ein bißchen kleiner.«
Er war mittelgroß. Sein Gesicht war so rund wie sein Bauch. Alles an dem Mann wirkte rund. Er hatte einen zerbeulten Kavalleriehut auf dem Kopf. Die gelben Hosenträger über der blauen Uniformbluse sahen ausgeleiert aus. Das Gesicht war ein wenig rosig, die Nase war knollig und schimmerte rot, die Augen waren klein und lebhaft.
»Tag, Sergeant«, sagte Banteen.
»Du siehst aus, als wärst du tagelang begraben gewesen.« Er grinste. Er hieß Bill Brumbauch, Sergeant der Kavallerie. Als Ordonnanz von General Dexter führte er ein feines Leben. Banteen mochte ihn. Brumbauch war kein verbiesterter Kommißschädel, er hatte Verstand. Er war überhaupt in Ordnung.
Als Banteen gerade zwei Tage in Fort Chadbourne war, war er Zeuge gewesen, wie Brumbauch einen jungen schwarzen Infanteristen vor einem wildgewordenen Korporal in Schutz genommen hatte. Brumbauch war ein Mann, der Respekt verdiente. Vielleicht noch mehr, als General Dexter, obwohl der Frieden mit den Indianern wollte, was für einen General der US-Army geradezu ein Wunder war.
»Ich hätte mal wieder Lust auf ein Spielchen«, sagte Brumbauch.
»Ich auch«, sagte Banteen. »Weiß Gott, ich auch.«
»Du mußt wieder los, wie?«
»Ja.«
»Der Alte ist ziemlich aufgeregt, seit du mit dem Mex zurück bist.«
»Er hat Grund.«
»Das glaube ich auch.« Brumbauch nickte versonnen. »Er weiß immer, was er tut.«
»Wie lange bist du bei ihm?«
»Vier Jahre. Ich war schon im Krieg bei ihm. Er gehörte zur Tennessee-Armee, war erst im Stab von General Grant, dann bei Sherman. Ich bin mit ihm quer durch Georgia marschiert. Um ein Haar wären wir in Andersonville gelandet. Der Alte war dann Adjutant von Kilpatrick. Es gab zu viele Generäle, sag ich dir. Man konnte sie kaum noch auseinanderhalten. Aber wenn es einen gab, der seine Sterne verdient hat, dann war es Dexter. Ein guter Mann, der Alte.«
Brumbauch wirkte mit einemmal ernst.
»Das glaube ich auch«, sagte Banteen.
»Er hetzt seine Leute nicht so herum«, sagte Brumbauch. »Wenn er dich so, wie du aussiehst, wieder losjagt, ist es sehr ernst.«
»Es ist sehr ernst«, sagte Banteen. »Wenn ich nicht mehr zurückkehre, kannst du für mich beten, Brumbauch. Du betest doch?«
»Ab und zu.«
»Das ist gut. Du kannst auch auf Vorrat für mich beten. Vielleicht hilft es. Man sollte nie etwas unversucht lassen.«
»Es ist wegen Niowa, wie?«
»Ja.«