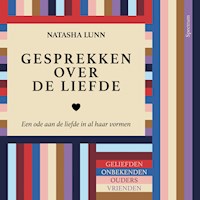11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Natasha Lunn hat zwei Jahre lang Menschen zu ihren Beziehungen und ihrer Liebe befragt und dabei herausgefunden, dass sich alle Fragen, die wir haben, auf drei große zurückführen lassen: Wie finden wir die Liebe? Wie können wir sie festhalten? Wie überleben wir, wenn wir sie verloren haben? Dieses Buch versammelt wunderschöne Geschichten über die Liebe und praktische Ratschläge von Experten. So kommen etwa Philippa Perry, Hilary Mantel und Alain de Botton zu Wort. Es gibt Hoffnung - die Liebe zu finden, sie aufrechtzuerhalten, über sie hinwegzukommen. Und es inspiriert, die Liebe zu Partnern, Freunden und Kindern ernst zu nehmen und sich selbst und seine Wünsche immer wieder zu hinterfragen. Denn es geht nicht nur darum, was wir in der Liebe wollen, sondern auch darum, wer wir selbst sein wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gespräche über die Liebe
Die Autorin
NATASHA LUNN ist Journalistin und leitet die Kulturredaktion des RED Magazines in London. Ihr E-Mail-Newsletter Conversations on Love, in dem sie Autoren, Berühmtheiten und Expertinnen über Liebe befragt, ist ein Überraschungserfolg geworden.
Das Buch
»Gespräche über die Liebe ist eine Seltenheit: aufrichtig und schonungslos ehrlich, tröstlich und geerdet, gefühlvoll und zugleich pragmatisch.«Dolly Alderton, AutorinDie Liebe – wir haben einerseits unglaublich hohe Erwartungen an sie, anderseits wissen wir erstaunlich wenig darüber. Als wollten wir unbedingt ins Meer springen, weigerten uns jedoch, vorher schwimmen zu lernen. Natasha Lunn hat Schriftstellerinnen, Therapeuten und andere Expertinnen zu ihren Erfahrungen mit der Liebe befragt, hat jahrelang Geschichten für ihren Newsletter Conversations on Love gesammelt und teilt ihre Erkenntnisse nun in diesem Buch.
Natasha Lunn
Gespräche über die Liebe
Wie wir sie finden, an ihr wachsen und sie nicht verlieren
Aus dem Englischen von Katja Hald
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage September 2021© Natasha Lunn, 2021© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Conversations of Love bei Viking, einem Imprint von Penguin Random House, LondonAutorinnenfoto: privatE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.ISBN 978-3-8437-2463-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Einführung
Wie finden wir die Liebe?
Romantische Fantasien und die Realität
Die unerträgliche Bürde der Ungewissheit
Nach draußen schauen
Wie bewahren wir die Liebe?
Flitterwochen
Zeiten der Freundschaft
Den anderen immer wieder neu sehen
Wie bewältigen wir den Verlust der Liebe?
Wenn sich die erträumte Zukunft in Luft auflöst
Vertrauensvorschuss
Zum Schluss
Was ich über die Liebe gerne früher gewusst hätte
Anhang
Danksagung
Literaturempfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Einführung
Widmung
Für alle, die sich in Sehnsucht verlieren
Motto
»Geschichten, die uns bis tief in die Nacht wach halten, sind Geschichten über die Liebe. Scheinbar können wir über dieses Rätsel des Lebens nie genug erfahren. Wieder und wieder lesen wir dieselben Szenen, dieselben Worte, versuchen, die Bedeutung aus ihnen herauszuschälen. Nichts ist uns vertrauter als die Liebe. Nichts entzieht sich uns so vollständig.«1
Jeanette Winterson, The Powerbook
Einführung
Jahrelang habe ich mich ständig nach irgendetwas gesehnt. Nach einer Antwort auf eine Textnachricht, nach einem »Ich liebe dich« oder nach einem Mann, der mich auf diese ganz besondere Art ansieht. Hatte ich eine Beziehung, hoffte ich sehnsüchtig, sie würde halten, hatte ich keine, sehnte ich mich nach einer. Diese Sehnsucht äußerte sich in einer anhaltenden Ruhelosigkeit, die sich wie Nebel auf mein gesamtes Leben legte und verhinderte, dass ich die Dinge klar sehen konnte.
Ich dachte, es wäre Liebe, wonach ich mich sehnte, aber da täuschte ich mich. Wovon ich so besessen war, war eine Idee von Liebe, nicht die wahre Liebe selbst. In den vielen Jahren, in denen ich mich Tag und Nacht fragte: »Wann werde ich sie endlich finden?«, habe ich nicht ein einziges Mal innegehalten, um darüber nachzudenken, was genau die Liebe eigentlich ist. Wer macht das schon? In der Schule lernen wir nichts über sie, wir stellen keine Recherchen dazu an, werden nicht darin geprüft und wiederholen auch nicht einmal im Jahr, was wir darüber wissen. Wir werden angehalten, uns mit Wirtschaftslehre, Grammatik oder Geografie auseinanderzusetzen, aber nicht mit der Liebe. Dass wir einerseits so große Erwartungen an sie haben, andererseits aber so wenig Zeit darauf verwenden, sie zu verstehen, ist befremdlich, als wollten wir unbedingt ins Meer springen, weigerten uns jedoch, schwimmen zu lernen.
Und doch bleibt kein Leben von der Liebe unberührt, ob wir uns nun darüber Gedanken machen oder nicht. Sie durchdringt alles, Tag für Tag, ungehindert, grausam und wunderschön. Ich sehe mir ein Video vom sechs Wochen alten Baby eines befreundeten Paares an, wie es fröhlich in der Badewanne planscht, und nur eine Stunde später lese ich die bedrückende E-Mail einer Frau, die gerade erfahren hat, dass auch ihr dritter Versuch einer künstlichen Befruchtung fehlgeschlagen ist. Meine Gedanken wandern von zwei frisch verlobten Paaren zu einem anderen Paar, das seine Verlobung eben erst gelöst hat, und dann zu einem vierten, das nie so weit gekommen ist, sich zu verloben. Ich höre mir die Probleme einer Freundin an, die sich nach einer unerwarteten Scheidung ein neues Leben aufbauen muss, trauere mit einer anderen um einen verlorenen Elternteil und freue mich am Kichern einer dritten, die sich an eine frische Liebe herantastet. Die Liebe erblüht und vergeht in unserem Leben, ein unaufhaltsames, unerklärliches Auf und Ab. Zumindest dachte ich das.
Lange Zeit war ich davon ausgegangen, die Liebe sei schuld an meinem Unglück, und ich wollte verstehen, warum ich in Liebensdingen so unfähig war. Warum konnte ich einen Job, in dem ich nicht glücklich war, einfach kündigen, aber an einer unglücklichen Beziehung festhalten? Warum war ich in jedem anderen Bereich meines Lebens handlungsfähig, ging es aber um die Liebe, war ich plötzlich wie gelähmt? Warum dachte ich, die Ehe sei das Ende und nicht der Anfang der Liebe? In mir keimte der Verdacht, dass ich die Liebe bisher gründlich missverstanden hatte. Das war für mich, was Elizabeth Gilbert einmal die »Brotkrume der Neugier« nannte: eine winzige Spur, die ich aufnehmen und der ich nachgehen wollte.
Aus diesem Grund habe ich in meinem E-Mail-Newsletter Conversations on Love vier Jahre lang Schriftsteller, Therapeutinnen und andere Experten zu ihren Erfahrungen mit Liebe befragt, habe Menschen zugehört, die von ihrer Liebe zu einem anderen Menschen erzählten, ihrer Liebe zu einer Stadt, zu einem Gedicht oder einem Baum. Ich habe einen Mann interviewt, der sich wünschte, er hätte mit mehr Menschen geschlafen, und eine Frau, die sagte, Sex sei das Unterbewusstsein einer Ehe. Ich habe den Geschichten von Menschen gelauscht, die sich jahrzehntelang über viele Grenzen hinweg ihre Freundschaft bewahrten, von Menschen, die sich verliebten, als sie ein Kind verloren oder um einen Angehörigen trauerten, Menschen, die die Geburt eines Babys in einem Kriegsgebiet erlebten, und Geschichten von Menschen, die gelernt haben, Liebe im Alleinsein zu finden. Jede dieser Geschichten war für mich eine Erinnerung daran, dass Liebe möglich und mein Begriff von ihr nur begrenzt ist.
Denn während ich all diese Gespräche führte, ging die Liebe auch in meinem Leben ein und aus, und die Interviews erweiterten meine Perspektive, was Liebe sein und wie sie aussehen konnte. Als ich jedoch nach einer Fehlgeburt verzweifelt versuchte, wieder schwanger zu werden, begriff ich, wie viel ich noch lernen musste. Obwohl ich dachte, in der Zwischenzeit reifer geworden zu sein und meine jugendlichen Sehnsüchte hinter mir gelassen zu haben, gab es viele Parallelen zwischen meinem Kinderwunsch mit dreißig und der Sehnsucht nach einem Partner in den zehn Jahren davor. In beiden Fällen war ich stärker auf die Liebe konzentriert, die ich nicht hatte, als auf die, die ich hatte. Und das machte mich anfällig für Selbstmitleid. Ich verglich mich mit anderen und verspürte dabei, dass es eine Art von Glück gab, von dem ich ausgeschlossen war. Nachdem ich jahrelang sehnsüchtig den Paaren hinterhergesehen hatte, die sonntags Hand in Hand spazieren gingen, sah ich nun den Frauen hinterher, die einen Kinderwagen durch den Stadtpark schoben. Der Gegenstand meiner Sehnsucht war ein anderer, aber die Ruhe- und Rastlosigkeit waren dieselben. Damals begriff ich, dass es, solange ich die Liebe auf diese begrenzte Weise definierte, immer etwas geben würde, wonach ich mich sehne – einen Partner, eine Ehe, ein Baby, ein zweites Baby, ein Enkelkind, noch viele Jahre auf dieser Erde mit meiner Mutter, meinem Vater oder meinem Mann. Also stellte ich weitere Fragen und begann, dieses Buch zu schreiben.
Möglicherweise beschäftigt das Thema Liebe auch Sie täglich. Vielleicht wünschen Sie sich eine Beziehung oder überlegen insgeheim, Ihre zu beenden. Vielleicht leben Sie schon sehr lange in einer Partnerschaft und fragen sich, wie Sie Ihre Liebe durch die vielen Stürme des Lebens retten können. Vielleicht sind Sie Mutter oder Vater und wollen eine bessere Mutter oder ein besserer Vater sein. Oder Sie haben einen Elternteil verloren, und dieser Verlust stellt plötzlich alles andere in den Schatten. Oberflächlich betrachtet ist das, was wir uns von der Liebe erhoffen, bei jedem Menschen etwas anderes. Aber ich habe festgestellt, dass unsere individuellen Probleme häufig auf drei ganz grundsätzlichen Fragen basieren: Wie finden wir die Liebe? Wie bewahren wir sie? Und wie verarbeiten wir ihren Verlust? Diesen drei Fragen möchte ich in diesem Buch unter anderem nachgehen.
Ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, dass die Gespräche, die ich über die Liebe geführt habe, mein Leben verändert haben. Sie haben mir geholfen, den Nebel der Sehnsucht zu verscheuchen und zu erkennen, wie viel Liebe ich bereits in meinem Leben erfahren habe. Durch sie bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass wir versuchen müssen, die Liebe, auch wenn sie in vielerlei Hinsicht unergründlich ist, zu definieren. Wie bell hooks in ihrem Buch Alles über Liebe schreibt: »Wenn wir in jungem Alter fehlerhafte Definitionen des Begriffs Liebe lernen, fällt es uns im späteren Leben schwer zu lieben«, und »eine gute Definition markiert unseren Ausgangspunkt und zeigt uns, wo wir am Ende sein wollen«.2
Darüber hinaus glaube ich, dass wir lernen müssen zu lieben, so wie wir auch andere Fähigkeiten erlernen, denn diese Kunst kann für den Verlauf unseres Lebens durchaus entscheidend sein. In einer Studie, wie sich soziale Kontakte auf die Lebenserwartung auswirken, fand Dr. Julianne Holt-Lunstad heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, frühzeitig zu sterben, bei Menschen mit starken sozialen Bindungen um fünfzig Prozent niedriger ist als bei Menschen mit schwachen sozialen Bindungen.3 Obwohl dem Thema Liebe nur wenig Aufmerksamkeit zuteilwird – man vergleiche den Umfang der Rubriken einer Zeitung, die sich Politik, Wirtschaft und Reisen widmen, mit der für Beziehungsthemen –, gibt es kaum etwas, das ernster und wichtiger wäre. Ein Mangel an Liebe kann seelisch und körperlich krank machen, während viel Liebe heilen kann.
In den Gesprächen in diesem Buch geht es zwar nicht nur um Liebesgeschichten und den Stellenwert sowie die Facetten der Liebe, sondern auch darum, was Menschen zueinander hinzieht und wie sie sich enttäuschen, was sie verletzt und was sie heilt. Es wird geschildert, wie sie es schaffen weiterzumachen, auch wenn sie glauben, dazu nicht in der Lage zu sein. Es wird gezeigt, wie sie den Verlusten, die sie in ihrem Leben erfahren haben, einen Sinn abzuringen versuchen. Ich hoffe, dass diese Geschichten für Sie dieselbe Bedeutung haben werden wie für mich: als eine mahnende Erinnerung, nicht zuzulassen, dass die Menschen, die wir lieben, in den Hintergrund gedrängt werden. Mögen diese Geschichten Sie einladen, die Liebe ernster zu nehmen, und eine Ermutigung für Sie sein, dem Leben, das uns geschenkt wurde, eine Bedeutung zu verleihen.
Ein Protagonist aus Hilary Mantels Roman Brüder sagte einmal: »Die Liebe ist stärker, beständiger als die Angst.« In einem Interview, das ich mit der Autorin einmal führte, erklärte sie mir: »Einer der Gründe zu schreiben, ist, herauszufinden, ob das der Wahrheit entspricht.« Genau das möchte ich auch tun. Ist die Liebe stärker als die Angst vor der Unsicherheit oder vor der Veränderung? Kann sie helfen, die Angst vor dem Tod zu überwinden? Die Beantwortung dieser Fragen scheint ein endloses Unterfangen zu sein. Dabei habe ich die wichtigste Lektion über die Liebe gelernt: dass sie eine Lebensaufgabe ist, eine Geschichte, die nie zu Ende sein wird. Ist es nicht ein großes Glück, das zu wissen? Zu wissen, dass es niemals einen letzten Satz geben wird, aber immer wieder einen neuen Anfang? Das hier ist einer davon.
Wie finden wir die Liebe?
»Das Leben ist kein Problem, das gelöst werden muss, es ist ein Rätsel, das gelebt werden will.«4M. Scott PeckRomantische Fantasien und die Realität
»Wenn ich dich begehre, fehlt ein Teil von mir …«
5
Anne Carson,
Eros the Bittersweet
Ben war der erste Junge, den ich küsste. Ich war vierzehn und in allem unsicher, was ich tat. Ich wusste nicht, welche Musik mir gefiel, welche Schuhmarke ich tragen sollte, was für ein Mensch ich sein wollte. Absolut sicher war ich mir nur darüber, dass ich ihn wollte. Zu einer Zeit, in der mir die ganze Welt offenstand und ich mich leicht für die falschen Dinge entscheiden konnte, war dieses Gefühl, das ich nicht kontrollieren konnte, irgendwie entlastend – als hätte sich das Gefühl entschieden , nicht ich.
Kennengelernt hatte ich ihn ein Jahr zuvor, bevor wir uns im Kino zum ersten Mal küssten. Ich war dreizehn und er zwölf, sechs Monate jünger als ich. Er kam zu uns nach Hause, um sich mit meinem jüngeren Bruder zu treffen. Die beiden gingen auf dieselbe Schule. Als ich ihn sah, stand er direkt vor meinem Fenster oben auf der Treppe vor dem Haus und ließ ein zitronengelbes Jojo auf und ab hüpfen. »Hi«, sagte er. »Hallo«, antwortete ich. Und das war’s. Zwei Wörter genügten, um eine Schwärmerei in Gang zu setzen, die fünfzehn Jahre anhalten sollte. Nach und nach sammelte ich immer mehr Details über ihn, wie forensisches Material zum Beweis seiner Existenz: die exakte Stelle eines Leberflecks auf seinem Arm, die Art und Weise, wie er sich Butter auf seinen Toast schmierte oder beim Lächeln jedes Mal die Augen zusammenkniff. Ich sehnte mich danach, von ihm genauso wahrgenommen zu werden. Ich lernte, dass Liebe etwas ist, das uns widerfährt – oder auch nicht. Ein Geschenk, das uns gegeben oder vorenthalten wird.
Unsere amourösen Episoden über die Jahre waren kurz und unbeständig. Zum ersten Mal hat er mich mit vierzehn hintergangen. Mit sechzehn kamen wir dann wieder zusammen – das einzige Mal, das wir nervös »Ich liebe dich« zueinander sagten – und dann noch einmal mit achtzehn. In diesen Phasen verbrachten wir nicht wirklich viel Zeit miteinander, nur vereinzelt ein paar Tage und Nächte, in denen wir knutschten, alte Star-Wars-Videos schauten oder nachts über leere Landstraßen fuhren. Dass wir nie eine richtige Beziehung hatten, war für mich unbedeutend. Unsere Beziehung lebte von der Unklarheit, von all den Dingen zwischen uns, die wir niemals aussprechen würden.
Die langen und aufregenden Kapitel unserer Liebesgeschichte schrieb nicht die Realität, sondern mein Kopf. In meiner Fantasie erlebten wir eine Tun-sie’s-oder-tun-sie’s-nicht-Romanze nach dem Vorbild von Dawson und Joey in Dawson’s Creek. Wir waren immer kurz davor, dass es passiert, und dann passierte es doch nicht, weil es zu Missverständnissen (eine falsch verstandene Textnachricht) oder schicksalhaften Zwischenfällen (das Missfallen meiner Eltern, ein anderes Mädchen) kam, die unsere Annäherungsversuche ständig durchkreuzten. Warum habe ich nicht einfach Schluss mit ihm gemacht? Als er in der Schule ein anderes Mädchen küsste, war das eine erste Erfahrung von Zurückweisung, die mein Selbstwertgefühl in einem kritischen Alter prägte. Von diesem Moment an war seine Zuneigung für mich wie ein Pokal, den ich mir zurückholen konnte und der mich als liebenswert auszeichnete. Ein anderer Grund, weshalb ich Ben nicht loslassen konnte, war der Wunsch, die Beziehung meiner Eltern zu »kopieren«. Sie hatten sich mit fünfzehn in der Schule kennengelernt, und ihre Beziehung, die mir romantischer erschien als jeder Roman in meinem Regal, war mein frühestes Vorbild für Liebe. Ich hatte Ben auf ein Podest gehoben, aber der Traum von einer immerwährenden Teenagerliebe stand auf einem noch viel höheren Podest.
Viele von uns kennen diese jugendliche Verliebtheit, bei der die Sehnsucht eine größere Rolle spielt als die Gewissheit und die Fantasie die Realität übertrumpft. Oft wird sie mit einer wunderbaren Intensität ausgelebt, die bei hormongesteuerten Teenagern, die viel freie Zeit haben, verständlich ist. Vielleicht ist diese Fixierung sogar eine Form von Kreativität – ein Beispiel für die enorme Vorstellungskraft junger Menschen, die aus den spärlichen Details einer gewöhnlichen Verbindung eine andere Welt erschaffen können. Daher bereue ich meine romantischen Fantasien von damals nicht. Was ich allerdings bereue, ist die Schablone für Liebe, die ich daraus gebastelt habe, und all die Jahre, in denen ich versucht habe, mich so zu verbiegen, dass ich in diese Schablone hineinpasste.
Während unserer Studentenzeit tauschten Ben und ich weiterhin unregelmäßige Zuneigungsbekundungen aus. Er schickte mir selbst aufgenommene CDs mit kryptischen Botschaften, die ich in Schuhkartons unter dem Bett aufbewahrte, und schrieb wehmütige E-Mails, die meinen damaligen Freund ziemlich wütend machten, als er sie entdeckte. Soweit ich mich erinnere, war es das erste Mal, dass er mich mehr wollte als ich ihn, auch wenn das aus seiner Sicht anders gewesen sein mag. Es gibt immer zwei Versionen einer Geschichte. Trotzdem schlief ich, wenn ich Heimweh hatte, in Bens verwaschenem schwarzen H&M-T-Shirt. Er war zu einer Erinnerung an zu Hause geworden, die Verbindung zu einer früheren vertrauten Version meiner selbst, zu der ich immer dann zurückkehrte, wenn mich die Gegenwart verunsicherte.
Die Ironie dabei war, dass ich nur deshalb unsicher war, weil ich die wenig hilfreichen Lehren, die ich aus meiner Schwärmerei als Teenager gezogen hatte, mit in meine Beziehungen als Zwanzigjährige nahm. Das Schema war fast immer das gleiche: Ich lernte jemanden kennen, idealisierte ihn, verbarg Teile von mir und spielte die Rolle einer Frau, die unkomplizierter war, als ich zu sein glaubte. Diese Frau hatte nie irgendwelche Ansprüche. Oft ging ich monatelang – manchmal über ein Jahr – mit jemandem aus, ohne dass er mein »Freund« oder ich seine »Freundin« wurde oder sich echte Nähe zwischen uns entwickelte. Genauso wie Ben sprachen diese Männer nie aus, was sie für mich empfanden, auch wenn sie ihre Gefühle andeuteten. Es war wie in Sinn und Sinnlichkeit, als Marianne auf Eleanors Frage, ob Willoughby ihr je seine Liebe gestanden hätte, antwortet: »Es wurde nie offen ausgesprochen, aber jeden Tag angedeutet. Manchmal dachte ich, es wäre geschehen – aber so war es nicht.«
Wenn wir in einer Beziehung nicht ehrlich sind – sei es zu unserem Partner oder zu uns selbst –, ist das vergleichbar mit dem Versuch, einen Deckel auf ein Marmeladenglas zu schrauben, dessen Gewinde nicht sauber in den Rillen sitzt. Von außen betrachtet scheint der Deckel zu passen, aber wenn wir drehen, spüren wir diesen leichten Widerstand, der uns signalisiert, dass er doch nicht richtig sitzt. In diesem Moment wissen wir, wir können schrauben, solange wir wollen, der Deckel wird das Glas nie richtig verschließen. So war es auch mit meinen Beziehungen damals. Im Grunde spürte ich von Anfang an, dass etwas nicht richtig passte. Mit diesem Wissen im Hinterkopf zu versuchen, echte Intimität aufzubauen, war beängstigend. Ich fürchtete ständig, meine Partner wollten nicht mit mir zusammen sein, traute mich aber nicht, es anzusprechen. Ich wurde sehr gut darin, so zu tun, als ob ich nichts brauchte. Am Ende vergaß ich jedoch, wie es war, ein Mensch mit eigenen Bedürfnissen und Wünschen zu sein. Und das bedeutete auch, dass ich Unzuverlässigkeit fälschlicherweise als anziehend empfand. Die Brocken an Zuneigung, die diese Männer mir hinwarfen, waren aber nur deshalb aufregend, weil sie unverbindlich waren: eine unerwartete Textnachricht um halb zwei Uhr morgens »Bist du noch unterwegs? X« oder ein betrunkenes »Ich liebe dich«, das in nüchternem Zustand nie wiederholt wurde. Keiner der Männer, mit denen ich damals zusammen war, hat mit mir Schluss gemacht, aber es hat sich auch keiner wirklich auf eine Beziehung eingelassen. Sie hatten immer einem Fuß in der Tür, wie der Freund einer Freundin, der in ihre Wohnung eingezogen war, aber so gut wie alles, was er besaß, im Haus seiner Eltern gelassen hatte.
Sehr viel zuverlässiger als Zuneigung bekam ich in diesen Beziehungen hingegen eine unbedachte – vielleicht auch unbeabsichtigte – Grausamkeit zu spüren, die ich stets stillschweigend hinnahm und in der ich nur einen weiteren Beweis dafür sah, dass ich es nicht wert war, geliebt zu werden. Ein Mann sagte mir beispielsweise, meine Lippen wären immer so trocken, als er mich im Bett küsste, ein anderer, ich trüge zu viel Make-up, und ein dritter erklärte mir, nichts mache eine Frau unattraktiver als Unsicherheit, nachdem ich gerade meinen Mut zusammengenommen hatte, um ihn zu fragen, warum er sich so lange Zeit gelassen hatte, auf meine Textnachricht zu antworten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich an keinem Ort der Welt einsamer fühlt als nachts im Bett neben einem Menschen, Rücken an Rücken liegend und dabei hoffend, dass er sich umdreht und die Arme um einen legt. Diese unerfüllte Sehnsucht vermittelte mir das Gefühl, klein zu sein.
Damals hielt ich dieses Unterdrücken des Selbst für Scham und ein lästiges persönliches Problem. Heute weiß ich, dass es vielen so geht. Ich habe mit unzähligen Menschen gesprochen, die sich selbst in ihren Beziehungen verloren haben – obwohl sie in ihrem Beruf, ihrer Familie und in ihren Freundschaften sehr selbstbewusst sind. Sie haben ihre Persönlichkeit den vermeintlichen Wünschen und Bedürfnissen des Partners oder der Partnerin entsprechend in eine andere Form gepresst und dabei die eigenen Wünsche und Bedürfnisse völlig aus dem Blick verloren. Dieses Schrumpfen des Selbst beginnt mit ganz kleinen Dingen: Wir behaupten, im Kino einen Horrorfilm sehen zu wollen; stellen auf Spotify eine Playlist zusammen, die den anderen beeindrucken soll, anstatt die Songs auszuwählen, die wir selbst gerne hören. Wir kaufen ein Kleid, das wir uns nicht leisten können, weil wir denken, dass es dem anderen gefällt. Und irgendwann ist es dann so weit, dass wir eine Verabredung mit Freunden ausschlagen, weil wir uns den Abend lieber freihalten, nur für den Fall, dass der andere uns spontan sehen will. Wir tun, als wäre es keine große Sache, wenn der andere sich an unserem Geburtstag erst abends um elf Uhr blicken lässt, oder sagen, wir bräuchten keinen Beziehungsstatus oder regelmäßigen Austausch oder hin und wieder eine kleine Aufmerksamkeit, die uns das Gefühl gibt, geliebt zu werden. Wir tun, als brauchten wir überhaupt nichts.
Als ich die Psychiaterin Dr. Megan Poe fragte, warum Menschen in Beziehungen oft ihr Ichbewusstsein verlieren, sagte sie, das liege daran, dass sie versuchten, den anderen zu »orten« und mit ihm zu verschmelzen, ohne sich jedoch selbst zu zeigen. Laut Dr. Poe, die früher Seminare zum Thema Liebe an der New York University gab, glauben viele, indem sie sich dem anderen anpassen, würden sie automatisch ein Paar. Dabei macht sie das nur unsicher, weil sie nicht sie selbst sind, und das wiederum verunsichert den anderen, weil er den Partner nicht wiedererkennt. »Wenn zu viel falsche Persönlichkeit mit ins Spiel kommt, kann alles ziemlich undurchsichtig werden«, sagte Dr. Poe, »und der andere fragt sich dann zwangsläufig: ›Wo ist sie oder er hingekommen? Ich erkenne den Menschen, in den ich mich verliebt habe, nicht wieder‹.«
In einer Rede 1977 vor Absolventen des Douglass College sagte Adrienne Rich, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen bedeute, darauf zu bestehen, dass jene, denen wir unsere Freundschaft und Liebe schenken, in der Lage sind, unser Denken zu respektieren. Wie Charlotte Brontës Jane Erye sollten wir von uns sagen können: »Ich trage einen inneren Schatz in mir, der mich am Leben erhalten wird, auch wenn mir alle äußeren Freuden versagt bleiben oder nur zu einem Preis geboten werden, den zu zahlen ich mir nicht leisten kann.«6 Als ich den exakten Wortlaut von Richs Zitat in Jane Eyre nachschlug, bin ich auch auf den Satz davor gestoßen: »Ich kann durchaus allein leben, wenn Selbstachtung und Umstände es erfordern.« Als ich beide Sätze zusammen las, wurde mir klar, dass ich das genaue Gegenteil von Jane Eyre war. Ich hatte meinen »inneren Schatz« (und damit die Möglichkeit, einfach wegzugehen) aus den Augen verloren und dadurch meine Selbstachtung aufgegeben. Und wofür? Nicht für die Liebe, sondern für ein Bauchgefühl, weil ich glaubte, die Männer, mit denen ich zusammen war, wären außergewöhnliche Menschen, sehr viel klüger und interessanter als ich. (Es war kein Zufall, dass ich häufig mit Journalisten, Werbern oder Autoren ausging – alles Berufe, die ich gerne selbst ausgeübt hätte, damals aber noch nicht mutig genug war, es zu tun.) Erst Jahre später, während eines Interviews mit dem Psychologen Dr. Frank Tallis, begriff ich, wie irreführend dieses Bauchgefühl sein kann. Denn, so Tallis, wenn wir keinen Beweis für echte Nähe haben, neigen wir dazu, die eigene Unsicherheit oder ein mangelndes Verständnis zu beschönigen. Wir behelfen uns mit Wörtern wie »Bauchgefühl« oder »Chemie«, weil wir nichts Greifbares haben, auf das wir eine bestimmte Emotion zurückführen können – keine konkreten Beispiele für Wohlwollen, Fürsorge oder Verbundenheit, nur eine unbestimmte Anziehungskraft. Dieser Mangel an Beweisen wird laut Tallis zu einem »Brandbeschleuniger für romantische Verklärung. Wir denken, ich kann es nicht erklären, also muss es Schicksal sein, etwas Tiefergehendes. Aber damit zieht eine falsche Schlussfolgerung die nächste nach sich, und mit jeder neuen Fehlinterpretation entfernen wir uns weiter von der Realität«7. Ich erkannte mich in seinen Ausführungen sofort wieder und zuckte innerlich zusammen bei der Erinnerung an die vielen Male, als ich mich auf unerklärliche Weise zu jemandem hingezogen fühlte, ohne wirklich zu wissen, wer dieser Mensch war. Nur hatte ich das damals noch nicht begriffen und radierte weiterhin Teile von mir einfach aus, um an Beziehungen festhalten zu können, die mit der realen Welt wenig zu tun hatten.
Ben und ich hielten auch in jenen Jahren, in denen wir beide wechselnde Beziehungen hatten, weiterhin Kontakt. Unsere Eltern waren – und sind es noch – eng befreundet, weshalb wir schon als Kinder oft gemeinsam in die Ferien fuhren. Und auch zu jener Zeit fuhren wir für einen Besuch bei unseren Eltern in Dörfer, die nur fünf Minuten voneinander entfernt lagen. Bei diesen Gelegenheiten flirteten wir miteinander, knutschten ein bisschen oder telefonierten die ganze Nacht. Manchmal, so denke ich, rief er mich an, weil er sich verloren fühlte. Wir waren in erster Linie Freunde, die füreinander da waren, wenn einer die Aufmerksamkeit des anderen brauchte. Mit Ende zwanzig kamen wir dann für ein kurzes Intermezzo, das allerdings nur ein oder zwei Monate dauerte, doch noch einmal zusammen. Wir waren wie zwei Erwachsene, die taten, als wären sie wieder dreizehn, und das stimmte mich irgendwie traurig. Im Bett verglich ich unsere gealterten Körper mit denen unserer Teenagerjahre – seinen weicheren, runderen Bauch und meine dickeren von Zellulitis gezeichneten Oberschenkel –, ohne recht zu wissen, ob ich nach dem Menschen suchte, den ich einst kannte, oder nach dem, den ich nie wirklich gekannt habe. Ich denke, wir haben damals beide im jeweils anderen nach Antworten auf unsere Probleme mit Nähe und dem Erwachsensein gesucht – an einem Ort, an dem wir diese Antworten niemals finden würden.
Ein Jahr später verabredeten wir uns auf einen Drink, der unser letzter zu zweit sein sollte. Als wir danach aus der Bar in Soho in die milde Nachtluft auf den Gehsteig traten, spürte ich, dass ich eine Entscheidung treffen musste, die mit der Person, die vor mir stand, im Grunde nichts zu tun hatte. Ich musste mich zwischen Unreife und Erwachsensein entscheiden, zwischen Fantasie und Realität. Wollte ich echter Nähe weiterhin aus dem Weg gehen und mich hinter der Sicherheit einer verklärten Schwärmerei verschanzen, die mir keine Veränderungen abverlangte? Nein. Ich wollte eine echte Beziehung in der Realität. Das würde sehr viel Mut und Selbstanalyse erfordern, vielleicht müsste ich ein bisschen Einsamkeit ertragen und definitiv mehr Verantwortung übernehmen. Und dazu gehörte auch, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich mich einsam fühlte, Bens Aufmerksamkeit suchen konnte. Ich musste mir klarmachen, dass ich Männer idealisierte, anstatt sie so zu sehen, wie sie waren. Und ich musste meinen »inneren Schatz« wiederfinden, der mir abhandengekommen war. Das bedeutete, wie bell hooks in Alles über Liebe schreibt, »mehr über die Bedeutung der Liebe jenseits aller Fantasien zu erfahren – jenseits dessen, was wir uns vorstellen«8. Damals hielt ich es für riskant, sich einem Menschen, den man gerade erst kennengelernt hatte, vollständig zu zeigen, aber tief in mir machte sich bereits eine neue Erkenntnis breit, nämlich die, dass das Risiko, es nicht zu tun – nie richtig wahrgenommen zu werden, nie seine Bedürfnisse zu äußern, nie echte Liebe zu geben und zu bekommen – sehr viel größer war. Nach all den Jahren, in denen ich in der Liebe passiv war, begriff ich endlich, dass wir immer eine Wahl haben, auch wenn das manchmal schwer zu erkennen ist. Und ich hatte die Wahl, ob ich weiter in meiner Fantasiewelt leben oder aus ihr heraustreten wollte, um authentisch – echt – zu leben.
Wenn wir darüber nachdenken, wer oder wie wir in früheren Beziehungen waren, löst das oft gemischte Gefühle aus: irgendwas zwischen traurig und amüsiert, gekränkt und frustriert. Mittlerweile kann ich mit meinen Freunden über die eher peinlichen Episoden lachen – eines der wenigen guten Dinge an verunglückten Dates –, und anstatt mich zu schämen, habe ich heute eher Mitleid mit meinem jüngeren Selbst, das so verzweifelt die große Liebe finden wollte und immer an den falschen Orten suchte.
Ein Teil von mir bedauert die vielen Jahre, die ich mit der Sorge, ich könnte »versagen« und die Liebe nie finden, vergeudet habe. Und gleichzeitig bin ich entsetzt, wie ich von einer Fantasie so besessen sein konnte, dass ich die wahre Liebe fast verpasst hätte, weil ich sie nicht sah, obwohl ich sie – als ich den Mann kennenlernte, den ich eines Tages heiraten würde – direkt vor der Nase hatte. Aber ich weiß auch, dass meine früheren »Fehlschläge« mich letzten Endes an den Punkt gebracht haben, an dem ich heute stehe. Wie Hilary Mantel in unserem Interview sagte: »Manche Fehler sind kreative Irrtümer, die wir machen müssen.« Sie hatte recht, denn in all den unbeholfenen Fehlern und Jahren der Sehnsucht habe ich einen Ansatz für die erste Frage in diesem Buch gefunden: Wie finden wir die Liebe?
Bevor wir versuchen, diese Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, noch etwas präziser zu werden. Denn wie sollen wir ergründen, wie wir die Liebe finden, ohne zu wissen, was dieses Wort überhaupt bedeutet? Mit dieser Frage beschäftigen sich die nachfolgenden Gespräche. Inwiefern kann unsere Definition von Liebe beeinflussen, wie und wo und ob wir sie finden? Welche Klischees können uns dabei helfen, und welche sollten wir ablegen? Und haben wir bei unserer Suche nach der Liebe mehr Kontrolle über das, was geschieht, als wir glauben, oder eher weniger? Die Antworten darauf beinhalten weder verlässliche Strategien für Dating-Apps noch gesicherte Erkenntnisse darüber, wo wir statistisch gesehen die besten Chancen haben, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Aber ich wünsche mir, dass sie eine Einladung sind, den Begriff der Liebe weiter zu fassen und Beispiele für sie zu finden, die wir bisher vielleicht übersehen haben.
Als ich zwischen zwanzig und dreißig auf der Suche nach der Liebe war, schien die Gruppe all jener, die sich eine Paarbeziehung wünschten, in zwei Typen unterteilt zu sein: jene, die sich sehr schnell auf neue Beziehungen einließen und in den Zeiten dazwischen mit ihrem – wenn auch nur kurzen – Singledasein zufrieden waren, und jene, denen es unmöglich war, sich zu verlieben, die alleine unglücklich waren und trotzdem immer wieder in den Startlöchern einer Beziehung stecken blieben. Ich zählte zu letzterem Typ, und als eine Kollegin die wenig hilfreiche Bemerkung machte: »Wenn man lange Zeit Single ist, obwohl man das nicht will, gibt es meistens einen Grund dafür«, war für mich klar, dass es auch bei mir einen Grund geben musste, warum ich alleine war. Wirkte ich zu bedürftig oder zu fordernd? Der Gedanke, dass ein Teil des Problems vielleicht nicht bei mir lag – daran, wer ich war und wie ich war –, sondern mit dem Kontext zu tun hatte, in dem ich meine Suche nach Liebe betrachtete, kam mir nicht.
Erst als ich anfing, unterschiedliche Menschen zum Thema Beziehungen zu befragen, fiel mir auf, wie viele andere in genau dieselbe Falle tappten wie ich, weil sie zu sehr auf ihre romantischen Vorstellungen von Liebe fixiert waren. Einige führten ihre Besessenheit in puncto romantischer Liebe auf die alten Märchen unserer Populärkultur zurück, und zweifellos spielten diese Geschichten auch bei mir eine nicht unerhebliche Rolle. Aber da waren auch noch die schädlichen Geschichten vom Alleinsein, die in meine Vorstellung von Liebe gesickert waren. Warum glaubte ich, es wäre eine Tragödie, allein zu sein? Und welche Auswirkungen hatte die Angst vor dem Alleinsein auf meine Suche nach der Liebe? Antworten auf diese Fragen erhoffte ich mir von dem Philosophen und School-of-Life-Gründer Alain de Botton.
De Botton war einer der Ersten, die ich zum Thema Liebe befragte, weil er auch einer der Ersten war, die mich dazu ermutigt hatten, mich mit dessen Komplexität auseinanderzusetzen. Aus seinem Roman Versuch über die Liebe habe ich viel über Verliebtheit gelernt – über Fantasien und Fehlstarts, über Obsessionen und die Geschichten, die wir ineinander hineinprojizieren. Später dann erfuhr ich aus seinem Buch Der Lauf der Liebe, vor welche Herausforderungen uns Intimität stellt, wenn der anfängliche Glanz der Begierde längst verblasst ist. Kaum jemand schreibt mit solch akribischer Sorgfalt und so viel Pragmatismus über die Liebe wie Alain de Botton. Er bringt präzise auf den Punkt, weshalb die Suche nach Liebe für manche von uns eine so schmerzhafte Erfahrung ist.
Die Psychologie des Alleinseins. Ein Gespräch mit Alain de Botton
Natasha Lunn: Viele von uns begehen den Fehler zu glauben, eine romantische Liebesbeziehung wäre die Antwort auf all ihre Probleme. Inwiefern wird die Partnersuche dadurch schwieriger?
Alain de Botton: Eine solche Fehleinschätzung suggeriert, dass es eine Tragödie und unser Leben im Wesentlichen vergeudet wäre, wenn wir keinen Partner finden. Dadurch wird unsere Suche nach Liebe verzweifelt, was wenig hilfreich ist. Die beste Geisteshaltung für die Partnersuche – eigentlich für alles, was wir uns wünschen – ist die Fähigkeit, etwas einfach sein zu lassen, wenn es nicht das Richtige ist. Ansonsten liefern wir uns der Barmherzigkeit des Schicksals oder Menschen aus, die unsere Verzweiflung ausnutzen. Sagen zu können: »Ich kann auch alleine leben«, ist daher paradoxerweise einer der Garanten dafür, eines Tages eine glückliche Paarbeziehung zu führen.Die Psychologie des Alleinseins ist ziemlich interessant, weil wir es, je nachdem, welche Geschichte wir uns dazu erzählen, als beschämend empfinden oder nicht. Wenn wir beispielsweise an einem Montagabend alleine sind, fühlen wir uns deshalb nicht besonders schlecht. Wir sagen uns: »Ich habe einen harten Arbeitstag hinter mir und noch eine lange Woche vor mir, da habe ich gerne ein wenig Zeit für mich.« Sind wir jedoch an einem Samstagabend alleine, könnten wir denken: »Was stimmt nicht mit mir? Alle gehen aus und verbringen einen wundervollen Abend mit anderen Menschen, nur ich hocke zu Hause.«Wir haben vom Leben anderer oft nur eine oberflächliche Vorstellung, die unsere Verzweiflung darüber, allein zu sein, noch vergrößert. Wenn wir alleine sind, neigen wir dazu, uns einzureden, dass alle außer uns in glücklichen Beziehungen leben, und denken schnell, wir wären der einzige Mensch, der alleine ist. Aber das stimmt nicht. Viele liebenswerte und kompetente Menschen sind alleine. Das muss keine Tragödie sein.
Aber man kann sich schon einsam fühlen, wenn die befreundeten Paare am Wochenende plötzlich alle wegfahren. Wie, glauben Sie, können wir diese Wochenenden anders wahrnehmen?
Zunächst einmal müssen wir herausfinden, wo das eigentliche Problem liegt. Denn das Problem ist nicht das Alleinsein an sich. Das Problem besteht darin, alleine zu sein, während man eine ganz bestimmte Vorstellung oder Idee vom Menschsein im Kopf hat. Anstatt einen Tanzkurs zu machen, nur um dem Samstagabendfrust zu entgehen, können wir auch unsere Vorstellung vom Alleinsein ändern. Denn wenn es montags in Ordnung ist, den Abend alleine zu verbringen, und samstags ist es eine Tragödie, dann ist das echte Problem nicht die Tatsache, dass wir alleine sind, sondern die Geschichte, die wir uns dazu erzählen.
Sie sagten einmal, wenn wir das Wort »Liebe« benutzen, sprechen wir im Grunde von Verbundenheit. Das hat mich an Zeiten erinnert, in denen ich glaubte, es gebe in meinem Leben keine Liebe, obwohl es sie tatsächlich gab. Hilft es uns, wenn wir die Bedeutung des Wortes »Liebe« neu bewerten?
Ja, oder wenn wir uns fragen, was wir uns von der Liebe erhoffen. Es gibt Menschen, die haben das Gefühl, ohne eine Beziehung wäre ihr Leben unvollständig. Fragt man sie dann, was an ihrem beziehungslosen Leben denn so schrecklich ist, sind es nur kleine Dinge, mit denen sie unzufrieden sind und die man auch ändern kann. Jemand sagt vielleicht, er sehne sich nach Liebe, sobald er dann aber gezwungen ist, darüber nachzudenken, warum, stellt sich heraus, dass er Verbundenheit will. Verbundenheit hängt aber nicht notwendigerweise von einer Paarbeziehung ab. Man kann sich auch außerhalb einer Partnerschaft mit jemandem verbunden fühlen. Ein anderer sagt vielleicht: »Ich wünsche mir intellektuelle Stimulation.« Brauchen wir dazu eine Paarbeziehung? Auch hier lautet die Antwort: nicht unbedingt. Viele Dinge, die wir Paarbeziehungen zuschreiben, sind auch anderweitig zu bekommen. So machen wir beispielsweise bei Beziehungen und Freundschaften einen tragischen Fehler in der hierarchischen Ordnung. Dass wir die Freundschaft heute weit unter der Paarbeziehung ansiedeln, ist tatsächlich verwunderlich, denn das war nicht immer so. Im Deutschland des frühen 19. Jahrhunderts galt eine gute Freundschaft beispielweise als wichtiger und näher an den Wurzeln des Glücks als eine Liebesbeziehung.
Ein Thema, zu dem ich immer wieder unterschiedliche Meinungen höre, ist das Klischee, wir müssten uns selbst lieben, um jemand anderen lieben zu können. Ich frage mich, ob Selbsterkenntnis nicht vielleicht ein sinnvolleres Ziel ist als Selbstliebe. Wie stehen Sie dazu?
Ich würde die Betonung auch auf Selbsterkenntnis legen und auf die Fähigkeit, diese zu kommunizieren. Wenn wir von uns sagen: »Ich vergöttere mich nicht, bin aber interessiert an mir und kann anderen die Wahrheit über mich kommunizieren«, weckt das mehr Vertrauen, als wenn wir sagen: »Ich bin perfekt.« Tatsächlich ist es ziemlich romantisch, persönlichen Schmerz, innere Zerrissenheit und die eigenen Unzulänglichkeiten anzuerkennen. Eine übertriebene Selbstverherrlichung hingegen trennt uns von anderen, während die Auseinandersetzung mit der eigenen Verletzlichkeit der Schlüssel zu einer engen Bindung ist. Bei der Selbstliebe geht es nicht so sehr darum, sich selbst zu lieben, als vielmehr darum, zu akzeptieren, dass jeder Mensch auch unvorteilhafte Seiten hat. Denn dann sind die eigenen Unzulänglichkeiten auch kein Grund mehr zu glauben, wir könnten keine gute Beziehung führen. Sie machen uns nicht mehr zu schrecklichen Menschen, die keine Liebe verdienen, sondern zu einem Teil der menschlichen Familie.
Wenn wir uns selbst nicht wertschätzen oder verstehen, ist das Risiko, dass wir uns in einer Beziehung verlieren, dann größer?
Dass wir die Verbindung zu uns selbst verlieren könnten, klingt irgendwie abwegig. Wie soll das gehen? Wir sind, wer wir sind. Warum sollten wir weniger wir selbst sein, wenn wir Kontakt mit anderen Menschen haben? Aber Informationen, die wir von unseren Sinnen und unserem emotionalen Selbst erhalten, können von Informationen, die wir von anderen bekommen, außer Kraft gesetzt werden. Ein klassisches Beispiel dafür wäre, wenn wir sagen: »Ich bin ein bisschen traurig«, und jemand anderer sagt: »Nein, bist du nicht. Alles ist gut. Du machst das prima.« Das kann dazu führen, dass wir die eigene Sichtweise für nicht legitim halten und denken: »Der andere hat recht. Eigentlich geht es mir doch gut.« Dabei wäre es wichtig, einen Schritt zurückzutreten und anzuerkennen, dass da etwas wirklich schwierig ist.Wir können das Risiko, uns selbst zu verlieren, durch das Prisma der Selbstliebe oder des Selbsthasses betrachten, oder aber wir fragen uns: »Wie sehr vertraue ich darauf, dass ich mir meiner eigenen Gefühle sicher sein kann? Und wie viele meiner Gefühle werden von Geschichten, die von außen kommen, außer Kraft gesetzt?« Denn in der Regel hat jeder, mit dem wir in Beziehung treten, eine Meinung dazu, was richtig für uns ist oder was richtig oder falsch in der Welt ist. Und die Fähigkeit, sagen zu können: »Das ist interessant, aber ich habe meine eigene Realität und bin nicht sicher, ob deine dazu passt«, hängt davon ab, ob wir diesen Muskel bereits in der Kindheit trainiert haben. Oft ist das nicht der Fall, weil viele Aspekte der kindlichen Realität von den Eltern außer Kraft gesetzt werden. Ein Kind sagt vielleicht: »Oma ist so blöd. Ich könnte sie umbringen.« Und die Eltern erwidern darauf: »Nein, das könntest du nicht. Du liebst deine Oma.« Klügere Eltern würden sagen: »Ich denke, wir alle sind manchmal wütend auf andere. Wahrscheinlich hat sie dich irgendwie enttäuscht. Hast du eine Idee, womit?« So kann das Kind sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzen. Es kann versuchen, sie zu verstehen, und darüber reden. Aber oft weichen wir den verstörenden Gefühlen von Kindern aus und fordern sie auf, diese abzustellen. Und als Erwachsene glauben sie dann, ihre Gefühle hätten keine Berechtigung.
Mit Anfang zwanzig hatte ich oft schwierige Beziehungen, weil ich einem undefinierbaren Bauchgefühl folgte. Glauben Sie, dass das sogenannte Bauchgefühl in der Liebe wenig hilfreich ist?
Wir können uns auf unsere Gefühle nicht voll und ganz verlassen, weil sie ihr Ziel gerne mal verfehlen oder darüber hinausschießen. Nehmen wir beispielsweise die Angst. Wir neigen dazu, vor den falschen Dingen Angst zu haben und die, vor denen wir uns ängstigen müssten, zu ignorieren. Wir fürchten uns vor Gespenstern, aber nicht davor, dass unser Leben sehr kurz sein und wir unsere wahren Talente vernachlässigen könnten. Wir sind nicht besonders gut darin, zu erkennen, wovor wir uns fürchten müssen, und genauso wenig wissen wir, wen wir lieben können – und in welchem Maße. Sobald uns ein reizvoller Kandidat oder eine reizvolle Kandidatin über den Weg läuft, verlieren wir einen Teil unseres Urteilsvermögens. Wir stellen uns vor, wer dieser Mensch ist und wie wir unser Leben mit ihm verbringen, und glauben, er sei die Quelle uneingeschränkten Glücks. In dieser Phase ist es hilfreich, wenn wir uns bewusst machen, dass wir verliebt sind. Gleichzeitig sollten wir uns aber auch klarmachen, dass das nicht immer so bleiben wird. Wir sollten unserer Euphorie wohlwollend gegenüberstehen, dabei aber nicht den Kontakt zur Realität verlieren und vergessen, dass die andere Person uns im Grunde fremd ist und ein schöner Abend oder ein schönes Wochenende nicht alles sind. Kurz: dass unsere aktuellen Gefühle keine verlässliche Vorhersage für die Zukunft sind. Ich glaube, diese beiden Dinge sind durchaus kompatibel. Wir können das Verliebtsein trotzdem genießen, so wie wir auch einen Horrorfilm genießen können. Wir fürchten uns (weil wir denken, oh mein Gott, das Monster wird ihn kriegen), und gleichzeitig wissen wir, nein, es ist nur ein Film, das ist nicht real. Eine ähnliche Trennung von Empfinden und Betrachten ist auch im Anfangsstadium der Liebe möglich.
Wenn wir bis über beide Ohren verliebt sind, fällt es uns oft schwer zu erkennen, dass es eine Fantasie ist, in die wir verliebt sind. Wie macht sich das bemerkbar?
Das hängt vom Grad der Idealisierung ab. Wenn wir vergessen, dass wir ein menschliches Wesen und keine göttliche Kreatur kennengelernt haben, werden wir am Ende ziemlich enttäuscht sein, wenn wir feststellen, dass der andere auch nur ein Mensch mit Fehlern und Schwächen ist. Daher hilft es, wenn wir trotz allem ein klein wenig pessimistisch bleiben, was andere Menschen betrifft. Ich glaube, dass sich das mit Wohlwollen und Enthusiasmus durchaus verträgt. Eines der besten Vorbilder für Liebe ist die Art, wie Eltern ihre Kinder lieben. Eltern lieben ihre Kinder wirklich. Und trotzdem mögen sie sie manchmal nicht – sie haben genug von ihnen, finden sie schrecklich und wären sie am liebsten für eine Weile los. Das alles passiert auch zwischen Erwachsenen, die sich lieben. Manchmal haben wir genug vom anderen und sehen seine offenkundigen Fehler, halten aber dennoch fest zu ihm. Der andere geht uns auf die Nerven, und trotzdem lieben wir ihn.
Das klingt, als wäre das Idealisieren eines anderen Menschen das exakte Gegenteil von Liebe, weil wir uns weigern, ihn ganz zu sehen?
Ja, wir nehmen den anderen nicht richtig wahr. Niemand möchte idealisiert werden – wir wollen, dass man uns sieht und akzeptiert und uns vergibt. Wir wollen wissen, dass wir wir selbst sein können, auch in weniger erbaulichen Momenten. Denn auch wenn wir diejenigen sind, die idealisiert werden, hat das eine entfremdende Wirkung. Wir haben den Eindruck, wahrgenommen und bewundert zu werden wie nie zuvor, tatsächlich fallen aber viele wichtige Aspekte, die uns ausmachen, unter den Tisch.
Eine Sache, die mich schon lange beschäftigt, ist die Frage der Kontrolle in der Liebe. Ich glaube, dass wir in der Liebe tatsächlich mehr kontrollieren können, als man uns glauben macht, und dass es wichtig ist zu erkennen, dass unsere Rolle keine passive ist. Andererseits frage ich mich, ob Liebe nicht auch viel mit Glück zu tun hat. Denn wir können so offen und selbstbewusst sein, wie wir wollen, und uns noch so sehr wünschen, jemanden kennenzulernen, und trotzdem passiert es manchmal nicht.
Man muss nicht religiös sein, um zu glauben, dass der Zufall eine gewaltige Rolle spielt und das Leben eines anderen Menschen in Wirklichkeit ein großes Mysterium ist. Wir können andere nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen. Wir glauben, wenn wir die richtigen Dinge sagen oder die richtigen Bücher zum Thema lesen, reduzieren wir das Risiko zu scheitern und haben mehr Kontrolle. Aber das stimmt nur teilweise. Wir wissen nicht, wo im Leben ein anderer Mensch gerade steht. Vielleicht ist er einfach nicht verliebt in uns, was dann zwar furchtbar schade ist, aber es lässt sich darüber nun mal nicht streiten. Wir müssen es akzeptieren wie schlechtes Wetter. Wir können das Wetter nicht kontrollieren, genauso wenig, wie wir beeinflussen können, ob andere Menschen uns attraktiv finden. Daher ist eine gewisse Zurückhaltung tatsächlich hilfreich – für jeden von uns. Nur so können wir akzeptieren, dass es selbst dann in Ordnung wäre, wenn wir alleine blieben. Um an diesen Punkt zu kommen, müssen wir mit vielen verschiedenen Leuten sprechen: mit Menschen, die geschieden sind und uns wahrscheinlich raten, uns niemals auf eine dauerhafte Beziehung einzulassen; mit alten Menschen, die ihr Leben lang alleine und zufrieden waren; mit Priestern, Nonnen und Mönchen. Wir müssen uns von der geißelnden Vorstellung lösen, dass wir mit zwanzig viele Dates haben, mit achtundzwanzig den idealen Partner finden und mit einunddreißig unser erstes Kind bekommen müssen, sonst würden wir im Leben unglücklich sein. Selbst wenn das alles irgendwann einmal geschieht, wird es manchmal großartig und manchmal frustrierend sein. Wir müssen ein bisschen fantasievoller werden, wenn es darum geht, sich vorzustellen, wie ein gutes Leben aussehen könnte.
Was hätten Sie über die Suche nach der Liebe gerne früher gewusst?