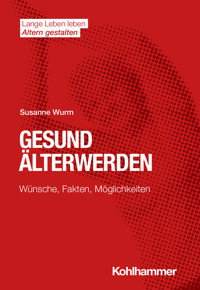
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn nur die Biologie zählte, würden wir alle ungefähr auf die gleiche Weise altern. Doch so ist das nicht! Das Buch räumt mit gängigen Mythen und Klischees auf, die zum Beispiel zu Krankheiten, Vulnerabilität und Einsamkeit im Alter bestehen. Darüber hinaus beleuchtet das Buch Fragen wie: Welche Bedeutung kommt der Bildung für das gesunde Älterwerden zu? Welche Rolle spielen unsere Vorstellungen vom Älterwerden? Können später geborene Jahrgänge erwarten, gesünder ins Alter zu kommen? Warum ist es für Prävention nie zu spät? Und: Was kann man konkret tun, um gut für das Alter und im Alter vorzusorgen? Entlang dieser und weiterer Fragen liefert das Buch überraschende Fakten aus der Forschung und zeigt, wie aus unserem sehnlichen Wunsch, gesund zu altern, Wirklichkeit werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Danksagung
Einleitung: Gesund Älterwerden – ein Leben lang
Der Gewinn an Lebensjahren
Weltweit altert die Bevölkerung
Wir können aktiv werden, jederzeit
1 Was passiert, wenn wir älter werden: Prozesse und gesundheitliche Folgen
1.1 Mythen und Fakten zu Gesundheit und Krankheit im Alter
Gesund lange leben: Ein Paradox oder geht das wirklich?
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit
Macht es einen Unterschied, ob man Krankheiten als normale Begleiterscheinung des Alters betrachtet oder nicht?
1.2 Gesund sein – gesund fühlen: die 30-Prozent-Regel
Abweichungen liefern wichtige Informationen
Wer wird voraussichtlich länger leben?
Wie kann man es schaffen, eine gute subjektive Gesundheit aufrechtzuerhalten?
1.3 Sind ältere Menschen heutzutage gesünder als früher?
Mehr Jahre in guter Gesundheit?
2 Über die Vielfalt des Alterns
2.1 Gesundheitliche Unterschiede – und Ungleichheiten
Altern Frauen und Männer unterschiedlich?
Die Rolle sozialer Ungleichheit für die Gesundheit im Alter
Einsamkeit – ein besonders verbreiteter Risikofaktor im Alter?
2.2 Gesund Älterwerden: eine Frage der inneren Einstellung?
Gesellschaftliche und individuelle Vorstellungen vom Älterwerden und Altsein
Die Rolle von Altersbildern für unsere Gesundheit
Länger leben durch positivere Vorstellungen vom Älterwerden
Wie wirken Altersbilder auf unsere Gesundheit und Langlebigkeit?
2.3 Zwischen Anpassung, Bewältigung und persönlichem Wachstum
Wie laut tickt unsere soziale Uhr?
Was haben wir selbst in der Hand? Die Bedeutung von Selbstregulation für die Gesundheit
Gewinnorientierte Ziele sind nicht der Jugend vorbehalten
3 Möglichkeiten der Vorsorge für das Alter
3.1 Warum es für Prävention nie zu spät ist
Erfolge der Prävention und Gesundheitsförderung bei chronischen Krankheiten
Prävention im Kontext der klinischen Versorgung
3.2 Aktivität bewegt viel
Mind the gap: Die Lücke zwischen Bewegungsempfehlungen und Aktivität
Schritte hin zu mehr körperlicher Aktivität
3.3 Gesund Altern heißt auch, Altersdiskriminierung zu bekämpfen
Alters(selbst)diskriminierung bekämpfen – aber wie?
Ein Anfang und Hoffnungsschimmer: Altersbilder verändern sich zum Positiven
Literatur
Lange Leben leben | Altern gestalten
Wissen – Positionen – Impulse
Hrsg. von Hans-Werner Wahl, Hans Förstl, Ines Himmelsbach und Elisabeth Wacker
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/lange-leben-leben
Die Autorin
Prof. Dr. phil. Susanne Wurm ist Psychologin und Alternsforscherin. Sie leitet am Institut für Community Medicine der Universitätsmedizin Greifswald die Abteilung für Präventionsforschung und Sozialmedizin.
Susanne Wurm
Gesund Älterwerden
Wünsche, Fakten, Möglichkeiten
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-038761-4
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-038762-1epub:ISBN 978-3-17-038763-8
Danksagung
Für die wertvolle Unterstützung beim Lektorat des Manuskriptes möchte ich mich bei meiner Familie herzlich bedanken. Mein besonderer Dank gilt außerdem meinen Kolleginnen Monika Hanke und Frauke Meyer-Wyk für ihre sorgfältigen Recherchen und redaktionellen Tätigkeiten. Schließlich gilt mein Dank Hans-Werner Wahl, Herausgeber der Buchreihe, für seine fachlichen Rückmeldungen zum Manuskript. Dieses Buch ist meinem Vater gewidmet, einem zentralen Ideengeber für dieses Buch und meinem lebenslangen Mentor, in großer Dankbarkeit.
Greifswald, im Mai 2023Susanne Wurm
Einleitung: Gesund Älterwerden – ein Leben lang
»Jugend ist eine neue Form des Rassismus, eine Obsession. Es ist die einzige soziale Ungerechtigkeit, die es wirklich gibt.« Karl Lagerfeld (1933 – 2019)1
Damit fängt es an: Kaum, dass wir geboren sind, werden wir auch schon älter. Das geht so weiter, das ganze Leben lang bis zu seinem Ende. Biologisch ist das zwar so vorprogrammiert, doch das Älterwerden lässt sich nicht allein an biologischen Veränderungen beschreiben. Wir altern weit vielschichtiger und verkennen den Faktor Zeit, der unseren Alterungsprozess maßgeblich mitbestimmt. Das Buch erklärt, warum die eigenen Einstellungen essenziell dafür sind, wie gesund und wie lange Menschen leben und warum auch 80-jährige Menschen im Durchschnitt weitere acht bis zehn weitere Lebensjahre vor sich haben. Es erläutert zudem, warum es oftmals bedeutsamer ist, wann eine Person geboren wurde und in welcher Zeit sie aufwuchs als danach zu schauen, wie alt eine Person ist. Und es gibt ermutigende Beispiele dafür, dass chronische Krankheiten rückgängig gemacht werden können und Prävention gerade auch dann Früchte trägt, wenn Krankheiten bestehen. Das Buch2 rüttelt damit an althergebrachten Vorstellungen von Krankheiten sowie vom Älterwerden und Altsein und veranschaulicht, warum es sich lohnt, diese kritisch zu hinterfragen. Es regt dazu an, verbreitete Mechanismen der Alters(selbst)diskriminierung aufzubrechen und sich gemeinsam auf den Weg zu einer neuen Kultur des Alterns aufzumachen. Es ist an der Zeit.
Der Gewinn an Lebensjahren
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts lag die durchschnittliche Lebenserwartung noch bei weniger als 40 Jahren. Zwar gab es auch damals Menschen, die 70 oder 80 Jahre alt wurden, doch der Großteil starb deutlich früher. Viele Kinder und Jugendliche überlebten beispielsweise die damals vorherrschenden Infektionskrankheiten wie Typhus und Cholera nicht.
Die gute Nachricht über das Älterwerden heute: Ein langes Leben ist für die meisten von uns planbar geworden, denn wir haben dafür eine ganze Menge Zeit. Zeit, um Dinge zu lernen, Ausbildung und Beruf zu verfolgen, mit der Familie und in weiteren sozialen Zusammenhängen zu leben, eigenen Interessen nachzugehen oder auch bisherige Lebensmodelle umzukrempeln, um ganz Neues auszuprobieren – ein Leben in der Großstadt nach Jahrzehnten auf dem Land; ein Leben in einer neuen Partnerschaft, vielleicht mit neuen Kindern oder Enkelkindern; die lang ersehnte Weltreise, das Erlernen einer neuen Sprache oder der Umzug vom großen Familienheim in ein Tiny House. Für all diese und weitere Dinge Lebenszeit zu haben, ist ein großer Gewinn.
Dieser Gewinn an Lebenszeit ist nicht nur im Vergleich zu früheren Jahrhunderten spürbar. Deutlich wird dies beispielsweise an einer Person, die 1960 geboren wurde, heute Anfang 60 ist und voraussichtlich mit 66 Jahren in Ruhestand gehen wird: In ihrem Geburtsjahr lag die Lebenserwartung bei 67 Jahren für Männer und 72 Jahren für Frauen. Würde man danach gehen, hätte die Person, je nachdem, ob Mann oder Frau, nur noch 1 bis 5 Jahre im Ruhestand zu leben! Leicht wird übersehen, dass es sich bei der Lebenserwartung bei Geburt um einen Durchschnittswert handelt. Manche Menschen versterben tatsächlich deutlich früher als es die durchschnittliche Lebenserwartung nahelegt, aber andere eben auch sehr viel später. Verbesserungen in der medizinischen Versorgung tragen zusätzlich dazu bei, dass heutige 60-Jährige erwarten können, noch über 20 weitere Lebensjahre zu leben und damit über 80, vielleicht auch mehr als 90 Jahre alt zu werden. Natürlich gibt es keine Garantie für ein langes Leben. Dennoch können, anders als in früheren Jahrhunderten, die meisten mit einem langen Leben rechnen.
Weltweit altert die Bevölkerung
Auch die Gesellschaften, in denen wir leben, altern. Jede Sekunde feiern zwei Menschen irgendwo auf der Welt ihren 60. Geburtstag. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit erreichten so viele Menschen dieses Alter und nie zuvor wurden so viele Menschen gleichzeitig alt. Bereits jetzt sind weltweit über eine Milliarde Menschen 60 Jahre oder älter – bis zum Jahr 2050 werden es wahrscheinlich doppelt so viele sein.
Nicht zufällig eröffneten die Vereinten Nationen im Jahr 2021 die Dekade des gesunden Älterwerdens.3 Ziel der kommenden Jahre ist es, dass verschiedene Akteure gemeinsam handeln – unter anderem Regierungen, Zivilgesellschaften, internationale Organisationen, Expertinnen und Experten, Medien – um das Leben älterer Menschen, ihrer Familien und der Gemeinden, in denen sie leben, zu verbessern.
Die Covid-19-Pandemie hat besonders deutlich gezeigt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse eine wesentliche Grundlage für die Politik bilden. Schon heute verfügt die Alternsforschung über ein umfangreiches Wissen darüber, wie wir möglichst gesund älter werden können. Ähnlich wie beim Älterwerden, das nicht auf das biologische Altern reduziert werden sollte, geht es auch beim Begriff der Gesundheit darum, genauer zu beleuchten, was darunter verstanden wird.
Wir können aktiv werden, jederzeit
Die erste Grundthese dieses Buches lautet, dass Gesundheit weit mehr als die Abwesenheit von Krankheit ist. Ausgehend von Definitionen der Weltgesundheitsorganisation und aufbauend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen soll hier ein differenzierter Einblick in die gesundheitsbezogene Alternsforschung vermittelt werden. Dabei werden verschiedene Perspektiven auf Gesundheit dargestellt. Es wird dadurch besser verständlich, warum das Alter nicht einfach mit Krankheit gleichzusetzen ist. Das Altern setzt vielmehr erstaunliche Ressourcen frei und unser subjektives Erleben spielt eine zentrale Rolle dafür, wie gut und lange wir leben.
Die zweite Grundthese schließt daran an und greift eine der vier Handlungsfelder der Dekade des gesunden Älterwerdens auf. Wir sollten Altersbilder kritisch reflektieren. Dazu zählt, wie wir über ältere Menschen denken, welche Gefühle wir ihnen gegenüber haben und wie wir uns ihnen gegenüber verhalten. Altersbilder beziehen sich zugleich auf unser eigenes Älterwerden und Altsein, welche Gedanken und Gefühle wir diesbezüglich haben, die zu einer Altersselbstdiskriminierung führen können. Altersbilder zu hinterfragen ist eine entscheidende Grundlage dafür, Altersdiskriminierung zu bekämpfen. Auf diesem Weg lassen sich gesundes Älterwerden und eine gute Gesellschaft für alle Altersgruppen fördern. In großangelegten Studien wurde gezeigt, dass Menschen, die eine positive Sicht auf das eigene Älterwerden haben, länger leben können als jene, die weniger positiv darauf blicken: Eine positive Sicht kann mit dazu beitragen, dass bis zu 13 Jahre mehr Lebenszeit gewonnen werden (Wurm & Schäfer, 2022). Neben einem gesunden Lebensstil und genetischen Faktoren spielt also auch eine Rolle, was wir über das Älterwerden denken.
Die dritte Grundthese lautet kurz und knapp: Für Prävention ist es nie zu spät. Manch einer kennt Sätze wie »Bei Ihnen ist es zu spät, um mit dem Rauchen aufzuhören« oder »Schonen Sie sich mal in Ihrem Alter«. Andere mögen sich vielleicht schon einmal gedacht haben: »Ich bin zu alt, um jetzt noch mit einem neuen Hobby anzufangen.« Es mag viele Gründe (und Ausreden) geben, Dinge nicht zu tun. Doch es gibt bessere und zudem wissenschaftlich fundierte Gründe, lebenslang zu lernen, auch spät im Alter noch mit dem Rauchen aufzuhören und körperlich aktiv zu werden. Es ist beispielsweise beeindruckend, dass sich Lungenzellen auch nach 30 oder sogar 40 Jahren Rauchen wieder erholen und dadurch das Risiko für Lungenkrebs sinkt (Yoshida et al., 2020). Dieses Buch liefert zu etlichen aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen die näheren Hintergründe. Dabei gilt es, eine möglichst ausgewogene Balance zu finden zwischen Verständlichkeit, die immer auch eine gewisse Vereinfachung bedeutet, und wissenschaftlicher Fundiertheit.
Das Zitat des verstorbenen Modedesigners Karl Lagerfeld zur Jugend als neuer Form des Rassismus mag provokant und überspitzt sein. Doch das Zitat hat einen wahren Kern, so unwissenschaftlich er ausgedrückt sein mag: Galten in der Agrargesellschaft alte Bauern und Handwerker noch als »Wissensspeicher«, richtete sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend der Fokus auf die Jugend. Ende des 19. Jahrhunderts entstand die Zeitschrift »Jugend« und die ersten Olympischen Spiele wurden abgehalten. Diese Entwicklungen ebenso wie die Industrialisierung haben die alten »Wissensspeicher« entwertet und zur bis heute andauernden Jugendfixierung beigetragen. Unter diesem »Jugendlichkeitswahn« haben bereits Generationen gelitten. Ihn bezeichnet Karl Lagerfeld als Rassismus und meint damit das, was im internationalen Kontext als Ageism bezeichnet wird: negative Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen gegenüber Menschen aufgrund ihres Alters. Zwar können auch junge Menschen davon betroffen sein, beispielsweise wenn ihre fachlichen Kompetenzen aufgrund ihres jungen Alters nicht anerkannt werden. Doch weit häufiger besteht Ageism gegenüber älteren Menschen, die dem hohen gesellschaftlichen Wert von Jugendlichkeit und Fitness nicht entsprechen. Kein Wunder, dass die Schönheitsindustrie floriert und »Botox to go« eine moderne Form der Mittagspause geworden ist. Betrachtet man die zahlenmäßige Verteilung von jüngeren und älteren Menschen in der Gesellschaft, stehen in Deutschland 8,4 Millionen junge Erwachsene zwischen 15 und 24 Jahre (10,1 % der Bevölkerung) etwa doppelt so vielen älteren Menschen ab 67 Jahren gegenüber.
Jeder möchte lange leben, aber keiner will alt werden – dieser geläufige Spruch des irischen Satirikers Jonathan Swift (1667 – 1745)4 illustriert unseren Wunsch nach langem Leben bei gleichzeitig ewig währender Jugend. Diese Ambivalenz des Alterns beleuchtet das Buch, in dem es den Blick weitet auf ein Sowohl-als-auch: Was sind die gesundheitlichen Herausforderungen und Schwierigkeiten? Und wo liegen die Potentiale des Älterwerdens? Wie hilft Prävention, wo jedoch liegen die Grenzen der Machbarkeit? Was gewinnen wir und was geht verloren mit dem Alter? Klar gesagt werden soll an dieser Stelle: Das vorliegende Buch vertritt nicht die Position, dass das Altern bei der richtigen Einstellung ein federleichter Tanz werden wird. Doch es wendet sich gegen immer noch verbreitete einseitige Vorstellungen, die Altern allein mit Abbau und Verlust gleichsetzen. Gegen diese Position sprechen viele wissenschaftliche Erkenntnisse.
Endnoten
1Quelle: www.rnd.de/panorama/karl-lagerfeld-diese-spruche-sind-kult-EKNP2LNX65Y4W22PVIC4YK2AX4.html (Januar 2023)
2Zugunsten einer lesefreundlichen Darstellung wird in der Regel die neutrale bzw. männliche Form verwendet. Diese gilt für alle Geschlechtsformen (weiblich, männlich, divers).
3siehe www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing
4Original: »Every man desires to live long; but no man would be old.« Quelle: Swift, J. (1747). Thoughts on Various Subjects. In Pope, A., Swift, J., Gay, J., Arbuthnot, J. Miscellanies. The Fifth Ed., Corrected with Several Additional Pieces in Verse and Prose. Vereinigtes Königreich: Bathurst, S. 267.
1 Was passiert, wenn wir älter werden: Prozesse und gesundheitliche Folgen
Bis heute ist es eine verbreitete Vorstellung, Entwicklung vollziehe sich während Kindheit, Jugend und bis ins junge Erwachsenenalter hinein als kontinuierliches Wachstum, bis schließlich die Mitte des Lebens einen Wendepunkt darstelle. Ab diesem, so die übliche Vorstellung, begänne das Altern und damit ein fortschreitender Abbau bis zum Lebensende. Seit Jahrhunderten hält sich dieses zweigeteilte Bild von Wachstum und Entwicklung auf der einen Seite, in Illustrationen oftmals als aufsteigende Treppe dargestellt, und Abbau und Altern auf der anderen Seite, illustriert als Abwärtstreppe des Lebens (vgl. Wahl et al., 2021).
In der heutigen Forschung gilt diese Zweiteilung von Entwicklung und Altern als überholt. Denn die gesamte Lebensspanne ist gleichzeitig ein Entwicklungs- wie auch ein Alternsprozess, das heißt beständige Veränderung, von der Geburt bis zum Lebensende. Auch im Alter erleben Menschen Gewinne (z. B. durch mehr Zeit für persönliche Interessen) und auch Kinder erleben Verluste (z. B. durch eine schwerere Krankheit oder den Verlust einer nahestehenden Person). Nicht selten verschiebt sich zwar der Anteil erlebter Gewinne und Verluste über die Lebensspanne in Richtung eines Mehr an Verlusten, doch ist dies nicht zwangsläufig und immer der Fall. Es gibt Menschen, die sich erst im Erwachsenenalter von einer schwierigen Kindheit und Jugend erholen und Entwicklungen nachholen, die ihnen in früheren Lebensphasen nicht möglich waren. Und es gibt Menschen, die im Alter Freiheiten erleben, die ihnen zuvor nicht gegeben waren, sei es durch berufliche oder familiäre Verpflichtungen oder auch infolge gesundheitlicher Belastungen. Denn Krankheiten werden nicht immer und zwangsläufig mit dem Alter schlimmer; viele Menschen erholen sich nach Krankheiten wieder und holen dann Dinge nach, die ihnen längere Zeit unerreichbar erschienen.
1.1 Mythen und Fakten zu Gesundheit und Krankheit im Alter
»Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird, sondern wie man alt wird« (Ursula Lehr; 1930 – 2022)5
Um Mythen und Fakten zu Gesundheit und Krankheit beleuchten zu können, gilt es zunächst, einen Blick darauf zu werfen, was unter »Gesundheit« üblicherweise verstanden wird. Gesundheit ist zunächst ein neutraler Begriff. Er wird zum einen verwendet, um das Gegenteil von Krankheit zu beschreiben. Dies ist häufig die medizinische Perspektive auf Gesundheit. Der Begriff wird zudem verwendet, um die Laienperspektive auf Gesundheit abzubilden, die subjektive Gesundheit, also wie gesund sich eine Person fühlt. Eine dritte Bedeutung bezieht sich auf die Funktionsfähigkeit. Dazu zählt, inwieweit eine Person körperliche Einschränkungen oder Behinderungen hat. Häufig wird dabei betrachtet, inwieweit eine Person zentralen Aktivitäten des täglichen Lebens nachkommen kann. Ist sie also beispielsweise bettlägerig oder kann sie selbständig einkaufen gehen? Neben körperlichen Einschränkungen wird auch die kognitive Leistungsfähigkeit betrachtet. Diese kann sich im Zuge von dem Alter zugeschriebenen Abbauprozessen im Gehirn ebenfalls verschlechtern. Gesundheit umfasst zudem das psychische Wohlbefinden, dessen Kehrseite Angst und Depression sein können.
Darüber hinaus gibt es dynamische Definitionen von Gesundheit. Dazu zählt die Vorstellung, dass eine Person gesund ist, sofern sie in der Lage ist, krank zu werden und sich nach einer Krankheit wieder von ihr zu erholen. Diese Definition bezieht stärker die Reservekapazitäten einer Person mit ein. Dazu zählen biologische, soziale und psychologische Reserven.
Die Vorstellung, dass es ab der Mitte des Lebens gesundheitlich nur noch bergab geht, ist in vielen von uns tief verankert. Oft wird das Alter mit biologischen Abbauprozessen und Krankheit gleichgesetzt. Das ist nicht ganz falsch und doch eine einseitige Betrachtungsweise. Biologisch betrachtet ist Altern eine zunehmende Störung physiologischer Aktivitäten. Jede Körperzelle, das heißt alle Organsysteme und somit der gesamte Organismus, ist von altersbedingten Veränderungen auf der genetischen und zellphysiologischen Ebene betroffen. Mit dem Altern verändert sich die Fähigkeit des Organismus zur sogenannten Homöostase, zur Selbstregulation. Dadurch steigt die Anfälligkeit für Krankheiten und Infektionen. Erste Anzeichen des Älterwerdens merken wir oft durch den Beginn der Altersweitsichtigkeit (Presbyopie). Für Frauen ist die Menopause und damit das Ende der reproduktiven Lebensphase ein weiteres, klares Signal des Älterwerdens.





























