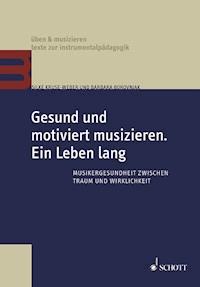
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schott Music
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: üben & musizieren – texte zur instrumentalpädagogik
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Musikerinnen und Musiker müssen lebenslang auf gesunde psychische und physische Ressourcen zurückgreifen können, aber sie leiden häufig – nicht nur während der Berufsausübung, sondern auch während der Instrumentalausbildung – unter Überlastungssyndromen, die sie beim Musizieren behindern oder sogar zum Aufhören zwingen. Warum werden so viele Musikerinnen und Musiker krank? Warum bleiben andere bei bester Gesundheit? Die Autorinnen und Autoren erörtern aktuelle Erkenntnisse und Ansätze zur Musikergesundheit. Sie nehmen zukunftsweisende Perspektiven in den Blick, damit unterrichtende und ausübende Musikerinnen und Musiker für die Risikobereiche gesundheitlicher Fragen sensibilisiert sind und präventiv Verantwortung übernehmen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesund und motiviert musizieren.Ein Leben lang
Gesund und motiviert musizieren.Ein Leben lang
MUSIKERGESUNDHEIT ZWISCHENTRAUM UND WIRKLICHKEIT
HERAUSGEGEBEN VON SILKE KRUSE-WEBERUND BARBARA BOROVNJAK
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Bestellnummer SDP 148
ISBN 978-3-7957-8572-7
© 2016 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Als Printausgabe erschienen unter der Bestellnummer UM 5015
© 2015 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
www.schott-music.com
www.schott-buch.de
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlags. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung kopiert und in ein Netzwerk gestellt werden. Das gilt auch für Intranets von Schulen oder sonstigen Bildungseinrichtungen.
Inhalt
Exposition
Empirische Befunde zur Musikergesundheit.
Grundlagen des Musizierens
Heiner Gembris
Musizieren und Gesundheit in der Lebenszeitperspektive.
Drei empirische Studien zu gesundheitlichen Aspekten des Musizierens vom Schulalter bis zum höheren Erwachsenenalter
Wilfried Gruhn
Gesundes Musizieren mit kontrollierten Bewegungen.
Motorik und Vorstellungsbildung aus neurokognitiver und biomechanischer Sicht
Wenn ein Traum zu scheitern scheint.
Hilfe im Umgang mit Hindernissen
Helmut Möller
Angst im Kopf, was nun?
Erklärungsansätze und Interventionsmöglichkeiten
Ulrike Wohlwender
„...seit 3 Jahren einschlafende Finger auf der Bühne“.
Overuse-Syndrom eines Pianisten im Spiegel der Individualität seiner Hand
Hildegard Wind
Die Feldenkraismethode bei Fokaler Dystonie.
Paradigmenwechsel und Neustart mit allen Sinnen
Tobias Grosshauser
Entdecken, Erforschen, Verstehen.
Unterstützende Technologien für ein physiologisch gesundes Musizieren
Matthias Bertsch
Kein Spielen bis zum Umfallen.
Kooperation und Hilfestellung für Musiker durch Netzwerke
Vom Traum zur Wirklichkeit.
Gesund und motiviert in (Hochschul-)Ausbildung und Beruf
Peter Röbke
Mehr als Schmerzfreiheit.
Gedanken zur körperlichen, seelischen und geistigen Gesundheit von Musikern
Magdalena Bork
Vom schönen Traum zur eigenen Wirklichkeit.
Der Wandel der Berufsbilder im Entwicklungsverlauf von Musikern
Gary McPherson
Von fremdgesteuertem Üben zu selbstgesteuerten Lernaktivitäten.
Schlüsselprozesse effizienten musikalischen Lernens verstehen
Jörg Maria Ortwein
Der Wille als Steuermann.
Ein Willenstest zur Analyse von motivationalen Stärken und Schwächen bei Musikstudierenden
Silke Kruse-Weber
Zusammenspiel von Polaritäten in der Instrumentalpädagogik.
Ein Plädoyer für die Individualisierung durch Vielfalt und Offenheit
Institutionelle Implementierung der Musikergesundheit in die musikalische (Hochschul-)Ausbildung
Silke Kruse-Weber (Moderation)
Interdisziplinäres Roundtablegespräch
mit Horst Hildebrandt, Julia Maier, Peter Röbke, Maria Schuppert, Priska Schriefl und Tom Sol
Maria Schuppert
Mehr als „Pflicht und Kür“.
Zur Definition und Implementierung der Musikergesundheit in der Ausbildung
Horst Hildebrandt
Angewandte Musikphysiologie.
Brücke zwischen Musikermedizin und musikalischer (Hochschul-)Ausbildung
Epilog
Barbara Borovnjak
Music-Life Balance.
Über Balance-Akte des Musizierens in intra- und interpersonalen Kontexten
Autorenhinweise
Exposition
Das Thema und die Motive
Musikergesundheit zwischen Traum und Wirklichkeit
Die Beiträge dieses Buchs entspringen dem internationalen und interdisziplinären Symposium „Traum und Wirklichkeit. Gesund und motiviert musizieren – ein Leben lang“, welches im Juni 2013 an der Kunstuniversität Graz stattgefunden hat.
Das Thema Musikergesundheit wird unter den beiden Perspektiven des Laien- und Profimusizierens in den Blick genommen. Sowohl Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker als auch Laien wünschen und erträumen sich ein lebendiges und motiviertes Musizieren. Wirklichkeit ist jedoch, dass bereits Kinder und Jugendliche beim instrumentalen Üben und Musizieren, aber besonders professionelle Musikerinnen und Musiker in zunehmendem Maß mit Schmerzen und Beschwerden und in der Folge Leistungseinbußen beim Musizieren konfrontiert sind, welche sie bisweilen sogar zum Aufhören zwingen. Die Musikermediziner Eckart Altenmüller, Claudia Spahn und Bernhard Richter (2011) berichten, dass an der Spitze der durch Musizieren physisch belastenden Faktoren akute und chronische schmerzhafte Überlastungen des Bewegungsapparats, einseitige Bewegungen, Überdehnung und Überschreiten von Spannungen stehen. Auftrittsängste und psychische Belastungen durch z. B. Frustrationen, Unsicherheit über die berufliche Zukunft, Konflikte, fehlende Konzentration und vor allem Stress nehmen ebenso einen breiten Raum ein.
Untersuchungen zu gesundheitlichen Problemen von Musikstudierenden sowie Musikschülerinnen und-schülern ergaben, dass 43 % der Befragten während ihres Studiums und 68-88 % während ihrer Instrumentalzeit Probleme im Zusammenhang mit dem Musizieren hatten. 25 % der Musikstudierenden leiden bereits bei Eintritt in das Musikstudium unter spielbezogenen Beeinträchtigungen und ein Drittel der Musikstudierenden hat erhöhte Angstwerte bei Auftritten.1 Es wird angenommen, dass etwa 45 % der Musikstudierenden deshalb professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Musizieren als Hochleistungsdomäne
Professionelle Musikerinnen und Musiker haben per se noch keine erhöhten Gesundheitsrisiken. Dennoch werden bei ihnen Körper und Psyche – wie im Profisport – zum Teil über Jahrzehnte bis zum Äußersten strapaziert. Je nach Instrument und individueller Konstitution müssen sie mit verschiedenen berufsbedingten Belastungsfaktoren umgehen. Um auf höchstem Niveau punktgenau zu musizieren, sind Musiker (ebenso wie Sportler) auf eine einwandfrei kontrollierbare psychische und physische Konstitution angewiesen. Dies macht präventive Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit und eine individualisierte ressourcenorientierte Betreuung für Musiker notwendig.
Gerne werden die Leistungen im Sport mit der Kunst des Musizierens verglichen. Tatsächlich gibt es Ähnlichkeiten, doch bestehen auf mehreren Ebenen grundlegende Unterschiede. Gemeinsam sind für beide Disziplinen der frühe Beginn, das Risiko der Grenzüberschreitung der individuellen sensomotorischen und biomechanischen Möglichkeiten, das Setzen immer höherer Leistungsziele sowie die Notwendigkeit der punktgenauen Spitzenleistung. Musizieren ist eine komplexe Tätigkeit. Musikerinnen und Musiker spielen oft viele Stunden unter höchster körperlicher und emotionaler Anspannung, um ihre Ziele zu erreichen – oft ohne auf genügende Ruhepausen zu achten. Während Profisportler nach einer kurzen Karriere meist Trainer werden, musizieren Musiker oft viele Jahrzehnte länger – bis ins hohe Alter (vgl. den Beitrag von Maria Schuppert in diesem Buch). Wenngleich inzwischen ein Umdenken spürbar wird, so besteht bei Berufsmusikern, anders als im Leistungssport, noch immer die Tendenz, physische und vor allem psychische Probleme lange Zeit zu ignorieren oder zu tabuisieren.
Verantwortung und Sensibilisierung für die Risiken des Musizierens
Im Hinblick auf eine Verantwortung und Sensibilisierung für die Risiken des Musizierens ist in den vergangenen Jahren eine erfreuliche Entwicklung an den Ausbildungsinstitutionen zu erkennen. Zahlreiche Ausbildungsinstitutionen – im primären und (post)sekundären Bereich – haben ihre Verantwortung erkannt und entsprechende Maßnahmen zur Musikergesundheit, mehr oder weniger umfassend, in die Ausbildung implementiert. Dennoch gibt es zahlreiche Lehrende, sei es an Musikschulen oder Musikhochschulen, die oft wenig über die Risiken wissen und sich darüber hinaus gegen die Auseinandersetzung mit der Thematik wehren. Sie nehmen an, dass diejenigen, die ein körperliches oder seelisches Leiden haben, dem Alltag auf der Bühne nicht gewachsen sind. Aber genau hier wird bisweilen der Grundstein für spätere Erkrankungen gelegt, da die Betroffenen bis zur physischen und psychischen Erschöpfung üben.
Das Symposium
Das Symposium „Traum und Wirklichkeit. Gesund und motiviert Musizieren – ein Leben lang“ war für die Kunstuniversität Graz ein Auftakt, sich den Möglichkeiten der Umsetzung zur Gestaltung eines curricularen Gesamtkonzepts der Musikergesundheit mit Rücksicht auf das eigene Profil und die Ressourcen der Universität anzunähern. Der interdisziplinäre Ansatz des Symposiums zeigte sich darin, dass Expertinnen und Experten aus den Domänen der Musik, Musikmedizin, Neurobiologie, Instrumental- und Gesangspädagogik, Psychologie, Elektrotechnik, Entspannungs- und Körpermethoden sowie Physiotherapie zusammentrafen. Neben wissenschaftlichen Vorträgen zur Musikergesundheit erhielten die Teilnehmenden des Symposiums „Traum und Wirklichkeit“ in einem breiten Angebot an interaktiven Vorträgen und Workshops und (in)formellem Erfahrungsaustausch die Möglichkeit, Informationen für Präventionsmöglichkeiten und Lösungsstrategien zur Musikergesundheit zu sammeln, um sich zu orientieren und Ansätze für das eigene Musizieren und Unterrichten zu entwickeln.
In einer Poster-Präsentation bestand die Möglichkeit, sich über Forschungsansätze zu informieren. An den Informationsständen gaben Experten Auskunft über Körper- und Entspannungsmethoden sowie über unterschiedliche Möglichkeiten der Prävention. Ferner konnte man in persönlichen Gesprächen geeignete Methoden – u. a. Meditation, Yoga, Auftrittstraining, Alexandertechnik, Feldenkrais, Grinberg-Methode, QiGong, TaijiQuan, Pilates, Kinesiologie, Dispokinesis, Autogenes Training, Progressive Muskelrelaxation und die Perspektiven des mentalen Trainings – entdecken. Im Rahmen des Symposiums wurden auch Einzelcoachings angeboten. Die individuelle Beratung und Unterstützung während der beiden Veranstaltungstage wurde besonders von den Studierenden wertgeschätzt.
Das Symposium – und nun auch die Dokumentation – möchte für folgende Perspektiven der Musikergesundheit ein Initiator sein:
■ Vermittlung von Fachwissen und praktischen Impulsen für ausübende und unterrichtende Musikerinnen und Musiker,
■ Erkennen und Sensibilisieren der Implikationen für die musikermedizinische Diagnostik und Therapie,
■ Reflexion und Orientierung im Hinblick auf Prävention, Zufriedenheit und Leistungsoptimierung von Lernenden und Lehrenden der Musik,
■ Diskussion der Erkenntnisse im Hinblick auf die Zukunft der Instrumental- und Gesangspädagogik,
■ Optimierung der musikalischen Aus- und Weiterbildung im Hinblick auf ein gesundes Musizieren – ein Leben lang.
Die Beiträge
Empirische Befunde zu Musikergesundheit – Grundlagen des Musizierens
Zunächst werden empirische Befunde zur Musikergesundheit erfasst. Heiner Gembris stellt vier seiner Studien zu diesem Thema vor, die ernst zu nehmende Daten im Hinblick auf das Musizieren in der Lebenszeitperspektive liefern. Wilfried Gruhn zeigt ausgewählte Aspekte aus der Bewegungsforschung, die die koordinativen Zusammenhänge und Interaktionen in der gleichzeitigen Entwicklung von musikalischem und motorischem Lernen verdeutlichen.
Wenn ein Traum zu scheitern scheint – Hilfe im Umgang mit Hindernissen
Auf jeder Leistungsstufe ist das Musizieren-Lernen auch mit dem Scheitern verbunden. Die Hindernisse, seien sie psychischer oder physischer Natur, konfrontieren Musizierende mit mehr oder weniger großen Leistungseinschränkungen. Vor allem Angststörungen plagen Musikerinnen und Musiker – im Vergleich mit dem Bevölkerungsdurchschnitt dreimal häufiger. Mit den Erklärungsansätzen und möglichen Interventionsstrategien bezüglich Aufführungsangst setzt sich Helmut Möller auseinander.
Ulrike Wohlwender greift das Thema Musikphysiologie auf. Anhand von Fallbeispielen vor allem bei Overuse-Syndromen erörtert sie, wie bei genauer Beobachtung der individuellen Hand und gleichzeitiger Analyse der Spieltechnik, bei der Akzeptanz physiologischer Begrenzungen, einer angepassten Repertoirewahl und einer bewusst angewendeten und balancierten Spieltechnik ohne zu starke Gelenkwiderstände, die Symptome deutlich verbessert werden können.
Hildegard Wind berichtet, wie sie als Musikerin durch den Umgang mit der gefürchteten Koordinationsstörung Fokale Dystonie auch einen Neueinstieg zu einer neuen, viel sinnlicheren Ebene des Musizierens gefunden hat. Die Selbstwahrnehmungsmethode nach Moshé Feldenkrais hat ihr – mit und ohne Instrument – Ansätze gegeben, neue, behutsame Arten der Bewegungsausführung zu entwickeln und sensibler zu erspüren.
Tobias Grosshauser gibt einen Überblick über innovative Sensortechnologien, mit denen vielfältige Parameter des Musizierens gemessen werden können – einerseits geben sie Feedback für u. a. Fehlhaltungen und Ermüdungserscheinungen, andererseits erhalten die Musikerinnen und Musiker Anregung, sich bewusster und forschender mit den Parametern des Musizierens auseinanderzusetzen.
Matthias Bertsch zeigt Möglichkeiten auf, wie sich Musiker selbstverantwortlich mit ihren jeweiligen Instrumenten und dazugehörigen spezifischen Beschwerden in einem Netzwerk der Musikergesundheit (u. a. Instrumentenbauer, Fachgesellschaften, Websites und Fachliteratur) durch offene Kommunikation Unterstützung und Information holen können.
Vom Traum zur Wirklichkeit – Musizieren und Motivation in (Hochschul-)Ausbildung und Beruf
In diesem Abschnitt wird die Entwicklung in der Aneignung und der Vermittlung des Musizierens – die Ausbildung bis zum Berufsleben – erörtert.
Peter Röbke setzt sich mit anthropologischen Grundsätzen des Musizierens auseinander. Er legt dar, dass in der musikalischen Ausbildung auch Raum dafür da sein muss, den eigenen Urgrund des Musizierens – die frühe psychische Heimat des Musizierens – wieder zu finden und zu pflegen; Musiker müssen einen Sinn im eigenen Musizieren sehen, freundlich im Umgang mit Leib und Seele sein, um mit Leib und Seele musizieren und tiefe seelische und musikalische Erlebnisse kreieren zu können.
An diese Überlegungen schließen sich die Ausführungen von Magdalena Bork zu unterschiedlichsten Motiven des Berufswunschs und „Traumberufs Musiker?“ an. Die Interviews mit Studierenden zeigen, dass sie nur vereinzelt selbst gefragt wurden, was oder wofür sie lernen wollten – obwohl die Auseinandersetzung mit den eigenen Werten und persönlichen Träumen und Wünschen in Bezug auf den Beruf als so wesentlich gesehen wird.
Gary McPherson adaptiert das soziokognitive Lernmodell der Selbstregulation für Musikerinnen und Musiker. Die Fähigkeit zur Selbstregulation gilt als wesentliches Instrument für ein effizientes und motiviertes Üben. Optimistisch stimmt, dass diese Fähigkeit durch Beobachten und Nachahmung von Persönlichkeits-, Verhaltens- und Umweltfaktoren erlernt wird, bis Musiker ihre Lernaktivitäten selbst steuern und damit ihre Leistung selbst verbessern können.
Jörg Maria Ortwein entwickelt einen Willenstest für Musikerinnen und Musiker, sodass sie ihre Stärken und Schwächen ihrer Motivation eigenverantwortlich bei einem Online-Test genauer bestimmen und durch die Anwendung entsprechender kognitiver, emotionaler und motivationaler Strategien der Unterstützung z. B. psychische Krisensituationen überwinden können.
Ausgehend vom Problem der „Einseitigkeit“ in der Instrumental- und Gesangspädagogik werden im Beitrag von Silke Kruse-Weber die Ansätze der Pathogenese und Salutogenese mit grundlegenden polaren Sichtweisen erörtert. Die Autorin plädiert für einen offenen und vielfältigen Umgang mit körperlichen, seelischen und geistigen Ressourcen in der (Hochschul-)Ausbildung von Musikerinnen und Musikern.
Implementierung der Musikgesundheit in die musikalische (Hochschul-)Ausbildung
Das interdisziplinäre Roundtablegespräch mit Horst Hildebrandt, Julia Maier, Peter Röbke, Maria Schuppert, Priska Schriefl und Tom Sol thematisiert die Sicht der Studierenden zu Transparenz und Auswahl der Angebote zur Musikergesundheit, Aufgaben der Hochschullehrenden und denen der Universität, Vermittlung des Musikermediziners zwischen Professorinnen, Professoren und Studierenden, Kommunikation der wissenschaftlichen Erkenntnisse an die Praxis und vor allem Grundfragen nach der jeweils eigenen Wirklichkeit, sei es die Akzeptanz physischer Begrenzungen oder die Identifikation mit der eigenen psychischen Heimat des Musizierens in Freundschaft mit Körper und Seele.
Nachfolgend berichten zwei Musikmediziner über institutionelle Ansätze der Musikergesundheit in der musikalischen (Hochschul-)Ausbildung. Maria Schuppert gibt einen Ein- und Überblick über die historische Entwicklung, Aufgabenbereiche, Inhalte und Ziele der Musikermedizin. Weiterhin veranschaulicht sie als Lösungsansatz zur Implementierung der Musikergesundheit an einer Musikhochschule das interdisziplinäre und umfassende Gesamtkonzept der Musikhochschule Detmold.
Horst Hildebrandt gibt einen Rückblick auf seine Erfahrungen mit Angeboten zur Musikphysiologie und Musikermedizin an einer Schweizer Musikschule sowie an der Zürcher Hochschule für Musik. Er betont, wie wichtig es in musikmedizinischen Sprechstunden ist, auch das musikerspezifische Wissen über die Instrumental- und Gesangstechnik, Ergonomie, unterschiedliche Lehrmeinungen zu gesangs- und instrumentaltechnischen Fragen mit einzubeziehen.
Epilog
Barbara Borovnjak fasst die vorangegangenen Beiträge unter dem speziellen Blickwinkel der Balance zusammen. Die Musikergesundheit wird auf individueller und institutioneller Ebene betrachtet.
Dank
Besonderer Dank gilt den Autorinnen und Autoren! Sie haben mit ihren Beiträgen die umfassende und farbenreiche Dokumentation des Symposiums erst ermöglicht. Ganz herzlicher Dank gilt der sorgfältigen und kooperativen Mitarbeit meiner Mitherausgeberin Barbara Borovnjak. Danken möchte ich auch meinem Team, insbesondere Margareth Tumler, Magdalena Krinner, Alexander Christof und Patrik Thurner, die in der Vor- und Nachbereitung sehr engagiert, einfühlsam und kreativ für einen professionellen Ablauf des Symposiums gesorgt haben. Letztlich waren Symposium und Publikation nicht denkbar ohne die Unterstützung der Kunstuniversität Graz, des Landes Steiermark und des Bürgermeisteramts der Stadt Graz.
Silke Kruse-Weber
1 Spahn/Richter/Altenmüller 2011, S. 11-12.
Literatur
■ Spahn, Claudia/Richter, Bernhard/Altenmüller, Eckart (Hg.): Musikermedizin: Diagnostik, Therapie und Prävention von musikerspezifischen Erkrankungen, Schattauer, Stuttgart 2011
Musizieren und Gesundheitin der Lebenszeitperspektive
DREI EMPIRISCHE STUDIENZU GESUNDHEITLICHEN ASPEKTEN DES MUSIZIERENSVOM SCHULALTER BIS ZUM HÖHEREN ERWACHSENENALTER
HEINER GEMBRIS
Ausgangspunkte und Hintergrund
Das Themenfeld Musik, Musizieren und Gesundheit umfasst gegenwärtig sehr breitgefächerte, heterogene Bereiche. Dazu zählen beispielsweise:
1. die Musiktherapie,
2. die Musikermedizin,
3. die Erforschung von Wohlbefinden und Gesundheit durch Singen und Instrumentalspiel im Kontext von Gesundheitswissenschaft und Public Health,1
4. im weiteren Sinne der Markt mit Tonträgern zur Entspannung/Meditation sowie neuerdings
5. die Verbindung von Musik und Gesundheit (zur Prophylaxe und Therapie) als Marketingkonzept zur Tourismusförderung, mit dem Fokus auf „Best-Agern“.2
Während die ersten drei genannten Bereiche über eine mehr oder weniger lange Tradition verfügen und Praxisorientierung mit wissenschaftlicher Forschung verbinden, orientieren sich die beiden letztgenannten Bereiche an kommerziellen Interessen, wobei wissenschaftliche Begründbarkeit oder Forschung keine wesentliche Rolle spielen. Dennoch sollten diese Bereiche nicht grundsätzlich aus der wissenschaftlichen Betrachtung ausgeschlossen werden, denn sie spielen im Alltagskontext von funktionaler Musik und Gesundheit durchaus eine gewisse Rolle.
Mein persönlicher Zugang zu dem Themenfeld Musizieren und Gesundheit entstammt keinem der fünf genannten Bereiche, sondern hat sich aus einem völlig anderen Zusammenhang ergeben, und zwar aus einem entwicklungspsychologischen Interesse, genauer gesagt: aus der Beschäftigung mit der Entwicklung musikalischer Begabung und Aktivitäten in der Lebenszeitperspektive. Der erste Anstoß kam aus einer eigenen Studie zur Funktion und Bedeutung von Musik bei Amateurmusikern aus Seniorenorchestern.3 Darin zeigte sich auf der einen Seite, dass das Musizieren in höherem Alter durch körperliche Beeinträchtigungen oder Krankheiten beeinflusst oder teilweise beschränkt wird. Auf der anderen Seite zeigte sich ein großer Gewinn für den gesundheitlichen Bereich, indem das aktive Musizieren die Lebensqualität im Alter verbessert. Die in dieser Studie am häufigsten genannten Gewinne aus den musikalischen Aktivitäten waren: der Gewinn an Lebensfreude, Lebensqualität, Kontakten zu anderen Menschen, der Gewinn an Glück, das Gefühl, fit gehalten zu werden durch das Musizieren, das Entstehen von Gemeinschaftsgefühl etc. und auch das Gefühl, durch Musik gesund gehalten zu werden.4 Entsprechende positive Effekte des Musizierens auf das psychosoziale Wohlbefinden und auf die subjektive Gesundheit zeigen sich auch in internationalen Studien.5
Ein weiterer Anstoß zum Thema „Musizieren und Gesundheit“ ergab sich aus unserer Studie „Älter werden im Orchester“, in der wir vielfältige Aspekte des professionellen Musizierens in der Lebenszeitperspektive auf einer sehr breiten Datenbasis untersucht haben.6 Dabei stellt die Gesundheit eine wichtige Rahmenbedingung und Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der musikalischen Leistungsfähigkeit dar. Zugleich ist es aber auch das oft jahrzehntelange Musizieren in einem (hoch-)leistungsorientierten Umfeld, durch das die Gesundheit Schaden nimmt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























