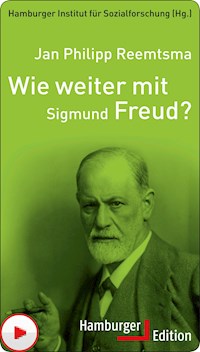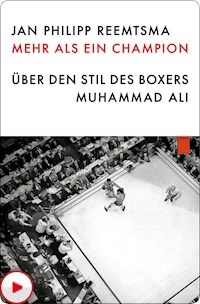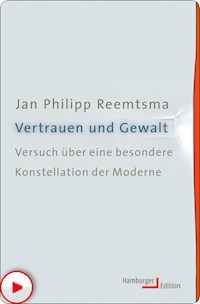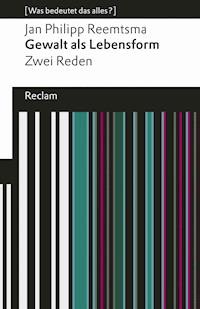
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Reemtsmas Überlegungen zur Gewalt – in zwei Texten gebündelt: zum einen in »Gewalt als attraktive Lebensform betrachtet«, seinem Abschiedsvortrag vom Hamburger Institut für Sozialforschung, zum anderen in seinem Essay »Gewalt und Vertrauen. Grundzüge einer Theorie der Gewalt in der Moderne«. Es geht u.a. um die Frage, warum ›ganz normale‹ Menschen (meist Männer) – oder gar: ›ganz normale Familienväter‹ – unvorstellbare Grausamkeiten begehen. Allein diese Frage zu stellen sei, so Reemtsma, »albern, weil die Antwort auf der Hand liegt: Wer denn sonst?« Wundern sollte uns vielmehr, »warum diese Massaker nicht das letzte Wort der bisherigen Geschichte geblieben sind.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 67
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Jan Philipp Reemtsma
Gewalt als Lebensform
Zwei Reden
Reclam
Alle Rechte vorbehalten
© 2016 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2016
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961177-8
Inhalt
Gewalt als attraktive Lebensform betrachtet
»Es war drei Uhr nachmittags. Plötzlich wurde Rufen und Schreien, eine Art von übermütigem Johlen, Pfeifen und das Gestampf vieler Schritte auf der Straße vernehmbar, ein Lärm, der sich näherte und anwuchs …
›Mama, was ist das?‹, sagte Clara, die durchs Fenster […] blickte. ›All die Leute … Was haben sie?‹
›Mein Gott!‹, rief die Konsulin, indem sie […] angstvoll aufsprang und zum Fenster eilte. ›Sollte es … O mein Gott, ja, die Revolution … Es ist das Volk …‹«
Die Konsulin wird gleich den Diener rufen: »›Anton?!‹« – mit »bebender Stimme« – und ihn anweisen: »›Anton, geh hinunter! Schließe die Hausthür! Mach’ Alles zu! Es ist das Volk …‹«
Es ist das Revolutionsjahr 1848, der Schauplatz ist Lübeck, zitiert habe ich aus Thomas Manns Buddenbrooks. Und so beginnt die Schilderung: »Die Sache war die, daß während des ganzen Tages bereits Unruhen in der Stadt geherrscht hatten. In der Breiten Straße war am Morgen die Schaufensterscheibe des Tuchhändlers Benthien vermittelst Steinwurfes zertrümmert worden, wobei Gott allein wußte, was das Fenster des Herrn Benthien mit der hohen Politik zu tun hatte.«1 Über das Fenster des Herrn Benthien wird später noch zu sprechen sein. Wie die Sache sonst abläuft – man wird sich erinnern. Die Bürgerschaft bleibt den Tag über belagert, am Ende, vor allem durch souveränes Agieren des Konsuls Johann Buddenbrook, entspannt sich die Lage, und die Ordnung wird wiederhergestellt: »›Nicht mal die Lampen sind angezündet … Dat geiht denn doch tau wied mit de Revolution!‹«2 Auch über Lampen wird noch zu sprechen sein.
Man fährt dann nach Hause, der Konsul Buddenbrook in der Kutsche mit seinem Schwiegervater Lebrecht Kröger, dem die Sache schon zuvor auf sein aristokratisches Gemüt geschlagen war: »›Das kleine Abenteuer geht Ihnen hoffentlich nicht nahe, Vater?‹ Unter dem schneeweißen Toupé waren auf Lebrecht Krögers Stirn zwei bläuliche Adern in besorgniserregender Weise geschwollen, und während die eine seiner aristokratischen Greisenhände mit den opalisierenden Knöpfen an seiner Weste spielte, zitterte die andere, mit einem großen Brillanten geschmückt, auf seinen Knieen. ›Papperlapapp, Buddenbrook!‹ sagte er mit sonderbarer Müdigkeit. ›Ich bin ennüyiert [gelangweilt], das ist das Ganze.‹ Aber er strafte sich selber Lügen, indem er plötzlich hervorzischte: ›Parbleu, Jean, man müßte diesen infamen Schmierfinken‹« – gemeint sind die vermuteten Agitatoren – »›den Respekt mit Pulver und Blei in den Leib knallen … das Pack …! Die Canaille …!‹« – »Die Canaille« werden auch seine vorletzten Worte sein, denn: »Plötzlich – die Equipage rasselte durch die Burgstraße – geschah etwas Erschreckendes. Als nämlich der Wagen, fünfzehn Schritte etwa von dem in Halbdunkel getauchten Gemäuer des Thores, eine Ansammlung lärmender und vergnügter Gassenjungen passierte, flog durch das offene Fenster ein Stein herein. Es war ein ganz harmloser Feldstein, kaum von der Größe eines Hühnereies, der, zur Feier der Revolution von der Hand irgend eines Krischan Snut oder Heine Voß geschleudert, sicherlich nicht böse gemeint und wahrscheinlich gar nicht nach dem Wagen gezielt worden war. Lautlos kam er durchs Fenster herein, prallte lautlos gegen Lebrecht Krögers von dickem Pelze bedeckte Brust, rollte ebenso lautlos an der Felldecke hinab und blieb am Boden liegen. ›Täppische Flegelei!‹, sagte der Konsul ärgerlich. ›Ist man denn heute Abend außer Rand und Band? … Aber er hat Sie nicht verletzt, wie, Schwiegervater?‹ Der alte Kröger schwieg, er schwieg beängstigend. […] Dann aber kam es ganz tief aus ihm heraus … langsam, kalt und schwer, ein einziges Wort: ›Die Canaille.‹«3 Und schließlich, als es ans Aussteigen geht, nur noch »›Helfen Sie mir‹« – dann bricht er tot zusammen.
Die Canaille – als ich im Februar in diesem Hause den Abendvortrag von Fabien Jobard auf der Tagung »Politische Gewalt im urbanen Raum« kommentierte, kam ich auf die Formulierung des früheren französischen Innenministers angesichts der Pariser Vorstadtrevolten zu sprechen: »les racailles«, auf Deutsch etwa »das Gesindel«. Mit dem Hinweis, »Gesindel« sei zweifellos kein soziologischer Begriff, wollte ich das Problem pointieren, das der Abendvortrag aufgeworfen hatte. Jobard hatte sich gegen eine Art überheblich-achselzuckender Bewertung der Träger der Unruhen gewendet, sie seien im Grunde sprachlos und hätten keine politische Agenda. Zwar sei die – auch gemessen an den sonderbar ziellosen, allenfalls symbolisch zu verstehenden Zerstörungs- und Plünderungsaktionen, angesichts der zwischen Rassismusvorwurf und eigenen rassistischen Wutaktionen sonderbar oszillierenden Affektlagen – tatsächlich nicht auszumachen, allerdings hätten diese Aufstände durchaus zuweilen politische Wirkungen – Verbesserung der Sozialfürsorge in manchen Stadtteilen etwa – zur Folge gehabt und könnten so wenigstens nicht als politisch funktionslos angesehen werden. In diesem Zusammenhang kritisierte der Vortragende das Überheblichkeitsvokabular aus der Tradition der klassischen Arbeiteraristokratie wie etwa »Lumpenproletariat« – also jene zu disziplinierter Organisation nicht fähigen proletarischen Schichten, die allenfalls spontane Zusammenrottungen zustande brächten. Der Ausdruck stammt bekanntlich aus dem Kommunistischen Manifest – schlagen wir nach: »Das Lumpenproletariat, diese passive Verfaulung der untersten Schichten der alten Gesellschaft, wird durch eine proletarische Revolution stellenweise in die Bewegung hineingeschleudert, seiner ganzen Lebenslage nach wird es bereitwilliger sein, sich zu reaktionären Umtrieben erkaufen zu lassen.«4 Hätte ich in meinem Kommentar erwogen, zum Verständnis von Vorstadtunruhen auf die Marx’sche Klassenanalyse zurückzugreifen, hätte die Süddeutsche Zeitung, die nicht die Tagung, wohl aber meinen Kommentar zum Gegenstand eines in jeder Hinsicht entgeisterten Artikels mit dem Tenor machte: ›Das schlägt ja dem Fass den Boden aus – der Vorstand des Hamburger Instituts für Sozialforschung zitiert zustimmend Sarkozy!‹, das für einen erwägenswerten Gedanken gehalten.
Aber lassen wir das. Worauf ich hinweisen wollte, war, dass es eine gewisse Gruppe von Verlegenheitsvokabeln gibt – Marx: »passive Verfaulung«, Sarkozy: »Gesindel« –, die darauf zeigen, dass man sich mit denselben Schwierigkeiten herumschlägt wie Clara Buddenbrook: »[W]as ist das? All die Leute … Was haben sie?« Diese Leute – bei Victor Hugo jene der Miserables, die sich, man weiß nicht wie, zusammentun; in einem Fall liefert das Begräbnis eines populären Generals den Anlass: »In dem Leichenzug kreisten die wildesten Gerüchte. […] Ein Mann, der unbekannt blieb, verbreitete das Gerücht, zwei Werkmeister, die man gewonnen habe, würden dem Volk die Tore einer Waffenfabrik öffnen. Die meisten Leute waren gleichzeitig begeistert und niedergeschlagen. Man sah in der Menge auch wahre Verbrechertypen, Leute, die es auf eine Plünderung abgesehen hatten. Wenn Sümpfe aufgewühlt werden, steigt der Kot an die Oberfläche.«5 Sarkozy sprach davon, den Abschaum »wegzukärchern«. Ob Hugo, ob Marx, ob Sarkozy – die Assoziationen sind dieselben: Abschaum, Fäulnis, Kot. Sapienti sat.
Oder falls nicht – gewiss ließe sich in der Tradition Freuds und seiner Ausleger dazu eine Menge sagen, aber das können andere besser. Ich will nur darauf hinweisen, dass ontogenetisch, also von der Entwicklung des Einzelwesens her gesehen, mit der Wahrnehmung des eigenen Kots als Schmutz der Schritt hin zum selbständigen, zu Individualität wie Vergemeinschaftung geeigneten Menschen getan wird – und phylogenetisch, also stammesgeschichtlich … nun, Thomas Mann lässt in seiner Moses-Erzählung Das Gesetz die Sauberkeitserziehung das Erste