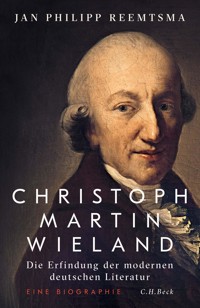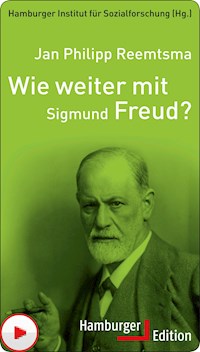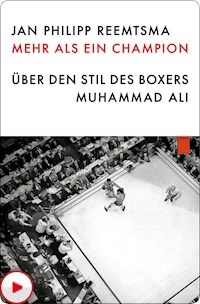9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was heißt das eigentlich: einen literarischen Text interpretieren? Was ist das Reden über Literatur überhaupt für eine Tätigkeit? Womit hat man es zu tun, wenn man es mit literarischer Qualität zu tun bekommt? Hat das Gerede von "Tod des Autors" irgendeinen Sinn und geht es bei Literatur um anderes als um Schönheit? Jan Philipp Reemtsma entwirft in diesem Buch eine radikale Theorie der Lesekompetenz. Lange gab es keine derart virtuose Einführung in die Grundlagen der Literaturwissenschaft. Wer den Literaturwissenschaftler und public intellectual Jan Philipp Reemtsma kennt, der weiß, dass seine Urteile über Texte ob sie von Heinrich von Kleist stammen oder von Stephen King vor allem eines sind: nie langweilig. Sie zeigen nicht nur by the way, was, wie und warum man lesen sollte. Sie verknüpfen auch mühelos Theorie und hermeneutische Praxis, E und U, Germanistik, Philosophie und Polemik. Reemtsmas Grundkurs im Gebrauch von Skalpell und Tupfer im Literatur-OP hat den bestmöglichen Effekt: Man will danach lesen. Besser lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Jan Philipp Reemtsma
Was heißt: einen literarischenText interpretieren?
Voraussetzungen undImplikationen des Redensüber Literatur
C.H.Beck
Zum Buch
Was heißt das eigentlich: einen literarischen Text interpretieren? Was ist das Reden über Literatur überhaupt für eine Tätigkeit? Womit hat man es zu tun, wenn man es mit literarischer Qualität zu tun bekommt? Hat das Gerede von „Tod des Autors“ irgendeinen Sinn – und geht es bei Literatur um anderes als um Schönheit? Jan Philipp Reemtsma entwirft in diesem Buch eine radikale Theorie der Lesekompetenz. Lange gab es keine derart virtuose Einführung in die Grundlagen der Literaturwissenschaft.
Wer den Literaturwissenschaftler und public intellectual Jan Philipp Reemtsma kennt, der weiß, dass seine Urteile über Texte – ob sie von Heinrich von Kleist stammen oder von Stephen King – vor allem eines sind: nie langweilig. Sie zeigen nicht nur by the way, was, wie und warum man lesen sollte. Sie verknüpfen auch mühelos Theorie und hermeneutische Praxis, E und U, Germanistik, Philosophie und Polemik. Reemtsmas Grundkurs im Gebrauch von Skalpell und Tupfer im Literatur-OP hat den bestmöglichen Effekt: Man will danach lesen. Besser lesen.
Über den Autor
Jan Philipp Reemtsma ist Geschäftsführender Vorstand der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur und Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Hamburg. Bei C.H.Beck ist von ihm zuletzt erschienen: Schriften zur Literatur (in drei Bänden, 2015).
Inhalt
Ein- und Durchführung
Schwierigkeiten
Ratlosigkeit
Die Umstehenden
Es lassen
tà toiaũta
Ansichtssachen
Die Nachricht vom Tode des Autors scheint übertrieben
Metaphern verstehen
Verstehen
Paraphrasieren
Subjektive Allgemeinheit
Wer spricht zu wem?
Affekte
Die Welt als Referenzcode und das Erhabene
Die Emanzipation der modernen Philologie von der theologischen – und die Folgen
Sola scriptura, der Blick, die Leute
Schönheit (1)
Schönheit (2)
z.B. Klassik
Klassik als Referenzraum
Schönheit (3)
Dank
Anmerkungen
Wozu langes Ankämpfen gegen fremdeDefinitionen? Man stelle die eigne hin. Jean Paul, Vorschule der Ästhetik
Ein- und Durchführung
Worum es geht, ist längst gesagt, aber selten so schön und pointiert wie hier:
Im Seminar hatten sie zwei Stücke von Shakespeare gelesen, und die Woche endete mit dem Studium seiner Sonette. Die Studenten waren gereizt und verwirrt, fast verängstigt von der wachsenden Spannung zwischen ihnen und jener gebeugten Gestalt, die sie hinter dem Rednerpult hervor ansah. Sloane hatte ihnen das dreiundsiebzigste Sonett laut vorgelesen; und nun schweifte sein Blick durch den Raum, die Lippen zu humorlosem Lächeln zusammengepresst.
«Was bedeutet dieses Sonett?», fragte er abrupt, schwieg wieder und suchte den Raum mit einer grimmigen, beinahe freudigen Hoffnungslosigkeit ab. «Mr Wilbur?» Keine Antwort. «Mr Schmidt?» Jemand hustete. Sloane drehte sich mit dunkel blitzenden Augen zu Stoner um. «Mr Stoner, was bedeutet das Sonett?»
Stoner schluckte und versuchte, den Mund zu öffnen.
«Es ist ein Sonett, Mr Stoner», erklärte Sloane trocken, «eine lyrische Komposition aus vierzehn Zeilen in einer bestimmten Anordnung (…) Der Verfasser heißt William Shakespeare, ein Dichter, der zwar schon tot ist, aber in den Köpfen nicht weniger Menschen dennoch einen Platz von einiger Bedeutung einnimmt. (…) Über drei Jahrhunderte hinweg redet Mr Shakespeare mit Ihnen, Mr Stoner. Können Sie ihn hören? (…) Was sagt er Ihnen, Mr Stoner? Was bedeutet das Sonett?»
Stoner hob langsam und zögerlich den Blick. «Es bedeutet», sagte er und streckte mit vager Bewegung die Hände in die Höhe (…) «Es bedeutet», sagte er noch einmal, konnte aber nicht beenden, was er zu sagen begonnen hatte.
Sloane sah ihn neugierig an.[1]
Das ist schon alles. Das Ihnen hier vorliegende Buch sieht Stoner und überhaupt alle, die den Mund aufmachen, um angesichts eines literarischen Textes «Es bedeutet …» zu sagen, neugierig an. Denn es bleibt ja nicht beim Mundaufsperren. Anschließend wird eine Menge und allerlei gesagt, Gescheites, Verblüffendes, Irritierendes, Irisierendes, Elektrisierendes und dummes Zeug. Darum aber geht es im Folgenden nicht. Ebensowenig um die Frage, wie man das denn macht: über einen literarischen Text reden, damit es kein dummes Zeug wird. Es soll um die Frage gehen, was das für eine Art Reden ist, das Reden über literarische Texte, das dann eben doch meistens zu irgendeinem «Es bedeutet …» wird, zu einer Interpretation. Also was heißt das: einen literarischen Text interpretieren?
Es ist eine Tätigkeit, die unternommen wird, seit es literarische Texte gibt. Nein, natürlich «konstituieren» sich literarische Texte nicht «durch den Akt der Rezeption». Solcher und ähnlicher nichtssagender Unfug soll hier nicht behauptet werden – das ist aber so ziemlich das Einzige, was ich meiner Leserin für das Folgende versprechen kann. Ich werde die Frage in unterschiedlicher Weise stellen und gänzlich befriedigend nicht beantworten können. Warum das so ist oder wahrscheinlich sein muß, wird, wie ich hoffe, im Zuge meines Redens über das Reden über Literatur deutlich werden.
In welches Genre der vorliegende Text gehört – außer daß «Essay» natürlich immer hingeht –, ist vielleicht nicht so wichtig. Ob man ihn «Versuch einer philosophischen Pragmatik des Redens über Literatur» nennt oder vielleicht ein simuliertes Gespräch, tut nichts zur Sache. Es geht um die Problematik des Redens über Literatur, nachdem die Unterscheidung nicht-literarisch/literarisch einmal getroffen ist, und die wird traditioneller-, d.h. historisch kontingenterweise, in vielerlei Arten getroffen. Sie zu treffen, und zwar in einer bestimmten Art, ist aber die Voraussetzung, der der vorliegende Text ein wenig mit Wittgenstein nachzugehen versucht. Sie bedingt sowohl einen jeweils spezifischen individuellen, nicht begründbaren Anfang des Redens über Literatur wie die Nötigung, diese rhetorische Anmaßung rechtfertigend einzuholen – eines der zentralen Themen von Kants «Kritik der Urteilskraft» und ein peripheres Thema von Goethes «Wilhelm Meisters Lehrjahre». Dieser besondere Rechtfertigungsmodus hat Auswirkungen auf die Gemeinschaft derjenigen, die über Literatur reden oder solchem Reden zuhören, mit einer Anspielung auf eine Passage aus Platons «Apologie des Sokrates» hier zuweilen «die Umstehenden» genannt. An die auf diese Weise sichtbar gemachten Probleme schließen sich Gedanken über Notwendigkeiten und Chancen an, die sich daraus ergeben.
Was sich bis zu letzteren Überlegungen sagen läßt, läßt sich auch in einer für solche Thematiken ungebräuchlichen, oder sagen wir: durch andere Kontexte ein wenig erwartungskontaminierten Weise sagen oder, wenn man will, notieren.
Es ist falsch zu glauben, die Aufgabe der Physik sei es, etwas über die Natur herauszufinden. Physik befaßt sich damit, waswir über die Natur sagen können.
Aage Petersen
1. Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache, basierend auf der Möglichkeit, es durch ein Synonym zu ersetzen. Einem Wort, dessen singuläres Vorkommen an einem Orte – d.h. seine Nicht-Ersetzbarkeit durch ein Synonym – durch die Konvention, Texte «literarisch» zu nennen, unterstellt wird, Bedeutung zuzusprechen, ist die Zuschreibung seiner Bedeutsamkeit durch die Interpretation des Textes.
1.1. Die Bedeutsamkeit eines Textes ist der Umgang, den man mit ihm pflegt.
1.1.1. Die Bedeutsamkeit eines Wortes in einem literarischen Text ist der Umgang mit ihm in der Interpretation.
2. Man kann Texte nicht oder mißverstehen. Dann kann man mit ihnen nichts – nichts Einsehbares – anfangen.
2.1. Die Bedeutsamkeit eines Textes ergibt sich aus der Behebung einer Situation des Mißverstehens, seiner Erläuterung.
3. Nicht-literarische und literarische Texte kombinieren sprachliche Zeichen (nicht Töne oder Farben oder Konturen oder raumfüllende Materie); die graphische oder akustische Dimension dieser Zeichen wird als literarische Funktion ihrer Sprachlichkeit aufgefaßt.
3.1. Sprachliche Zeichen haben Bedeutung auf Grund ihrer Ersetzbarkeit durch andere sprachliche Zeichen, d.h. die Operation «x bedeutet dasselbe wie y».
3.1.1. Literarische Texte unterscheiden sich von nicht-literarischen durch die Konvention, die lautliche oder graphische Gestalt ihrer Bestandteile für potentiell bedeutungsvoll zu erklären, d.h. die stets vorhandene Möglichkeit zu sagen, ihre Bedeutung sei nicht «ihr Gebrauch in der Sprache».
3.1.2. Von «literarischen Texten» und über sie zu sprechen heißt, über die Konsequenzen dieser Möglichkeit anhand vorliegender Beispiele zu sprechen.
3.2. Von der «Bedeutung literarischer Texte» zu sprechen heißt, über ihre Literarizität zu sprechen.
3.2.1. Regeln für die Zuschreibung von Literarizität gibt es nicht.
3.2.2. Regeln dafür, einem Bestandteil eines literarischen Textes eine ästhetische Funktion zuzuschreiben, gibt es nicht; es gibt kein Analogon zur Operation «Ersetzung durch ein Synonym» oder «dasselbe mit anderen Worten sagen» (= Paraphrase).
3.3. Literarische Texte haben (insofern) keinen Inhalt und keine Funktion in außerliterarischer Kommunikation. Oder jeden beliebigen.
4. Die Interpretation eines literarischen Textes bezieht sich auf sein Vorhandensein als Werk.
4.1. Ein Werk hat einen Autor.
4.1.1. Ohne Zusprechung des Werkcharakters hätte die Rede von der «Bedeutung eines literarischen Textes» keine Bedeutung.
4.2. Der literarische Text hat eine Bedeutung, die ihr ein Autor gegeben hat. Diese Bedeutung ist nicht die Interpretation (auch nicht durch den Autor).
4.2.1. Von einer Bedeutungsgebung durch Textrezeption zu sprechen ist eine vermeidbare Art, über die Tatsache möglicher verschiedenartiger Textinterpretationen zu sprechen.
4.2.2. Die Interpretation eines literarischen Textes ist stets nur eine mögliche Interpretation und stellt eine mögliche Art, über seine Bedeutung zu sprechen, dar.
4.2.2.1. Es gibt keine richtige Interpretation (im Sinne von: nur diese eine richtige).
4.2.2.2. Es gibt falsche und/oder unsinnige Interpretationen (Fehlinterpretationen).
4.2.2.2.1. Fehlinterpretationen machen u.a. falsche Annahmen über dem Autor mögliche Bedeutungsintentionen.
4.2.2.2.1.1. Von möglichen Bedeutungsintentionen zu sprechen heißt, zu behaupten, daß ein Autor etwas müsse gewollt haben können.
4.2.2.3. Die umfassende Hilfsdisziplin zur Eingrenzung von Bedeutungsintentionen nennt man Literaturgeschichte.
4.3. Ein Text ohne Autor ist bedeutungslos, man kann ihn einen Zufallstext nennen.
4.3.1. Ein hergestellter Zufallstext ist ein Spiel mit dem Verschwinden des Autors, das möglich ist, weil es die Notwendigkeit des Autors als Verständnisregel voraussetzt.
5. Das Reden über literarische Texte ist Darlegung einer Lektüre.
5.1. Diese Lektüre steht in einer Spannung zwischen der Ausrichtung an den Wortbedeutungen (= Bedeutungen, die wir den Wörtern zuschrieben, wäre der Text kein literarischer) und dem Wissen um die Konvention der Literarizität.
5.1.1. Diese Spannung schlägt sich in einem Lektüreerlebnis, einer ästhetischen Aufmerksamkeitskonzentration nieder.
5.1.1.1. Lektüre eines literarischen Textes heißt nicht: Auskunft über einen Affektzustand zu geben.
5.1.1.2. Lektüre eines literarischen Textes heißt nicht: Auskunft über akustische und graphische Eigenarten oder über literarische Texte als historische Dokumente zu geben.
5.1.1.3. Solche Auskünfte sind mögliche Teile der Interpretation literarischer Texte – und müssen dies zuweilen sein.
5.1.2. Die lektürebestimmende Spannung zwischen nicht-literarischer Semantik und dem Wissen um die Konvention der Literarizität konzentriert sich in Leseerlebnissen.
5.1.3. Die Interpretation erweist das Erlebnis als Zeugnis der Lektüre.
5.2. Die Auskunft über das Leseerlebnis beinhaltet die Rekonstruktion des Zusammenhangs von Textbeschaffenheit und (affektiver) Reaktion; in argumentativ geordneter Form ist solche Auskunft die Interpretation des literarischen Textes.
5.2.1. Die Interpretation eines literarischen Textes ist seine Darstellung als Werk und Auskunft über Dimensionen seiner Eigenschaft als bedeutungsvoll.
6. Die Interpretation eines literarischen Textes beansprucht (irgendeine) öffentliche Aufmerksamkeit für die Mitteilung eines subjektiven Erlebnisses.
6.1. Dieser Anspruch impliziert die Selbstverpflichtung, darüber Auskunft zu geben, daß das, was jetzt geredet werden wird, andere etwas angehe.
6.1.1. Die Interpretation ist das Ansinnen einer gemeinschaftlichen Lektüre des literarischen Textes.
6.1.1.1. Die Interpretation kann anhand einer gemeinschaftlichen Lektüre den gemeinsamen Blick auf die Welt ändern. (Man sagt: Es ist auch so.)
6.2. Die Interpretation wirkt, anders als die Rezitation (= «Interpretation» als Homonym), nicht durch Anziehung, sondern durch Argumentation.
6.2.1. Der Beginn der Argumentation ist die unvermittelte Mitteilung einer subjektiven Affiziertheit.
6.2.2. Der Weg der Interpretation besteht in der Thematisierung der ästhetischen Bedeutung, die sie der Spannung zwischen dem Gebrauch eines Textbestandteils in der Sprache und seiner Nicht-Paraphrasierbarkeit zuschreibt.
6.2.2.1. Diese Spannung wird zum Ausdruck gebracht, indem die Als-ob-Lektüre durch den Hinweis auf die Literarizität des Textes unterbrochen wird.
6.2.2.2. Die Als-ob-Lektüre folgt einem Referenzcode, dem sie den Text für eine Weile als zugehörig zuschreibt.
6.2.2.3. Daß die Störung oder Unterbrechung der Lektüre eines literarischen Textes nach Maßgabe eines Referenzcodes durch den Einspruch der Nicht-Paraphrasierbarkeit ihrerseits auf eine Bedeutung verweise (die nicht in der Operation der Synonymisierbarkeit/Paraphrasierbarkeit aufgehe), ist eine (historisch erfolgreiche) Konvention.
6.2.2.4. Es handelt sich bei den Bedeutungszuschreibungen für Literarizität um Vorschläge für eine Regel, die im Zweifelsfall durch ihre Erstanwendung, die Anlaß für diese Zuschreibung ist, gesetzt ist.
6.2.2.4.1. Die literarische Urteilskraft besteht ebenso in der Anwendung von Regeln auf Einzelfälle wie der Extrapolation möglicher Regeln aus Einzelfällen.
6.2.2.4.2. Diese Extrapolationen sind gelungen, wenn sie eine gemeinsame Sicht auf den literarischen Text als wesentlichen Beitrag zu einer neuen/veränderten/modifizierten gemeinsamen Sicht auf die Welt erlauben.
6.2.2.4.2.1. Eine überzeugende Interpretation eines literarischen Textes bedeutet die Erweiterung diesbezüglicher Kommunikationsmöglichkeiten und ihre tendenzielle Konventionalisierung in spezialisierten (gebildeten) Öffentlichkeiten.
6.2.2.4.2.2. Das Reden von der «Wahrheit» im Zusammenhang der Interpretation eines literarischen Textes deutet, wenn es denn etwas bedeutet, auf diese Erweiterung hin.
6.2.2.4.2.3. Davon zu sprechen, daß ein literarischer Text schweige, durch Schweigen spreche, zeige, aber nicht sage, und derlei mehr, ist keine Aussage über einen besonderen literarischen Text, sondern benennt die Besonderheit der Rede über literarische Texte.
6.3. Die Interpretation erweist den literarischen Text als ein bedeutungsvolles Ganzes.
6.3.1. Das Reden über einen literarischen Text als ein bedeutungsvolles Ganzes ist ein Reden über die Art seiner Schönheit.
6.3.1.1. Gegenstand der Interpretation des literarischen Textes ist seine Schönheit.
6.3.1.1.1. Das Fragment ist eine Spielart des Ganzen.
6.3.1.1.2. Das Erhabene ist eine Spielart des Schönen.
6.3.2. Das Erhabene – oder andere ästhetische Spielformen des Schönen (wie das Häßliche) – als moralisch bedeutsam darzustellen bedeutet eine Verwechslung von Referenzcode und Werk.
6.4. Das Absurde ist der Umstand der Nichtkongruenz der Schönheit des Werks mit den eventuellen Ordnungsvorstellungen eines möglichen auf die Welt bezogenen Referenzcodes.
6.4.1. Das Absurde ist eine philologische Kategorie.
6.5. Das Werk ist ein Ganzes, die Welt nicht.
7. Die Möglichkeit, über die Schönheit eines literarischen Textes zu sprechen, setzt eine exklusive Form von Gemeinschaftlichkeit voraus, nämlich eine Partialöffentlichkeit, in der die Bildungsvoraussetzungen gegeben sind, unter denen über die Schönheit literarischer Texte geredet werden kann.
7.1. Historisch kommen solche Partialöffentlichkeiten zuerst als – in der Regel sozial verortbare – Geschmacksgemeinschaften vor, in denen es um den Konsens als Zugehörigkeitskriterium (und die Vorstellung von seiner Nichtkontingenz) geht, und dann, nach deren Zerfall, als solche, die – sozial und geographisch potentiell diffus – sich der Wandelbarkeit ihrer Konsense und deren Kontingenz bewußt sind.
7.1.1. Um die Kontingenz eines Konsenses zu wissen bedeutet nicht: nicht um ihn streiten.
7.2. Eine solche zureichend gebildete und hinreichend diffuse Partialöffentlichkeit verfügt über die Idee der Menschheit als regulatives Ideal der Pflege eines interesselosen (= nicht durch präferierte Referenzcodes blockierten) Interesses an der Schönheit und der Idee der Verallgemeinerbarkeit.
7.2.1. Diese (zureichend gebildete und hinreichend diffuse) exklusive Partialöffentlichkeit pflegt so ein Ideal einschränkungsloser Inklusivität.
7.2.1.1. Die Verwechslung der Idee der Menschheit als regulativer Idee zur Gestaltung des Redens über das Schöne mit einer politischen Idee führt zu Verwirrungen und dem die Eigenart des Redens über Literatur verkennenden Gerede über die politisch zu affirmierende soziale Funktion von Kunst.
7.3. Das Interpretieren literarischer Texte findet innerhalb einer zureichend gebildeten Partialöffentlichkeit statt und hat den Sinn, sie zu erhalten.
7.3.1. Die Erhaltung einer zureichend gebildeten und hinreichend diffusen Partialöffentlichkeit, in der über literarische Schönheit geredet wird, ist eine der notwendigen Bedingungen zur Erhaltung dessen, was wir vielleicht «eine literate Gesellschaft» nennen möchten, nachdem die sie repräsentierenden Geschmacksgemeinschaften nicht mehr existieren.
8. Das habituelle Interpretieren von literarischen Texten in zureichend gebildeten Partialöffentlichkeiten hat eine auf andere Weise nicht mögliche kognitive Erschließung der Welt durch Verstehen kollektiv rezipierter affektiver Reaktionen in der Form sprachlicher Artistik mit sich gebracht.
8.1. «Shakespeare hat uns erfunden.» (Harold Bloom)
Ich führe die acht Sätze im Folgenden aus und ergänze, worum es in ihnen geht, um allerlei, auch Exemplarisches und ebenso unzufällige wie zuweilen umfangreiche, aber nicht mutwillige Asides.
Schwierigkeiten
Ratlosigkeit
Helena: So sage denn, wie sprech’ ich auch so schön?Faust: Das ist gar leicht, es muß von Herzen gehn.
Johann Wolfgang von Goethe, Faust.Der Tragödie Zweiter Theil
Am 10. April 1917 schreibt ein Dr. Siegfried Wolff an Franz Kafka:
Sehr geehrter Herr,
Sie haben mich unglücklich gemacht.
Ich habe Ihre Verwandlung gekauft und meiner Kusine geschenkt.
Die weiß sich die Geschichte aber nicht zu erklären. Meine Kusinehats ihrer Mutter gegeben, die weiß auch keine Erklärung.
Die Mutter hat das Buch meiner anderen Kusine gegeben und die hat auch keine Erklärung.
Nun haben sie an mich geschrieben. Ich soll ihnen die Geschichte erklären. Weil ich der Doctor der Familie wäre.
Aber ich bin ratlos.
Herr! Ich habe Monate hindurch im Schützengraben mich mit den Russen herumgehauen und nicht mit der Wimper gezuckt. Wenn aber mein Renommee bei meinen Kusinen zum Teufel ginge, das ertrüg ich nicht.
Nur Sie können mir helfen. Sie müssen es; denn Sie haben mir die Suppe eingebrockt. Also bitte sagen Sie mir, was meine Kusine sich bei der Verwandlung zu denken hat.
Mit vorzüglicher Hochachtung
ergebenst Dr. Siegfried Wolff[2]
Was immer dem Manne zu schreiben gewesen wäre, es wäre ihm nicht zu antworten gewesen. Nicht wegen besonderer Eigenschaften der Erzählung «Die Verwandlung», nicht wegen irgendwelcher Eigenarten des Autors Franz Kafka. Sondern aus ungefähr demselben Grunde, aus dem jemand, der noch nie einen Witz gehört hat, keinen Witz versteht, wenn er einen hört. «Einen Witz verstehen» hat zur Voraussetzung, daß man an der sozialen Praxis «Witze hören und erzählen» teilhat. Man kann in solche soziale kommunikative Praxen nicht einfach hineinspringen. Man wird in ihnen groß.
Und doch sind sie nicht selbstverständlich, besser gesagt: sie sind nicht so selbstverständlich, daß ihre Selbstverständlichkeit einem Nachdenken über sie erfolgreich Widerstand entgegensetzen könnte, allerdings immerhin so selbstverständlich, daß ihre Selbstverständlichkeit zuweilen einigen Eigensinn gegen manche Form der Problematisierung und vor allem gegen die Thematisierung dieser Selbstverständlichkeit selbst mobilisiert.
Die Umstehenden
Er, der immer nur im Wahnsinn handelt (…)Seiner Klagen Reim’, in Sand geschrieben, Sind vom Winde gleich verjagt; Er versteht nicht, was er sagt
Johann Wolfgang von Goethe,West-Östlicher Divan, «Anklage»
Nach den Staatsmännern nämlich ging ich zu den Dichtern, den tragischen sowohl als den dithyrambischen und den übrigen, um dort mich selbst durch die Tat zu überführen als unwissender denn sie. Von ihren Gedichten also diejenigen vornehmend, welche sie mir am vorzüglichsten schienen ausgearbeitet zu haben, fragte ich sie aus, was sie wohl damit meinten, auf daß ich auch zugleich etwas lernte von ihnen. Schämen muß ich mich nun freilich, ihr Männer, euch die Wahrheit zu sagen: dennoch soll sie gesagt werden. Um es nämlich geradeheraus zu sagen, fast sprachen alle Anwesenden besser als sie selbst über das, was sie gedichtet hatten.[3]
Es geht hier nicht um das, was die Umstehenden – vielleicht – besser wissen über das, was «die Dichter meinen», sondern, daß die Dichter selbst keine befriedigende Auskunft geben.
Die Erzählung, wie es denn zu solchen Fragen und Befunden gekommen ist, sei in Erinnerung gerufen: Ein Orakelspruch besagt, Sokrates sei der «weiseste» der Menschen, Sokrates erhebt Einspruch: Das könne nicht sein, denn er wisse, daß er nichts (nichts wirklich, nichts genau oder zureichend) wisse, aber der Gott lüge ja nicht – was also meine er? Es folgt die Befragung der Zünfte und Talente, die der Politiker zunächst, am Ende der Handwerker, dazwischen die der Dichter. Den Dichtern ergeht es wie den Politikern, sie können über das, was sie tun, keine befriedigende Auskunft geben. Die Politiker erscheinen schlechthin als Blender, die Dichter können, was sie können, aber können darüber nichts Ordentliches sagen, die Handwerker können über ihr Handwerk Auskunft geben, aber sowohl die Dichter als auch die Handwerker meinen, auch über alles mögliche andere mitreden zu können. Daraus folgt Sokrates’ Einsicht, der Weiseste sei der, der, wie er, eingesehen habe, daß er nichts wisse. Oder so: Besser sei es, gar nichts zu wissen bzw. können, als auf Grund dessen, was man kann, sich darüber hinaus etwas anzumaßen. Daher die sokratisch/platonische Vorstellung eines Gemeinwesens der Fachleute, geführt von denen, die über das Wissen um das Wesen der Dinge verfügen, den Philosophen. Das lassen wir auf sich beruhen.
Die Frage nach dem, «was der Dichter gemeint habe», ist also alt. Wahrscheinlich so alt wie Literatur, die, gehört oder gelesen, Gespräche nach sich zieht. Aber: um was geht es dieser Frage eigentlich? Ist sie letztlich nur Ausdruck der Enttäuschung darüber, daß die Dichter nichts der Art sagen, die der Fragende erwartet hat? Platon/Sokrates fährt ja fort, das komme wohl daher, daß die Dichter wie die Wahrsager oder Orakelsänger in einer Art Besessenheit Worte machten, sie «sagen viel Schönes, wissen aber nichts von dem, was sie sagen».[4] Das war eine folgenreiche Annahme. Sie konnte Verehrung und Verachtung der Dichter zusammenbringen, den göttlichen mit dem weltfremden Sänger. Jedenfalls hat sie die Rolle der «anderen Anwesenden» insofern gerechtfertigt, als daß es ja irgendwen geben muß, der sagt, was die Dichter «eigentlich meinen» – und so steht diese Frage auch am Anfang unseres Redens darüber, was das Reden über Literatur eigentlich für eine Beschäftigung sei.
Aber eben nicht als eine Frage, die einen Abstand schafft und die ein Phänomen als Problem anzusehen möglich macht, sondern als Selbstverständlichkeit. Noch Adorno spricht vom «Rätselcharakter» aller Kunst,[5] meint damit gewiß etwas anderes als das, was schlechten Literaturunterricht seit jeher kennzeichnet («Was will uns der Dichter damit sagen?»), aber die Vorstellung, daß Dichtung in irgendeiner Weise nicht sage, was sie ausspreche – oder nicht ausspreche, was sie sagen wolle –, bleibt doch gedankenleitend.
Nicht, daß ich meinte, das Reden über Literatur brauche so eine Legitimation, um betrieben zu werden. Dieses Reden über Literatur gibt es so, wie es Literatur gibt. Beides gehört zu unserer Kultur; beides gehört in unserer Kultur zusammen. Aber: Reden über Literatur braucht Literatur – trivialerweise –, umgekehrt gilt das nicht. Und Ratio oder Ethos des Redens über Literatur kann man nicht aus Behauptungen darüber ableiten, was es mit dieser im eigentlichen Sinne auf sich habe. Über das Reden über Literatur nachzudenken heißt nicht, ästhetische Theorie oder Theorie des Ästhetischen durch die Hintertür zu betreiben. Das ist das erste, was man aus Kants «Kritik der Urteilskraft» lernen kann.
Bei Platon gibt es bereits kein Verwechseln mehr von Kunst und Beschwören des oder Sprechen aus dem Numinosen. Hier mag Ähnliches vor sich gehen – Platon enthält sich da –, aber dasselbe ist es nicht. Die Frage nach dem, was die Dichter «eigentlich meinen», klingt aber ganz so, als wäre diese Unterscheidung bei denen, die anfangen, über literarische Werke zu sprechen – sie zu interpretieren –, nicht recht angekommen. Jedenfalls scheint es gelegentlich so zu sein, daß dort, wo das Reden über Literatur sich selbst feiert, es den eigenen Reiz aus magischer Selbstkostümierung zu gewinnen versucht:
Die Werke sprechen wie Feen in Märchen: du willst das Unbedingte, es soll dir werden, doch unkenntlich. Unverhüllt ist das Wahre der diskursiven Erkenntnis, aber dafür hat sie es nicht; die Erkenntnis, welche Kunst ist, hat es, aber als ein ihr Inkommensurables (…) In oberster Instanz sind die Kunstwerke rätselhaft nicht ihrer Komposition sondern ihrem Wahrheitsgehalt nach. Die Frage, mit der ein jegliches (Kunstwerk) den aus sich entläßt, der es durchschritt – die: Was soll das alles?, rastlos wiederkehrend, geht über in die: Ist es denn wahr? (…) Die letzte Auskunft diskursiven Denkens bleibt das Tabu über der Antwort. Als mimetisches sich Sträuben gegen das Tabu sucht Kunst die Antwort zu erteilen, und erteilt sie, als urteilslose, doch nicht; dadurch wird sie rätselhaft wie das Grauen der Vorwelt, das sich verwandelt, nicht verschwindet; alle Kunst bleibt dessen Seismogramm. Für ihr Rätsel fehlt der Schlüssel wie zu den Schriften mancher untergegangenen Völker.[6]
Selbstfeier – wogegen per se nichts zu sagen ist, aber was wird da gefeiert? Es scheint mir, daß es nur Sinn hat, von unlösbaren Problemen zu sprechen, wenn man eine wenigstens ungefähre Vorstellung davon hat, wie eine Lösung aussehen könnte. Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von Kunstwerken scheint mir der nach dem Sinn des Lebens zu ähneln – nicht, daß sie nicht eindeutig so oder so zu beantworten wäre, ist das Problem, sondern daß man, wenn man über sie grübelt, gar nicht weiß, welcher Art die Antwort wohl wäre, damit wir sie überhaupt als Antwort erkennen könnten.
Die Selbstverständlichkeit, daß Literatur ohne Reden über Literatur nicht vorkommt, ist, was die Rede des Sokrates dokumentiert. Man tut es einfach, und niemand wundert sich darüber. Aber diese Selbstverständlichkeit scheint eine Unterstellung mit sich zu bringen, daß es ein irgendwie beschaffenes Etwas gebe, auf das das Reden ziele, daß es nicht einfach Gerede sei, so oder so beschaffen, nicht ein Gerede wie bei einem Feuerwerk oder einem Sonnenuntergang oder derlei, d.h. allenfalls nach Klischeerepetition und originellem Einfall unterschieden. Obwohl es, möglicherweise, genau das ist.
Es lassen
In jeder Kunst (…) obliegt (es) der Praxis, die Schwierigkeiten zu zeigen und die Erscheinungen anzugeben, und der Spekulation, die Erscheinungen zu erklären und die Schwierigkeiten zu beseitigen. Daraus folgt, daß es kaum einen vernünftigdenkenden Künstler gibt, der über seine Kunst gut sprechen kann.
Denis Diderot
Daß es sich beim Interpretieren literarischer Texte um eine Tätigkeit handle, die alles andere als selbstverständlich sei, wenn sie auch seit alters her zu beobachten ist, lautet die These Susan Sontags aus ihrem Essay «Against Interpretation».[7] Es handle sich um eine Usurpation der Umstehenden (wenn wir auf die Schilderung des Sokrates sehen), die den Dichter, der nur zu sagen hat, was er geschrieben hat, non est dicendum ultra quod scripsi, gewissermaßen übertönt, mundtot macht oder gar schrifttot, eine philisterhafte Zusammenrottung vitalen Pöbels, die begonnen habe mit dem Übersetzen religiöser Semantiken in profane. Die «Texte des Altertums» seien «in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr tragbar» gewesen. «Damals griff man zur Interpretation und brachte auf diese Weise die alten Texte mit den ‹modernen› Ansprüchen in Einklang. So allegorisierten die Stoiker, ihrer Vorstellung von der moralischen Lauterkeit der Götter entsprechend, die derben Züge hinweg, die Zeus und seinem ungestümen Clan in Homers Epen eigen sind. Was Homer mit dem Ehebruch des Zeus mit der Leto zum Ausdruck bringen wollte, so erklärten sie, war die Vereinigung von Macht und Weisheit. Auf die gleiche Weise interpretierte Philo von Alexandria die wahrheitsgetreuen historischen Geschichten der hebräischen Bibel als religiöse Paradigmen.» Man habe, aus einer Art Pietät, an Texten festhalten wollen, die in ihrer «offensichtlichen Bedeutung» unannehmbar geworden seien. Man habe sie also neu interpretiert, und dies mit der Geste, die «wahre Bedeutung» der Texte «aufzudecken».
«In unserer Zeit», fährt Sontag fort, «ist die Interpretation sogar noch komplexer. Denn die zeitgenössische Begeisterung für die Interpretation hat ihren Grund häufig nicht in der Ehrfurcht vor dem beschwerlichen Text (…), sondern in einer offenen Aggressivität, einer offenkundigen Verachtung des äußeren Erscheinungsbildes.» Es gehe dem Interpretieren darum, den Sinn hinter der Kulisse, unter der Oberfläche (oder wie auch immer) sichtbar zu machen. Verantwortlich für diesen Wahn, etwas aufdecken oder hervorholen zu müssen, macht Sontag die «meistgepriesenen und einflußreichsten modernen Lehren, die von Marx und Freud», die «letztlich auf ein wohldurchdachtes hermeneutisches System (…), auf aggressive und pietätlose Interpretationstheorien» hinausliefen. Marx habe Revolutionen und Kriege, Freud Träume und Versprecher als Ausdrucksformen von etwas anderem verstanden. Beide hätten «interpretiert». «Und interpretieren heißt das Phänomen neu formulieren, letztlich ein Äquivalent für das Phänomen finden.»[8]
Daß es Sontag zunächst um eine Polemik gegen eine intellektuelle Mode in den USA Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts und, was die angeführten Beispiele zeigen, um ein paar zugegebenermaßen zu Recht abzukanzelnde Auswüchse geht, sei angemerkt. Ja, gewiß verlöre «A Streetcar Named Desire» an Schmelz, und auch Kazans Verfilmung täte das, sähen wir das Stück so an, wie es der Regisseur nicht verfilmt, sondern wie er seine Verfilmung (nach Sontags Referat) kommentiert hat: als eine Allegorie von Zivilisation und Barbarei (oder so). Selbst wenn Tennessee Williams solcher Interpretation zugestimmt hätte, wäre sie nicht richtiger geworden, sondern zeigte entweder des Dichters eigenes philisterhaftes Gemüt – oder gewisse Schwächen seiner Dichtung: «Vielleicht glaubte Tennessee Williams selbst, daß Kazan recht hat mit seiner Deutung von ‹A Streetcar Named Desire›. Es mag sein, daß Cocteau die auf Freudsche Symbolik und Gesellschaftskritik ausgerichteten, kunstvollen Auslegungen seiner Filme ‹Le sang d’un poète› und ‹Orphée› gewollt hat. Aber das Verdienst dieser Filme liegt sicher nicht in ihrer ‹Bedeutung›. Ja, Williams’ Stücke und Cocteaus Filme sind in genau dem Maße mangelhaft, unaufrichtig, ersonnen, unüberzeugend, in dem sie derlei ominöse Bedeutungen suggerieren.»[9] Dann wären es also – jedenfalls in solchen Fällen – nicht die Umstehenden, die schädlichen oder schändlichen Unsinn über die Werke der Dichter verbreiten, sondern die – manche – Dichter selbst, die schon gleich auf den Beifall der Interpretation schielen. Sontag möchte einen Paradigmenwechsel, könnte man sagen, oder einen Generationenwechsel unter den Tonangebenden, den Meisterdenkern bzw. den Vormündern (wie Hamann süffisant, auf Kant gemünzt, gesagt hat). Diese Attitüde jugendlichen Mutes hat in ihrer von Generation zu Generation weitergereichten Routiniertheit etwas schon in den Kinderschuhen Vergreistes, aber nicht nur die sie stets aufs neue auf neu polieren, sondern auch die sie wie ein neues Wunder anstaunen, gibt es immer wieder. Aber das nur am Rande.
Für unseren Zusammenhang wichtig ist die Kennzeichnung von «interpretieren» als eine Tätigkeit à la «‹Was X sagen will, ist …›, ‹Was X meinte, ist …› und so weiter und so weiter»:
Die Arbeit der Interpretation ist im Grunde eine Übersetzungsarbeit. Der Interpret sagt: Schaut her, seht ihr nicht, daß X in Wirklichkeit A ist – oder bedeutet? Daß Y in Wirklichkeit B ist? Daß Z in Wirklichkeit C ist? (…) Schon seit Jahrzehnten haben es Literaturkritiker als ihre Aufgabe betrachtet, die Elemente des Gedichts, des Dramas, des Romans oder der Erzählung in etwas anderes zu übersetzen.[10]
Die «Aggressivität» und «Pietätlosigkeit», die Sontag den marxschen oder freudschen Hermeneutiken zuschreibt, sind für sie nur radikale Ausprägungen einer grundsätzlichen aggressiven Pietätlosigkeit aller Hermeneutiken, die sich auf solche Formeln bringen lassen. Deren Ursachen, besser: deren Ursünde liegt für sie in einem grundsätzlich falschen Verständnis von Kunstwerken, das darin bestehe – siehe oben –, Kunstwerke überhaupt als Träger von «Bedeutungen» anzusehen und ihnen einen Inhalt zuzuschreiben, den man befragen könne. Man solle aber Kunstwerke auffassen wie Naturgegenstände: gegeben, einfach «da», ohne Bedeutung. Nun sind, wäre einzuwenden, Kunstwerke aber keine Naturdinge. Warum sollte man sie also so ansehen, als wären sie welche? Zumal über die doch auch Entbehrliches geschwatzt wird. Nur, eben, so recht interpretieren lassen sie sich – nach dem Ende aller Theodizee – nicht. Das wäre aber im Grunde der Triumph der Profanisierung: daß die Texte, die heilig waren, auch nicht mehr Träger von «Bedeutung» (und sei es von Philistern zusammengepfuschter und mit der Geste des Kennertums servierter) wären, sondern bloß ebenso da wie Stein und Moos und Eidechs. Anstaunen kann man das – aber: warum sollte man?
Susan Sontag polemisiert gegen eine gewisse Art von auskennerischem Feuilleton. Was sie dagegensetzen möchte, bleibt unklar.[11] Der Satz «Statt einer Hermeneutik brauchen wir eine Erotik der Kunst»[12] hilft nicht weiter. Was wäre das denn? Und was wäre das für eine Erotik, die solcherart «gebraucht» und dekretiert wird? Das ist Gerede. Aber was ist es mit der Kunst, den «literarischen Texten»? Wenn sie denn nur bestaunt (aber was sagt man dem, der nicht staunt?) oder schweigend begafft (wo wäre der Unterschied?, aber man muß vielleicht keinen machen) werden sollen, was machen wir mit dem Redebedürfnis der «Umstehenden»? Wie wäre es zu verstehen, was macht seine Selbstverständlichkeit aus, was ist es, um die stoische Formel zu verwenden, «an sich selbst»?
Susan Sontag identifiziert das Reden über Kunst/Literatur mit einer bestimmten Form, die es annehmen kann, der des Übersetzens von einer Art des Sprechens in eine andere, verbunden mit der Behauptung «dies bedeutet das». Das eine verberge etwas, das das andere entberge. Vielleicht liegt darin der Ertrag von Sontags Polemik: daß beim Reden über das Reden über Literatur nicht vermutet werden müsse, es gehe irgend um Wahrheit (also gegen das diesbezügliche Brüderpaar Heidegger und Adorno). Noch daß es etwas Besonderes zu entdecken gäbe bzw. daß es dem Reden über Literatur darum gehen müsse. Dem Brief des Dr. Wolff an Franz Kafka liegt dasselbe Verständnis von «Interpretieren» zu Grunde – nur eben geschrieben voll verzweifelter Hoffnung – wie Susan Sontags Essay – der eben verfaßt mit dem Abscheu vor dem Weihwasser der Laienpfaffen.
Kann man die Frage niedriger hängen? Was tut einer, der über einen literarischen Text redet? Das ist die Frage in Platons «Ion».
tà toiaũta
Wie gefällt dir Musik? Gut. Was magst du besonders? Das. Was meinst du damit? Na, das hier.
«Deine Freunde», Erzähl mal
Goethe meinte, Sokrates habe uns in seinem «Ion» eine Art Possenspiel à la Aristophanes gegeben: «(Sokrates) begegnet einem Rhapsoden, einem Vorleser, einem Declamator, der berühmt war wegen seines Vortrags der homerischen Gedichte und der so eben den Preis davon getragen hat und bald einen andern davon zu tragen gedenkt. Diesen Ion giebt uns Plato als einen äußerst beschränkten Menschen, als einen, der zwar die homerischen Gedichte mit Emphase vorzutragen und seine Zuhörer zu rühren versteht, der es auch wagt, über den Homer zu reden, aber wahrscheinlich mehr um die darin vorkommenden Stellen zu erläutern als zu erklären, mehr bey dieser Gelegenheit etwas zu sagen als durch seine Auslegung die Zuhörer dem Geist des Dichters näher zu bringen.» Und solche Erläuterung möchte Goethe auch gerne für den Platon des «Ion»: «wer uns auseinandersetzte, was Männer wie Plato im Ernst, Scherz und Halbscherz, was sie aus Ueberzeugung, oder nur discursive gesagt haben, würde uns einen außerordentlichen Dienst erzeigen und zu unserer Bildung unendlich viel beytragen».[13]
Man muß sich in den Zeitkontext hineindenken, dann wird es komisch, und der Dialog dürfte seine Wirkung auf sein Publikum, das man sich als ein für solche Scherze geeignetes vorzustellen hat, nicht verfehlt haben. Aber davon ganz abgesehen lohnt es sich vielleicht, hier auf einen Text näher einzugehen, der auf ebenso entschiedene wie umständliche Weise einen Erkenntnis-, ja Erörterungsverzicht aufweist. Man ist auf so etwas bei Platon nicht unbedingt gefaßt; auch die sogenannten «aporetischen» Dialoge sind nicht von solcher Art. Sie haben jedenfalls ihre traditionelle philosophische Würde, der «Ion» hat die nicht.
Es ist reizvoll, den «Ion» vor dem Hintergrund zu lesen, den Christian Meier «ein eigentümliches Bewußtsein menschlichen Könnens»[14] genannt hat: jener plötzlich in Athen aufbrechenden Idee, die Welt zur Verfügung zu haben. Nicht in ihr einen ruhmvollen Platz einzunehmen, sondern sie nach eigenen – und das heißt: menschlichen, und das heißt: athenischen – Maßen zu gestalten. Ein plötzlicher Wahn, der Künstler und Techniker, Gelehrte und Politiker sonderbar einte; ein Wahn, ohne den wir, unsere Zivilisation, unsere Kunst, unsere Literatur, unsere Vorstellung von Politik – sehr anders wären.
Ein Wahn, wenn man es pointieren will, der auf den Ruderbänken der athenischen Flotte in der Bucht von Salamis begann. Man datiert sicherlich nicht zu Unrecht den entscheidenden Schub, den die athenische Idee von Demokratie erhielt, auf dieses Gemeinschaftserlebnis. Auch die früheren Verfassungen der athenischen Polis sind vor militärischem Hintergrund zu verstehen. Das Bürgerheer der schwerbewaffneten Hopliten löste das aristokratische mit Fußvolk und Kavallerie ab, was nicht ohne Folgen blieb. Aber das auf die Hoplitenphalanx gestützte Kriegführen war allen griechischen Poleis gemeinsam. Das Salamis-Erlebnis nicht.
Welche Rolle auch immer das Moment des Egalitären gespielt haben mag, für das, was uns hier interessiert, ist der Entschluß, die Stadt zu evakuieren, sie dem Feind zur Plünderung zu überlassen, den Sieg über die persische Flotte in den vertrauten Buchten zu suchen, entscheidend gewesen. Man tat etwas Unerhörtes. Man kämpfte nicht mehr, wie es später römisch hieß, pro aris et focis. Man ließ die Stadt zerstören. Man würde sie wieder aufbauen. Man mutete das einer gesamten Stadtbevölkerung zu. Und die machte widerspruchslos (soweit wir wissen) mit. Man gewährte sich Definitionsfreiheit: was «die Stadt», ihr Heiliges, ihr Heimatliches sei, was nur ein Manöver und noch keine Niederlage – und spielte, das sollte man nicht vergessen, va banque, denn eine Seeschlacht dieser Art hatte es noch nicht gegeben, und ausgemacht war selbst bei einem Sieg nicht, daß das persische Landheer Athen räumen würde. Aber es kam alles so, als hätte es nicht anders kommen können. «Es kam die Meinung auf, daß es keinen Zufall gebe; das sei nur eine Ausrede von Leuten, die nicht richtig gerechnet hätten: So fand denn auch Perikles, daß man einen ganzen großen Krieg zwischen Athen und Sparta planen könnte.»[15]
Das war fünfzig Jahre danach. Und es war dieser Krieg – nicht zuletzt die wahnhafte Kalkulation des sonderbaren und bis heute sonderbar verehrten Perikles –, der dieses «Könnensbewußtsein» historisch folgenreich erschütterte. Folgenreich: die Erfindung der Philosophie kommt da her.
Intellektueller Ausdruck des «Könnensbewußtseins» war die sogenannte Sophistik. Ursprünglich war «Sophist» eine Bezeichnung für einen gelehrten, vielleicht besser: viel bewanderten Mann. In den entscheidenden Athener Jahren wird daraus die Bezeichnung für einen, der sein Wissen für Geld weitergibt – und vor allem rhetorische Techniken vermittelt, die den Sieg im argumentativen Wettstreit oder überhaupt in Debatten sicherstellen sollten. In der Polemik gegen die Sophistik wird daraus der Vorwurf, sie versuchten aus Schwarz Weiß zu machen.
Die Niederlage Athens, der Sieg Spartas widerlegte – in den Augen mancher – zweierlei: die Demokratie und den Machbarkeitswahn. Poetisch waren beide zuvor deutlich in Frage gestellt worden, durch Aristophanes, durch Sophokles in der «Antigone», durch Euripides in den «Troerinnen» (letzteres eine deutliche Warnung vor dem Versuch Athens, den Krieg durch seine Ausweitung und Radikalisierung zu gewinnen). Sokrates verkörperte die Kritik sowohl an der Sophistik wie am politischen Konzept der Mitbestimmung aller über alles.
Sokrates war ein antisophistischer Sophist, so wie Jesus von Nazareth ein antipharisäischer Pharisäer war.[16] Sokrates fragte, wenn wir den Überlieferungen glauben können, seine Mitbürger nach ihren Überzeugungen und Gewißheiten mit dem Ziel, zu zeigen, wie schlecht begründet sie seien. In seinen Auseinandersetzungen mit anderen Sophisten versuchte er zu zeigen, in welcher Weise eine bloß technisch ausgefeilte Argumentationskunst sowie die in Athen modische intellektuelle Selbstgefälligkeit und zur Schau gestellte Abgebrühtheit moralisch wie politisch fatal seien. Außer einem oft diffusen Konservatismus[17] setzte er dem herrschenden Könnensbewußtsein aber nur eine fragende, letztlich destruktive Haltung[18] entgegen. Sein Schüler Platon verwendete die lebendige Erinnerung an Sokrates, um ihn zu einer – seiner – literarischen Kunstfigur zu machen, in deren Namen er das begründet, was dann abendländisch «Philosophie» heißen sollte. Es geht dabei um Letztbegründungen, um die Ersetzung der Debatte um das, was richtig, schön, gut, erstrebenswert, abzulehnen, böse etc. sei, durch eine intellektuelle, zuweilen divinatorisch gefärbte Suche nach «dem» Schönen, Guten etc., aus deren Erkenntnis abzuleiten sei, was im Einzelfall zu sagen wäre. Kurz: Es geht um die Postulierung eines neuen intellektuellen Raums, der Transzendenz, als unerläßlicher Grundlage sicheren Urteilens. Nicht alle Philosophie ist diesem von Platon eingeführten Gestus gefolgt, aber auch wer dissentiert, tut das in Abgrenzung.[19]