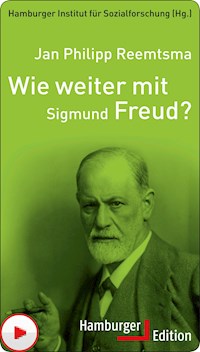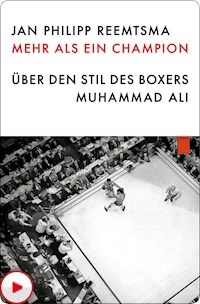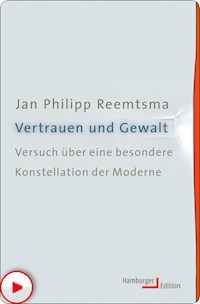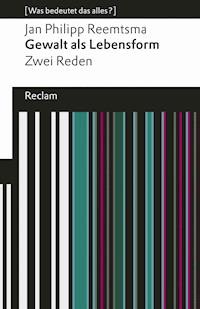28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit Christoph Martin Wieland beginnt die moderne deutsche Literatur. Er eröffnet sie nicht nur selbst mit seinen Werken, sondern er ist auch der «Erfinder» dessen, was wir heute die «Weimarer Klassik» nennen. Mit seiner langerwarteten Biografie – der ersten seit siebzig Jahren – befreit Jan Philipp Reemtsma Wieland endlich aus dem langen Schatten, in den ihn Goethe und Schiller gestellt haben. Sein «Wieland» ist aufregend und fulminant, ein germanistischer Glücksfall, denn er gibt uns einen Klassiker zurück, ohne den die Verwandlung der deutschen Literatur in eine vor und eine nach Weimar gar nicht angemessen verstanden werden kann. Innovator, Aufklärer, Schriftsteller, Journalist, political animal, Menschenkenner, all das war der geistige Pate Weimars, Christoph Martin Wieland. Neben Lessing ist er die Zentralgestalt der deutschen Aufklärung. Durch ihn wird der Roman in Deutschland zu einer anerkannten Literaturgattung, er schreibt die erste moderne deutsche Oper und bringt mit seinen erotischen Verserzählungen einen neuenTon in die deutsche Poesie. «Der Teutsche Merkur», damals eine der wichtigsten literarisch-politischen Zeitschriften Europas, wird von ihm herausgegeben, und gleichsam nebenbei prägt er das Genre des politischen Journalismus mit seinenTexten über die Französische Revolution und Napoleon, dessen Alleinherrschaft er frühzeitig vorhersah und den er 1808 in Weimar auch persönlich traf. Gründe genug, Wieland neu zur Kenntnis zu nehmen. Jan Philipp Reemtsmas grandiose Biografie, die Summe einer jahrzehntelangen Forschung, bietet die Gelegenheit dazu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jan Philipp Reemtsma
CHRISTOPH MARTIN WIELAND
Die Erfindung der modernen deutschen Literatur
In Zusammenarbeit mit Fanny Esterházy
C.H.Beck
Zum Buch
«Nach meinem Tode wird’s endlich herauskommen, was ich war, und mir wird mit vollem gerütteltem und geschütteltem Maas Gerechtigkeit wiederfahren.»
Christoph Martin Wieland
Mit Christoph Martin Wieland beginnt die moderne deutsche Literatur. Er eröffnet sie nicht nur selbst mit seinen Werken, sondern er ist auch der «Erfinder» dessen, was wir heute die «Weimarer Klassik» nennen. Mit seiner langerwarteten Biographie – der ersten seit siebzig Jahren – befreit Jan Philipp Reemtsma Wieland endlich aus dem langen Schatten, in den ihn Goethe und Schiller gestellt haben. Sein «Wieland» ist aufregend und fulminant, ein germanistischer Glücksfall, denn er gibt uns einen Klassiker zurück, ohne den die Verwandlung der deutschen Literatur in eine vor und eine nach Weimar gar nicht angemessen verstanden werden kann.
Innovator, Aufklärer, Schriftsteller, Journalist, political animal, Menschenkenner, all das war der geistige Pate Weimars, Christoph Martin Wieland. Neben Lessing ist er die Zentralgestalt der deutschen Aufklärung. Durch ihn wird der Roman in Deutschland zu einer anerkannten Literaturgattung, er schreibt die erste moderne deutsche Oper und bringt mit seinen erotischen Verserzählungen einen neuen Ton in die deutsche Poesie. «Der Teutsche Merkur», damals eine der wichtigsten literarisch-politischen Zeitschriften Europas, wird von ihm herausgegeben, und gleichsam nebenbei prägt er das Genre des politischen Journalismus mit seinen Texten über die Französische Revolution und Napoleon, dessen Alleinherrschaft er frühzeitig vorhersah und den er 1808 in Weimar auch persönlich traf. Gründe genug, Wieland neu zur Kenntnis zu nehmen. Jan Philipp Reemtsmas Biographie, die Summe einer jahrzehntelangen Forschung, bietet die Gelegenheit dazu.
Über den Autor
Jan Philipp Reemtsma war Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Hamburg und wurde u.a. mit dem Lessing-Preis und zuletzt dem Moses-Mendelssohn-Preis und dem Weimar-Preis ausgezeichnet. Er hat bei C.H.Beck u.a. Schriften zur Literatur (2015) und Was heißt: einen literarischen Text interpretieren? (2016) veröffentlicht.
Inhalt
Wer Christoph Martin Wieland war –
Erstes Kapitel: «Mein Vaterstädtchen ist unstreitig eines der elendesten und verdorbensten in der sublunarischen Welt» – Biberach, Zürich
Kindheit und Jugend
Sophie Gutermann/La Roche (1)
Johann Jakob Bodmer
Der Autor als sehr junger Mann
Der Denunziant
War er fromm?
Was ist deutsch?
Was eine Metapher ist
Klopstock oder Wer bin ich?
Zweites Kapitel: «die Gründe warum ich Bern verlasse sind ein wenig verwikelt» – Bern
Ein neues Ambiente
Julie Bondeli (1)
Der werdende Autor
Rückkehr nach Biberach
Julie Bondeli (2)
Drittes Kapitel: «Biberach ist schlechterdings der Ort nicht wo ich bleiben kann» – Biberach
... wäre er doch anderswo!
Paritätsquerelen
Prediger Brechter
Kanzleialltag
Warthausen/Graf Stadion
Sophie La Roche (2)
Christine Hogel
Anna Dorothea Hillenbrand (1)
Viertes Kapitel: «bisher von keinem Deutschen versuchte Art von Reimerey» – Versromane und -erzählungen (1)
«Komische Erzählungen»
«Musarion»
Fünftes Kapitel: «... und werfen einander mit Rosen» – Romane (1)
«Geschichte des Agathon»
«Die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva»
Sechstes Kapitel: «was er gut gemacht hat, wird schwerlich jemand besser machen» – Übersetzungen (1)
William Shakespeare
Siebtes Kapitel: «Niemals haben die Grazien dieses freudeleere Chaos von alten Steinhauffen angeblickt – kein Wort mehr von diesem verhaßten Neste!» – Erfurt
Abschied, Umzug, Ankunft
In Erfurt
Der Weg nach Weimar
Achtes Kapitel: «so will ich fortfahren, mit den Musen zu kurzweilen» – Versromane und -erzählungen (2)
«Idris und Zenide»
«Der Neue Amadis»
Neuntes Kapitel: «Ach, warum ist Weimar nicht Athen, oder Smyrna, oder so was» – Weimar (1)
Wieland «bei Hofe»?
Sein Leben in Weimar
Man schreibt ihm...
Reise in die Schweiz
Töchter
Goethe
Herder
Schiller
Die Xenien
Zehntes Kapitel: «... wenn in diesen unsern Tagen irgendwo in Europa ein Athen wäre...» – Oper
«Aurora»
«Alceste»
«Rosamunde»
Elftes Kapitel: «Ich bin entschlossen, eine Art von Journal zu entrepreniren» – Der Teutsche Merkur
Zwölftes Kapitel: «Nichts mehr von neuen Konstituzionen!» – Der politische Schriftsteller/Französische Revolution
Dreizehntes Kapitel: «Ich hingegen mache es mir so schwer als möglich» – Versromane und -erzählungen (3), Märchen in Prosa
«Erzählungen und Märchen»
«Oberon»
«Klelia und Sinibald»
Märchen in Prosa
Vierzehntes Kapitel: «Es gibt eine Art von Menschen...» – Romane (2)
«Sokrates mainomenos» oder «Der Nachlaß des Diogenes von Sinope»
«Der goldne Spiegel»
«Geschichte des weisen Danischmend»
«Geschichte der Abderiten»
Fünfzehntes Kapitel: «viel Geschmack, viel Fleiß, u ein sehr zartes grammatisches Gewissen» – Übersetzungen (2)
Horaz
Lukian
Aristophanes und Euripides
Sechzehntes Kapitel: «Dieser reinen Natur- und Genuß-Fülle...» – Oßmannstedt
Die «Sämmtlichen Werke»
Sophie von La Roche (3)
Sophie Brentano (und ihr Bruder Clemens)
Anna Dorothea Wieland (2)
Jean Paul
Heinrich von Kleist
Johann Gottfried Seume
Friedrich Schlegel
Söhne
Siebzehntes Kapitel: «... entkeimte die schönste Blüthe meines Alters, mein Aristipp» – Romane (3)
«Peregrinus Proteus»
«Agathodämon»
«Aristipp und einige seiner Zeitgenossen»
Achtzehntes Kapitel: «Nein, lieber Rousseau!» – Philosophie
Rousseau
Kant
Xenophons Sokrates
Neunzehntes Kapitel: «ist es nicht widersinnisch in meinem 75sten Jahr Briefe, die ein alter Römer vor 1800 Jahren an seine Freunde und Zeitgenossen schrieb, zu übersetzen?» – Übersetzungen (3)
Ciceros Briefe
Zwanzigstes Kapitel: «allez, bon soir!» – Weimar (2)
Das Treffen mit Napoleon
Die letzte Liebe: Elisabeth Solms-Laubach
Die letzten Jahre
Nachbemerkung
Anhang
Dank
Zeittafel
Werke nach dem Erscheinungsjahr
Literaturverzeichnis
Abkürzungen und Siglen
Gesamt- und Auswahlausgaben
Einzelausgaben
Übersetzungen
Zeitgenössische Quellen
Weitere verwendete Literatur
Anmerkungen
Wer Christoph Martin Wieland war –
Erstes Kapitel:Biberach, Zürich
Zweites Kapitel:Bern
Drittes Kapitel:Biberach
Viertes Kapitel:Versromane und -erzählungen (1)
Fünftes Kapitel:Romane (1)
Sechstes Kapitel:Übersetzungen (1)
Siebtes Kapitel:Erfurt
Achtes Kapitel:Versromane und -erzählungen (2)
Neuntes Kapitel:Weimar (1)
Zehntes Kapitel:Oper
Elftes Kapitel:Der Teutsche Merkur
Zwölftes Kapitel:Der politische Schriftsteller/Französische Revolution
Dreizehntes Kapitel:Versromane und -erzählungen (3), Märchen in Prosa
Vierzehntes Kapitel:Romane (2)
Fünfzehntes Kapitel:Übersetzungen (2)
Sechzehntes Kapitel:Oßmannstedt
Siebzehntes Kapitel:Romane (3)
Achtzehntes Kapitel:Philosophie
Neunzehntes Kapitel:Übersetzungen (3)
Zwanzigstes Kapitel:Weimar (2)
Nachbemerkung
Bildnachweise
Personenregister
Nach meinem Tode wird’s endlich herauskommen, was ich war, und mir wird mit vollem gerütteltem und geschütteltem Maas Gerechtigkeit wiederfahren.
Christoph Martin Wieland, 27. Oktober 1783
Einer der ganz raren Fälle, wo intellektuelle Poesie verwirklicht wurde.
Arno Schmidt, Wieland oder die Prosaformen
Aber, Lieber, wenn dir was gefällt, dann äußer das auch lauthals, lebhaft und verliebt – und im übrigen, wir dienen denen, die uns zugefallen sind.
Peter Rühmkorf, Spelunkenkunde
Wer Christoph Martin Wieland war –
– diese Frage kann eine einfache Erzählung seines Lebens nicht beantworten. Das ist natürlich immer so. Die Nacherzählung eines Lebens kann im Falle von Schriftstellern (und anderen Künstlerinnen) nicht beantworten, was ihre Bedeutung für uns ausmacht und weshalb man sich vielleicht auch für ihr Leben interessiert. Wenn man filmische TV-Nacherzählungen eines Schriftstellerlebens gesehen hat, bleibt man auf dem Sofa doch meist ratlos zurück. Was dieses Leben für uns wichtig macht, bleibt unerzählt: die abertausend Stunden am Schreibtisch. Diese Grenze ist hinzunehmen und zu respektieren, der Autor einer Biographie kann nicht so tun, als wäre aus dem Hin und Her eines Lebens eine Art Notwendigkeit des literarischen Werks herauszufabulieren, das sein Ertrag war.
Christoph Martin Wieland wurde am 5. September 1733 in Oberholzheim bei Biberach geboren, er starb am 20. Januar 1813 in Weimar. Die wichtigen Lebensstationen waren, nach der Kindheit und Jugend in Biberach, Zürich und Bern, wo er sein Brot als Hauslehrer verdiente, dann wieder Biberach, wo er eine Stelle als Kanzleiverwalter innehatte. Dann war er Professor der Philosophie in Erfurt, von wo er nach Weimar gerufen wurde, um den künftigen Herzog Carl August auf seine Regierung vorzubereiten. In Weimar lebte er, mit einer Unterbrechung von wenigen Jahren im nahen Oßmannstedt, bis zu seinem Tode. Ein undramatisches Leben, vor allem eines ohne Kavalierstour nach Paris oder Italien. In diesen beinahe 80 Jahren wurde Wieland zum bedeutendsten und bekanntesten deutschen Schriftsteller, mit ihm begann, was das 19. Jahrhundert die «Weimarer Klassik» nennen sollte. Und gegen Ende seines Lebens sah er, wie diese einzigartige Bedeutung wieder vergessen wurde.
Zwei Karten würden deutlich machen, was Wieland zu Lebzeiten war und worum sich eine Biographie zu kümmern hat: eine, die den Radius seines Lebens zeigt, die Vaterstadt Biberach, dann die Wohnorte Zürich und Bern, Erfurt und Weimar und Oßmannstedt bei Weimar, schließlich die Orte seiner wenigen und kurzen Reisen – sein biographischer Lebensraum wird im Norden durch Magdeburg, im Westen durch Düsseldorf, im Süden durch das schweizerische Kehrsatz (bei Bern), im Osten durch Seilersdorf bei Dresden begrenzt. Auf der anderen Karte wäre zu sehen, wo und von wem die Ausgabe seiner Werke letzter Hand, die «Sämmtlichen Werke», subskribiert wurde. Es standen drei verschiedene Formate zu unterschiedlichen Preisen zur Auswahl (und zusätzlich eine nicht subskribierbare «wohlfeile» Ausgabe auf billigem Papier), die Listen weisen über 600 Förderer auf. Für die Ausgabe in Quart, die aufwendigste und teuerste Variante, unterzeichneten unter anderem der Herzog vom Weimar und seine Mutter, die verwitwete Herzogin von Weimar (versteht sich), die Königin von Dänemark, der König von England und die Königin von Neapel, Prinz Ferdinand von Preußen, die regierende Herzogin von Curland, Fürst Aloys Lichtenstein und Fürst Carl Lichnowsky in Wien, der Fürstbischof von Lübeck, der Bürgermeister von Biberach, fürstliche Bibliotheken und bürgerliche Lesegesellschaften, Privatleute und Buchhändler unter anderem aus Augsburg, Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, aus Riga, Breslau, Danzig, Warschau, Königsberg, St. Petersburg, Zürich, Basel, Wien, Graz, Salzburg, Amsterdam, Haarlem, London, Kopenhagen, Triest, Prag und Budapest, ein «Herr Oberster Freyre» in Lissabon und ein «Herr Thompson aus Amerika».
Die meisten Subskribenten hatte die Ausgabe in Großoktav, auch für sie kamen Bestellungen aus weiten Teilen Europas, von Reval (Tallinn) im Norden bis Neapel im Süden. Erwähnt sei die Familie Gontard aus Frankfurt am Main, die ebenfalls zu den Förderern zählt – sie ließen ihre Ausgabe in rotes Maroquin binden und versahen sie mit ihren Exlibris. Mag sein, Hölderlin hat seine Diotima nahe dieser Ausgabe in der Bibliothek geküsst.
Man zeichne also auf einer Landkarte die deutschen, österreichischen, Schweizer, englischen, ungarischen, baltischen, russischen, niederländischen, skandinavischen Orte ein – einer Karte, die noch von Lissabon über den Atlantik blickt –, und man hat die Bedeutung seines Werkes am Ende des 18. Jahrhunderts vor Augen. Und in diesem Augenblick der höchsten Anerkennung beginnt der sich im 19. Jahrhundert fortsetzende Prozess der Umbildung der Idee von «Dichtung» und dem, was «ein Dichter» sei, der dazu führt, dass Walter Benjamin in Wielands Jubiläumsjahr 1933 schreiben konnte: «Wieland wird nicht mehr gelesen.» Und Arno Schmidt konnte in seinem 1957 in Gesprächsform verfassten Funkessay über Wieland einen der Sprecher sagen lassen: «Ein berühmter Name, gewiß, aber mir nur eine Schattengestalt – die Literaturgeschichte hat ihn längst so endgültig abgetan …»
Auch mit dieser Umwertung des Autors hat sich der Biograph zu beschäftigen. Nicht, wie dies seine Vorgänger Johann Gottfried Gruber (1827) und Friedrich Sengle (1949) getan haben, um ihr Unternehmen gegen den Geist der Zeit zu rechtfertigen, sondern weil er, um Wielands Bedeutung für die deutsche Literatur darzustellen, beides verstehen muss, die große Bedeutung zeit seines Lebens und ihren Verfall, in seinen letzten Lebensjahren beginnend. Wieland selbst hat zweimal versucht, die eigene historische Rolle zu bestimmen; einmal 1794 im «Vorbericht» zu den erwähnten «Sämmtlichen Werken», später in einem Brief. – So heißt es in den «Sämmtlichen Werken»: «Es sind nun vier und vierzig Jahre seit der Verfasser der poetischen und prosaischen Werke, die in gegenwärtiger vollständiger Ausgabe von der letzten Hand gesammelt erscheinen, zum ersten Mahl im Kor der Dichter und Schriftsteller Deutschlands auftrat. Seine Laufbahn umfaßt also beinahe ein halbes Jahrhundert. Er begann sie, da eben die Morgenröthe unsrer Litteratur vor der aufgehenden Sonne zu schwinden anfing; und er beschließt sie – wie es scheint, mit ihrem Untergang.»
Man muss das nicht falsch lesen, er hat sich darin nicht als die «Sonne» bezeichnet, sondern als einer, der unter der Sonne der Zeit, als sie hoch stand zwischen Morgen und Abend, gewachsen sei. Gleichwohl ist die Aussage vermessen: Es will schon etwas wie «und nach uns wird kommen: nichts Nennenswertes» sagen. Jedenfalls ist es eine säkulare Verkennung gewesen – welcher Art?
Er meinte wohl, dass das, was durch ihn (und vielleicht Klopstock vor ihm) und Goethe und Schiller nach ihm «die deutsche Literatur» geworden war, in der nächsten Generation nicht fortgesetzt werde. «Er hatte das herzerhebende Glück, der Zeitgenosse aller Deutschen Dichter und Schriftsteller, in deren Werken der Geist der Unvergänglichkeit athmet, und der Nebenbuhler von keinem zu seyn; die meisten von ihnen waren seine Freunde, keiner sein Feind.»[1] Aus dieser freundlichen Bemerkung kann man den Blick rekonstruieren, den er auf die Literatur seiner Zeit warf: Sie war überschaubar. Man war einander nah, konnte einander kennen. Man korrespondierte, es hatte hier und da Besuche gegeben. Nur so hat die Hervorhebung von Freundschaft und mangelnder Rivalität einen Sinn. Es hatte zwar Generationenkämpfe gegeben (die jungen Klopstock-Verehrer hatten Wielands «Idris» verbrannt, der junge Goethe hatte gegen den gerade nach Weimar übersiedelten Wieland polemisiert), aber das hatte sich gegeben wie ein Familienstreit, der sich wieder legt. An der Schwelle zum 19. Jahrhundert dagegen findet eine Umbildung der literarischen Szene statt, die den «Vorbericht» im Moment seiner Niederschrift obsolet und anachronistisch werden lässt.
Als die Brüder August und Friedrich Schlegel 1798 in ihrer Zeitschrift «Athenäum» ihren Angriff auf Wieland starteten, war das nicht nur ein Streit, den eine jüngere gegen eine ältere Generation führte, was es natürlich auch war, sondern es war eine marktstrategische Aktion. Es ging darum, Terrain zu besetzen, nicht einfach Aufmerksamkeit zu heischen, sondern Gegenaufmerksamkeit zu errichten. Das war weniger ellenbogenhaft als marketingmäßig. Wieland nahm einen neuen Ton wahr, den er auch aus den Goethe/Schillerschen «Xenien» heraushörte, und empfand ihn als rüpelhaftes und niveauloses Benehmen. Aber ein solcher Tadel trifft nicht mehr, wenn sich das Ambiente ändert. Für den Wieland des «Vorberichts» war das literarische Deutschland keine Umwelt mehr, in der Literatur, wie er sie sich dachte, gedeihen konnte, weil es die Literaten nicht mehr zu geben schien, die dazu gehörten. Es war in der deutschen Literatur etwas vor sich gegangen, das noch nicht ganz überschaubar war.
Am 13. August 1808 schreibt Christoph Martin Wieland an Volrath Friedrich Karl Ludwig zu Solms-Rödelheim, den Schwiegersohn seiner jahrelangen brieflich Geliebten – gesehen hat er sie nie –, diesen Satz: «Ich weiß recht gut, daß ich Etwas bin, und, unter uns gesagt, ich bin sogar überzeugt, daß ich, da wo ich stehe, ganz allein stehe und Niemand unter den Völkern mit mir ist noch war.» Das mag man für ein verblüffend kühn entworfenes Selbstbild halten. Aber haben nicht andere Dichter ähnlich geredet? Etwa der große Barockpoet Paul Fleming in seinem letzten Gedicht: «Mein Schall floh überweit, kein Landsmann sang mir gleich (…) Man wird mich nennen hören/bis daß die letzte Glut diß alles wird verstören.»[2] Oder Bertolt Brecht in jungen Augsburger Jahren. Aber der zitierte Satz gehört nicht in das Genre der produktionsnotwendigen Selbsterhebungen oder Selbstüberhebungen, die man seit Ovids «aere perennius» eben kennt (und hatte Ovid nicht recht?). Man muss ihn zusammen mit den Sätzen lesen, die ihm folgen. «Aber, wie gesagt, in dem Sinn worin Shakespear, Klopstock, Göthe, Schiller Dichter, und Dichter von der ersten Größe, sind, kommt mir dieser Nahme keineswegs zu: dazu habe ich weder Genie noch Talent, weder Tiefe noch Energie, weder anschauende Kenntniss der wirklichen Welt, noch Reichthum, Lebendigkeit und Fülle der Imagination genug, wiewohl es mir an einem gewissen Grade von allem diesen nie gefehlt haben mag.» Die Sätze klingen verwundert-resigniert. Was verstand er unter «Dichter erster Größe»? Und worin sah er sich so allein stehend «unter den Völkern»?
Wieland hat damit den Blick vorweggenommen, den das 19. Jahrhundert auf ihn einüben und der auch die erste Hälfte des 20. bestimmen wird. Man sah ihn als Vorbereiter dessen, was dann kam – mit der Weimarer Klassik, aus der man ihn wegdachte und die man auf Goethe&Schiller reduzierte, und mit dem, was folgte. Man beschrieb Wieland als einen Noch-nicht, einen, dem das «Eigentliche» fehlte, und in dem zitierten Brief nimmt er selbst sich auch so wahr. Was ist, was wäre denn dies eigentlich «Dichterische»? Er schreibt von einem Mangel an «anschauender Kenntnis der wirklichen Welt, Reichtum, Lebendigkeit und Fülle», und der Leser seines letzten großen Romans «Aristipp und einige seiner Zeitgenossen» wundert sich, weil er mit ebendiesen Begriffen genau diesen Roman beschreiben würde. Es müssen diese Wörter im Zusammenhang der Selbstbeschreibung im Brief anders geklungen haben. So fährt er fort: «Ich habe in den Jahren meines Lebens, wo die productive Kraft meines Geistes in ihrer größten Energie war, weder Kälte genug gehabt, um ein speculativer Philosoph, noch Feuer und Schöpfungskraft genug, um ein eigentlicher Dichter zu seyn.» Das nicht also, «aber eine Art von Poet, und das ist ein Macher (…), der sich 50 bis 60 Jahre lang, mehr von Innen als von aussen, gedrungen fand, allerley Machwerk zu Tag zu fördern, dessen Werth oder Unwerth zu bestimmen er nun, da es einmahl in fremde, gewaschne u ungewaschne Hände gekommen, competenten u nicht competenten Richtern überlassen muß.»[3] Der Nachwelt eben, deren Urteil er sich achselzuckend überlässt.
Das Wort «Macher», das zuvor fiel, fällt auf. Im heutigen Sinne abwertend ist es nicht, das Wort lehnt an der ursprünglichen griechischen Bedeutung des «Poeten», die eben genau «Macher» ist. Wieland hatte in seinen Kommentaren immer auf das Technische in der Poesie, die Beherrschung der Instrumente hingewiesen. Als man ihm vorhielt, nicht «originell» zu sein, zeigte er sich verständnislos: Neue Stoffe zu erfinden vermöge doch jedermann, aber die geeignete Form – und eine neue für einen alten Stoff – zu finden, das mache den Poeten aus. Dahinter steckt ein für unser eingeübtes Gefühl des «Dichterischen» erstaunlich geringer Anspruch. Nicht der des poetischen Erfassens von etwas, das wir «Welt» nennen, der Verbindung von großem Deutungsentwurf und Seelenimprägnierung des Beschriebenen. Nicht so, wie wir im Laufe des 19. Jahrhunderts uns angewöhnt haben, «große Literatur» zu lesen, eine Art des Lesens, des Auffassens von Literatur, dem Begriffe wie «Machen» oder «Technik» fremd wurden, wo Schönheit, die nicht wenigstens ein wenig mit dem Erhabenen assoziiert wurde, gleich in die Nähe von «bunt» und «Oberfläche» oder «Artistik» geriet. Für Sätze wie den von Brecht, Schönheit sei das Überwinden von Schwierigkeiten, brauchte es dann ein neues Jahrhundert.
Für den in die Lesebräuche des 19. Jahrhunderts Hineingeborenen war Wieland ein Autor, dem es vor allem an «Tiefe» mangelte. Wieland sah dieses Urteil, diese neuen Maßstäbe kommen. Die Literatur und vor allem die Art, sie zu rezipieren und zu deuten, entwickelte sich anders, als er im «Vorbericht» von 1794 noch meinte, und in eine ihm fremde Richtung. Das sah er im Brief von 1808. Er wusste, dass er ein Typus war, der das Dichterische, wie man es aufzufassen begann, nicht mehr repräsentieren konnte. Der Beginn dieser neuen Wahrnehmung war zunächst das, was man mit dem anachronistischen, aber wohl passenden Wort «Star» bezeichnen kann: der Auftritt des jungen Goethe. Die Art und Weise, wie sich ein junger Dichter öffentlich gab, und die Art, wie man seine Werke las, ergaben ein neues Gemeinsames, eine (noch einmal ein treffender Anachronismus) Performance. Das Getue um die Werther-Kostümierung ist dabei mehr als eine Kuriosität am Rande. Hans Mayers «Goethe. Versuch über den Erfolg» ist die ihrerseits klassische Analyse des Phänomens, und Thomas Manns «Lotte in Weimar» schildert eine Welt, die von dieser neuen Art, auf «einen Dichter» zu sehen, geprägt ist. Auch Schillers Weg in die Aufmerksamkeit zeigt diese neue Weise, einen Dichter, «der einem etwas zu sagen hat», anzusehen, und dass dann im Laufe der Jahrzehnte diese beiden Individualitätsentwürfe eigene Verehrungsformen nach sich zogen, gehört dazu.
In Goethe und Schiller sah Wieland also etwas, das er nicht war, und er sah, dass es die andern so sahen. Klopstock nennt er, weil um ihn etwas wie eine gemeindehafte Dichterverehrung stattgefunden hat; Shakespeare, den erst Wielands Übersetzungen einem deutschsprachigen Publikum nahegebracht haben, weil auch ihm in Deutschland eine Verehrung zuwuchs, die europäisch durchaus nicht die Norm war.
Interessant ist zudem, wie er eine weitere Performanz, zu der er nicht getaugt habe, in Parallele setzt, die des «speculativen Philosophen», auch er ein Modell des 19. Jahrhunderts, wo sich verfestigt, was sich zu Lebzeiten Wielands abgezeichnet hat, die Trennung von Philosophie als Kasuistik gelingenden Lebens von der Philosophie als eigener, akademisch gepflegter Denkform (die eigenem, aber nur eigenem Anspruch nach das Erbe der Theologie als Leitdisziplin antritt). Auch hier kommt es, wie man weiß, zu Gemeindebildungen, man wird ein «-ianer» mit vorgesetztem Kant-, Hegel,– Fichte- und so fort. Diese Entwicklung hat Wieland, dessen Schwiegersohn der einflussreiche Kant-Popularisator Karl Leonhard Reinhold war, mit kritischen Interventionen begleitet.
Was war er denn als jener «Macher», der sich dort, wo er sich stehen sah, «ganz allein» stehen sah, «und Niemand unter den Völkern mit mir ist noch war»? Die Diagnose vom Ende der deutschen Literatur hatte er zurückgenommen, jedoch nicht die von ihrem Anfang, der mit dem Beginn seiner Laufbahn verbunden gewesen sei. Die Geschichte der deutschen Literatur ist in gewissem Sinne eine abgeschlossen wirkender deutscher Literaturepochen. Die Literatur des Barock setzt die des Mittelalters nicht fort, die der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht die des Barock. Man kannte das noch gar nicht so lang Vergangene oft nicht einmal mehr, das 18. Jahrhundert entdeckte die mittelhochdeutsche Literatur so, wie man Ruinen freilegt, über denen lange schon Bauwerke stehen, die von ihrem Untergrund nichts wissen. Die Naturlyrik des 19. Jahrhunderts ist etwas ganz anderes als die Gedichte des Barthold Heinrich Brockes (gestorben 1747), dessen Vergessensein Wieland schon bedauert. Dass die – wir würden heute sagen: moderne – deutsche Literatur in der Mitte des 18. Jahrhunderts eigentlich beginnt, ist keine extravagante Ansicht, sondern war Konsens der damaligen Zeit. Ein deutscher Autor um 1750 fühlte sich zudem nicht auf der literarischen Höhe des übrigen Europa. Die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges sei die Ursache dieses Missstandes gewesen, war eine allgemein geteilte Diagnose. Noch 1791 schrieb Friedrich Schiller einleitend zu seiner «Geschichte des Dreißigjährigen Krieges»: «Ein dreißigjähriger verheerender Krieg, der von dem Innern des Böhmerlandes bis an die Mündung der Schelde, von den Ufern des Po bis an die Küsten der Ostsee Länder entvölkerte, Ernten zertrat, Städte und Dörfer in Asche legte; ein Krieg, in welchem mehr als dreimal hundert tausend Streiter ihren Untergang fanden, der den aufglimmenden Funken der Kultur in Deutschland auf ein halbes Jahrhundert verlöschte, und die kaum auflebenden bessern Sitten der alten barbarischen Wildheit zurück gab.»[4]
Dass die deutsche Literatur sich neu oder überhaupt erstmals zu schaffen hätte, war bei wohl allen, mochten sie auch recht unterschiedliche Vorstellungen davon haben, in welcher Weise das erfolgen werde oder solle, Konsens. Ob sich die deutsche Literatur, um zur Qualität der italienischen, spanischen, französischen, englischen aufzuschließen, an jene oder diese anschließen solle, wurde debattiert. Klopstock verordnete ihr einen Beginn wie der antiken und schuf ein Epos in daktylischen Hexametern wie «Ilias», «Odyssee» und «Aeneis», nur für ein christliches Zeitalter angemessen: den «Messias».
Der Blick des 19. Jahrhunderts auf die deutsche Literatur ist vom Geiste der teleologischen Geschichtsphilosophie, die zum allgemeinen Deutungsinstrument avanciert. Allerdings ist im Falle der deutschen Literatur das Ziel schon Vergangenheit. Das Telos ist die «Weimarer Klassik». Karl Robert Mandelkow hat es so pointiert: «Der Begriff einer Weimarer Klassik hat sich bekanntlich erst spät, Ende der achtziger Jahre des Neunzehnten Jahrhunderts, als Kennzeichnung einer auch für die Gegenwart verbindlichen überzeitlichen und unüberholbaren Norm der deutschen Literatur und zugleich als das geistige Zentrum der ideellen Geschichte der Deutschen durchgesetzt. Dieser Begriff, bezogen auf die Dioskuren Goethe und Schiller und zumeist eingeengt auf das sogenannte klassische Jahrzehnt ihrer Zusammenarbeit 1794 und 1805, ist das Ergebnis einer bereits vor Goethes Tod einsetzenden intensiven Diskussion um Kennzeichnung und Abgrenzung ihrer Werke im Vergleich und in der Auseinandersetzung mit der gesamten zeitgenössischen Literatur; zeitgenössisch bezogen auf die mit ihnen Gleichzeitigen wie mit der gesamten nachklassischen Literatur des 19. Jahrhunderts.»[5]
Was vorher war, war Vorbereitung, etwas, was man als ein «Noch nicht» charakterisiert, was nachher kommt, als ein «Nicht mehr». In beiden Fällen versteht man es als defizitär. Dieses starre Schema, dem sich auch die besten Köpfe der Germanistik nie wirklich entziehen konnten, macht die Lektüre so vieler im Grunde kluger Texte bis ins 20. Jahrhundert hinein so verblüffend langweilig.
Dass jenseits dieses Schemas – und der Selbstwahrnehmung der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts folgend – die deutsche Literatur tatsächlich «gemacht», man kann sogar sagen «erfunden» wurde, weil man sich als vorgängerlos wahrnahm und nirgendwo anknüpfte, muss man festhalten, wenn man diesen Sonderweg begreifen will und verstehen will, wie Wieland zu dem zitierten Selbstbild kommen konnte. Aber man muss sich, was nicht leichtfällt, vom Deutungsschema des 19. Jahrhunderts freimachen, um dieses Machen oder Erfinden nicht als tastende Suche nach etwas, das sich dann anders vollendet, misszuverstehen.
Die moderne deutsche Literatur wird von zwei Autoren erfunden, Lessing und Wieland. Die Worte, mit denen die moderne deutsche Literatur beginnt, lauten: «Die Post ist also noch nicht da?» Das ist der erste Satz von Gotthold Ephraim Lessings «Der junge Gelehrte», 1748 uraufgeführt. Das war ein vollkommen neuer Ton auf der deutschen Bühne. Lessings Name steht für das Theater, den kulturhistorischen Essay, die Literaturkritik, die Polemik als Gattung. Christoph Martin Wieland ist der andere, mit dessen Werk der Beginn der modernen deutschen Literatur zu verbinden ist. Sein Name steht für den Roman, für Versroman und -erzählung, die deutschsprachige Oper, politischen Journalismus, die Übersetzung Shakespeares, Horaz’ und Ciceros und vieler anderer. – Lessing blieb für ein weiteres Publikum präsent, weil er Theaterautor war und weil die Muster, die er für das bürgerliche Trauerspiel, für die Komödie aufgestellt hatte, zu Klassikern wurden. Wieland, der Begründer der «Weimarer Klassik», wurde nie ein Klassiker. Er war kein Bühnenautor, und er war auch kein Lyriker, ging also schon deswegen dem Bildungsbürgertum verloren. Er war nicht auf der Premierenbühne und nicht im Lesebuch.
Es gab auch Weltanschauliches, das die Leserinnen und Leser mit seinem Werk auf unvertrauten Fuß setzte. Patriot war er nicht, nannte Patriotismus eine «Modetugend», als man sich darauf besann, deutsch zu werden; christlich hatte er in seiner Jugend gedichtet und es dann so hinter sich gelassen, dass er uns wie ein geborener Agnostiker vorkommen muss: Wir würden vielleicht bessere Menschen sein, wenn uns der Gedanke an ein Leben nach dem Tode fremd wäre, schrieb er als sehr alter Mann. Der erotische Witz, das intellektuelle Spiel, gegen Tiefe und Erhabenheit die Leichtigkeit des poetischen Ernstes – das alles ist dem, was im 19. Jahrhundert gebildete ästhetische Vorliebe wie Hausmannskost wird, so fremd, dass man sich durch die Literaturgeschichten, die es voneinander abschrieben, weiterreichte, das alles sei eben doch bloß Rokoko und etwas für Leute, an die man sich glücklicherweise nur noch wie von ungefähr erinnert.
Tatsächlich hat sich etwas wie ein Wieland-Abscheu herausgebildet, Sengle berichtet davon. Wenn er «auf Wieland hinwies, so war beim durchschnittlichen Gebildeten ein schlecht verhehlter Abscheu zu bemerken»,[6] und man fragt sich, was da abgewehrt wurde. Gewiss war immer seine schon seine Mit-, vor allem aber seine Nachwelt irritierende Erotik einer der Gründe, seine Auffassung, dass sich Amor nicht in einer Gestalt porträtieren, dass sich Liebe, Erotik, Sexualität nur durch eine unabschließbare Kasuistik erfassen lasse. Man empfand sowas irgendwann als unmoralisch, weil man das A-Moralische in der Darstellung nicht mehr ertragen konnte.
Ebenso gewiss spielte auch Wielands Abneigung gegen das Vorschriftenmachen im Denken eine Rolle. Man warf ihm vor, keine festen Ansichten zu haben. Seine politischen Schriften führten vor, wie man denken konnte, wie man zu Auffassungen gelangen konnte – Leitartikel schrieb er nicht. Die Suche nach gedanklichen Fundamenten, auch im Philosophischen, war ihm fremd. In seinem letzten großen Roman «Aristipp und einige seiner Zeitgenossen» lässt er den Titelhelden Aristippos von Kyrene über die Platonische Frage nach «dem Guten» (oder «dem Schönen») antworten: «Wozu soll’s?» Als es zum guten Ton gehörte, Wieland nicht zu kennen und nicht zu lesen, vergaß man, was auf dieses «Wozu soll’s?» folgte: nicht das Achselzucken des Banausen, sondern das Ersetzen dieser Art philosophischen Fragens durch ein in einem weiteren Sinn anthropologisches Fragen nach dem, was Menschen denn schön, gut usw. nennen und aus welchen Gründen, wie etwa David Hume in seinem «Enquiry about the Principles of Morals». Wieland gehört in die Reihe Montaigne, Hume, Diderot.[7] Es ist eine andere philosophische Tradition als die der Suche nach dem Absoluten und Erhabenen.[8]
Was die Wieland-Lektüre stets behindert hat, war die Frage, welches «der eigentliche Wieland» denn nun sei, der Verfasser der Romane (und, wenn ja, welcher?), der Verskünstler, der Übersetzer (Shakespeares? Horaz’? Ciceros?), der politische Schriftsteller (den man lange ganz vergessen hatte, obwohl durch ihn und seine Zeitschrift «Der Teutsche Merkur» die deutsche Leserschaft besser über die Französische Revolution informiert wurde als von anderswoher). Da lag ein klares Hindernis. Nicht, dass man sehr viel wissen muss (oder wenigstens sollte), wenn man Wieland lesen will, ist das Problem. Das sollte man bei vielen anderen Autoren auch, und wenn das nicht der Fall ist, kann man sie nichtsdestoweniger lesen (nur für den Faulpelz ist das eine Ausrede). Das Problem war und ist, dass man sich für sehr vieles interessieren muss, wenn man Wieland genießen will. Und man sollte sich auf das Abenteuer einlassen zu beobachten, wie durch die Werke dieses einen Autors die deutsche Literatur zu dem wurde, was Wieland selbst «Weltliteratur» nannte. Eine Entwicklung, die er selbst mit Verwunderung dem Besucheraufkommen in Weimar ablas: Auf einmal war für Reisende aus ganz Europa diese kleine Thüringer Stadt der Ort, den der Gebildete besucht haben musste.
Schließlich muss man einen Sinn für eine besondere Rarität haben, nicht nur das Nebeneinander von Intellektualität und Poesie, sondern ihre Verbindung in intellektueller Poesie.
Erstes Kapitel:
«Mein Vaterstädtchen ist unstreitig eines der elendesten und verdorbensten in der sublunarischen Welt»
Biberach, Zürich
Er hat wohl zuweilen gesagt, er sei in Biberach geboren, tatsächlich war es das Dorf Oberholzheim bei Biberach, wo der Vater als Pfarrer tätig war. Aber schon als er dreieinhalb Jahre alt war, zog die Familie nach Biberach, dort ist er aufgewachsen und die nächsten zehn Jahre geblieben. Oberholzheim also, 1733 am 5. September. «Morgens gegen 8 Uhr», steht im Taufregister.[1] Sein Vater Thomas Adam Wieland, seine Mutter Regina Katharina geb. Kick. Die Wielands hatten bäuerliche Vorfahren dort; «Wielande» gab es hier auch noch zu Lebzeiten Christoph Martins, «grobe Knallfinken und Lümmel»,[2] wie er sagte. In Biberach war sein Urgroßvater Martin Justus Bürgermeister gewesen, sein Großvater war, wie der Vater, Pfarrer in Oberholzheim.
Kindheit und Jugend
Über seine Kindheit und Jugend weiß man recht wenig. Das, was man zu wissen meint, kennt man vornehmlich aus seinen späteren Briefen oder von aufgezeichneten Gesprächsäußerungen, meist Anekdotisches und wenig Belangvolles à la: Er habe als Einjähriger eine «ziemlich hässliche Wärterin, Greth genannt, mit einer schwärmerischen Leidenschaft geliebt».[3] Er schreibt es 1808 an eine Dame und sagt ihr damit einerseits, wie früh er schon an Weiblichkeit interessiert gewesen, und andererseits, dass es ihm nie in erster Linie um Schönheit sive Äußerlichkeiten gegangen sei. Was immer die Adressatin daraus hat lesen mögen. – Auch habe er als etwa Dreijähriger gerne Lämmchen mit Hafer gefüttert, allerdings auch einen halbjährigen Säugling, zu dem er sich «geschlichen» habe und dem er, als er «in der Wiege recht bauernmäßig das Maul aufsperrte», Hafer in jenes Maul gestopft habe. Er wäre, so Wieland in der Erinnerung, daran fast erstickt. Wieland nahm es als Beispiel dafür, dass er «schon winzig klein viel Bonhommie gegen Menschen und Thiere gehabt» habe.[4] So kann man es auch sehen. – Als die Familie 1736 nach Biberach zog, übernahm der Vater dort eine Predigerstelle an der Maria-Magdalenen-Kirche.
Wielands Geburtshaus und Pfarrkirche in Oberholzheim. Kupferstich von Wenzel Pobuda nach M. Johann Christoph Gottfried Braun, 1840
Über Biberach muss man einige Worte sagen.[5] Die erste urkundliche Erwähnung fällt in das Jahr 1083, als Stadt wird Biberach ab 1226 bezeichnet, ab 1281 ist Biberach Reichsstadt. Im Zuge der Reformation wird Biberach gemischt-konfessionell. Im Dreißigjährigen Krieg verliert die Stadt die Hälfte bis zwei Drittel ihrer Bevölkerung durch Tod oder Flucht. In Folge der Niederlage in der Schlacht am Weißen Berg bei Prag kollabierte die evangelische Position in Süddeutschland, Biberach wurde von kaiserlichen Truppen besetzt, die Rechte der Protestanten, die sich auf den Augsburger Religionsfrieden von 1555 beriefen, wurden gravierend eingeschränkt, wenn auch in den Grenzen des vom Kaiser respektierten Reichsrechts – was natürlich okkasionelle Willkürmaßnahmen nicht verhinderte. Im April 1632 wird die Stadt von den (protestantischen) Schweden besetzt, im September von den (katholischen) kaiserlichen Truppen erobert. Nach dem Westfälischen Frieden 1648 wird Biberach mit anderen süddeutschen Städten zur «paritätischen» Stadt – ein Status, der 1649 von einer «Kaiserlichen Exekutions-Kommission» wie folgt geregelt wird:
Rats- und Gerichtsstellen und städtische Ämter werden gleichberechtigt und zahlenmäßig gleich auf beide Konfessionen verteilt;
rechtliche Wiederherstellung des Status quo ante, was die im Krieg Vertriebenen betrifft;
Wiedereinstellung der evangelischen Geistlichen und Lehrer nach dem Stand von 1624;
Besoldung der Geistlichen aus den öffentlichen Kassen;
Versorgung der Armen und Kranken ohne Ansehung ihrer Religion;
Einhaltung der katholischen Feiertage durch die Evangelischen;
genaue Regelung der Nutzung einer Simultankirche.[6]
Auch bemühte man sich, die jeweiligen Predigten polemikfrei zu gestalten, was mal mehr mal weniger genau beachtet wurde. All das – war es doch zunächst ein externes Oktroi – ging nicht ohne Konflikte ab und blieb eine latente Quelle von allerdings immer geringerformatigen Streitigkeiten.[7]
Bei allen Problemen, die zunächst immer wieder dazu führten, dass externe Schlichter bis hin zum Kaiserhof auf den Plan gerufen wurden, war dieses Modell doch über die Zeit extrem erfolgreich. In den paritätisch verfassten Städten lernten die Konfessionen miteinander zu leben und ihre Streitigkeiten vor Gerichten, Schiedsgerichten und im Zweifelsfall durch das Mittel gewaltfreier Boshaftigkeit auszutragen. Man könnte sagen, dass die destruktiven Energien, die im Dreißigjährigen Krieg zu einer ungeheuren Katastrophe geführt hatten, sich im städtischen Kleinkram verbrauchten.
Ab dem vierten Lebensjahre, sagt Wieland, habe er Lateinstunden erhalten, mit dem fünften Schönschreiben gelernt, früh auch Klavierunterricht bekommen. In der Schule dann sei er als Sechsjähriger unter Neun- und Zehnjährigen der Jüngste in der Lateinklasse gewesen, und vom neunten Jahre an habe er «ohne Anweisung» lateinische Verse gemacht, «und um diese Beschäftigung zu verbergen», habe er «mit Anbruch der Morgenröthe aufstehen müssen».[8] Ist das glaubhaft? Der Privatunterricht und der daraus resultierende Vorsprung in der Schule gewiss – und die Verse? Warum nicht. Er war, das zeigt sein rasanter Fortschritt vom 19. Jahr bis Mitte 20, das, was man ein Naturtalent nennt – warum soll es dergleichen nur in der Musik, der Mathematik und im Schach geben? Mit Elf fängt er an, mit einer gewissen Systematik zu lesen, schwärmt für Schriften Gottscheds (was sich derb ändern wird, wir kommen später darauf), sein Lieblingsautor sei Barthold Heinrich Brockes gewesen (das schreibt er als 19-Jähriger,[9] als 43-Jähriger schreibt er, manchmal sei Brockes «noch izt» sein Liebling[10]). – Im zwölften Jahre habe er eine Satire auf seines Rektors kleinwüchsige Frau gemacht, angelehnt an eine Verszeile bei Juvenal (sie müsse sich zum Küssen auf die Zehenspitzen stellen – einem Zwölfjährigen mag man solch plattes Zeug durchgehen lassen).[11]
Wielands Vater, Thomas Adam Wieland d. J. (1704–1772). Ölporträt, Johann Martin Klauflügel zugeschrieben
Das ist es, was wir über seine Kindheit in Biberach hören. Dann kommt er nach Klosterbergen ins Internat. Der Vater annonciert das dem evangelischen Senat, wohl um Dispens von der Schulpflicht vor Ort zu erhalten. Klosterbergen bei Magdeburg war eines der führenden Internate in Deutschland. Der 19-Jährige schreibt, dort sei die Basis seiner wissenschaftlichen Kenntnisse (Philologie, Mathematik, Philosophie) gelegt worden, er habe Wolff und Bayle gelesen – also deutsche Früh- und französische Hochaufklärung – und weitere französische Autoren, Fontenelle, Voltaire.[12] Auch fiel dort, wie er berichtet, eine amüsante Geschichte vor, die immer wieder nacherzählt worden ist: «Damals machte ich (…) einen philosophischen Auffsatz worinn ich aus philosophischen principiis, die ich durch einen Syncretismum der democritisch u: Leibnitzischen Lehren, heraus brachte, zeigen wollte, wie Venus gar wohl hätte, ohne Zuthun eines Gottes, durch die innerlichen Gesetze der Bewegung d. Atomen aus Meerschaum entstehen können und daraus den Schluß machte die Welt könne ohne Zuthun Gottes entstanden seyn. Ich bewies aber in eben dieser Schrift daß Gott nichtsdestoweniger als die Seele dieser Welt existiere. Dieser Auffsatz fiel meinen Lehrern in die Hände und machte mir viel Verdruß, welcher noch grösser gewesen seyn würde, wenn nicht meine übrige Aufführung so sehr moralisch gewesen wäre.»[13]
Kurios genug. Gott als Weltseele, aber nicht notwendigerweise als Demiurg. Das ist kaum christlich, und Klosterbergen war, ungeachtet der freigeistigen Lektüre, die dort, wie es scheint, ohne Einschränkung zu haben war, ein christliches Internat. Merkwürdiger aber ist, dass Wieland den Namen nicht nennt, der die wahre Antriebskraft hinter seinem Aufsatz gewesen zu sein scheint: Lukrez. Denn die Selbstschaffung der Welt aus Atomen und deren Bewegung ist das Thema von Lukrez’ großem Werk «De rerum natura», das für Wieland nur wenig später Anreger und Abstoßungspunkt für seine «Natur der Dinge» geworden ist.
Apropos «moralische Aufführung» – ein Mitschüler Wielands erinnert sich: «Wieland war ein wohlgesitteter, fleißiger Schüler, seinem Lebensalter durch einen ungewöhnlichen Ernst schon entwachsen. Weder in den Freistunden noch bei gemeinschaftlichen Spaziergängen mischte sich der späterhin so frohsinnig heitere Dichter mit seinen Mitschülern, mit wissenschaftlich ernsten Gesprächen suchte er immer die Nähe der Lehrer, zeigte auch im Äußeren die Würde reifer Jahre, indem er eine gar stattliche Perücke trug.»[14] So reden die Gleichaltrigen über einen der ihren, der einer der ihren eben nicht gewesen ist, und finden das ein Leben lang merkwürdig.
Trotz seiner Orientierung nicht auf die Peers, sondern auf die Lehrer – oder gerade deshalb – ist er nicht immer ein leichter Umgang. Er sei, so berichtet er später, mit seinem Griechischunterricht unzufrieden gewesen und habe das Erlernen dieser Sprache aufgegeben. Er sollte es bald nachholen und wurde, mit seinen schon früh bemerkenswerten Lateinkenntnissen, (neben allem anderen) einer der bedeutenden deutschen Altphilologen. Von seinem Französischlehrer wird er schlecht behandelt, er beschwert sich, gibt den Unterricht auf und besteht darauf, sich die Sprache selbst beizubringen.[15]
Im Frühling 1749, 15-jährig, kann er Klosterbergen verlassen. Er geht nach Erfurt zum Bruder einer angeheirateten Tante, Johann Wilhelm Baumer. Er möchte dort seinen philosophischen Neigungen unter Anleitung nachgehen, wird aber enttäuscht. Später wird er von einer «abscheulichen Menge von Seelenblähungen sprechen», die er sich von Baumers Philosophielektionen zugezogen habe. Außerdem sei es bei Tisch sehr karg zugegangen. «Das beste, was er an mir that, war ein sogenanntes Privatissimum, das er mir über – den Don Quichote las.» Man sollte hier Cervantes’ «Don Quijote» nicht so sehr als Satire auf die damals populären Ritterromane verstehen, auch nicht als Abgesang auf den Feudalismus – beides ist er ja nur an der Oberfläche –, sondern vor allem auf seine erkenntnispsychologische Absicht sehen: Diese wird Wieland später in seiner «Geschichte des Don Sylvio von Rosalva» wieder aufnehmen. – Im nächsten Frühling kehrt er nach Biberach ins Elternhaus zurück. Dort vernichtet er seine frühen poetischen Versuche. Man sieht, dass er es ernst meint und weit mehr will, als er bisher kann.
Eine Cousine (zweiten Grades) Christoph Martins, Sophie Gutermann, besucht 1750 die Familie, sie wird eine der einflussreichsten Frauen in seinem Leben werden – wenn auch nicht so einflussreich, wie die Legende möchte, die hinter literarischen Figuren das «Vorbild im Leben» aufspüren möchte, was regelmäßig (nicht nur im Falle Wielands) zu Albernheiten führt.
Sophie Gutermann/La Roche (1)
Johann Gottfried Gruber, der Herausgeber der ersten postumen Werkausgabe Wielands und sein erster Biograph, berichtet über Sophie Gutermann das Folgende:[16] Ihr Vater habe sie früh, mit drei Jahren, lesen gelehrt, mit zwölf Jahren habe er sie zu seiner Bibliothekarin gemacht (das heißt, sie habe für ihn oder seine Gäste – er betrieb eine Gelehrtengesellschaft – Lektüre herausgesucht). Sie las viel, erhielt Unterricht durch ihren Vater in Astronomie, Französisch und Geschichte – all dies, so verfehlt Gruber nicht hinzuzusetzen, «ohne Nachtheil ihrer Weiblichkeit», denn sie habe auch Zeichnen, Sticken, Tanzen und Hauswirtschaft gelernt. Wieland wird allerdings später behaupten, ihr Vater sei der Meinung gewesen, «ein FrauenZimmer müsse außer dem Catechismus nichts wissen».[17] Mit 16 lernt sie den Fürstlich-Augsburgischen Leibarzt und späteren Kursächsischen Residenten in Rom, Giovanni Ludovico Bianconi, kennen, der um ihre Hand anhält. Bianconi setzt ihre Ausbildung fort, nun ist es italienische Kunst und Literatur, Mathematik und allerlei, außerdem erhält sie unter seiner Aufsicht Singunterricht. Sie ist unter die Erzieher gefallen, der junge Wieland wird auch so einer sein.
Sophie wird 18, ihre Mutter stirbt, das Trauerjahr verlängert die Verlobungszeit, und in dieses Jahr fällt ein fataler Streit zwischen Bräutigam und Brautvater, denn Sophie ist Lutheranerin, Bianconi ist katholisch, verlangt zwar nicht die Konversion seiner Frau, wohl aber, dass die zu erwartenden Kinder katholisch würden. Der Vater besteht auf lutherischer Taufe und Erziehung. Bianconi will eine heimliche Heirat mit Sophie in Rom, sie will nicht oder traut sich nicht, ohne den Segen des Vaters soll es nicht sein, Bianconi reist allein ab. Der Vater zwingt Sophie, vor seinen Augen alle Briefe, für sie komponierte Arien, mathematische Übungsblätter zu zerreißen und zu verbrennen, das Porträt Bianconis mit der Schere zu zerschneiden, einen Brillantring mit seinem Namenszug «mit zwei in den Ring entgegengesteckten Eisen entzwei (zu) brechen und die Brillanten auf dem Boden umherrollen» zu lassen. So schreibt sie in einer autobiographischen Erinnerung. Sie habe sich geschworen, um sein Andenken zu ehren, künftig nie mehr Italienisch zu sprechen, Klavier zu spielen, zu singen oder sonstiges durch ihn Gelerntes anzuwenden. So habe sie es zeitlebens gehalten.[18]
Sophie zieht sich in sich zurück, ihr Vater verordnet ihr etwas wie einen Erholungsurlaub: nach Biberach zu den Verwandten. In Wielands Elternhaus dürfte das Vorgefallene mehr oder weniger bekannt und Teil der Gespräche gewesen sein. Wieland war der Jüngere, an Bildung dürften sie vielleicht gleichwertig gewesen sein, vielleicht war sie die Überlegene, gewiss hat der Jüngere so getan, als wäre er es. Er verliebte sich in sie, das ist sicher, ob sie gleichermaßen in ihn verliebt war, weiß man nicht, mag sein, dass es etwas wie seelische Erholung für sie war, Spiel.
Sophie Gutermann von Gutershofen, später verh. von La Roche (1730–1807). Foto nach verschollenem Original von J. H. Tischbein, kurz nach 1750
Seine Liebe jedenfalls ist bemerkenswert und sehr eigenartig. Er erklärt, Sophie zu lieben, bevor er sie das erste Mal gesehen hat. Wer die Briefe, die diese Liebe dokumentieren, liest, wird seine Beteuerungen überspannt finden, aber cave! Briefe sind in jener Zeit, gerade was Zuneigungsbekundungen angeht, ein Ort schwärmerischer Verve, man liebt sich von der ersten oder wenigstens zweiten Zeile an, und Briefe unter Freunden, Freundinnen, ob Frau, ob Mann, ohne solche Beteuerungen wirkten vermutlich kalt. Dennoch dürfte dieser Fall ein besonderer sein. Ein sehr junger Mann, 17 Jahre, schreibt lange schwärmerische Briefe an eine ältere Cousine, die er nie gesehen, nie gesprochen hat, die er nur aus Erzählungen kennt (darunter die von der so fatal beendeten Verlobung), und offenbart ihr darin, sie sei ohne jeden Zweifel die ihm vom Schicksal Bestimmte. Das kann bei aller sentimentalischen Briefkultur nicht häufig vorgekommen sein. Man muss natürlich Abstriche machen, wenn er im ersten Brief in den ersten Zeilen von «der vollkommensten Person» und einer «Göttin» spricht, aber die Gesamtintensität der vielen Briefe, die Zielstrebigkeit, mit der er sich in ihre Aufmerksamkeit drängt, ist bemerkenswert. Man denkt beklommen daran, dass sie über kurz oder lang nach Biberach kommen wird. Wie steht dann der Verfasser dieser Briefe, die doch bereits die Anbahnung eines Lebensbundes avisieren, da – und wie geht es dann weiter? Der Gedanke scheint weder ihn noch sie zu stören, sie scheinen darauf zu vertrauen, dass sie die Rollen, die sie da entwerfen, schon werden zu spielen wissen.
Er schwärmt sie an, sie macht Komplimente, was seinen Geist betrifft, er wehrt bescheiden ab. Dann kommt am 24. August 1750 ein großes Bekenntnis. Er spricht von seinem Lebensziel, und es ist «Zufriedenheit und andauernde Freude». Nota bene. Geistige Freuden will der 17-Jährige, mehr als sinnliche, weltlicher Ruhm interessiert ihn nicht. Auch Wissenschaften und Literatur, «die ansonsten fast meine einzige Freude bedeuten», sind nicht der Königsweg, da lauern zu viele Unsicherheiten. Nein, rebus sic stantibus muss Zufriedenheit und Seelenruhe menschlichem Zusammensein erwachsen. Es braucht, wie es scheint, eine Person, voller Reiz und Schönheit, an der er beweisen kann, dass er einen Sinn dafür besitzt. Sie soll ernsthaft sein und «gravitätischen Geist» besitzen, «ein Schmetterling von Geist gefällt mir nicht». Literatur und Wissenschaften soll sie pflegen, ihr Herz «ganz und gar gut, empfänglich für Eindrücke von Zärtlichkeit, von Mitleid, von Traurigkeit aber nicht von Wut, die ich niemals mit Geduld bei einem Andern ertragen könnte, wer auch immer es sei» – und vor allem: «vor allem muss sie ihren Geliebten mit großer Feinfühligkeit behandeln». Treu soll sie sein, ein wenig Eifersucht gehöre aber zur zärtlichen Liebe, sofern sie nicht zu weit gehe und unentschuldbar würde. Alle Mühe, ihn glücklich zu machen, müsse sie sich geben. Gefragt sind zudem Umgangsformen, Weltkenntnis, Höflichkeit, Heiterkeit gegen jedermann (das sei nicht immer leicht, gewiss, aber er müsse darauf bestehen). Und wenn all das zusammenkomme und noch viel mehr, würde er sie auf immer lieben und für sie sterben, würde mit einer solchen Person lieber im Elend als auf einem Fürstenthrone ohne sie leben, «kurz gesagt, sie wird mein Glück machen, und ich werde sie mehr lieben als mein Leben. Nun beglückwünscht mich, meine teure, meine sehr geliebte Sophie (…).»[19] Sie antwortet zumindest in einer Weise, die ihn nicht enttäuscht.
Derlei befremdet die heutige Leserin (und den Leser nicht weniger) derart, dass man sagen möchte: Er ist nicht ganz bei Trost. Und: Wer so anfängt, der wird sein Leben lang ein fataler Umgang sein. Das auch, wenn man den erwähnten so ganz anderen Briefstil der damaligen Zeit in Rechnung stellt und abzieht. Doch: abzieht wovon? Was wäre die überzeitliche Empfindungslage, auf die wir alles bringen können, wenn wir das Zeitspezifische abziehen, um dann das Individuelle recht wägen zu können? Müßige Mühe und müßige Spekulation. Ein wenig philologische, hermeneutische Sensibilität und ein Sich-Hüten vor psychologischem Jargon dürften reichen. Wieland lebte in einer Zeit, die das Schwärmerische kultivierte und sich dessen nicht unbewusst war. Der Schwärmer war eine in der Literatur ausgiebig dargestellte und pro wie contra diskutierte Figur (nicht zuletzt im späteren Werk Wielands). Und die Wort- wie Wörterwahl, mit der das Schwärmerische in der eigenen Seele wie im Umgang miteinander zum Ausdruck gebracht wurde, war auch Experiment. Da probiert einer aus, ob das Kleid ihm passt, das er sich zurechtgelegt hat. Nur dass das kein Probieren vor dem Spiegel ist, sondern Bekleidung, mit der man den anderen gegenübertritt, selbstgewiss und doch nie ganz der Tatsache unbewusst, dass das Leben eine Inszenierung ist. Wenn man dennoch zuweilen innehält und fragt, ob er ganz bei Trost ist, so sind es die Passagen, in denen er genau das vollkommen vergisst.
Sophie ist für ihn ein Alter Ego: Passagen seiner Briefe könnten ein ad se ipsum sein. Gleichzeitig stellt er sich der Geliebten vor und in ein gutes Licht. So-und-so sei er und er wisse, dass sie so einen lieben könne, vielleicht müsse. Im Grunde seien sie füreinander bestimmt, denn sie seien ein Herz und ein Kopf. Und dann vergreift er sich erstaunlich im Ton. Als sie und ihre Schwester Katharina, genannt Cadeau oder Caton, erkranken und von einer sinistren Prophezeiung die Rede ist, dass nur eine der beiden überleben werde, wünscht er der Schwester den Tod und begründet das auch: «weil Sie unendlich vollkommener sind als sie, wie schön auch immer sie sein mag, und vor allem, weil mein Leben von Ihrem abhängt.» Was für eine entgleiste Liebesbeteuerung. Die Schwester übrigens ist, wie man liest, die hübschere. Man mag über diesen Zusammenhang gar nicht nachdenken und an diesen Brief nicht zurück, wenn er, Jahre später aus der Schweiz nach Biberach zurückgekehrt, ebenjener Schwester schöne Augen und deren Tochter den Hof macht.
Das über die Zeiten nachhaltig Unangenehme dieser Briefe ist ihre demonstrierte Frömmigkeit. Man weiß ja, dass, wer seine Frömmigkeit beteuert, nicht fromm ist. Die folgende Herzensrohheit aber kann nur ein Frommer begehen: «Falls Ihre teure Schwester stirbt, seien Sie gewiss, meine teure Sophie, dass es starke Gründe dafür gibt, dass sie glücklich in einem Zustand leben wird, der besser ist als der, nach dem sie in dieser Welt streben konnte.»[20] Kein Kommentar – oder doch nur diesen: Wieland schrieb eine Folge von «Briefen Verstorbener», in denen dieses Thema ausführlich traktiert wird. Derlei entsprach der Frömmigkeit der Zeit, aber er legte noch etwas drauf, man liest das Forcierte, die Künstlichkeit heraus. Man hat immer einen vor Augen und Ohren, der nur darauf wartet, den Tinnef ein für allemal loszuwerden, aber noch nicht weiß, wie. Es wird ihm vollständig gelingen, aber so weit ist er noch nicht. Jetzt möchte er Sophie mit der «bezaubernden Idee» trösten, dass sie ihre Schwester «vielleicht eines Tages wiederhaben werden». Sagen wir, er setzt auf einen christlichen Schelm anderthalbe.
Wer aber innerlich darauf wartet, eine Last wie diese christlichen Verbogen- und Verlogenheiten loszuwerden, wird es irgendwie merken lassen. Christoph Martin und Sophie korrespondieren über die Briefe der Ninon de Lenclos (1620–1705), der berühmten französischen Salondame und Kurtisane des 17. Jahrhunderts. Wieland ist, bei allem pflichtschuldigen moralischen Protest, fasziniert von dieser Frau und steckt Sophie an, die kokett schreibt: «Sie sind ein kleiner Bösewicht», aber Lenclos’ Prosa lobt und hervorhebt, dass sie «die Wahrheit über eine große Zahl von Liebhabern» sage[21] – woher Sophie das auch immer wissen will. Sie denkt sich ihren Teil und rümpft über die notorisch große Zahl der Liebhaber nicht die Nase. Beide probieren Rollen aus, gewissermaßen hinter der Deckung dessen, was sie sonst so schreiben.
Er hat seine Rolle längst gefunden, er will ein Dichter sein. Was das zu jener Zeit hieß, wird zu erörtern sein, durch dieses ganze Buch hindurch. Hier ist erstmal festzuhalten: Ein christlicher Dichter soll es sein – aber auch einer, der das Antike kennt und davon lernt. Zum Dichter – ob antik, mittelalterlich oder modern – gehört die Geliebte, die Angeschwärmte, Angebetete, Angehimmelte, und die hat er gewählt, als sie ihm in den Weg lief: Sophie, klug, recht schön, attraktiv unglücklich. Sie nimmt die Rolle an – aber ohne sich allzu sehr festzulegen. Sie lässt es sich mehr gefallen, als dass sie wirklich mitspielt. Aber darauf kommt es nicht an. Eine Dichtergeliebte muss nur besungen sein, es muss sie nicht unbedingt wirklich geben auf dieser Welt, und wenn doch, kann man sie sich zurechtsingen. Wielands beteuerte Liebe zu einer Frau, die er nur aus Erzählungen und Berichten kennt, ist so besehen nicht nur jugendliche Überspanntheit, sondern auch eine irgendwie frühreife Einsicht in die Wirklichkeit solcher Schwärmereien. Die Geste muss stimmen (das heißt, einer gewissen Konvention folgen), und wenn sie in Verse gefasst wird, müssen die gut sein. Es ist ein Spiel, das noch viel von der Gestik des Minnesangs hat, abgemattet durch Bürgerlichkeit und unironische Sentimentalität, und noch weit vom biographischen Wahn des späten 19. Jahrhunderts, das hinter jedem Liebesgedicht ein geliebtes Gesicht sehen will und jede Naturschilderung als nicht geknipstes Foto, zu dem man den Ort «Hier-hat-er-gestanden-als-er …» ermitteln kann, was dann als Triumph der Germanistik Buchform annimmt.
Im August 1750 kommt es schließlich zur ersten persönlichen Begegnung. Es folgen lange Spaziergänge um Biberach. Was werden sie einander gesagt haben? Die brieflichen Beteuerungen wiederholt? Kann man das nachimprovisieren, stundenlang? Wir wissen das nicht, es entzieht sich uns. Kam es zu «mehr»? Ein Kuss, irgendwann? Was für einer? Dass es mancherlei Küsse gibt, dürfte er aus Ovids «Ars amandi» gewusst haben, sie vermutlich auch. Am Ende waren sie verlobt, Sophie reiste zurück nach Augsburg, und Christoph Martin ging nach Tübingen, um dort ein Jurastudium aufzunehmen.
Dies tat er allenfalls mit Maßen. Die späteren Selbstauskünfte, er habe im Grunde gar nicht studiert, sind wohl teilweise Stilisierungen, aber dass ihm weder das Fach noch die mit ihm verbundenen Berufsaussichten (irgendwie und -wo im Staatsdienst) lagen, steht außer Frage. Er arbeitet stattdessen an sich als künftigem Dichter. Zudem ist wohl vor allem sein Vater mit der Sophienschwärmerei alles andere als zufrieden, er hält sie für Theater und seinen Sohn für einen Leichtfuß. An die Mutter schreibt er aus Tübingen: «Daß mein lieber Papa meiner Unbeständigkeit zutraut, daß ich einmal aufhören könnte, meine Sophie zu lieben, ist mir sehr leid. (…) Die ganze Welt ist mir ein Nichts gegen meine englische[22] und mehr als englische Sophie.» Ohne sie wolle er nicht (mehr) leben.[23]
An sie schreibt er aber weniger als Verliebter denn als eine Art Mentor, das gehört zu seiner Rolle. Aber was vielleicht nicht zu erwarten ist, ist, dass er sie nicht zur verehrenden Dichtergeliebten machen will, sondern selbst zur Dichterin. Sie sei «geschikt eine volkomne Dichterin zu werden», das dazu nötige Wissen habe sie, zudem seien Frauen die besseren Dichterinnen, sie seien empfindsamer und hätten mehr Geschmack als die Männer. Dann folgt eine poetologische Lektion für sie à la: Dichten heiße mit Worten malen, bei den Adjektiven sei man sorgfältig und vermeide «lächerliche und unnatürliche»: «Es ist eine Haupt Eigenschaft eines Beyworts daß an dem Plaz wo es ist, kein anderes mus stehen können ohne das ganze Bild zu verunstalten.»[24] Nähme man die Maximen dieses Briefes und späterer Schreiben an andere zusammen, erhielte man eine unverächtliche Stilfibel.
Sie möge sich im Deutschen üben (sie hatten zunächst auf Französisch korrespondiert), die deutsche Sprache sei viel schöner als die französische – ein Urteil, das alles andere als allgemein war zu jener Zeit, man hielt das Deutsche hinsichtlich seiner Eignung zur Poesie für weder dem Französischen noch dem Italienischen oder Englischen gleichrangig. Es ist Wieland, der diesen Konsens der Öffentlichkeit ändern wird.
Beide verehren sie Klopstock, besonders seine Messiade.[25] An den Schweizer Philologen und Schriftsteller Johann Jakob Bodmer, in dessen Nähe Klopstock 1750 acht Monate gelebt hatte, schreibt Wieland von seiner Hochachtung für diesen und dass eine «Verwandtin» von ihm ihn auch «unendlich hoch» schätze, so sehr «daß ich sie etliche mahl so schön weinen gesehen (…) Wie rühmlich sind Hr. Klopstocken die Thränen meiner Freundin? Doch nur in den Augen der wenigen die sie kennen.»[26]
Bodmer hatte er sich von Tübingen aus als eine Art Schüler angedient, er umwirbt und umschmeichelt ihn brieflich, bis tatsächlich eine Einladung nach Zürich eintrifft. Vor seiner Abreise nach Zürich ist er noch einmal in Biberach, wo er Sophie zu einem Abschiedsbesuch erwartet. Er nennt sie nun im Brief seine «englische Doris»,[27] später auch «Serena».[28] Freundinnen, zuweilen Freunde mit Pseudonymen griechischer oder lateinischer Provenienz zu versehen war keine Wielandsche Marotte, das ist Zeitmode bei poetisierenden Gebildeten.[29] Sophies Ankunft verzögert sich, endlich kommt sie doch, vier Tage verbringen sie gemeinsam, am 15. Oktober 1752 ist Abschied, er wird sie erst Jahre später wiedersehen.
Was mögen das für Tage gewesen sein? Arno Schmidt schrieb von einem irritierenden Gegenüber des altklugen Vielzujungen und einer «sexuell und intellektuell hochgezüchteten Neunzehnjährigen».[30] Er übersetzt (sich, ist hinzuzufügen) den Satz von Wielands erstem Biographen Gruber: «Sophie hatte zwei Jahre voraus, und eben darum, als Weib, einen gegen des Jünglings Alter ungleich bedeutenderen Vorsprung an vollendeter Bildung und innerer Haltung, die sogar durch die Prüfungen des Schicksals noch mehr befestigt worden waren.»[31] Immerhin hatte sie kurz vor der Ehe mit einem weltläufigen Mann gestanden. Hat sie sich ernstlich auf den jüngeren Cousin, den Kopf voll mit Klopstock-Flausen, einlassen wollen? Als er nach Zürich ging – fühlte sie sich verlassen oder war sie erleichtert?
Zuvor passt sie sich seiner Bodmer-Verehrung an, seinem literarischen Geschmack und seinem Ton. Er sagt ihr ja, wohin er will und warum, sie liest Bodmers Werke, schreibt ihm nach Zürich über ihre Lektüre des eben erschienenen Gedichts «Jacob und Joseph». Sie identifiziert sich mit der Figur der Asenat, also Josephs Frau.[32] Die Stelle in Bodmers «Joseph und Jacob» lautet (damit man auch gleich mal einen Eindruck der Bodmerschen poetischen Diktion bekommt): «Jacob kysst Asenat auf die stirn und, gesegnet, so sagt er,/Meine tochter, seyst du dem Hœchsten, die zærtlichkeit Rachels/Werde durch dich wiederholt, und beselige Joseph nur længer!»[33]
Er schreibt später: «Sie ist meine Base, und wurde zuletzt meine Geliebte, u: Braut (…) Durch sie habe ich alle Leiden u: alle möglichen Glükseligkeiten der Liebe kennen gelernt, diejenige ausgenommen, die der völlige Besitz gewährt.»[34] «Geliebte» wird also zu der Zeit anders verwendet, als wir es heute tun. – Es kommt zu Unstimmigkeiten. Worin diese bestanden haben, weiß man nicht, die Briefe, die darüber Aufschluss geben könnten, sind nicht erhalten. Wieland bittet sie für einen Brief um Entschuldigung, aber was in ihm gestanden haben mag, wird aus der Bitte nicht deutlich. Er versichert Sophie seiner Liebe und Zärtlichkeit und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass ihr Herz dereinst «mein sey». Aber den Brief vergisst er abzuschicken, holt das nach, begleitet von einem noch zerknirschteren. Zaghaft fragt er, ob sie ihn noch lieben könne wie ehedem.[35] Das war Mitte 1753, Sophie wohnt übrigens zu dieser Zeit in Biberach bei den Wielands. Aus Augsburg (von Sophies Mutter) erhält Wieland gegen Ende 1753 die Nachricht, Sophie habe sich mit einem Herrn La Roche verheiratet, dann schreibt auch Sophie, die Briefe sind nicht erhalten. Wieland gibt sich die Schuld, oder sagen wir: er gibt sich den Anschein, als täte er das. «Und so leben Sie denn wohl, meine Geliebte, leben Sie auf ewig wohl! Seyn Sie immer so glücklich, als Sie ohne Zweifel itzt sind, ja wenn es zur Zufriedenheit Ihres Herzens gehört, so möge Ihr Gewissen Sie immer auf dem Gedanken lassen, daß ich zuerst das Band gebrochen, das uns einst verbunden hat.»
An die Stelle ewiger Liebe (er verfehlt nicht hinzuzufügen, die hätten sie sich vor dem Angesicht Gottes zugesagt) soll nun Zuneigung und Freundschaft treten.[36] Diese Briefe werden augenscheinlich von Wielands Eltern zurückgehalten. Wieland schreibt erneut und referiert den Inhalt seiner vorherigen Schreiben. Dann: «Wie vielen vortrefflichen Herzen haben Sie wehe gethan! – Doch keine Vorwürfe!»[37] Dann schreibt ihm der Ehemann La Roche, berichtet, wie oft und herzlich bei ihnen über Wieland gesprochen werde: «sie lobt, ich aber bewundre, und bedaure einen Edlen Freund, dem ich ein empfindliches mißvergnügen erweket». Er lobt den Einfluss Wielands auf seine Frau, ja, er verdanke sein Glück recht eigentlich diesem: «vergeßen (Sie) meine Ihnen zugefügte ohnbill und begnügen Sie sich einen zwahr unbekanten Menschen glükselig gemacht zu haben».[38] Und Sophie schreibt am selben Tage, sie habe Wieland die Liebe aufkündigen müssen – «es war mir alle Zeit (…) unmöglich argwohn zu ertragen»: Es scheint, als hätten gemeinsame Bekannte von irgendwelchen Liebeleien Wielands geklatscht. Nun aber habe sie selbst das «Wohnhaus meines glüks» zerstört, doch endlich habe der «Edelmühtige und liebreiche La Roche, den ruin an sich» gekauft «und glaubte an meinem darunter begrabenen Herzen, einen Schaz der ihn ganz glüklich machen könnte, zu finden».[39] – Wieland antwortet La Roche herzlich und freut sich voller Eitelkeit (er nennt es selbst so), dass «Sie einen Theil der Glückseligkeit, die Ihnen Ihre vortreffliche Gemalin giebt, auf meine Rechnung schreiben zu können glauben».[40] An Sophie («Wertheste Freundin» heißt es nun statt «meine liebste Sophie») schreibt er tadelnd. Sie solle lernen, in schwierigen Lagen Geduld zu üben, jeder sei hin und wieder anderen gegenüber unbillig, und so solle jeder lernen, Unbilligkeiten zu ertragen, und vor allem nicht die Schuld für eigene Misere bei anderen suchen. Aber: «erinnern Sie Sich auch, ich bitte Sie, daß ich den Besitz Ihres Herzens (nicht Ihrer Person) und seine Sympathien mit dem meinigen, für meine süßeste Glückseligkeit hielt – und urtheilen Sie nun, ob ich ohne Wehmuth gedenken kann, daß diese Sympathie nur ein Traum meiner Liebe gewesen.»[41]
La Roche ist Sekretär und, wie man munkelt, natürlicher (das heißt unehelicher) Sohn des Grafen Anton Heinrich Friedrich Stadion (1691–1768), der seinerseits als Großhofmeister im Dienste des Kurfürsten von Mainz ist und zwischen Mainz und seinem Sitz, dem Schloss Warthausen bei Biberach, pendelt. Im Jahr darauf erfährt Wieland, seine Serena sei einer Tochter entbunden worden. «Ohne Zweifel werden Sie» – er schreibt dies im Juli 1755 an Bodmer und einige andere – «glauben Hr. La Roche sei so edelmüthig gewesen mich eine Nachricht, die mich so sehr interessirt, selbst wissen zu lassen. Aber er hat es nicht gethan. Ich erfuhr es durch meine Mutter.» Er will gleich an das Paar La Roche schreiben und seinem Unmut Ausdruck verleihen, aber man rät ihm ab und dazu, abzuwarten, ob nicht Sophie ihm noch schreiben werde. Er werde «noch vierzehn Tage» warten.[42] Nichts erfolgt, auch Wieland schreibt nicht. Im September wendet er sich an Katharina von Hillern, geborene Gutermann, die Schwester, wir haben sie oben erwähnt. Er bittet um «einige Nachrichten von dem Wohlbefinden Ihrer theuren Frau Schwester in Maynz». Er habe seit dem ersten und einzigen Brief La Roches (und dem beigelegten Sophies) keinerlei Nachricht mehr erhalten, seit über einem Jahr nicht, obwohl er Sophie wegen des Todes einer ihrer Freundinnen einen langen Brief geschrieben habe.[43] Gewiss habe La Roche sehr viel zu tun und komme nicht dazu, Briefe zu schreiben, aber er bitte doch dringend, ab und zu Nachrichten zu erhalten, wie es Sophie gehe.[44] Katharina von Hillern wird aktiv, Wieland schreibt erneut an Sophie und erhält nun Antwort.[45] Seinem Freund Johann Georg Zimmermann, einem Schweizer Arzt und Schriftsteller, er verfasst ein vielgelesenes Buch «Über die Einsamkeit», schreibt er, die «Ungenannte» in seiner Gedichtsammlung «Sympathien» sei die «Königin meines Hertzens. Das war sie und wird es allezeit seyn! Ach!»[46]